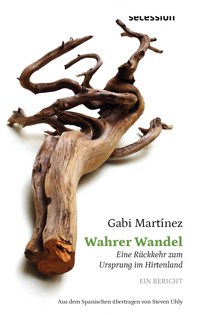
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Secession Verlag Berlin
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sanjuanilla 2018. Ein junger Mann aus Barcelona kehrt dorthin zurück, wo seine Mutter groß geworden ist: nach Extremadura, eine der ländlichsten Regionen Spaniens. Er möchte Schafe hüten, um zu verstehen, wie seine Mutter zu dem Menschen wurde, der ihn großgezogen hat. Die neue Umgebung verändert den Städter nach und nach und öffnet ihm die Augen für andere Prioritäten. Ihm wird bewusst, wie sehr wir das Dasein aller Lebewesen mit unserem hektischen, konsumorientierten Lebensstil gefährden. Er beginnt sich zu verändern und lässt seinen Leser auf sehr persönliche Weise an diesem Wandel teilhaben. Martínez' Helden sind einfache Leute, die auf unterschiedlichste Weise versuchen, Tiere zu retten und im Einklang mit der Natur zu leben. Ihn treiben Fragen um, vor denen wir alle stehen: Können wir das Artensterben aufhalten? Was müssen wir dafür tun, was müssen wir unterlassen? Wie sähe ein wahrer Wandel aus? Werden wir eines Tages als einzige Spezies noch übrig bleiben, weil es uns nicht gelungen ist, die anderen zu retten? Dieses Buch ist ein Aufruf, es will Menschen ermutigen, nicht einfach dem Trott des Altbekannten zu folgen, sondern etwas Neues, in Wahrheit, etwas Altes zu wagen: ein einfaches Leben, nicht wider, sondern im Einklang mit der Natur!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 369
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gabi Martínez
Wahrer Wandel
Eine Rückkehr zum
Ursprung im Hirtenland
EIN BERICHT
Aus dem Spanischen
übersetzt von Steven Uhly
Die Arbeit des Übersetzers am vorliegenden Text wurde vom Deutschen
Übersetzerfonds gefördert im Rahmen des Programms »NEUSTART KULTUR«
der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.
Kofinanziert von der Europäischen Union. Die geäußerten Ansichten und
Meinungen sind jedoch ausschließlich die der Autorin und spiegeln nicht
unbedingt die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union
noch die Bewilligungsbehörde können für diese verantwortlich gemacht werden.
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel Un cambio de verdad
© 2020 der Originalausgabe: Seix Barral, Barcelona
© 2020 Gabi Martínez
CASANOVAS & LYNCH LITERARY AGENCY S.L, Barcelona
Erste Auflage
©2024 by Secession Verlag Berlin
Alle Rechte vorbehalten
Übersetzung: Steven Uhly
Lektorat: Christian Ruzicska
Korrektorat: Peter Natter
www.secession-verlag.com
Foto, Gestaltung und Satz: Eva Mutter, Barcelona
ISBN E-Book: 978-3-96639-116-0
Für Edu und Cris, Erben dieser Kraft
Und wenn nun in der Pause und nicht
im Pfiff die Bedeutung der Botschaft läge?
Wenn die Amseln in der Stille zueinander sprächen?
Herr Palomar, ITALO CALVINO
Es gibt nur ein wahres Ereignis,
und wir nennen es Schönheit.
(Ein Körper) sein oder nicht sein, SANTIAGO ALBA RICO
Ich hatte viel Zeit draußen verbracht,
so dass ich einen schönen Stapel Briefe
abschicken musste, bevor ich mich
darauf einstellen konnte, die Arbeit
des Nachmittags meines Lebens anzugehen,
die Aufgabe, eine neue Ordnung zu errichten.
Leben auf dem Land, SUE HUBBELL
Wenn die Augen ins Licht blicken, leiden sie ein wenig.
LEONARDO DA VINCI
Die Voraussetzungen
Als ich in Extremadura eintraf, um Hirtenlehrling zu werden, sanken die Temperaturen nachts unter null Grad und nach drei fastregenlosen Jahren ängstigte die Dürre Viehzüchter und Bauern.Meine Aufgabe bestand darin, eine Herde von über vierhundertSchafen auf dem Gut eines Freundes eines Freundes eines entfernten Verwandten zu hüten, der sie mir zur Verfügung stellte, nachdem er gehört hatte, ich wolle versuchen, eine Zeit lang so zu leben,wie meine Mutter es als Kind getan hatte.
Ich hätte es früher, viel früher versuchen können, doch als ichmit zwanzig Jahren, während ich in der Stadt lebte, die Gelegenheitzu reisen bekam, zog ich es vor, mich aus der scheinbar vertrautenUmgebung zu entfernen und stattdessen außerhalb Spaniens aufEntdeckungstour zu gehen. Mehr als ein Jahrzehnt lang nutzte ichdie wirtschaftlich gesehen goldene Zeit des Journalismus und derLiteratur, um vom Nil bis nach Australien alles zu bereisen. 2008änderte sich das Panorama.
In jenem Jahr schien die globale Gemeinschaft immer empfänglicher für die zunehmenden Warnungen vor dem Klimawandel zu werden. Von Zeit zu Zeit tauchten Debatten über das Themaauf und es wurde eifrig über die Frage berichtet, welche furchteinflößenden und unmittelbar bevorstehenden Folgen die Beschleunigung haben würde, die wir der Erde aufgezwungen hatten. Politiker, Schauspieler und einflussreiche Musiker präsentiertenDokumentarfilme, organisierten Konzerte, reisten an Orte, die vonder Umweltzerstörung bedroht oder bereits stark mitgenommenwaren, damit wir uns für den Gedanken erwärmten, ein Sandkornim Kampf gegen den Klimawandel beizusteuern. Sie deuteten denVersuch an, das, was Thomas Berry »das große Zwiegespräch« zwischen der menschlichen Rasse und der Natur genannt hatte, wiederaufzunehmen. Und dann »platzte die Blase«, wie die Analystensagen, und leitete eine weltweite Wirtschaftskrise ein.
Die erste Maßnahme der spanischen Regierung bestand darin,die Zuschüsse für erneuerbare Energien zu streichen. Das scheinbar entscheidende Problem des Klimawandels verschwand an einem einzigen Tag aus Nachrichten und Politik. Das Desaster offenbarte schon bald Täuschungen und Fiktionen, die typisch fürjede Art von Blase sind, und selbstorganisierte Menschengruppen,unter denen sich auch meine Eltern befanden, begannen aus unterschiedlichen Gründen, auf der Straße zu protestieren, obwohlnatürlich fast niemand für die Kontrolle der Kohlendioxidemissionen oder den Schutz des Braunbären demonstrierte. Man konntewirklich meinen, es gebe inmitten derartiger Notstände keine Zeit,darüber nachzudenken, was geschehen würde, falls die Stauseenim Sommer austrockneten.
Die Welt füllte sich noch weiter mit Zahlen, Statistiken, Grafiken, die laut Analysten und Wissenschaftlern Wege zur »Erholung« wiesen. Es gelte, effizienter, pragmatischer zu sein und sichohne Zögern auf das Nützliche zu konzentrieren, denn nur so,erzählten sie uns, würden wir vorankommen. Die Natur wurdeerneut so sehr dazu degradiert, unsere dringendsten Bedürfnissezu bedienen, dass jeder, der die Exzesse gegen sie beklagte, unberührte Gebiete verteidigte, oder versuchte, Tiere zu retten, unweigerlich als Snob, Träumer oder übernächtiger Romantiker dastand.Manche wurden als Dichter bezeichnet. Was nützt es, das Kraut,den Auerhahn oder die Sonne zu besingen? Dichter. Im Bunde mitdem Nutzlosen.
Als jedoch Tausende Konsumenten damit begannen, sich nachkostengünstigeren Lebensweisen umzuschauen, entdeckten viele,dass einige derer, die nicht nur die lyrischen Qualitäten der Sonnepredigten, sich mithilfe von Solarzellen selbst versorgten.
Am 9. November 2015 belastete die spanische Regierung dieNutzer dieser Solarzellen mit der sogenannten Sonnensteuer.Ein Katalog für die Eintreibung von Geldern je nach konsumierter Sonne. Es beeindruckt und verwirrt, dass jemand es wagt, denMarktwert des Sterns zu bestimmen, der uns Leben spendet, undzugleich bringt es die Beziehung, die unsere Spezies derzeit zurNatur unterhält, auf den Punkt. Die Besteuerung der Sonne ist dassurreale i-Tüpfelchen einer Krise, die den Gierigen freie Hand gewährte, um weiterhin Schmutz zu produzieren, Urwälder zu zerstören, noch schneller Monokulturen aus der Erde zu stampfen,stets mit dem Argument, sie täten es für uns, für die Menschen.Eine kleine Gruppe einflussreicher Leute verbreitete geschickt dieIdee, es gehe darum, alles Mögliche zu tun, um die Krise zu surfen, und wenn für unsere »Rettung« ein weiterer Wald ausgebeutet oder ein Resort am letzten unberührten Strand gebaut werdenmusste, dann war eben nichts zu machen.
Millionen Menschen nahmen diese Erzählung einfach hin.
Heutzutage werden Zahlen und Statistiken genauso gelesen wiefrüher die Bibel, wobei auf erstaunliche Weise vergessen wird, welche Folgen es hatte, so religiös an etwas zu glauben.
Und meine Frage lautete: Wie sind wir hier gelandet? Wiekommt es, dass jemand es wagt, eine Steuer auf die Sonne zu erheben? Warum wird nicht mehr über den Luchs gesprochen?
Eben darum: wegen der Erzählung.
Diese Antwort gab ich mir selbst. Die Blase, jede Blase, ist eine Geschichte, die in voller Lautstärke erzählt wird, damit du keineranderen deine Aufmerksamkeit schenkst. Die Blase scheint allesbesetzt zu halten. Wenn du dich nicht in eine stille Ecke zurückziehst, wirst du nichts anderes mehr hören. Wenn die Intuitiondich nicht warnt, wirst du nichts anderes mehr hören. Und vielleicht willst du auch gar nichts anderes hören, denn man mussanerkennen, dass es eine gut erzählte Geschichte ist. Sie ist sogut, dass du nicht einmal wahrnimmst, dass es sich um eine Geschichte handelt. So gut, dass, wenn die Geschichte Ende sagt, duauch das glaubst, obwohl es eigentlich nicht vorbei ist. Und die Geschichte, die alle Geschichten enthält, die wir uns erzählt haben,um bis hierher zu gelangen, ist die größte Blase von allen: die Erzählung.
Wenn die üblichen Mikrofone melden, die Blase sei 2008 geplatzt, sprechen sie nur von der Wirtschaft, ohne die narrativeBlase zu erwähnen, entweder, weil sie sie nicht wahrnehmen, oderweil es nicht opportun erscheint. Sie besteht jedoch nicht aus Wasser. Die Erzählung der Zahlen, der Wissenschaft und der Beschleunigung hält unsere Vorstellungskraft gefangen. Irgendjemandemist es gelungen, zu erzählen, die Technologie sei unsere ideale Verbündete, und Zweifel beantworte man mit Zahlen. Dieser Jemandhat es verstanden, die Emotion der Taste und des Schalters gegendie des Windes und der großen Räume durchzusetzen. Und während wir den Flötenspielern der Taste, den begeisterten Verfechtern der schwindelerregenden Komposition zuhörten, trenntenwir uns allmählich von der Erde und ihrem natürlichen Rhythmus ab.
Wenn man etwas erzählt, erschafft man es. Die Zukunft wird aufgrund der Geschichten, die wir uns erzählen, erbaut, ob sie nunvon Robotern oder von Störchen handeln. Sie müssten gar nichtmiteinander konkurrieren, Geschichten können von beiden sprechen, doch die Roboter tilgen seit Jahren die Störche aus unserenErzählungen. Während des letzten Jahrhunderts hielt sich derStorch mehr oder weniger in der Phantasie, vor allem dank jenerFabel, die davon erzählte, dieser Vogel bringe die Babys im Direktflug aus (der großen Stadt) Paris. Aber welches Gespräch handeltheutzutage, da man den wissenschaftlich informierten Kinderndiese Geschichte nicht mehr erzählt, noch von Störchen? WelcheArt von Gefühl erzeugt ihre Erwähnung? Das ist eine Schlüsselfrage, denn genau da wird die Zukunft riskiert. Im Gefühl. Auchdie narrative Blase füllt sich damit.
Das Reden über Zahlen und Roboter macht uns mit ihrer künstlichen Welt vertraut und erzeugt einen emotionalen Rahmen, derGefühle entstehen lässt. Und diese Gefühle laden uns dazu ein,diese binäre und metallische Welt zu erforschen, uns tiefer undtiefer in die Lieblingsgeschichten von Leuten zu begeben, die nichtan Dichter glauben.
Sag mir, wovon du sprichst, und ich sage dir, wohin du gehst.Sagt dein Mund Storch, so wirst du dich möglicherweise eines Tages auf die Suche nach ihm machen. Und dies wird nicht durchTastendruck erfolgen. Du wirst eine wirkliche Reise unternehmen.Erzählst du Geschichten von Adlern, so wird der Adler eines Tages über dich hinwegfliegen. Wenn du hörst, wie ein Freund dieMaulwurfsgrille imitiert, wünschst du dir herauszufinden, ob erihr Kreischen übertreibt. Und es wäre nicht ungewöhnlich, wenndu nach deiner Erfahrung eine Geschichte darüber erzählen würdest. Es wird eine Geschichte des Wandels sein, denn Geschichtensprechen vom Wandel. Am wichtigsten ist jetzt die Frage, welchenWandel wir uns erzählen wollen.
Bis hierher führte mich das Nachdenken über die Sonnensteuer.
Ich glaubte, dass wir alle uns gegenseitig eine Geschichte erzählt hatten, die es uns nicht nur erlaubte, Realitäten zu verwirklichen, die ohne Zweifel wahnsinnig sind, sondern diese auch nochzu tolerieren. Versunken in unserer angeblichen Überlegenheit,sind wir Menschen in die Logik des Künstlichen mit der Annahmeeingetreten, die Natur schulde uns Mautgebühren, und erteilenuns selbst deshalb die Erlaubnis, Exzesse und Fehler anzuhäufen.Die Straflosigkeit hat viele dazu ermuntert, die Erde zu zerstören,obwohl sie sie doch so sehr lieben, wie sie nicht müde werden zubehaupten. In Spanien sind vierundachtzig Prozent der einheimischen Rinderrassen heute vom Aussterben bedroht. Während diePolitiker Fahnen schwenken und ihre Liebe zu diesem Land verkünden, beuten sie seine lebenswichtige Natur aus und offenbarenTag für Tag Haltungen und Werte, die denen meiner Eltern, einerManchega mit Wurzeln in der Extremadura, und eines Katalanen,diametral entgegengesetzt sind.
Ich wurde in Barcelona geboren und wuchs dort auf, ich binviel durch Spanien gereist, worüber ich auch geschrieben habe,doch dabei spürte ich stets, dass ich es hinauszögerte, jenen Streifzug zu unternehmen, der es mir erlauben würde, die allzu ungewissen Wurzeln meiner Mutter zu erforschen. Vielleicht, weil ichahnte, dass diese Erfahrung wichtige Fragen würde klären können,und weil ich darauf vorbereitet sein, über einen gewissen weltlichen Kontext verfügen wollte, bevor ich die Reise ins Innere unserer Heimat antrat. Wenn ich mich also endlich dazu entschloss, dieDehesas1und Steppen ihrer Kindheit kennenzulernen, so tat ich esvielleicht aus dem Wunsch heraus, zumindest eine ehrliche Antwort zu erhalten, weit weg von den Stadtzentren, die so verseuchtsind, dass es krank macht, wo die Luftverschmutzung, die Ungerechtigkeit und die Heuchelei miteinander wetteifern, um uns vergessen zu lassen, dass es ein natürliches Gleichgewicht gibt.
Ich glaubte, zugegebenermaßen ein wenig romantisch, die Natur würde mir etwas saubere Luft verschaffen, ich sah die Lückezum Atmen und stellte mir vor, dass ich, indem ich Schafe hütete,mich den Ursprüngen dieses Teils der Familie nähern könnte, unddass ich mich in ihre Geschichte und in unsere Verbindung vertiefen würde, indem ich beobachtete, wie andere Mütter mit ihrenJungtieren umgingen.
Jetzt, da meine Haut dunkel geworden ist, mein Bart länger alsüblich und meine Hände braun und so kräftig, dass ich selbst sienoch vor einem halben Jahr einem anderen Menschen zugeordnet hätte, hat sich die natürliche Sprache wie immer gegen die lyrische Phantasie durchgesetzt und mich zu einer steppenartigenSchafhürde geführt, die von Trappen und Grashüpfern umzingeltist. Wandel über Wandel über Wandel und Wandel. Dies ist dieWirklichkeit.
Es ist bereits Sommer, die Dehesas haben die Farbe gewechselt, doch ich denke noch immer jeden Tag über das Licht nach.Über die Auswirkungen seiner Herrschaft und über seine Abwesenheit. Es gibt gute Gründe und eine Herde, um ein derartigesFieber zu erklären. Nur Zentimeter von meinen nackten Füßenentfernt fällt senkrecht das Sonnenlicht auf die Erde, während ichmich daran erinnere, wie das Licht mich vor Monaten blendete,doch erst jetzt verstehe ich, dass dieses Staunen mit meiner Mutter begann. Sie war diejenige, die mir beibrachte, dass es so vieleFarben gibt, wie du sehen kannst. Dass die Suche nach der Alternative eine Wahl ist. Ich hatte mich lange danach gesehnt, ein Stückder Natur, die ihr Leben inspiriert hat, wiederzugewinnen, und imLaufe der Jahre ist eine Notwendigkeit daraus geworden, als lägein der Art und Weise, wie sie aufgewachsen war und sich mit derWelt in Verbindung gesetzt hatte, jene elementare Antwort, die ichin Wahrheit kannte, die wir alle kennen, und die ich dennoch allmählich aus den Augen verlor.
1. Dt. ›Weideland‹. Ich verwende den spanischen Begriff, um irreführende Analogienmit deutschem Weideland zu vermeiden. (Diese und alle weiteren Anmerkungen vomÜbersetzer.)
Sanjuanilla
Stille gibt es nicht, die Farbe Schwarz dagegen schon. An solcheDinge denkt man bei drei Grad unter null, während man bis überdie Ohren zugedeckt in einer Schäferhütte liegt. Die Glut knistert im Kamin, ein Fenster ist angelehnt, um die Ansammlung vonKohlendioxid zu vermeiden, wie meine Mutter und andere Schäfermir empfohlen haben. Draußen bellt die Mastiffhündin. Auf demmit Steinen befestigten Zinkdach bewegt sich etwas. Die Stille istvoller Geräusche, sogar inmitten dieser Dehesa, sechs Kilometervom nächsten Dorf entfernt.
Drei Wochen zuvor habe ich die Gegend durchquert, um einepassende Hütte für mein Leben mit Schafen zu finden, und vielleicht meine Mutter etwas besser zu verstehen. Ihr ganzes Lebenlang hat sie über Wölfe, Bäche, Steineichen geredet. Über gestohlene Feigen, Zwergtrappen, Gewitter. Und über Schafe. Einmalhatte ich sie in die Region begleitet, aus der sie stammte, doch damals war ich ein dreizehnjähriger Junge, und das einzige, woranich mich erinnere, ist ein Stier, der über eine riesige grüne Graslandschaft trottete, gefolgt von einem Viehtreiber1. Das Bild hatdrei Jahrzehnte überdauert, wie eine Forderung nach mehr Hintergrund, der ich nun endlich nachkomme.
Die Nachnamen meiner Großeltern sind außerhalb der Region ebenso selten, wie sie unter den hiesigen Familien gewöhnlich sind. Kaum hatte ich verlauten lassen, dass ich eine Bleibesuche, tauchten unbekannte Verwandte auf, die mehr oder wenig freundlich waren und ein paar Geschichten zu erzählen hatten. Manche boten mir ein Zimmer oder sogar ein kälteisoliertes Haus an, denn ich hatte vor, im Winter umzuziehen. Siesagen, ich hätte die schlimmste Zeit gewählt. Genau so wollteich es.
Das Haus in Sanjuanilla steht in einer mit Steineichen bestandenen Senke fünfzig Meter von dem Teich entfernt, an dem diedrei Schafherden getränkt werden, die sich das Gut von Andrés Rodríguez, dem Besitzer, teilen. Doch Andrés lebt in einer entferntenStadt und der Hirte, der auf dem Gut arbeitet und mich den Beruflehren wird, heißt Juan Alfredo. Hinter der Viehtränke erhebt sicheine umzäunte Hügelkette, auf der Kühe weiden, die einem anderen Mann gehören. Das Haus steht auf leicht abfallendem Gelände,und der Weg nach unten führt zu einem Brunnen mit trinkbaremWasser. Was das Licht betrifft – vorgestern verlegten die Elektriker ein paar Kabel, die drei Glühbirnen an den Generator im Stallanschließen. Ich habe nicht vor, ihn allzu oft zu benutzen, denner läuft mit Benzin, die nächste Tankstelle liegt zwanzig Kilometerentfernt, und ich besitze kein Auto. Mein Plan ist, ihn nachts einpaar Stunden lang laufen zu lassen, wenn ich koche – auf meinemtragbaren Öfchen mit drei Kochstellen, die an eine Flasche mit Butangas angeschlossen sind.
Bei meinem ersten Besuch waren die Herden von zwei Hündinnen bewacht worden, doch Maya, die Hütehündin, starb plötzlich. Deshalb beginnen Siria und ich zu zweit. An dem Morgen, alswir uns zum ersten Mal begegneten, leckte sie sich die Schnauze,nachdem sie die Plazenta eines neugeborenen Lamms verschlungen hatte. Ihre traurigen Augen täuschen über die sehnigen Muskelpakete hinweg, die sich unter ihrem Fell wölben, wenn sie spieltoder rennt. Ein sieben Monate alter Mastiff ist reine Kraft in Aktion. Sie bellt schon seit einer Weile.
Ich bin so pleite wie immer, doch mein Bruder wird in meiner Wohnung in Barcelona wohnen und die Miete zahlen, bis ichzurückkomme. Zusammen mit meinem Ersparten sind so sechsMonate finanziell abgedeckt. Die kostenlose Unterkunft, die ichgefunden habe, ist hilfreich, und auch die Garantie, dass die Kosten in dieser Zeit minimal sein werden, weil ich vorhabe, sie mitGrundnahrungsmitteln und dem, was der Boden hergibt, zu bestreiten. Man hat mir versichert, ich könne schon im Frühling damit beginnen, wenn ich wolle und wisse, wie das geht.
Meine Mutter heißt Eloísa, und bevor ich herkam, gab sie mireine Spur, der ich folgen werde: »Ich erinnere mich daran, dassich arm war, aber immer in der Natur.« Während sie das sagte, lächelte sie mit einem Strahlen, das ich jetzt in der schwarzen Nachtsehe.
Mich zum Ursprung meiner Mutter zu begeben, bedeutet auch,eine Reise zu etwas Älterem als sie anzutreten. Es hat mit Samenund Wurzeln zu tun. Woher nahm sie ihre Widerstandskraft? Dasist mein Anliegen: Die Quelle ihrer Kraft zu erahnen.
1. Hunde wie etwa (in Deutschland) Rottweiler, die ursprünglich als Bullentreibergezüchtet wurden.
La Siberia
Dies ist La Siberia, ein Landkreis im Nordosten von Extremadura,der früher Die Berge und Die Seen – Los Montes y los Lagos – hieß,bevor ein spanischer Botschafter in Russland ihn durchquerte undeine Ähnlichkeit mit Sibirien feststellte, die die Runde machte. Alsder Zivilgouverneur sah, dass der Name sich durchsetzte, erließer ein Verbot, ihn öffentlich zu verwenden. Doch diese Leute haben Charakter. Es wird am Klima liegen. Zwischen Raureif undfünfzig Grad ziehen sich die Steine zusammen und dehnen sichaus, bis sie bersten, auch wenn die Sonne immer mehr Land gewinnt und La Siberia nun schon seit drei Jahren in Folge Dursthat. Im vergangenen Jahr reihte sich alle achtzehn Tage eine Hitzewelle an die nächste. Mit rund sieben Bewohnern je Quadratkilometer liegt die Bevölkerungsdichte so niedrig, dass sie Teil einerRegion ist, die als »spanisches Lappland« bezeichnet wird. Anscheinend verpasst man hier unbewohnten Gegenden nordischeNamen. Steppen, Dehesas und Pinienwälder wechseln einanderab, außerdem gibt es hier Eukalyptusschonungen, die währendder Franco-Diktatur gepflanzt wurden. Damals entstanden auchdie Stauseen, durch die diese Region zum nationalen Wasserreservoir wurde. Auf der gesamten iberischen Halbinsel gibt es keinenOrt mit mehr Binnenuferkilometern, doch da das meiste künstlich ist, mussten sich Flora, Fauna und die Menschen in den letzten Jahren allmählich an die dadurch ausgelösten Veränderungenanpassen. Hunderttausende Zikaden und Grillen zogen es vor, abzuwandern, wie auch ein paar Reiherkolonien, die von der Raupedes Prozessionsspinners bedrängt wurden. Man sieht auch kaumnoch Raben. Prächtig gedeihen dagegen Meloncillos1, Flusskrebseund Kraniche, die man überall auf den Feldern dabei beobachtenkann, wie sie Eicheln verschlucken, obwohl es viele von ihnen inzwischen zu den neuen bewässerten Feldern für Reis und Mais imOsten der Region gezogen hat.
Meine Mutter wuchs in Agudo auf, dem Mancha-Dorf, wo ichmich im Supermarkt mit Lebensmitteln versorgt habe, die nichtim Kühlschrank aufbewahrt werden müssen. Von Agudo aus mussman nur auf der von Dehesas flankierten Landstraße weiterfahren, um nach Extremadura und La Siberia zu gelangen, wobei mandurch Tamurejo kommt – die Wiege meiner Großmutter. Dernächste Ort ist Garbayuela, Heimatdorf meines als Hirte lebendenGroßvaters, den ich nie kennenlernte und um den sich Legendenranken. Von ihm lernte meine Mutter, mit Schafen umzugehen.Während meine Großmutter und meine Tante die Kirche putzten,nahm Eloy seine kleine Tochter auf die Dehesa mit, um ihr das beizubringen, was ich lernen will.
Ich komme spät, ich bin Städter. Doch die Natur ist noch da.Garbayuela liegt sechs Kilometer von dem Ort entfernt, wo ichversuche, in einen Sack gehüllt und mit Socken an den Füßen zuschlafen. Meine Mission besteht darin, die Schafherden täglichzuüberwachen, Juan Alfredo über jede Neuigkeit zu unterrichten undachtzugeben, dass Siria nicht abhaut, abgesehen davon, dass ichsie ernähren muss. Juan Alfredo sagt, die Mastiffhündin schlüpfebei jeder Gelegenheit unter dem Drahtzaun der Koppeln hindurch,und um ihre Ausflüge zu verhindern, bindet er ihr einen Holzstückin Form eines Y an den Hals, was sie aussehen lässt wie eine Sklavenhündin auf der Galeere.
»Ich komme morgen kurz nach sieben«, sagte er, bevor er ging.»Du bist seit dreißig Jahren der erste Mensch, der hier übernachtet.«
Die Hündin hat aufgehört zu bellen. Vielleicht ist etwas passiert?Ist es besser, wenn sie bellt, oder wenn sie nicht bellt? Auf demDach bewegt sich etwas. Starke Eisenstäbe schützen Tür und Fenster. Vor einiger Zeit öffnete ich die Augen und war mir nicht sicher,ob ich es wirklich getan hatte, denn die Dunkelheit war gleich odersogar noch hermetischer. Ich suchte nach Rissen in der Schwärze,indem ich mit den Augen zwinkerte, um die Tränendrüsen zu befeuchten und besser zu sehen, doch dieses Schwarz ist kompakt.Außer den Rabenvögeln und den Insekten mit Chitinpanzer gibtes in La Siberia auch Geier und Störche in dieser Farbe. Ich öffnedie Augen, um mich mit Schwarz zu füllen, das unbestreitbarer istals die Stille.
Um sieben Uhr zwanzig in der Früh verlassen mehr als zweihundert Schafe ihren Unterstand und kommen den Hang herunter.Ihre dunklen Silhouetten zeichnen sich auf dem Hügel ab. DieSonne schickt ein erstes Licht voraus. Ein paar Kuhglocken unddas Blöken der Lämmer begleiten das Geräusch der Hufe auf dertrockenen, gefrorenen Erde. Die Schattenherde zieht zehn Meteran meiner Haustür vorbei. Nur wenige Tiere wenden den Kopf undschauen den Eindringling an, dessen Haupt von einer Mütze auseinem anderen Sibirien bedeckt wird – ich hatte sie im NordenChinas gekauft. Die Kälte nagt an dem kleinen unbedeckten Teilmeines Kopfes und lässt schnell die Nase taub werden.
»Hallo, guten Morgen«, murmele ich und spüre, dass meineLippen von der Kälte trocken geworden sind. »Wie geht es euch?«
Vier oder fünf Schafe beschleunigen ihren Schritt, als sie meineStimme hören, und ziehen die anderen mit. Sie galoppieren noch,als die Reifen des Pickups über den steinigen Abhang herunterrollen. Juan Alfredo bringt mir einen Korb mit zwanzig Eiern von seinen Hühnern mit und ein riesiges Glas frischen Bienenhonig. DieSchafe warten still vor dem Gitter, das Zugang zum Pferch gewährt,während ich Juan Alfredo versichere, dass ich durchgeschlafenhabe. Die Kälte erwähne ich nicht. Auf meinem Nasenbein spüreich einen unangenehmen Druck, ein Stechen in meinen Augenlidern und ein taubes Gefühl von Frost auf den Brauen. Meine Nasenflügel sind feucht geworden, ich merke, wie sich dort Flüssigkeit ansammelt. Ein ziehender Schmerz, der von der Schädelmitteausgeht, macht mich leicht schwindelig.
Auf der Schulter trägt Juan Alfredo einen großen Futtersack,den er in die Fresströge entleert, bevor er die Schafe hereinlässt.Sie stürzen sich auf die Futterbälle, einige springen auf ihre Gefährten und stellen sich dabei auf die Hinterhufe, während siemit ihren Vorderbeinen auf die Rücken und Schnauzen der anderen einschlagen. Mehrere Lämmer laufen ziellos herum, ohne inReichweite des Futters zu gelangen. Die Sonne ist noch nicht hinter dem Hügel aufgetaucht, doch es ist bereits so hell, dass man dasschmutzige Weiß der Schafe sieht, die so eng zusammengedrängtstehen, dass sie ein Meer aus Wolle bilden, auf dem man sich niederlassen möchte. Drei Minuten später ist in den Fresströgen keineinziges Futterknäuel mehr, und die Schafe ziehen Richtung Südosten, bis sie hinter einem kleinen Hügel verschwinden.
»Das Wasser ist knapp«, sagt Juan Alfredo. »Ohne Regen gibt eskein Gras und sie müssen mit Pressfutter ernährt werden.«
Er zeigt mir, wie ich Wasser aus dem Brunnen ziehen kann, indem ich das Seil an einen Eimer binde. Ich könnte die Winde benutzen, den Eimer nach und nach herunterlassen und ihn zurSeite neigen, wenn er die Wasseroberfläche erreicht hat, doch JuanAlfredo wirft das Seil aus dem Handgelenk so, dass es in Schlangenlinien nach unten fällt. Der Eimer neigt sich bereits in der Luft,versinkt im Wasser und füllt sich sofort.
»Komm, jetzt du.«
Ich versuche es mehrere Male. Jedes Mal fällt der Eimer geradeaufs Wasser und füllt sich nur zu einem Viertel, so dass Juan Alfredo den Wurf wiederholt und mich anweist, darauf zu achten,wie er den Arm bewegt, nämlich so, als wäre er eine Verlängerungdes Seils. Erneut versenkt er den Eimer bis auf den Grund. Ichbin an der Reihe. Nach fünf Versuchen gelingt es mir, ihn zu zweiDritteln zu füllen. Für heute ist es genug. Ich werde viel Zeit zumÜben haben.
Wir ziehen los und gehen über die Felder, um die Gitter abzulaufen, die die verschiedenen Herden voneinander trennen. Jedeverfügt über ihre eigenen Dehesas, genügend Hektar, um in Ruhezu grasen. Während er geht, lässt Juan Alfredo die Arme baumeln,sodass ich unwillkürlich an die Evolutionskette denke. Er erklärtmir, wie sehr er sich um die Gesundheit seines Viehs sorgt, undwie wenig ihm eine kürzlich ausgestrahlte Fernsehreportage gefiel, die das furchtbare Innenleben eines Bauernhofs offenlegte. Erist davon überzeugt, dass alles davon abhängt, wohin der Reporterdie Kamera hält und nennt als Beispiel eines seiner Weibchen, dashinkt und bei bester Gesundheit ist. Aber wenn so ein Schwachkopf jetzt daherkäme und genau dieses Schaf filmen würde, oderdie Plazentas, die manchmal auf dem Boden auslaufen, oder denHintern eines Tieres, das von einer Mücke gestochen worden ist …
»Damit spielt man nicht«, sagt er. »Ein Hirte ist seine Schafe.Die Leute sehen uns durch sie. Was für einen Sinn soll es haben,sie schlecht zu behandeln?«
Juan Alfredo ist ein moderner Hirte. Um die dreißig Jahre, attraktiv, das Gesicht vom Leben auf dem Land gegerbt, die Statureines Apolls. Das Haar rabenschwarz, starke Arme und die angenehme, feste Stimme eines höfischen Beraters – jemand, dem manvertrauen kann.
Er bleibt nur kurz, denn in dieser Jahreszeit müssen die Olivenbäume beschnitten und das angefallene Astwerk verbrannt werden. Vier Rauchsäulen steigen von den Villares auf, der Gebirgskette, die man von der Senke aus im Norden erblickt.
Meine Zuflucht ist ein kleines Rechteck, das in drei Kammernunterteilt ist. Die zwei Betten mit schmiedeeisernem Kopfendestehen in dem Raum, der zu den Villares hinausgeht und dessenWände noch stärker von der Feuchtigkeit verwittert sind als derRest des Hauses. Deshalb brachte ich gestern Abend eine der Matratzen ins südliche Zimmer und legte meinen Schlafsack darauf.In diesem Raum befindet sich ein kleiner Schrank, dessen Türchen und Schublädchen sich schlecht öffnen oder schließen lassen. Zwischen beiden Zimmern gibt es eine winzige Diele, die auchals Wohnraum dient. Dort steht ein verrosteter Schaukelstuhl neben dem Schornstein. Ich habe den Schaukelstuhl mit der Deckegefüttert, die mir den besten Eindruck machte. Als ich mich darinwiegte, stellte ich fest, dass er nicht einmal quietscht, sondern insehr gutem Zustand ist. Das übrige Mobiliar besteht aus zwei niedrigen Tischen und fünf Baststühlchen. Wenn ich mich auf sie setze,kann ich mein Kinn auf die Knie legen. Weder Bad noch Toilette.
Siria liegt auf der kalten, sonnigen Veranda und beobachtetmeinen Aufbruch.
»Komm!«
Die Hündin erhebt sich und wir gehen los, um Schafe zu suchen. Sie geht an meiner Seite. Manchmal trottet sie ein Stückvoraus, oder sie bleibt zurück, um an einem Felsen oder an Exkrementen zu schnüffeln, doch es dauert nie lange, bis sie zu mirzurückkommt.
Als die Schafe eine Bewegung wahrnehmen, wenden sie uns geschlossen die Köpfe zu, als wären sie keine Feiglinge, doch sobaldwir uns ihnen weiter nähern, flüchten sie im Galopp.
Ich verbringe den Morgen damit, diejenige Herde zu begutachten, der Juan Alfredo eine einheitliche Merino-Identität verleihen will, um die »Urrasse des Landes« zurückzugewinnen.Seit Jahrzehnten haben die siberianischen Hirten Churras mitMerinas oder auch mit Manchegas, Castellanas, Charoleras, Limousinas oder Île de France vermischt, was zu einem Ungleichgewicht unter den Viehzüchtern geführt hat. Seit zwanzig MillionenJahren grasen diese Pflanzenfresser auf der Iberischen Halbinsel,und die Mehrheit der Hirten stimmt darin überein, dass das Merino-Schaf am besten im Tal des Guadiana und auf den Dehesasvon La Siberia gedeiht, weil es sich an die Umgebung angepasst hat.Die Frage ist, wie man Merino-Herden zurückgewinnt, denn manschätzt, dass von den sechzehn Millionen Schafen, die es in Spanien gibt, etwa hundertachtzigtausend »Merinos, die man wirklichMerinos nennen kann«, übrig sind.
»Ich kaufe ausschließlich reine Merino-Böcke«, sagt Juan Alfredo, der fremdrassige Schafe verkauft, um seinen Bestand soschnell wie möglich zu vereinheitlichen.
Um drei Uhr nachmittags mache ich mich auf den Weg nachSüden zum Dorf. Wenn die Schafe einmal gefressen haben, brauchen sie in der Regel niemanden mehr, und falls es zu einem Notfall kommt, wird Siria ihnen nützlicher sein als ich.
Die Steineichen sehen aus wie einsame Spaziergänger in einemMeer aus Hügeln. Hier eine, dort eine, man könnte fast meinen,ohne Sinn und Zweck. Doch es gibt einen Plan. Die Anarchie desSteineichenbestands ist trügerisch, ihre Unordnung ein Ergebnismenschlicher Kontrolle und Pflege. Die riesigen, scheinbar chaotischen Felder spenden Schatten, Humus und Eicheln, wie diejenigen, um die sich gerade drei Schafe und zwei Kraniche streiten, dieplötzlich abheben und sich einer Linie von Gefährten anschließen,die sich zweihundert Meter am Himmel entlangzieht.
In der Ferne höre ich eine Motorsäge und denke, dass ich keineAxt besitze. An der Hütte gibt es einen Stapel Feuerholz, docheine Axt zu haben, ist immer gut. Enric lieh mir seine nicht, weil erbefürchtete, man werde sie mir bei der Passagierkontrolle im Zugabnehmen, und wir vermuteten, dass es in Sanjuanilla eine solche Kontrolle geben würde. Enric ist der Vater meiner Freundin,ein Outdoor-Crack, der dem israelischen Heer Filter abkauft, umdie Sonne durch das gigantische Teleskop zu beobachten, das er inseiner Keramikwerkstatt aufgestellt hat, und der zahllose Nistkästen in den Gärten des Landhauses angebracht hat, in dem er wohnt.Als er erfuhr, dass ich nach La Siberia reisen würde, besorgte er mirein hervorragendes Fernglas, ein Kampfmesser, das scharf genugist, um Knochen zu durchtrennen, und verschiedene andere Gadgets zum Überleben. Anschließend wiederholte er mehrmals, wiewenig die Dehesa geschätzt werde und dass es notwendig sei, dieseinzufordern.
Oft wird die Dehesa als allzu stark manipulierte Kulturlandschaft angesehen, obwohl sie vielleicht der realistischste Naturraum ist, einer, der am meisten Zukunft hat. Ohne über die mythischen Eigenschaften der Wildnis zu verfügen, erlaubt sie dieVermehrung von Tieren in Freiheit – auch von wilden. Kein anderes vom Menschen beeinflusstes Natursystem hat so viel Effizienz und Gleichgewicht erreicht wie die mediterrane Dehesa. EinQuadratmeter Boden enthält bis zu sechzig verschiedene Pflanzenarten und Millionen Mikroorganismen, die in alle RichtungenLeben verströmen. Ein jeder würde erkennen, dass dies nachahmungswürdig ist, ein alternatives Ökosystem, wo das Wilde unddas Menschliche sich im Dialog miteinander befinden, und vielleicht liegt darin der Grund für seine Unauffälligkeit in einer Welt,die mehr zu epischen Extremen neigt als zu Kompromisslösungen.
Durch die Dehesa zu spazieren, ist ein schlichtesVergnügen.
In der weiten Landschaft geht man aus sich selbst heraus. JedeLandschaft hat diese Wirkung auf die eine oder andere Weise. DasGebirge zwingt einen dazu, über es nachzudenken, während dieEbene alles zulässt. Das Gebirge ist mehr Hauptdarsteller, seineRisiken sind offensichtlicher und augenscheinlich unmittelbarer, wohingegen die Herausforderung der Dehesa, der Steppe, derWüste sich an eine gewisse Gleichförmigkeit anpasst. Sieh dir dasan. Die Steineichen sind nicht sehr hoch, die Schafe blöken in aller Ruhe, mittelgroße Libellen suchen vergeblich nach Gras, aufdem sie sich niederlassen könnten – ihr Flügelschlag fächert einem Kaninchen Luft zu, das nicht einmal beim Anblick einesWildschweins die Flucht ergreift. Diese Mischlandschaft wiegtsich in ewiger Namenlosigkeit, und deshalb gibt es Leute, für diedie Ebene der Dehesa ein Ort der Ergebung und des Verzichts ist.Aber für die Hirten ist sie alles.
Vielleicht bilde ich mir das nur ein, doch ich habe den Eindruck, dass die Wüsten und die Ebenen seit Jahren nicht mehr sobesungen werden wie früher, während die Leute Schlange stehen,um den Mount Everest zu besteigen. Die Gier nach Adrenalin undSpektakel hat die Berge in den Himmel gehoben, aber wer besingtdie Dehesa? Vielleicht ist dies der Beginn einer Art Lied. Eine Songline aus der Extremadura. Die australischen Aborigines sind keineHirten, aber mit ihren Songlines haben sie die Natur besungen wiesonst niemand. Man kann Australien durchqueren, indem mandem Faden dieser Lieder folgt, die ebenso einem Felsen gewidmetsind wie einem Wallaby. Kann man mehr tun, als mit der eigenenStimme das zu ehren, was man liebt?
Dass La Siberia so heißt, erfuhr ich erst wenige Wochen vor meiner Anreise, und auch meine Mutter erfuhr auf diese Weise, dasssie sibirische Eltern hatte. Anfangs konnte Eloísa den pseudorussischen Namen dieser Felder ohne Mammuts nicht glauben. Esgibt keine Hinweise, anhand derer man der Spur dieser Landschaftfolgen könnte, höchstens ein paar Bücher, die sich mit Jargons beschäftigen, einige Blättchen zur Geschichte, das Liederbuch einesDorfs, die Märchen eines weiteren. Der Rest sind institutionelleSchriften und Publikationen, deren Adjektive weder das Wachstum von Reh oder Zistrose berühren, noch das Leben der Menschen. Zwischen der Schlucht des Guadiana und dem Stausee LaSerena erstreckt sich ein riesiges Gebiet, das noch viele Geheimnisse birgt.
Die zahllosen Weideplätze erinnern mich an James Rebanks,einen englischen Hirten aus dem Lake District, der die Schafeund das Gras verehrt, das sie fressen. Rebanks sieht die Gegend,in der er lebt, wie die Mehrheit seiner Nachbarn, und deshalb warer sprachlos, als er einen Schriftsteller namens Wainwright entdeckte, der »seinen« Distrikt berühmt machte, indem er einenBlick darauf verbreitete, der nichts mit der Sicht der Leute gemeinhatte, die ihn bewohnten.
»Es ärgerte mich«, schreibt er, »dass anscheinend bis jetzt niemand von außerhalb gedacht hat, dieser Ort sei wunderschön oderwert, besucht zu werden.« Gleichzeitig fand er es eigenartig, dassman seine Landschaft aus Gründen lieben konnte, die ihm selbstgar nicht bewusst gewesen waren.
Nicht dass ich hierhergekommen bin, um den Wainwright zumachen, doch es ist offensichtlich, dass niemand La Siberia besondere Aufmerksamkeit geschenkt hat, auch nicht den Schafenund den Hirten, die hier leben. Außerhalb von Extremadura gibtes nicht einmal eine Vorstellung von dieser Gegend.
Den Feldweg nach Garbayuela säumen Büsche, Kräuter und Tiere,die ich noch nicht benennen kann. Irgendwann in meinem Lebenbegann ich zu reisen, um über Orte zu schreiben, und nachdem icheinige ausländische Wirklichkeiten miteinander verglichen habeund besser meine eigene erkenne, verfüge ich über ein lückenhaftes Wissen über die Natur der Welt. Ich könnte detailliert über denDingo und den Baobab sprechen, oder über die Olive und den Feigenkaktus, aber ich habe keine Ahnung, wie etwa diese Pflanze hiermit den gelben Blütenblättern heißt. Deshalb vertraue ich auf dieBücher über Flora und Fauna, die ich im Rucksack habe, und aufmeine Mutter, die ich ab und zu anrufe, um mit ihr über ihr Dorfzu sprechen und Anleitung zu suchen.
In Garbayuela habe ich Faustina besucht, mit der ich entfernt verwandt bin, und nun weiß ich, dass meine beiden hiesigen Urgroßeltern wegen Diabetes erblindet waren, bevor sie starben. MeineMutter hat mir deren Geschichte nie erzählt, vielleicht kennt siesie gar nicht. Urgroßeltern wird ab jetzt ein Synonym für eine nochtiefere Finsternis sein. Jedenfalls ist es ein neuer Begriff. Wie vieleDinge sehen und wissen wir nicht! Die Welt beginnt mit den Großeltern, alles davor ist Legende. Urgroßeltern? Es wäre ein Luxus gewesen, zwei Fabeln aus Fleisch und Blut zu kennen und sie zu fragen, wie man die Natur ohne Licht sieht.
In einem Geschäft, wo der Besitzer und zwei Kunden sich übereine Herde schwarzer Schafe unterhalten, kaufe ich Batterien fürmeine Stirnlampe.
Als ich um sieben Uhr nach Sanjuanilla zurückkomme, setzt dieAbenddämmerung ein. Die Pforte sitzt so fest, dass ich mich fasteine Minute lang abmühe, bevor ich sie öffnen kann. Sie zu schließen, ist noch schwieriger. Mir fehlt die Kraft, um den Drahtringüber den Haken zu ziehen, der als Schloss dient. Nach fast fünfMinuten verzweifelter Verrenkungen, in denen ich unentwegt anJuan Alfredo und seine Bizeps denke, weil er die Pforte öffnet undschließt, als wäre nichts dabei, gelingt es mir, den Ring über denZapfen zu ziehen. Ich schwitze, obwohl die Temperatur bald unternull sinken wird.
Siria tänzelt um mich herum, springt gegen meine Oberschenkel und versetzt mir ein paar ordentliche Schläge gegen die Wadenmit ihrem Y aus Steineiche.
Zweimal mit der Karre hin und her, einmal, um fünf dickeHolzstücke von dem Stapel zu holen, der sich an der Rückseite desHauses befindet, und einmal für Astwerk. Beim zweiten Mal gelingt es mir, Feuer zu machen.
Mithilfe meiner Stirnlampe und einer Stablampe, die dünn wieein Reiherbein ist, finde ich den Weg zum Stall und öffne die Tür,die fürchterlich quietscht. Dahinter liegt ein großer Raum, dessenBoden aus festgestampfter Erde besteht. Hier liegen Taue, Hakenund Futtersäcke für Hunde herum, außerdem der Benzinkanister.Dreimal muss ich am Starterseil ziehen, um den Generator anzuwerfen. Zurück in meinem Wohnzimmer, rücke ich den Schaukelstuhl ans Feuer und beginne, mir ein paar Tierbücher anzuschauen.
Aus Mangel an siberianischer Lektüre oder Büchern über dieDehesas, habe ich mir ein paar Klassiker mitgebracht, die sich mitder Meseta1 beschäftigen. Außerdem Ansichten über die Jagd vonMiguel Delibes1, Werke von Hirten aus aller Welt – von ihnen selbstgeschrieben oder mit ihnen als Hauptfiguren –, und willkürlichausgewählte Schriften über die Natur, darunter zwei wissenschaftliche Bände. Ohne diese vierzehn Bücher hätte der Rucksack nurdie Hälfte gewogen.
Die Pferdehändler und -züchter antiker europäischer Kulturen verfügten über dreizehn chromatische Begriffe aus dem Latein, um ihre Tiere zu unterscheiden. Die Kirgisen der Steppenunterschieden fast doppelt so viele Fellfarben wie die Reiter inWestrussland. Das hängt damit zusammen, dass der größte Teilder chromatischen Lexik, die wir benutzen, aus nichteuropäischenKulturen stammt. Nur in Freiheit kann ein Distelfink die Farbe desErdbeerbaums annehmen.
Ich lese nicht mehr lange weiter, denn meine Augen werdenvom Ultraviolett des Feuers angezogen. So lebhaft, wie es flackert,wird jede längere Lektüre ohnehin zur Herausforderung, undheute kapituliere ich. Das Holz wärmt die Hütte und meinen Stolz.Fasziniert beobachte ich, wie die Scheite brennen, die ich selbst gesammelt habe.
1. Einzige in Europa heimische Raubtierart aus der Familie der Mangusten.
1. Die Iberische Meseta ist die zentrale Hochebene Spaniens (ca. 200.000 km2).DieExtremadura ist Teil dieser geologischen Formation.
1. Miguel Delibes Setién (1920 - 2010) war ein spanischer Schriftsteller aus Valladolid.
Die wohlfeile Angst
Nachdem er vier Lämmer auf den Kipper des Kleinlasters geladenhat, sagt Juan Alfredo:
»Du bist dran«, und reicht mir den Greifer. Es handelt sich umeine kleine Eisenstange, die in einen Haken ohne Spitze ausläuft.Dicht aneinander gedrängt bewegen sich die Schafe hin und herund drücken sich dabei an die Türgitter des Pferchs. Ich werfe denHaken und verfehle mein Ziel. Man muss ihn um das Gelenk eines Hinterlaufs schlingen, ihn hochziehen und das Tier ergreifen.Beim dritten Mal gelingt es mir. Anfangs strampelt das Schaf einwenig, doch als es meine Umarmung spürt, hält es still und ichkann mich darauf konzentrieren, seine Wolle aus wenigen Zentimetern zu riechen. Juan Alfredo öffnet die Lade des Kippers, damit ich es zu den anderen Lämmern schupse. Wir sammeln nochvier weitere ein, bevor wir den Anhänger zur Tränke von Garbayuela fahren, wo ein Dutzend Kleinlaster mit Kippern voller Schafeum einen Lkw stehen, der tausend Tiere fasst.
Der Donnerstags-Laster sammelt eine Auswahl Lämmer umdie fünfundzwanzig Kilo ein, die bereits in der Lage sind, Futterohne die Hilfe der Mutter zu fressen, denn ihr Bestimmungsortist eine Mastweide in Murcia, wo man sie sofort wieder verlädt,zurückschickt und die Erstattung des Geldes verlangt, wenn sienicht fähig sind, aus eigener Kraft zu schlucken. Ein Hirte sagt,man müsse aufpassen, wie sie an Gewicht zulegen:
»Sie kennen kein Maß, wenn du sie lässt, platzen sie.« Juan Alfredo bekommt fünfzig Euro für jedes der Tiere, die man nachder Mast in Länder wie Marokko, Dubai oder Saudi-Arabien schicken wird, wo sie mit einer Hingabe verzehrt werden, die Spaniernfremd ist. Hier gehört das Lamm nach dem Kaninchen zu dem amwenigsten gegessenen Fleisch, das lässt aufhorchen, wenn man bedenkt, dass die Phönizier dieses Land I-spn-ya nannten: »Land derKaninchen.«
Immer mehr Ladungen Schafe werden auf der Rampe in dendreigeschossigen Laster gehievt, während die Viehzüchter undHirten mich fragen, ob ich keine Angst hätte, in Sanjuanilla zuwohnen, obwohl niemanden die Kälte interessiert, die dort herrschen kann.
»Wovor muss ich denn Angst haben?«, frage ich.
»Keine Ahnung, so ganz allein dort …«
Was für eine Überraschung aus dem Mund von Profis! Habenwir etwa jetzt alle diese allzu wohlfeile Angst, auch die Hirten?
»Es gibt Flüchtige«, sagt einer. »Es passieren Sachen.«
Gegen die Furcht kann ich nur den Riegel vorschieben und denSchlüssel zweimal herumdrehen, aber weil ich es vorziehe, nichtdie Geister zu rufen, zeige ich ihnen meine rußverschmutztenFinger, um zu demonstrieren, wie ich die Kälte bekämpfe. GesternNacht verbrachte ich eine ganze Weile damit, Zweige im Kaminhin und her zu schieben, damit sie besser brennen. Ich versuche,sie nach ihrem Leben zu befragen, doch sie fragen mehr, zum Beispiel, warum mich ihr Land interessiert, das hat doch damit nichtszu tun. Als ich sage, dass ich Tabla Corta besuchen werde, antworten sie:
»Du wirst enttäuscht sein. Mirabueno? Blick auf die Felder undab und zu ein Geier. Siehst du die Flecken in dem Felsen dort?«
Mirabueno ist das Gebirge, das parallel zum Dorf verläuft, manist schnell dort. Es handelt sich um eine Quarzformation, dichtunter dem Gipfel ragt eine Steilwand empor, die gräulich-weiß gesprenkelt ist mit getrockneten Exkrementen von Geiern. Scheiße,Kriminelle und Enttäuschung. Was für eine Art, Werbung für eineso schöne Gegend zu machen!
Nachdem die Lämmer im Lkw verladen sind, begleite ich JuanAlfredo und helfe ihm, die Äste der dreitausend Olivenbäume zuverbrennen, die er in den letzten Tagen beschnitten hat. Als er denzwei Meter hohen Scheiterhaufen in Brand setzt, bildet sich einTornado aus Rauch und Flammen, der sechs Meter Höhe erreicht.Der Hang ist paradoxerweise mit einem frischen Parfum geschwängert, während die Hitze mich entspannt, weil sie mir die Kälte, andie ich mich noch gewöhnen muss, aus dem Körper treibt. Gleichzeitig suche ich nach Argumenten gegen das Gefühl der Desillusionierung, das mir diese Leute gerade vermittelt haben. Allerdingsschien die ihre eine routinierte Desillusion zu sein, geäußert mitder Gleichgültigkeit einer Willkommenszeremonie, als bestündedas Ziel darin, den Besucher zu demoralisieren, damit er sich ausdem Staub macht oder die Konsequenzen trägt. Diese Haltung istgar nicht so schlecht, denn sie scheint eine Herausforderung zuenthalten: Wenn du die Schicht entmutigender Worte überwindest, öffnet sich dir das, was nicht erzählt wird. Am besten, ich sehees so. Wenn so viele Menschen gleichzeitig wiederholen, dass dudich an einem bedauernswerten Ort aufhältst, kannst du dich einerseits fragen, ob es Sinn hat, weiterzumachen, und andererseits,welches die Ursachen des Traumas sind. Oder ob sie nur so tun.
Dusche
Da der Rückweg lang ist, beschleunige ich meinen Schritt. Als ichin der Hütte ankomme, nutze ich meine Körpertemperatur, umein Bad zu nehmen, wenn man es so nennen kann. Ich fülle zweigroße Kochtöpfe mit Wasser und stelle sie aufs Feuer. Dann karreich mehrere große Scheite und frisches Reisig herbei, bevor ich dieTöpfe vom Feuer nehme und mich bei sechs Grad ausziehe. Dasmag für manchen eine annehmbare Temperatur sein, doch ich binein Mittelmeerbewohner, bin dünn und komme gerade erst aus derStadt. Ein paar Schafe und Kühe schauen ab und an zu dem Mannherüber, der da unter den Steineichen steht, Hawaianas an den Füßen trägt und schnauft, während er sich mit dampfendem Wasserüberschüttet. Am Ende bläst ein leichter, eisiger Wind, den ich inEmpfang nehme, indem ich meine Lungen aufblähe und brülle.
Die Ebene in Katia
Nach weniger als einer Woche habe ich mich den Schafen angepasst und erwache jeden Morgen wenige Minuten bevor die Glöckchen ertönen, die ihre Prozession zum Trog verkünden. Währendich mich ankleide, atme ich Gebirge von Dampf aus, die ich in derFinsternis sehe, und als ich die Tür öffne, die Mütze fest über denKopf gezogen, defilieren die Schafe bereits blökend vor dem Tor





























