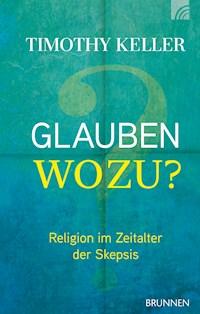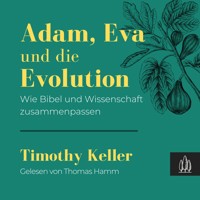Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Brunnen
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Warum Gott? Ist es heute noch vernünftig zu glauben? Ist der Glaube nicht irrelevant, ohne Antworten auf die drängenden Fragen der Zeit? Hat die Wissenschaft nicht den Glauben an Gott längst widerlegt? Mächtige Fragen an den Allmächtigen! Tim Keller findet Antworten, die nicht nur den Zweifler nachdenklich werden lassen. Und er nennt gute Gründe für den Glauben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 474
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Timothy Keller
WARUM GOTT?
Vernünftiger Glaube oder Irrlicht der Menschheit?
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
The Reason for God: Belief in an Age of Scepticism
© 2008 by Timothy Keller
RIVERHEAD BOOKS, Penguin Group (USA) Inc., 2008.
Aus dem Amerikanischen übersetzt von Friedemann Lux
Bibelzitate folgen, wo nicht anders angegeben, der „Hoffnung für alle“ – Die Bibel, Brunnen Verlag Gießen und Basel, © 1996, 2002 by International Bible Society,
sonst
Die Bibel: Revidierte Elberfelder Übersetzung, © R. Brockhaus Verlag, Wuppertal 1985/1991
oder Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © Katholisches Bibelwerk 1980.
3. Auflage 2011
© 2010 Brunnen Verlag Gießen
www.brunnen-verlag.de
Umschlagmotiv: Shutterstock
Umschlaggestaltung: Ralf Simon
Satz: DTP Brunnen
Druck: GGP, Pößneck
E-Book-Konvertierung: Satzweiss.com Print Web Software GmbH
ISBN 978-3-7655-7037-7
„Das Buch stand lange auf der Bestsellerliste der New York Times. Jetzt ist es auch bei uns zu haben. Zum Glück. ,Warum Gott?‘ ist eine außergewöhnlich kluge und kurzweilige Auseinandersetzung mit aktuellen Fragen und Zweifeln. Und es macht Lust auf den Glauben.“
Jürgen Werth, Direktor von ERF-Medien und Vorsitzender der Deutschen Evangelischen Allianz (in: Idea-Spektrum 41/2010)
„Timothy Keller hat ein großartiges, bewegendes und nachdenklich machendes Buch verfasst.“
Pro –christliches Medienmagazin 4/2010
„Eine knappe, leicht zugängliche Begründung eines durchdachten religiösen Glaubens.“
The Washington Post
„Als Gründer der Redeemer Presbyterian Church in New York City hat Keller erlebt, dass viele Menschen religiöse Überzeugungen hinterfragen und Fragen stellen wie ‚Wie kann es nur eine wahre Religion geben?‘ oder ‚Wie kann ein liebender Gott Leid zulassen‘. In diesem Buch … bringt Keller diese und andere Fragen zur Sprache und begründet seinen unbedingten Glauben an Gott. Mit Hilfe von Literatur, Philosophie und Pop-Kultur liefert der Autor überzeugende Gründe für einen festen Glauben. Es ist erfrischend, ein Buch zu lesen, das religiöse Sichtweisen präsentiert, ohne die säkulare Sicht, die in anderen Büchern präsentiert wird, über Gebühr zu kritisieren. Das Buch ist ein hervorragender Einstieg in die Diskussion und vertritt seine Position stichhaltig, gut geschrieben und gut recherchiert.“
Library Journal
„Durch seinen Dienst in New York gewinnt Tim Keller eine Generation von Suchenden und Skeptikern für den Glauben an Gott. Ich danke Gott für ihn.“
Billy Graham
„Dies ist das Buch, dass ich all meinen Freunden gebe, die ernsthaft geistlich Suchende oder Skeptiker sind.“
Rick Warren, Autor von „Leben mit Vision“
„(Es) ist Dr. Kellers Begabung, die Sprache seiner urbanen Zuhörer zu sprechen … es ist leicht zu verstehen, warum eine solche Anziehungskraft von ihm ausgeht.“
New York Times
FÜR KATHY, DIE KÜHNE
VORWORT
D
ieses Buch hat mich nicht überzeugt. War auch nicht nötig, denn ich glaube ja schon. Aber es hat mich inspiriert, motiviert, begeistert.
Und ich bin sicher, dass es denselben Effekt auch auf Sie, liebe Leserin, lieber Leser hat, egal ob Sie Christ sind oder nicht. Tim Keller schreibt, wie ich ihn selbst schon oft habe predigen hören. Zusammen mit Tausenden von skeptischen New Yorkern, die man vor ein paar Jahren nicht mit Hundert-Dollar-Scheinen in eine Kirche geködert hätte. Von Tim Keller fühlen sich diese Menschen angezogen, denn er spricht und schreibt nicht von der Kanzel herab, sondern auf Augenhöhe mit uns, den Nicht-Theologen.
Am Ende stehen wir alle nämlich vor der gleichen Herausforderung: eine Antwort zu finden auf die bohrende, manchmal nervende Frage, warum und wieso wir da sind. Tim Keller ist demütig genug zu wissen, dass man die Antwort ahnt, spürt, erhofft, aber nie weiß. Deshalb liefert er Argumente, die nicht die Existenz Gottes beweisen, aber als Wahrscheinlichkeitsverstärker dienen.
Mein Glaube, das muss ich zugeben, ist nicht Gewissheit, sondern Passion, Gewohnheitssache, Herzensangelegenheit. Ich reflektiere nicht jeden Tag über die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Einzeller von selbst über Millionen Jahre hinweg zu einem Menschen zusammenbaut, der Techno hört, Fußball spielt, Sex hat und Bücher wie dieses liest. Mein Bauch sagt mir, dass das höchst unwahrscheinlich ist. Und meinen Kopf beruhigt, dass die Fakten eher für meinen Bauch sprechen als gegen ihn.
Das Buch treibt den Ungläubigen nicht automatisch zur nächsten Kircheneintrittsstelle, aber vielleicht zum Griff in den Bücherschrank, um eine Bibel hervorzukramen und darin zu lesen – und dann ins Staunen zu kommen.
Als Pastorensohn bescheinige ich mir selbst einen „Obelix-Effekt“. In den Zaubertrank des Glaubens bin ich wie der dicke Gallier schon als Kind gefallen. Die Euphorie, die jemand erfährt, wenn er oder sie zum ersten Mal einen kräftigen Schluck aus der Glaubenspulle nimmt, kenne ich leider nicht. Ich war irgendwie schon immer fromm. Deshalb bin ich neidisch auf manche Leser dieses Buchs. Diejenigen, die sich dazu animieren lassen, Gott zu denken, ihn anzusprechen oder sich von ihm ansprechen zu lassen. Die werden merken: Glaube hat nicht nur Gründe. Er schmeckt auch noch verdammt gut. Und Tim Kellers Buch lässt sogar mir, trotz Obelix-Effekt, das Wasser im Mund zusammenlaufen.
Dr. Markus Spieker, TV-Hauptstadtkorrespondent und Buchautor
Weitere Informationen und „Impulse zum Weiterdenken“ unter www.warum-gott.de
EINLEITUNG
„Ich finde Ihren Mangel an Glauben – beklagenswert.“
(Darth Vader)
Beide Gegner haben recht
E
s klafft heute in Amerika ein tiefer Abgrund zwischen dem sogenannten liberalen und dem sogenannten konservativen Lager. Jedes der beiden Lager verlangt, dass man nicht nur anderer Meinung als der Gegner zu sein hat, sondern erklärt diesen entweder für verrückt (die milde Version) oder bezeichnet ihn als böse (die schärfere Version). Dies gilt ganz besonders dort, wo es um Religion geht. Die Liberalen schreien, dass der Fundamentalismus auf dem Vormarsch ist und Freiheit, Fortschritt und Vernunft bedroht. Sie warnen vor der „christlichen Rechten“, die die gläubigen Christen mobilisiert und angeblich kurz davor steht, das Land zurück ins Mittelalter zu führen. Die Konservativen ihrerseits werden nicht müde, den, wie sie es sehen, galoppierenden Glaubens- und Werteverfall in der Gesellschaft zu geißeln, und weisen darauf hin, dass die führenden Universitäten, Medien und Elite-Institutionen säkularisiert sind und die Kultur dominieren.
Wer hat hier recht? Ist nun der Glaube oder der Skeptizismus, sind die Christen oder ihre Gegner in der heutigen westlichen Welt auf dem Vormarsch? Die Antwort lautet beide Male „Ja“. Skepsis, Angst und Ablehnung gegenüber den traditionellen Religionen nehmen immer mehr zu, und religiöse Positionen werden immer deutlicher und aggressiver angegriffen. Gleichzeitig wächst die Zahl der echt gläubigen Anhänger der traditionellen Religionen.
In den USA wie in Europa nimmt die Zahl der Menschen, die nicht zur Kirche gehen, stetig zu.1 Die Zahl der Amerikaner, die bei Umfragen angeben, keiner Religion anzugehören, hat sich im vergangenen Jahrzehnt verdoppelt bis verdreifacht.2 Bereits vor einem Jahrhundert verwandelten sich die meisten Universitäten in den USA aus formal christlichen zu offen säkularen Institutionen.3 Das Ergebnis ist, dass Menschen mit traditionell religiöser Prägung wenig Zugang zu den Korridoren der kulturellen Macht haben. Doch während einerseits immer mehr Menschen von sich sagen, sie seien nicht religiös, erleben andererseits Kirchen, die, scheinbar altmodisch-naiv, an die Unfehlbarkeit der Bibel und an Wunder glauben, in den USA ein reges, in Afrika, Lateinamerika und Asien ein explosionsartiges Wachstum. Selbst in vielen Ländern Europas gibt es durchaus wachsende Kirchen.4 Und in den USA ist trotz der Säkularisierung der meisten Universitäten und Colleges der Glaube in einigen Ecken der akademischen Welt auf dem Vormarsch. Man schätzt, dass derzeit zwischen 10 und 25 Prozent der Philosophiedozenten und -professoren in den USA gläubige Christen sind, gegenüber weniger als einem Prozent vor 30 Jahren.5 Der bekannte Akademiker Stanley Fish hatte möglicherweise diesen Trend im Auge, als er berichtete: „Als Jacques Derrida [im November 2004] gestorben war, rief mich ein Reporter an und wollte wissen, was nach der hohen Theorie und dem Triumvirat von Rasse, Geschlecht und Klasse nun das nächste Zentrum der intellektuellen Energie in der akademischen Welt werden würde. Ich erwiderte wie aus der Pistole geschossen: die Religion.“6
Die Theorie, dass der wissenschaftliche und technische Fortschritt unweigerlich zur Säkularisierung führt, gehört wohl auf den Müllhaufen der Geschichte.
Kurz: Wenn es um Religion geht, erleben wir derzeit eine wachsende Polarisierung der Welt: Sie wird gleichzeitig immer religiöser und immer weniger religiös. Es gab eine Zeit, da glaubten die Intellektuellen, dass die säkularisierten europäischen Länder die Vorreiter für den Rest der Welt sein würden. Die Religion, so dachte man, würde aussterben, zumindest aber sich so „verdünnen“, dass die traditionellen, auf das Übernatürliche ausgerichteten Formen verschwinden würden. Aber die Theorie, dass der wissenschaftliche und technische Fortschritt unweigerlich zur Säkularisierung führt, wird inzwischen verworfen oder radikal neu formuliert.7 Selbst Europa steht möglicherweise eine nichtsäkulare Zukunft bevor; hier erlebt das konservative Christentum ein moderates, der Islam ein stürmisches Wachstum.
Die beiden Lager
Doch jetzt zunächst zu mir. Ich spreche aus einer vielleicht etwas ungewöhnlichen Perspektive über dieses Doppelphänomen. Ich bin in einer lutherischen Kirche im östlichen Pennsylvanien aufgewachsen. Anfang der 1960er-Jahre kam mein zweijähriger Konfirmandenunterricht. Ziel des Unternehmens: die jungen Leute tiefer in ihren Glauben einzuführen, damit sie sich bei der Konfirmation vor der Gemeinde dazu bekennen konnten. Im ersten Jahr wurden wir von einem Pastor im Ruhestand unterrichtet, der sehr konservativ war und oft von der Hölle sprach und wie wichtig es war, einen großen Glauben zu haben. Im zweiten Jahr wurde er dann durch einen jungen Pastor abgelöst, der frisch von der Universität kam, ein sozialer Aktivist war und tiefe Zweifel an der traditionellen christlichen Lehre hatte. Es war fast, als hätte man uns zwei verschiedene Religionen präsentiert: Im ersten Unterrichtsjahr standen wir vor einem heiligen, gerechten Gott, dessen Zorn man nur mit Mühe besänftigen konnte. Im zweiten Jahr hörten wir von einem Geist der Liebe, der das Universum durchwehte und der von einem erwartete, dass man für die Menschenrechte und die Befreiung der Unterdrückten kämpfte. Ich hatte große Lust, die beiden Pastoren zu fragen: „Wer von euch beiden lügt?“, aber das traute ich mich mit meinen 14 Jahren dann doch nicht und hielt lieber meinen Mund.
Später gingen meine Eltern in eine kleine methodistische Kirche, wo meine religiöse Entwicklung mehrere Jahre lang erneut vom Feuer-der-Hölle-Lager geprägt wurde, obwohl der Pastor und die Gemeindeglieder persönlich die liebenswertesten Menschen waren. Dann ging ich als junger Mann auf eine der netten, kleinen, liberalen Universitäten im Nordosten der USA, die sofort begann, das Höllenfeuer mit dem Wasser des Säkularismus zu löschen.
Die Abteilungen für Geschichte und Philosophie waren radikal gesellschaftskritisch und massiv von der neomarxistischen kritischen Theorie der Frankfurter Schule beeinflusst. Im Jahre 1968 war das angesagt! Faszinierend fand ich besonders den sozialen Aktivismus und die Kritik der bürgerlichen amerikanischen Gesellschaft – aber die philosophische Untermauerung irritierte mich. Ich hatte den Eindruck, dass bei beiden der feindlichen Lager, die ich da vor mir hatte, etwas grundlegend falsch lief. Die Leute, die so nach sozialer Gerechtigkeit schrien, waren moralische Relativisten, und den Leuten, die die Moral hochhielten, schien die Unterdrückung in der Welt egal zu sein. Emotional zog es mich zum ersten Lager hin (welchem jungen Menschen wäre es anders gegangen?): Befreit die Unterdrückten und schlaft, mit wem ihr wollt … Aber die Frage ließ mich nicht los: „Wenn Moral relativ ist, warum soll es dann mit der sozialen Gerechtigkeit nicht genauso sein?“ Widersprachen meine Professoren und ihre Jünger sich da nicht selber? Aber befanden sich die konservativen Kirchen nicht in einem ebensolchen Selbstwiderspruch? Wie konnte ich mich wieder einem Glauben anschließen, der die Rassentrennung im Süden der USA und die Apartheid in Südafrika unterstützte? (Was damals in traditionellen, christlichen Kreisen meist der Fall war.) Der Glaube, in dem ich aufgewachsen war, schien mir immer unwirklicher zu werden – aber ich sah auch keine brauchbare Alternative für mein Leben und Denken.
Bei beiden der feindlichen Lager, die ich da vor mir hatte, lief etwas grundlegend falsch.
Ich wusste das damals noch nicht, aber dieses religiöse „Niemandslandgefühl“ hatte seine Ursache in drei inneren Barrieren, die ich mit mir herumtrug. Im Laufe meiner Studentenjahre zerbröckelten sie nach und nach, sodass mein Glaube lebendig wurde. Die erste Barriere war eine intellektuelle. Ich rang mit einer ganzen Reihe schwieriger Anfragen an das Christentum: Wie war das mit den anderen Religionen? Mit dem Problem des Bösen und des Leides? Wie konnte ein liebender Gott richten und strafen? Warum sollte man überhaupt etwas glauben? Ich begann, Bücher zu lesen und Argumente zu durchdenken, das Für und Wider abzuwägen, und langsam, aber sicher fand ich den christlichen Glauben immer überzeugender. Der Rest dieses Buches zeigt Ihnen, warum ich das heute noch so sehe.
Die zweite Barriere war eine mehr persönliche. Als Kind kann man sich mit seinem Glauben auf die Autorität der Erwachsenen gründen, aber wenn wir dann selber erwachsen werden, brauchen wir auch die persönliche Erfahrung aus erster Hand. Ich hatte viele Jahre lang brav gebetet, dann und wann auch beim Anblick des Meeres oder der Berge diese ästhetische Ehrfurcht verspürt, aber nie hatte ich persönlich Gottes Gegenwart erfahren. Bei diesem Problem ging es nicht so sehr um das Erlernen irgendwelcher Gebetstechniken, sondern um einen Prozess, in dem ich mich meinen eigenen Bedürfnissen, Fehlern und Problemen stellte. Es war ein schmerzlicher Prozess, angestoßen, wie so oft, von Enttäuschungen und Versagenserlebnissen. Es würde ein zweites, anderes Buch brauchen, Ihnen dies im Einzelnen zu erzählen. Lassen Sie mich Ihnen hier nur sagen, dass eine Glaubensreise nie eine bloße intellektuelle Übung für die grauen Zellen ist.
Die dritte Barriere schließlich war gewissermaßen eine soziale. Ich musste dringend eine „dritte Fraktion“ finden, eine Gruppe von Christen, denen die Gerechtigkeit in der Welt wichtig war, aber die dieses Anliegen aus dem Wesen Gottes ableiteten und nicht aus irgendwelchen subjektiven Gefühlen. Als ich diese „anderen“ Brüder und Schwestern fand, wurde mein Leben anders.
Diese drei Barrieren fielen nicht schnell, und auch nicht in einer bestimmten Reihenfolge. Sie waren ineinander verwoben, die eine hing von der anderen ab, und ich ging sie nicht systematisch an. Erst im Rückblick sehe ich, wie diese drei Faktoren zusammenwirkten. Da ich also ständig jene „dritte Fraktion“ suchte, erwachte mein Interesse an der Gründung und Gestaltung neuer christlicher Gruppen und Gemeinden. Aber das hieß natürlich, dass ich Pastor werden musste. Und so wurde ich Pastor, nur wenige Jahre nach meinem Studium.
Gott in Manhattan
Ende der 1980er-Jahre zogen meine Frau Kathy und ich mit unseren drei kleinen Jungen nach Manhattan, um dort eine neue Gemeinde zu gründen, die vor allem Menschen ansprechen sollte, die nichts mehr mit Glauben und Kirche am Hut hatten. Während der Vorbereitungsphase erklärte mir fast jeder, dass mein Projekt zum Scheitern verurteilt war. Kirche – das war etwas für die Gemäßigten oder Konservativen, aber diese Stadt war quirlig und liberal. Kirche, das hieß Familie, aber New York City war voll von jungen Singles und „nichttraditionellen“ Haushalten. Und vor allem bedeutete Kirche Glauben, und Manhattan war das Reich der Skeptiker, Kritiker und Zyniker. Die Mittelklasse, das herkömmliche Publikum einer Gemeinde, floh in Scharen vor der Kriminalitätsrate und den hohen Lebenshaltungskosten der Stadt. Es blieben die Elitären und die Coolen, die ganz Reichen und die richtig Armen – lauter Leute, denen man mit Kirche nicht zu kommen brauchte. Das jedenfalls sagte man mir. Die Kirchengemeinden in der Stadt schrumpften, die meisten hatten Mühe, auch nur ihre Gebäude zu halten.
Viele der Leute, mit denen ich anfangs Kontakt hatte, sagten mir, dass die paar Gemeinden, denen es noch leidlich ging, dies dadurch erreicht hatten, dass sie die traditionelle christliche Lehre an das mehr pluralistische Ethos der Stadt angepasst hatten. „Sagen Sie den Leuten bloß nicht, dass sie an Jesus glauben müssen – damit sind Sie hier ein Hinterwäldler.“ Sie waren sprachlos, als ich ihnen erklärte, dass das Glaubensbekenntnis der neuen Gemeinde das althergebrachte sein würde: die Autorität der Bibel, die Göttlichkeit Christi, die Notwendigkeit von Bekehrung und Wiedergeburt – lauter Dinge, die für die große Mehrheit der New Yorker aus dem Mittelalter stammten. Niemand sagte es mir laut, aber der Kommentar „Vergessen Sie’s!“ hing ständig in der Luft.
Vor allem bedeutete Kirche Glauben, und Manhattan war das Reich der Skeptiker, Kritiker und Zyniker.
Nun, wir gründeten unsere „Redeemer Presbyterian Church“, und bis Ende 2007 war die Gemeinde auf über 5000 Glieder gewachsen und hatte über ein Dutzend Tochtergemeinden im Stadtgebiet hervorgebracht. Die Gemeinde ist multiethnisch und jung (das Durchschnittsalter liegt bei 30) und besteht zu über zwei Dritteln aus Singles. In Manhattan sind derweil Dutzende und in den anderen vier Stadtbezirken von New York Hunderte ähnliche, am traditionellen christlichen Glauben festhaltende Gemeinden entstanden. Nach einer Untersuchung sind in den letzten paar Jahren allein von Christen aus Afrika über hundert neue Gemeinden in New York City gegründet worden. Es ist atemberaubend.
Und New York ist nicht allein. Im Herbst 2006 erschien im Economist ein Bericht mit dem Untertitel: „Das Christentum stirbt überall aus, außer in London.“ Der Artikel stellte fest, dass entgegen dem in ganz Großbritannien und Europa zu beobachtenden Trend zu immer leereren Kirchen in London viele junge Akademiker, aber auch Einwanderer in christliche Gemeinden strömen.8 Genau dasselbe beobachte ich hier in New York.
Das bringt mich zu einem merkwürdigen Fazit. Wir befinden uns in einer Phase unserer kulturellen Entwicklung, in der Gläubige wie Skeptiker sich in ihrer Existenz bedroht fühlen, weil beide – Säkularismus und religiöser Glaube – massiv auf dem Vormarsch sind. Wir haben heute weder das christliche Abendland der Vergangenheit noch die religionslose Gesellschaft, die angeblich die Zukunft prägen sollte. Wir haben etwas völlig anderes.
Eine gespaltene Kultur
Noch vor drei Generationen wählte man sich seine Religion nicht, sondern wurde in sie hineingeboren. Die große Mehrheit der Menschen im Westen war entweder evangelisch oder katholisch. Doch heute befinden sich besonders die klassischen protestantischen Kirchen in einem rapiden Alterungsprozess und ihre Mitgliederzahlen gehen deutlich nach unten. Die Menschen entscheiden sich für ein Leben ohne Religion, für eine kirchlich nicht gebundene, persönlich zusammengebastelte Spiritualität oder aber für „rechtgläubige“ religiöse Gruppierungen mit hoher Verbindlichkeit, die von ihren Mitgliedern aktive Lebenshingabe und ein Bekehrungserlebnis erwarten. Womit die Bevölkerung, wie gesagt, gleichzeitig beides wird: religiöser und weniger religiös.
Weil dies so ist, ist die politische und öffentliche Diskussion über Glaubens- und Moralfragen zu einem Kampf der Kulturen und zu einer Sackgasse geworden. Die Emotionen gehen hoch, der Ton ist kämpferisch, ja manchmal hysterisch. Für die einen sind die, die an Gott und das Christentum glauben, die bösen „Fundamentalisten“, die „den Menschen ihren Glauben aufzwingen“ und „das Rad der Geschichte zurückdrehen“ wollen. Für die anderen sind die Nichtgläubigen „Feinde der Wahrheit“, die darauf aus sind, mit ihrem „moralischen Relativismus“ die Gesellschaft zu zerstören. Wir reden nicht mehr vernünftig miteinander, sondern bekämpfen einander.
Diese verfahrene Situation lässt sich nicht einfach dadurch lösen, dass man zu mehr Dialog aufruft. Um sich vernünftig streiten zu können, braucht man einen gemeinsamen Bezugsrahmen, auf den man sich verständigt hat. Doch dies wird schwierig, wenn die Kontrahenten die Realität mit völlig unterschiedlichen Augen sehen. Der Titel eines Buches von Alasdair MacIntyre, Whose Justice? Which Rationality? („Wessen Gerechtigkeit? Was für eine Rationalität?“) sagt hier mehr als viele Worte. Die Probleme, die wir haben, werden nicht so bald verschwinden.
Wie finden wir einen Ausweg aus dieser Sackgasse?
Als Erstes sollten beide Seiten anerkennen, dass beide, der religiöse Glaube und der Skeptizismus, auf Wachstumskurs sind. Sowohl der atheistische Autor Sam Harris als auch der Sprecher der amerikanischen religiösen Rechten, Pat Robertson, sollten sich darüber klar werden, dass ihr eigenes Lager stark ist und zunehmend an Einfluss gewinnt. Dies würde Schluss machen mit der in beiden Lagern grassierenden Angst, vielleicht schon morgen vom Gegner überrannt und ausgelöscht zu werden. Dergleichen ist kurz- bis mittelfristig gar nicht möglich. Wenn wir uns nicht mehr solchen Katastrophenszenarien hingeben würden, könnten wir dem Gegner viel gelassener und großzügiger begegnen.
Diese Einsicht würde nicht nur unsere Nerven beruhigen, sondern uns auch demütiger machen. Immer noch tönen viele Anhänger des Säkularismus, dass die Anhänger der Religion vergeblich versuchen würden, „das Rad der Geschichte anzuhalten“, obwohl rein nichts dafür spricht, dass die Religion aussterben wird. Und die Gläubigen ihrerseits sollten die Argumente der Skeptiker nicht so schnell abtun. Wenn unsere ehemals christlichen Gesellschaften in einem solchen Umfang dem Glauben den Rücken gekehrt haben, sollte uns das ein Anlass zur Selbstprüfung sein. Mit einem überheblichen „Die spinnen, die anderen“ kommen wir heute nicht weiter. Wir brauchen mehr. Aber was?
Ein zweiter Blick auf den Zweifel
Ich möchte einen Vorschlag machen, der in den letzten Jahren im Leben vieler junger New Yorker reiche Früchte getragen hat. Ich möchte beiden Seiten in dem Konflikt empfehlen, das Phänomen des Zweifels mit radikal anderen Augen zu sehen.
Fangen wir mit den Gläubigen an: Ein Glaube ohne jeden Zweifel ist wie ein menschlicher Körper ohne Immunsystem. Menschen, die (ob nun aus Gleichgültigkeit oder Zeitmangel) naiv durchs Leben gehen, ohne sich je ernsthaft zu fragen, warum sie das glauben, was sie glauben, werden hilflos sein, wenn die Schläge des Lebens oder die bohrenden Fragen des gewieften Zweiflers kommen. Der Glaube eines Menschen, der sich nicht jahrelang geduldig mit seinen Zweifeln auseinandergesetzt und sie erst nach langem Überlegen verworfen hat, kann über Nacht zusammenbrechen.
Zweifel (nicht nur die eigenen, sondern auch die der Freunde oder der Nachbarin) sind dazu da, dass man sie anerkennt und mit ihnen ringt. Es reicht heute nicht mehr, etwas deswegen zu glauben, weil die Eltern und Großeltern es auch geglaubt haben. Nur wer sich den Einwänden gegen seinen Glauben geduldig und engagiert stellt, ist in der Lage, diesen gegenüber dem Skeptiker (einschließlich seiner selbst) auf eine Art zu begründen, die plausibel und nicht lächerlich oder überheblich daherkommt. Und was für unsere Situation nicht weniger wichtig ist: Solch ein Prozess wird auch dazu führen, dass Sie, auch und gerade wenn Ihr Glaube stark und fest gegründet ist, den Zweifler respektieren und verstehen.
Ein Glaube ohne jeden Zweifel ist wie ein menschlicher Körper ohne Immunsystem.
Aber so wie der Gläubige lernen muss, nach den Gründen hinter seinem Glauben zu suchen, muss der Skeptiker lernen, sich zu fragen, welche Art von Glauben denn seinen Gedankengängen zugrunde liegt. Jeder Zweifel, wie skeptisch oder gar zynisch er auch daherkommt, ist im Grunde ein alternativer Glaube.9 Man kann einen Glauben A nicht anzweifeln, ohne selber eine Glaubensposition B einzunehmen. Wer das Christentum anzweifelt, weil „es nicht bloß eine wahre Religion“ geben kann, muss sich im Klaren sein, dass er damit einen Glauben vertritt. Niemand kann diese Annahme empirisch beweisen, und sie ist keineswegs eine universale Wahrheit, die alle Menschen akzeptieren. Wenn Sie in den Nahen Osten gehen und dort sagen: „Es kann nicht bloß eine wahre Religion geben“, würde fast jeder Ihnen antworten: „Warum nicht?“ Der Grund dafür, dass Sie den Glauben A (den der Christen) anzweifeln, ist schlicht, dass Sie von einem anderen Glauben B ausgehen, der sich ebenfalls nicht beweisen lässt. Jeder Zweifel gründet auf einem „Sprung in den Glauben“10.
Die einzig faire Art, den christlichen Glauben anzuzweifeln, besteht darin, den alternativen Glauben zu erkennen, der jedem Zweifel zugrunde liegt, und sich zu fragen, was für Gründe man für diesen Glauben hat.
Manche Menschen sagen: „Ich glaube nicht an das Christentum, weil ich nicht die Existenz von absoluten moralischen Werten akzeptieren kann. Jeder sollte über seine Moral selbst bestimmen.“ Ist dies eine Aussage, die man jemandem, der sie nicht teilt, beweisen kann? Nein, sondern sie ist ein Sprung in den Glauben, ein tiefer Glaube, dass es Individualrechte nicht nur in der Politik, sondern auch in der Ethik gibt. Es gibt keinen empirischen Beweis für diese Position; der Zweifel daran, dass es absolute moralische Werte gibt, ist ein Glaube.
Vielleicht antworten Sie jetzt: „Meine Zweifel gründen nicht in einem Glaubenssprung! Ich glaube überhaupt nichts über Gott, weder so noch so. Ich habe keinen Bedarf an Gott und habe kein Interesse daran, über ihn nachzudenken!“ Aber unter diesem Denken verborgen liegt der sehr moderne Glaube vieler Zeitgenossen, dass mir die Existenz Gottes egal sein kann, solange sie nicht meine emotionalen Bedürfnisse berührt. Das setzt voraus, dass es keinen Gott gibt, der jemand, der ihn nicht braucht, für das, was er glaubt und tut, zur Verantwortung ziehen wird. Dies mag stimmen oder nicht, aber in jedem Fall ist es ein Sprung in den Glauben.11
Die einzig richtige und faire Art, den christlichen Glauben anzuzweifeln, besteht darin, den alternativen Glauben zu erkennen, der jedem Zweifel zugrunde liegt, und sich zu fragen, was für Gründe man für diesen Glauben hat. Woher weiß ich denn, dass mein Glaube wahr ist? Es wäre inkonsequent, bei der Prüfung des christlichen Glaubens die Messlatte höher zu hängen als bei seinem eigenen Glauben, aber genau das passiert sehr häufig. Wir müssen lernen, unsere eigenen Zweifel anzuzweifeln. Meine These ist, dass jemand, der erkennt, was für Glaubenspositionen seinen Zweifeln am Christentum zugrunde liegen, und der dafür genauso viele Beweise verlangt wie für die Positionen des Christentums, erkennen wird, dass seine Zweifel durchaus nicht so unerschütterlich sind, wie es ihm zunächst erschien.
Ich möchte meinen Lesern zwei Denkübungen empfehlen. Die Skeptiker möchte ich bitten, sich dem „blinden Glauben“, auf dem ihr Zweifel aufbaut, zu stellen und zu erkennen, wie schwierig es ist, diesen Glauben jemandem, der ihn nicht teilt, plausibel zu machen. Und den Gläubigen möchte ich Mut machen, sich ernsthaft mit den persönlichen und kulturellen Einwänden gegen den Glauben auseinanderzusetzen, die es in ihrer Umgebung gibt. Am Ende dieser beiden Prozesse werden Sie vielleicht immer noch der alte Skeptiker oder Gläubige sein, aber Sie werden Ihre Position mit mehr Deutlichkeit und mehr Demut vertreten und so zu einem Verständnis, Einfühlungsvermögen und Respekt gegenüber der anderen Seite kommen, wie Sie sie bisher nicht hatten. So werden aus Feinden, die sich nur wüst beschimpft haben, Gesprächspartner, die begründet verschiedener Meinung sein können. Das geht dann, wenn jede der Parteien gelernt hat, die Position der anderen in ihrer stärksten und positivsten Form darzustellen. Erst dann verfügt sie über die nötige Gelassenheit und Fairness, sie zu kritisieren. So entsteht eine Atmosphäre der Höflichkeit in einer pluralistischen Gesellschaft, was kein kleiner Erfolg ist.
Ein dritter Weg?
Der Rest dieses Buches ist der Extrakt aus den zahlreichen Gesprächen, die ich im Laufe der Jahre mit Zweiflern geführt habe. In meinen Predigten wie im persönlichen Umgang habe ich versucht, Skeptikern behutsam zu helfen, sich ihre eigenen Glaubenspositionen anzuschauen, und gleichzeitig meinen Glauben ihrer harten Kritik ausgesetzt. Im ersten Teil dieses Buches werden wir uns die sieben größten Einwände gegen das Christentum anschauen, die ich im Laufe der Jahre von den Menschen gehört habe. Und wir werden uns die Glaubenspositionen anschauen, die diesen Einwänden zugrunde liegen. Im zweiten Teil wollen wir uns dann den Gründen zuwenden, die hinter den Glaubensaussagen des Christentums stehen.
Der respektvolle Dialog zwischen traditionellen Konservativen und säkularen Liberalen ist ein hohes Gut, und ich hoffe, dieses Buch wird ihn fördern. Aber meine Erfahrungen als Pastor in New York lassen mich dieses Buch noch aus einem anderen Grund schreiben: Als ich in New York ankam, merkte ich bald, dass die Situation bezogen auf Glaube und Zweifel in der Stadt nicht dem entsprach, was die Experten annahmen. Die älteren weißen Bürger, die die Kulturszene der Stadt bestimmten, waren eindeutig säkular geprägt. Aber unter den zunehmend multiethnischen jüngeren Akademikern und den Immigranten aus der Arbeiterschicht gab es eine reiche, in keine Schubladen passende Vielfalt starken religiösen Glaubens, und das Christentum wuchs hier sehr schnell.
Ich glaube, dass diese jungen Christen die Vorhut einer neuen religiösen, sozialen und politischen Struktur in Amerika sind, die die alte Version der Kulturkämpfe bald zum Auslaufmodell machen könnte. Nachdem sie mit Zweifeln und Einwänden gegen das Christentum gekämpft haben, kommen viele von ihnen auf der anderen Seite mit einem fest gegründeten, „orthodoxen“ Glauben heraus, der aber quer zu den gegenwärtigen politischen Kategorien (hier die „liberalen“ Demokraten, dort die „konservativen“ Republikaner) liegt. Viele erkennen, dass in dem „Kampf der Kulturen“ ja beide Seiten die individuelle Freiheit und das persönliche Glück höher stellen als Gott oder das Gemeinwohl. Der Individualismus der Liberalen verrät sich in ihren Positionen zu Abtreibung, Sex und der Ehe, der der Konservativen in ihrem tiefen Misstrauen gegenüber der öffentlichen Hand und ihrer Sicht von Armut als selbst verschuldet. Das neue, rasant wachsende multiethnisch-„orthodoxe“ Christentum in den amerikanischen Großstädten engagiert sich viel mehr für die Armen und die soziale Gerechtigkeit, als die Republikaner es je getan haben, und viel mehr für die klassische christliche Moral und Sexualethik, als die Demokraten es je getan haben. Während die erste Hälfte dieses Buches den Weg beschreibt, den viele dieser Christen durch den Dschungel des Zweifels gegangen sind, ist die zweite Hälfte eine mehr positive Darstellung des Glaubens, den sie in ihrem Alltag ausleben. Als Einstieg möchte ich Ihnen drei Glieder unserer Gemeinde vorstellen:
June hatte an einer Elite-Universität studiert und wohnte und arbeitete jetzt in Manhattan. Die Gedanken über ihre Figur ergriffen so stark Besitz von ihr, dass sie Essstörungen bekam und medikamentensüchtig wurde. Sie erkannte, dass sie dabei war, sich zugrunde zu richten, aber auch, dass sie eigentlich keinen Grund hatte, das zu stoppen. Was hatte ihr Leben denn schon für einen Sinn? Sie begann, in unsere Gemeinde zu gehen und Gottes Gnade und die Erfahrung seiner Gegenwart zu suchen. Ein Seelsorger half ihr, die Verbindung zwischen der Gnade Gottes und ihrem scheinbar unstillbaren Bedürfnis nach Anerkennung herzustellen. Sie wagte es schließlich und suchte eine Begegnung mit Gott selber. Sie kann nicht Tag und Uhrzeit nennen, aber zum ersten Mal in ihrem Leben erlebte sie sich „bedingungslos geliebt als eine echte Tochter Gottes“. Nach und nach wurde sie frei von ihrer Selbstzerstörung.
Jeffrey war ein Musiker aus New York, der in einer konservativen jüdischen Familie aufgewachsen war. Seine Eltern wurden beide schwer krebskrank, die Mutter erlag dem Krebs. Da er seit seiner Jugend oft selber krank gewesen war, studierte und praktizierte er die chinesische Heilkunst sowie taoistische und buddhistische Meditation. Körperliche Gesundheit wurde sein Ein und Alles. Als ein Freund begann, ihn mit in unsere Gottesdienste zu schleppen, hatte er eigentlich keinen „religiösen Bedarf“. Er mochte die Predigten, „bis auf das Ende, wenn dieser Jesus-Kram kam“ und er regelmäßig abschaltete. Aber bald wurde er neidisch auf die Freude und Zukunftshoffnung seiner christlichen Freunde, die er so noch nirgends erlebt hatte. Er fing schließlich an, sich auch das Ende der Predigten anzuhören – und erkannte, dass dort eine Herausforderung für sein Denken lag, der er sich nicht hatte stellen wollen. Dann erlebte er zu seiner Überraschung, wie bei seinen Meditationen „die Augenblicke der totalen, reinen Stille immer wieder durch Bilder von Jesus am Kreuz unterbrochen wurden.“ Er begann, zu dem Gott der Christen zu beten, und erkannte bald, dass der rote Faden seines Lebens der Versuch gewesen war, das Leiden um jeden Preis zu meiden. Jetzt merkte er, wie nutzlos dieses Lebensziel war. Als er begriff, dass Jesus seine Gesundheit, ja sein Leben geopfert hatte, um die Welt – und ihn! – zu erlösen, bewegte ihn das tief. Er merkte, dass es mit Jesus möglich war, dem unvermeidlichen Leiden der Zukunft entgegenzutreten und einen Weg hindurch zu finden.
Kelly kam von der Columbia University und war Atheistin. Als Zwölfjährige hatte sie miterlebt, wie ihr Großvater an Krebs starb und ihre zweijährige Schwester, die einen Gehirntumor hatte, operiert wurde und Bestrahlungen und Chemotherapie bekam. Als Studentin hatte sie die Hoffnung verloren, dass das Leben einen Sinn hatte. Mehrere ihrer christlichen Freunde an der Universität redeten mit ihr über Glaubensfragen, aber sie war „steiniger Boden“ für deren Zeugnisse. Doch als ihre Schwester mit 14 Jahren einen Schlaganfall bekam, der sie lähmte, war ihr das ein Ansporn, die Sache mit Gott nicht aufzugeben, sondern ihn ernsthaft zu suchen. Mittlerweile wohnte und arbeitete sie in New York City. Sie lernte ihren künftigen Mann, Kevin, kennen, der ebenfalls Columbia-Absolvent und Atheist war und an der Wall Street bei J. P. Morgan arbeitete. Die beiden hatten hartnäckige Zweifel an Gott, aber sie hatten auch Zweifel an ihren Zweifeln und so begannen sie, die Gottesdienste unserer Gemeinde zu besuchen. Ihre Reise zum Glauben war langsam und mühevoll. Eines der Dinge, die sie nicht aufgeben ließen, waren die vielen Christen, die sie in der Gemeinde kennenlernten und die es an intellektuellem Niveau mit jedem, den sie in der Stadt kannten, aufnehmen konnten. Was sie schließlich überzeugte, war nicht nur die intellektuelle Glaubwürdigkeit des christlichen Glaubens, sondern auch das Leben, von dem er sprach. Kelly schrieb: „Als Atheistin glaubte ich, ein moralisches, auf Gemeinwohl und soziale Gerechtigkeit ausgerichtetes Leben zu führen, aber das Christentum ging noch darüber hinaus, indem es selbst unser Denken und den Zustand unseres Herzens einbezog. Ich nahm schließlich Gottes Vergebung an und bat ihn, in mein Leben zu kommen.“ Kevin schrieb: „Als ich in einem Café saß und C. S. Lewis’ Pardon, ich bin Christ las, legte ich das Buch hin und schrieb in mein Notizbuch: ,Es spricht überwältigend viel dafür, dass das, was das Christentum behauptet, wahr ist.‘ Ich erkannte, dass meine Leistungen letztlich unbefriedigend waren, der Beifall der Menschen flüchtig und dass ein Carpe-diem-Leben des Abenteuers um des Abenteuers willen nur eine andere Form von Narzissmus und Götzendienst war. Und so fing ich an, an Christus zu glauben.“12
Jesus und unsere Zweifel
Kelly berichtet auch, wie ihr in ihrem Kampf mit dem Glauben und dem Zweifel der „ungläubige Thomas“ im Neuen Testament (Johannes 20) eine Hilfe war. In dieser Szene begegnet Jesus dem Zweifel auf eine Weise, die differenzierter ist als die des modernen Skeptikers, aber auch des modernen Gläubigen. Jesus fordert Thomas auf, nicht beim Zweifeln stehen zu bleiben („Glaube!“), aber geht gleichzeitig auf seine Forderung nach „Beweisen“ ein. In einer anderen Szene begegnet Jesus einem Mann, der voller Zweifel ist und ihn bittet: „Hilf mir doch gegen meine Zweifel!“ (Markus 9,24). Worauf Jesus ihn wegen seiner Ehrlichkeit segnet und sein Kind heilt. Egal ob Sie sich für einen Gläubigen oder einen Zweifler halten, ich möchte Sie einladen, genauso ehrlich zu sein wie dieser Mann und Ihre Zweifel besser kennenzulernen. Das Ergebnis wird Ihre kühnsten Erwartungen übersteigen.
TEIL I Der Sprung in den Zweifel
KAPITEL 1 „Es kann nicht nur eine wahre Religion geben“
„Wie soll es nur einen wahren Glauben geben können?“, fragte Blair, eine 24 Jahre alte Frau aus Manhattan. „Es ist doch anmaßend, wenn jemand behauptet, dass seine Religion besser als die anderen ist, und die Leute zu ihr zu bekehren versucht. Es sind doch wohl alle Religionen gleich gut, wenn es um die Bedürfnisse ihrer Anhänger geht.“
„Religiöse Exklusivität ist nicht nur engstirnig, sondern mordsgefährlich“, fügte Geoff hinzu, ein Twen aus Großbritannien, der ebenfalls in New York City wohnte, „Religion hat doch immer nur zu Streit, Spaltung und Konflikten geführt; vielleicht ist sie der größte Feind für den Frieden in der Welt. Wenn die Christen weiter behaupten, dass sie die ‚Wahrheit‘ haben, und wenn andere Religionen ins gleiche Horn stoßen, wird es in der Welt nie Frieden geben.“13
I
n meinen jetzt fast zwanzig Jahren in New York habe ich unzählige Gelegenheiten gehabt, Menschen zu fragen: „Was ist Ihr größtes Problem mit dem Christentum? Was stört Sie am meisten an dem, was Christen glauben und leben?“ Eine der häufigsten Antworten, die ich bekommen habe, lässt sich in dem Wort Ausschließlichkeitsanspruch zusammenfassen.
Ich wurde einmal als christlicher Vertreter zu einer Podiumsdiskussion in einem nahe gelegenen College eingeladen, zu der auch ein jüdischer Rabbi und ein muslimischer Imam kamen. Wir drei sollten über die Unterschiede zwischen unseren Religionen diskutieren. Das Gespräch war höflich, intelligent und respektvoll. Wir betonten alle, dass es erhebliche, unüberbrückbare Differenzen zwischen den drei Religionen gab. Ein Beispiel war Jesus. Wir alle stimmten der folgenden Aussage zu: „Wenn die Christen recht haben und Jesus Gott ist, dann lieben die Muslime und Juden Gott nicht so, wie er wirklich ist, und wenn die Muslime und Juden recht haben und Jesus nicht Gott ist, sondern nur ein Lehrer oder Prophet, dann lieben die Christen Gott nicht so, wie er wirklich ist.“ Der springende Punkt war: Es konnte nicht sein, dass wir alle drei mit unseren Auffassungen über das Wesen Gottes recht hatten.
Etliche der Studenten waren höchst aufgebracht. Einer sagte, dass das, worauf es ankam, doch wohl war, dass man überhaupt an Gott glaubte und im Übrigen selber Liebe praktizierte. Die Position, dass die eine Religion der Wahrheit näher kam als die andere, fand er intolerant. Ein anderer Student sah uns drei Geistliche an und sagte frustriert: „Es wird nie Frieden auf der Erde geben, wenn die Vertreter der Religionen weiter solche Ausschließlichkeitsansprüche stellen!“
Religion ist ein Sicherheitsrisiko für den Weltfrieden.
Die Meinung, dass eines der ganz großen Hindernisse für den Weltfrieden die Religion ist – vor allem die großen Weltreligionen, die behaupten, die allein wahren und den anderen überlegen zu sein – ist weitverbreitet. Es wird Sie vielleicht überraschen, wenn ich Ihnen sage, dass ich als Pastor diese Meinung teile. Religionen haben es an sich, dass sie die Herzen ihrer Anhänger auf einen potenziell gefährlichen Weg lenken. Jede Religion sagt ihren Gläubigen, dass sie „die Wahrheit“ haben, worauf sie sich prompt den Anhängern anderer Religionen überlegen fühlen. Sie sagt ihnen weiter, dass sie errettet werden und zu Gott kommen, wenn sie sich dieser Wahrheit ganz hingeben, was sie natürlich leicht dazu bringt, sich von den Menschen, die weniger rein und ernst leben, abzugrenzen. Es ist nur zu leicht, die anderen Religionen schlechtzumachen und zu karikieren. Und wenn es erst einmal so weit ist, ist der Weg zur gesellschaftlichen Ausgrenzung, ja zu Unterdrückung und Gewalt nicht mehr weit.
Religion ist also ein Sicherheitsrisiko für den Frieden. Wie kann man dieses Risiko minimieren? Unter den heutigen politischen und gesellschaftlichen Wortführern in der Welt kursieren drei Strategien: Entweder sie sind dafür, die Religion zu verbieten, sie schlechtzumachen oder sie radikal zur Privatsache zu erklären.14 Viele Menschen setzen große Hoffnungen auf diese Strategien, doch ich glaube nicht, dass sie von Erfolg gekrönt sein werden; eher werden sie die Situation noch verschärfen.
1. Religion verbieten?
Eine klassische Methode, den Ausschließlichkeitsansprüchen der Religionen zu begegnen, besteht darin, sie mit eiserner Hand zu kontrollieren oder sie, wo möglich, zu verbieten. Das 20. Jahrhundert hat gleich mehrere groß angelegte Versuche dazu gesehen. Die Kommunisten in der Sowjetunion, China, Kambodscha und anderswo, aber auf ihre Art auch die Nazis in Deutschland waren entschlossen, die Religionsausübung einzudämmen, um zu verhindern, dass sie die Gesellschaft spaltete oder die Macht des Staates gefährdete. Das Ergebnis war regelmäßig nicht mehr Friede und Harmonie, sondern mehr Unterdrückung. Die tragische Ironie dieser Situation hat Alister McGrath in seiner Geschichte des Atheismus so beschrieben:
Im 20. Jahrhundert finden wir eines der größten und traurigsten Paradoxe in der Geschichte der Menschheit: dass die größte Intoleranz und Gewalt dieses Jahrhunderts von denen praktiziert wurden, die glaubten, dass die Religion zu Intoleranz und Gewalt führt.15
Hand in Hand mit diesen Bemühungen ging die im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert weitverbreitete Annahme, dass im Zuge des weiteren technischen Fortschritts der Menschheit die Religion immer schwächer werden und schließlich aussterben würde. Die Religion hatte ihren Platz in der Entwicklung des Menschen: Früher haben wir die Religion gebraucht, um mit der Angst einflößenden und unerklärbaren Welt zurechtzukommen, aber je weiter die Wissenschaft fortschreiten würde, und je besser wir in der Lage sein würden, unsere Umgebung zu verstehen und zu beherrschen, umso geringer würde unser Bedürfnis nach Religion werden – dachten die Gelehrten.16
Doch genau dies ist nicht geschehen, und heute glaubt kaum noch jemand an diese „Säkularisierungstheorie“.17 Praktisch bei allen großen Religionen wächst die Mitgliederzahl. Vor allem in den Entwicklungsländern ist das Wachstum des Christentums geradezu explosionsartig. Allein in Nigeria gibt es mittlerweile sechsmal mehr Anglikaner als in den ganzen USA. In Ghana gibt es mehr Presbyterianer als in den USA und Schottland zusammen. In Korea ist der Anteil der Christen in 100 Jahren von ein auf 40 Prozent gestiegen, und Experten glauben, dass Ähnliches in China passieren wird. Wenn es in fünfzig Jahren eine halbe Milliarde chinesischer Christen geben sollte, wird dies den Gang der Geschichte verändern.18 Und was da so rasch wächst, ist in den allermeisten Fällen nicht das einst von Soziologen prognostizierte säkulare „Christentum light“, sondern ein robuster Glaube an Übernatürliches, der Wunder, die Autorität der Bibel und persönliche Bekehrung betont.
Die Vitalität der Religion in der Welt ist so groß, dass die Versuche, sie zu unterdrücken oder zu kontrollieren, sie oft nur noch stärker machen. Als die chinesischen Kommunisten nach dem Zweiten Weltkrieg alle westlichen Missionare auswiesen, glaubten sie, damit dem Christentum in China den Todesstoß zu versetzen. Tatsächlich wurden die Lücken in der Leitung der Kirchen von einheimischen Christen gefüllt, was die Kirchen chinesischer und damit stärker machte.
Nein, die Religion ist nicht ein Notbehelf aus primitiveren Stufen der Evolution der Menschheit, sie ist ein permanenter, zentraler Aspekt des Menschseins. Für den nicht religiösen Menschen ist dies eine bittere Pille. Unsere Welt ist eine tief religiöse Welt, und nichts spricht dafür, dass sich dies je ändern wird.
2. Religion schlechtmachen?
Die Religion wird nicht verschwinden, und keine Regierung kann ihre Kraft brechen. Aber kann man nicht den Religionen, die sich im Besitz „der Wahrheit“ wähnen und andere zu bekehren versuchen, durch Aufklärung und die richtigen Argumente den Wind aus den Segeln nehmen? Kann man nicht einfach die Bürger – egal, was für eine Religion sie haben – dazu anhalten, zuzugeben, dass jede Religion nur einer von vielen möglichen Lebensstilen und Wegen zu Gott ist?
Damit schafft man eine Atmosphäre, in der es, und sei es nur im persönlichen Gespräch, als unaufgeklärt und fanatisch gilt, religiöse Ausschließlichkeitsansprüche zu stellen. Man schafft dies durch das ständige Wiederholen gewisser Grundthesen, die mit der Zeit den Status allgemein akzeptierter Wahrheiten erlangen: „Man weiß doch, dass Missionieren falsch ist …“ Wer aus der Reihe tanzt, gilt als naiv oder gefährlich. Anders als die Verbotsstrategie erzielt dieses Rezept gewisse Teilerfolge. Auf Dauer wird es jedoch scheitern, denn es beruht auf einem inneren Widerspruch, ja fast schon einer Doppelmoral. Ich möchte dies zeigen, indem ich einige jener Grundthesen kritisch beleuchte.
„Alle großen Religionen sind gleich wahr und lehren im Grunde dasselbe.“
Diese These ist so verbreitet, dass vor wenigen Jahren ein Journalist jeden, der glaubte, „dass es minderwertige Religionen gibt“, kurzerhand zu einem rechtsradikalen Extremisten erklärte.19 Aber wollen wir wirklich im Ernst behaupten, dass totalitäre Sekten, die im Massenselbstmord enden, oder Religionen, die Kinderopfer verlangen, mit anderen Religionen auf einer Stufe stehen? Die meisten Zeitgenossen werden dies wohl verneinen.
Aber die meisten Menschen, die behaupten, dass alle Religionen gleich sind, denken dabei natürlich an die großen Weltreligionen und nicht an irgendwelche Splittergruppen. So auch der Student, der mir bei der oben erwähnten Podiumsdiskussion widersprach. Er behauptete, dass die Lehrunterschiede zwischen Judentum, Islam, Christentum, Buddhismus und Hinduismus doch letztlich nebensächlich seien und dass die Anhänger dieser Religionen alle an denselben Gott glaubten. Doch als ich ihn fragte, wer dieser Gott war, beschrieb er ihn als einen all-liebenden Geist im Universum. Und genau hier liegt der Widerspruch bei dieser Position: Man behauptet, dass die Lehre nicht so wichtig sei – und bringt im nächsten Atemzug lehrmäßige Aussagen über das Wesen Gottes, die den Lehren aller großen Religionen widersprechen. Der Buddhismus glaubt nicht, dass es überhaupt einen persönlichen Gott gibt. Juden, Christen und Muslime glauben an einen Gott, der die Menschen für ihren Glauben und ihr Leben zur Verantwortung zieht und dessen Eigenschaften sich nicht auf die der Liebe reduzieren lassen. Die Behauptung, dass Lehren nicht so wichtig seien, ist ironischerweise selber bereits eine Lehre. Und deren Vertreter setzen ein ganz bestimmtes Gottesbild voraus, das sie für besser und aufgeklärter als die Gottesbilder der klassischen Religionen halten. Sie tun also genau das, was sie den anderen verbieten wollen!
Die Behauptung, dass Lehren nicht so wichtig seien, ist ironischerweise selber bereits eine Lehre.
„Jede Religion erkennt einen Teil der spirituellen Wahrheit, aber die ganze Wahrheit kann keine sehen.“
Vertreter dieser These zitieren gerne die Geschichte von den Blinden und dem Elefanten. Mehrere Blinde gehen spazieren und stoßen dabei auf einen Elefanten, der sich von ihnen betasten lässt. „Dieses Tier ist so lang und geschmeidig wie eine Schlange“, erklärte der Erste, der den Rüssel des Elefanten erwischt hat. „Nein, nein, es ist dick und rund wie ein großer Baumstamm“, sagt der Zweite, der ein Bein des Elefanten befühlt. „Nein, es ist groß und flach“, erwidert der dritte Blinde, der die Seite des Elefanten entlangfährt. Jeder der Blinden fühlt nur einen Teil des Elefanten; das ganze Tier vorstellen kann sich keiner. Und ganz ähnlich, heißt es dann, erfasst jede der Weltreligionen nur einen Teil der spirituellen Realität, aber keine darf behaupten, die ganze Wahrheit zu erkennen.
Das Elefanten-Beispiel ist ein Schuss, der nach hinten losgeht. Die Geschichte wird nämlich aus der Perspektive von jemandem erzählt, der nicht blind ist. Woher will ich denn wissen, dass jeder der Blinden nur einen Teil des Elefanten erfasst, wenn ich nicht selber für mich in Anspruch nehmen kann, den ganzen Elefanten zu sehen?
Sie sieht demütig aus, die Versicherung, dass die Wahrheit ja viel größer ist als alles, was Menschen fassen können, aber wenn man sie als Mittel benutzt, um alle Wahrheitsansprüche für ungültig zu erklären, ist sie nichts als die höchst anmaßende Behauptung, über ein Wissen zu verfügen, das [allem anderen Wissen] überlegen ist. … Wir müssen hier fragen: „Was ist der [absolute] Bezugspunkt, von dem aus du behauptest, in der Lage zu sein, all die absoluten Behauptungen, die diese verschiedenen heiligen Schriften aufstellen, relativieren zu können?“20
Woher wollen Sie wissen können, dass keine Religion die ganze Wahrheit sieht, wenn Sie nicht selber über diese ganze Wahrheit verfügen? – Von der sie gerade behauptet haben, dass niemand sie hat.
„Der religiöse Glaube ist zu sehr ein Produkt der Geschichte und Kultur, um ,wahr‘ sein zu können.“
Als ich vor zwanzig Jahren nach New York kam, hörte ich oft das Argument, dass alle Religionen gleich wahr seien. Heute höre ich öfter, dass alle Religionen gleich falsch sind. Das geht dann ungefähr so: „Alle moralischen und spirituellen Behauptungen sind das Produkt unseres jeweiligen historischen und kulturellen Augenblicks; daher kann niemand behaupten, dass er die Wahrheit kennt, weil niemand beurteilen kann, ob die eine Aussage über die moralische oder spirituelle Realität zutreffender ist als die andere.“
Der Religionssoziologe Peter L. Berger hat die Unhaltbarkeit dieser häufig zu hörenden Behauptung aufgezeigt: In seinem Buch Auf den Spuren der Engel zeichnet er nach, wie im 20. Jahrhundert die „Soziologie des Wissens“ entdeckt wurde, also dass die Menschen das, was sie glauben, weitgehend deswegen glauben, weil sie gesellschaftlich dazu konditioniert worden sind. Wir denken gerne, dass unser Denken uns selber gehört, aber so einfach ist es nicht. Wir denken vielmehr wie die Menschen, die wir am meisten bewundern bzw. brauchen. Jeder Mensch gehört zu einer Gruppe, in der bestimmte Ansichten gelten und andere verneint werden. Berger bemerkt, dass viele aus dieser Tatsache den Schluss gezogen haben, dass es, da wir doch alle Gefangene unserer historischen und kulturellen Umgebung sind, nicht möglich ist, zu beurteilen, wie wahr oder falsch eine bestimmte Ansicht oder ein Glaube ist.
Doch dieser absolute Relativismus, so Berger weiter, funktioniert nur dann, wenn die Relativisten sich selber absolut, also gerade nicht relativ setzen.21 Wenn ich aus der gesellschaftlichen Bedingtheit allen Glaubens den Schluss ziehe, dass kein Glaube als für alle Menschen wahr betrachtet werden kann, ist diese Aussage ja selber wieder das Produkt bestimmter sozialer und kultureller Faktoren – und kann nach den Spielregeln der Relativisten nicht universal wahr sein. Der Relativismus, so Berger, relativiert sich selber und lässt sich letztlich nicht durchhalten.22 Sicher, unsere kulturellen Scheuklappen erschweren es uns, zwischen miteinander konkurrierenden Wahrheitsansprüchen abzuwägen. Die gesellschaftliche Bedingtheit von Glauben ist eine Tatsache, aber man kann sie nicht als Argument dafür benutzen, dass alle Wahrheit völlig relativ ist, oder das Argument widerlegt sich selber. Berger kommt zu dem Schluss, dass wir uns vor dem Abwägen religiöser Positionen nicht in das Klischee flüchten können, dass man die Wahrheit eben nicht erkennen könne. Die Denkarbeit bleibt uns nicht erspart, zu fragen, welche Behauptungen über Gott, über das Wesen des Menschen und über die spirituelle Realität wahr und welche falsch sind. Auf irgendeine Antwort auf diese Frage müssen wir unser Leben gründen.
Der Philosoph Alvin Plantinga vertritt seine eigene Version von Bergers These. Ihm werde oft gesagt: „Wenn Sie in Marokko geboren wären, wären Sie kein Christ, sondern ein Muslim.“ Plantingas Antwort:
Angenommen, wir räumen also ein, dass dann, wenn ich als Sohn muslimischer Eltern in Marokko und nicht christlicher Eltern in Michigan geboren wäre, meine Religion ganz anders geworden wäre. [Aber] das Gleiche gilt natürlich für den Pluralisten selber. … Wenn er in [Marokko] geboren worden wäre, wäre er heute sehr wahrscheinlich kein Pluralist. Folgt daraus also … dass seine pluralistischen Überzeugungen das Ergebnis eines unzuverlässigen Erkenntnisprozesses sind?23
Plantinga und Berger sagen das Gleiche. Man kann nicht sagen: „Alle Aussagen über die Religionen sind historisch bedingt und relativ, außer der, die ich gerade mache.“ Warum sollten wir jemandem, der behauptet, dass niemand entscheiden kann, welcher Glaube richtig und welcher falsch ist, glauben? Tatsache ist, dass wir alle im Leben Wahrheitsbehauptungen machen und dass es sehr schwierig ist, diese Behauptungen abzuwägen, aber dass wir dazu keine Alternative haben.
„Es ist anmaßend, wenn jemand behauptet, dass seine Religion die richtige ist, und versucht, andere zu ihr zu bekehren.“
Der bekannte Religionswissenschaftler John Hick schreibt: Wenn ich merke, dass es viele Menschen gibt, die so gut und intelligent sind wie ich selber, aber einer anderen Religion angehören, und wenn sie sich nicht von meiner Religion überzeugen lassen, dann ist es arrogant, wenn ich trotzdem versuche, sie zu bekehren, oder wenn ich meine Religion für die bessere halte.24
Auch dieses Argument stolpert über sich selber. Die meisten Menschen in der Welt teilen Hicks Ansicht nicht, dass alle Religionen gleich „richtig“ sind, und viele dieser Menschen sind so intelligent und gut wie Hick und nicht bereit, ihre Meinung zu ändern. Das macht die Behauptung, dass es anmaßend und falsch sei, wenn jemand behauptet, dass seine Religion die richtige ist, selber zu einer anmaßenden und falschen Aussage.
Man hört heute oft, dass es „ethnozentrisch“ (also eine Form von Rassismus bzw. von Verblendung durch die eigene Kultur) sei, zu behaupten, dass die eigene Religion besser sei als andere. Aber ist diese Aussage nicht selber genauso ethnozentrisch? Die meisten nicht westlichen Kulturen haben keine Probleme damit, zu behaupten, dass ihre eigene Kultur und Religion die beste ist. Die Vorstellung, dass man so etwas nicht behaupten darf, ist zutiefst in der westlichen Tradition der Selbstkritik und des Individualismus verwurzelt. Wer anderen die „Sünde“ des Ethnozentrismus vorwirft, sagt damit praktisch: „Die Art, wie unsere Kultur andere Kulturen sieht, ist fortschrittlicher als eure Art.“ Womit wir eben dasselbe tun, was wir den anderen verbieten wollen.25 Der Historiker C. John Sommerville stellt fest, dass „man eine Religion nur auf der Grundlage einer anderen Religion beurteilen kann.“ Um eine Religion bewerten zu können, brauche ich gewisse ethische Kriterien, die letztlich aus meiner eigenen Religion kommen.26
Ich glaube, der Grunddenkfehler in dieser Art, sich mit der Religion allgemein und dem Christentum im Besonderen auseinanderzusetzen, ist offensichtlich: Der Skeptiker glaubt, dass jede Behauptung, im Bereich der spirituellen Realität die Wahrheit zu kennen, falsch sein muss. Aber diese Behauptung ist ja selber eine religiöse Glaubensaussage. Sie geht von dem Dogma aus, dass man Gott nicht erkennen kann oder dass Gott nur die Liebe ist, aber niemals zornig, oder dass er eine das Universum durchdringende „Kraft“ ist und nicht eine Person, die in heiligen Schriften zu uns spricht – lauter unbeweisbare Glaubensaussagen. Und dazu glauben die Vertreter dieser These auch noch, dass ihr Weltbild das bessere sei. Sie glauben, dass die Welt ein besserer Ort wäre, wenn die Menschen ihre traditionellen Ansichten über Gott und die Wahrheit aufgeben und dafür ihre Position annehmen würden. Womit dieses Weltbild selber ein Glaube ist, der beansprucht, der allein wahre zu sein. Wenn alle Weltanschauungen, die behaupten, die einzig wahren zu sein, abzulehnen sind, dann diese ganz gewiss auch. Und wenn es nicht „intolerant“ ist, diese Anschauung zu vertreten, warum soll es dann intolerant sein, sich an eine der traditionellen Religionen zu halten?
Mark Lilla, Professor an der University of Chicago, sprach einmal mit einem intelligenten jungen Studenten der Wharton Business School, der zu Lillas Erstaunen bei einer Billy-Graham-Evangelisation „nach vorne gegangen war, um sein Leben Christus zu übergeben“. Lilla schreibt:
Ich wollte den Schritt, vor dem er da stand, problematisieren, wollte ihm die Augen dafür öffnen, dass es andere Möglichkeiten gab, zu leben, andere Methoden, Wissen und Liebe zu suchen, … ja ein neuer Mensch zu werden. Ich wollte ihn davon überzeugen, dass seine Würde davon abhing, dass er eine freie, skeptische Haltung gegenüber allen Dogmen behielt. Ich wollte … ihn retten …
Wie der Glaube will auch der Zweifel erlernt werden. Er ist eine Fertigkeit. Aber das Merkwürdige am Skeptizismus ist, dass seine Anhänger, alte wie heutige, so oft Proselytenmacher sind. Wenn ich sie lese, möchte ich oft am liebsten fragen: „Warum ist euch das alles so wichtig?“ Ihr Skeptizismus bietet keine gute Antwort auf diese Frage, und ich selber habe auch keine.27
Wo es um die Religion geht, sind wir alle „exklusiv“ in unseren Glaubensüberzeugungen, nur auf verschiedene Arten.
Lilla macht mit seiner weisen Selbsterkenntnis deutlich, wie seine Zweifel am Christentum selber den Status eines erlernten, alternativen Glaubens haben. Er glaubt, dass die Würde des Einzelnen von seinem Skeptizismus in Glaubensfragen abhängt – was natürlich selber ein Glaubenssatz ist. Er gibt offen zu, dass er nicht anders kann, als zu glauben, dass es besser wäre, wenn die Menschen seine Sicht der Realität und der Menschenwürde übernähmen und nicht die von Billy Graham.
Die Behauptung, dass die Religion X die einzig richtige ist, ist nicht engstirniger als die Aussage, dass die Art Y, über die Religionen zu denken (nämlich dass sie alle gleich sind), die einzig richtige ist. Wo es um die Religion geht, sind wir alle „exklusiv“ in unseren Glaubensüberzeugungen, nur auf verschiedene Arten.
3. Religion zur Privatsache machen?
Die dritte Strategie, um das Sicherheitsrisiko Religion unter Kontrolle zu bringen, besteht darin, den Menschen zu erlauben, in ihrer Privatsphäre ihre Religion für die einzig richtige zu halten und sie auch „evangelisieren“ zu lassen, aber in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit die Religion strikt auszublenden. Einflussreiche Denker wie John Rawls und Robert Audi argumentieren, dass man in der öffentlichen ethischen Diskussion nur solche moralischen Positionen vertreten darf, die säkular und nicht religiös begründet sind. Rawls ist bekannt geworden für seine Forderung, „umfassende“ religiöse Lehren aus dem öffentlichen Diskurs auszuschließen.28 Und vor Kurzem unterzeichneten zahlreiche Wissenschaftler und Philosophen eine „Erklärung zur Verteidigung von Wissenschaft und Säkularismus“, die die amerikanische Regierung aufforderte, „es nicht zuzulassen, dass Gesetzgebung oder Exekutive von der Religion beeinflusst werden.“29 Zu den Unterzeichnern gehörten u.a. Peter Singer, E.O. Wilson und Daniel C. Dennett. Auch der Philosoph Richard Rorty hat sich dafür stark gemacht, die Religion strikt auf die Privatsphäre zu beschränken und nie in öffentliche politische Diskussionen einzubeziehen. Die Berufung auf ein Argument, das auf dem Glauben basiere, sei schlicht ein „Gesprächskiller“, den man dem Nichtgläubigen nicht zumuten könne.30
Denen, die diese Strategie als diskriminierend empfinden, erwidern Rorty und andere, dass sie schlicht pragmatisch gemeint sei.31 Sie seien nicht gegen die Religion an sich und versuchten auch nicht, religiöse Überzeugungen zu kontrollieren, solange sich die Religion auf die Privatsphäre beschränke. Doch im Bereich der Öffentlichkeit führe es zu unnötigen Kontroversen und sei zeitraubend, ständig über Religion streiten zu müssen. Religiös begründete Positionen betrachten Rorty und seine Mitstreiter als sektiererisch und zu Kontroversen führend, während sie säkulare ethische Argumentationen als universal und allgemein nachvollziehbar betrachten. Deswegen sollte der öffentliche Diskurs stets säkular und nicht religiös sein. Die Menschen sollten ohne jeden Bezug auf göttliche Offenbarung oder Bekenntnistraditionen gemeinsam an den großen Problemen unserer Zeit wie Aids, Armut, Bildung etc. arbeiten. Wir sollten unsere religiösen Überzeugungen für uns behalten und gemeinsam nach Wegen zum Wohl der Menschen suchen.
Stephen L. Carter von der Universität Yale hat darauf erwidert, dass es, sobald wir moralisch argumentieren, völlig unmöglich ist, die Religion außen vor zu lassen:
Der Versuch, eine Öffentlichkeit zu schaffen, in der das religiöse Gespräch nicht mehr vorkommt, wird, so durchdacht er auch sein mag, am Ende den Vertretern der organisierten Religion immer sagen, dass sie allein, und sonst keiner, erst dann am öffentlichen Dialog teilnehmen dürfen, wenn sie den Teil ihrer Identität, der für sie der wichtigste ist, abgelegt haben.32
Wie kommt Carter zu solch einer Behauptung? Fragen wir zunächst, was Religion ist. Einige sagen, sie ist irgendeine Art von Glauben an Gott. Aber das würde nicht den Zen-Buddhismus abdecken, für den es eigentlich gar keinen Gott gibt. Andere sagen, Religion sei der Glaube an das Übernatürliche. Aber das trifft nicht den Hinduismus, der nicht an eine übernatürliche Welt jenseits der materiellen glaubt, sondern an eine spirituelle Realität, die innerhalb der Erfahrungswirklichkeit liegt. Aber was ist Religion dann? Sie ist ein System von Glaubensaussagen, die erklären, was der Sinn des Lebens ist, wer wir sind und was das Wichtigste ist, was die Menschen in ihrer Lebenszeit tun sollten. Es gibt z.B. Menschen, die glauben, dass diese materielle Welt die alleinige Realität ist, dass es reiner Zufall ist, dass es uns gibt, dass wir nach unserem Tod nicht mehr existieren und dass es deshalb darauf ankommt, in dem bisschen Leben, das wir haben, glücklich zu sein und uns nicht von anderen religiöse Überzeugungen aufdrücken zu lassen. Auch wenn es sich dabei um keine explizite, „organisierte Religion“ im üblichen Sinne handelt, so finden wir doch eine Art „Metaerzählung“, also eine Geschichte über den Sinn des Lebens, nebst einer Anweisung, wie man aufgrund dieses Sinns sein Leben am besten führt.