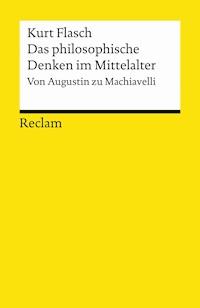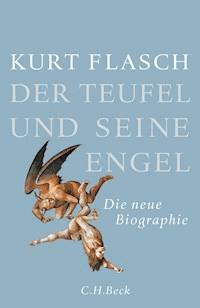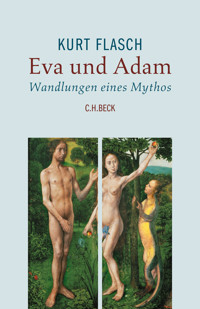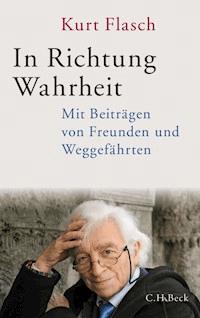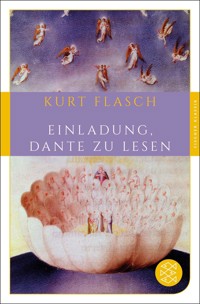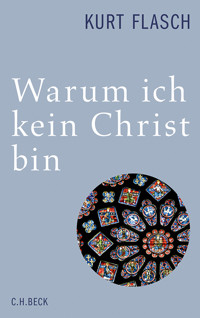
9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Heute fragen sich viele Menschen, ob sie noch Christen sind. Andere wollen es wieder werden und suchen nach Wegen. Kurt Flasch erzählt – ausgehend von seiner Herkunft aus einer liberal-katholischen, kulturell und politisch engagierten Familie –, wie er ins Zweifeln am Christentum gekommen ist. Er bespricht die Hauptpunkte der christlichen Lehre in ihrer katholischen wie evangelischen Form und wendet sich an jeden Gläubigen und an jeden Ungläubigen, der seine Gründe prüfen will, warum er Christ ist. Kurt Flasch ist Fachmann für antike und mittelalterliche Philosophie. Er hat sich ein Leben lang mit den Quellen zu dieser Zeit und deshalb auch mit dem Christentum befasst. Er erläutert argumentierend in persönlich gefärbter Darstellung, warum er kein Christ ist. Die Kritik gilt der christlichen Lehre, nicht dem Zustand der Kirchen. Das Buch ist keine Autobiographie und keine Kampfschrift. Es bemüht sich um historische Gerechtigkeit, benennt die christlichen Überzeugungen genau und mit geschichtlichem Verständnis, bringt aber an Details nur das, was nötig ist, um zu einem sachlichen Urteil zu kommen. Flasch prüft aus den Quellen heraus die katholischen und evangelischen Varianten der christlichen Lehren und begründet, warum er von ihnen keinen weiteren Gebrauch machen wird. Fromme wie Unfromme können daraus Nutzen ziehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Kurt Flasch
Warum ich kein Christ bin
Bericht und Argumentation
C.H.Beck
Inhaltsübersicht
Zum Buch
Heute fragen sich viele Menschen, ob sie noch Christen sind. Andere wollen es wieder werden und suchen nach Wegen. Kurt Flasch erzählt – ausgehend von seiner Herkunft aus einer liberal-katholischen, kulturell und politisch engagierten Familie –, wie er ins Zweifeln am Christentum gekommen ist. Er bespricht die Hauptpunkte der christlichen Lehre in ihrer katholischen wie evangelischen Form und wendet sich an jeden Gläubigen und an jeden Ungläubigen, der seine Gründe prüfen will, warum er Christ ist.
Kurt Flasch ist Fachmann für antike und mittelalterliche Philosophie. Er hat sich ein Leben lang mit den Quellen zu dieser Zeit und deshalb auch mit dem Christentum befasst. Er erläutert argumentierend in persönlich gefärbter Darstellung, warum er kein Christ ist. Die Kritik gilt der christlichen Lehre, nicht dem Zustand der Kirchen.
Das Buch ist keine Autobiographie und keine Kampfschrift. Es bemüht sich um historische Gerechtigkeit, benennt die christlichen Überzeugungen genau und mit geschichtlichem Verständnis, bringt aber an Details nur das, was nötig ist, um zu einem sachlichen Urteil zu kommen. Flasch prüft aus den Quellen heraus die katholischen und evangelischen Varianten der christlichen Lehren und begründet, warum er von ihnen keinen weiteren Gebrauch machen wird. Fromme wie Unfromme können daraus Nutzen ziehen.
Über den Autor
Kurt Flasch, geb. 1930, gilt als der bedeutendste deutsche Historiker mittelalterlicher Philosophie. Er wurde vielfach ausgezeichnet, u. a. 2000 mit dem Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa, 2009 mit dem Hannah-Arendt-Preis, 2010 mit dem Lessing-Preis für Kritik sowie mit dem Essay-Preis Tractatus und 2012 mit dem Joseph-Breitbach-Preis. Bei C.H.Beck sind von ihm zuletzt erschienen: Meister Eckhart. Philosoph des Christentums (³2011), Was ist Gott? Das Buch der 24 Philosophen (²2013) und seine Übersetzung von Boethius’ Trost der Philosophie (52013).
Vorwort
1) Ich bin kein Christ mehr. Hier möchte ich erklären, warum. Ich werde oft nach meinen Gründen gefragt; heute will ich darauf antworten, so kurz und klar wie möglich. Um es vorwegzunehmen: Mein Auszug hat wenig mit dem Zustand der Kirchen und viel mit ihrem Anspruch auf Wahrheit zu tun. Es geht hier nicht um Kirchenkritik, sondern um die Gründe, warum ich keine kirchliche Lehre teile.
2) Am 6. März 1927 hielt Bertrand Russell seinen berühmt gewordenen Vortrag: Why I am not a Christian. Es war ein Text von exemplarischer Klarheit und Kürze; er umfaßte 12 Seiten im Druck. Er verbindet in klassischer Einfachheit persönliche Reflexion mit theoretischer Argumentation. Nach 85 Jahren greife ich dieses Thema noch einmal auf; es hat an Aktualität hinzugewonnen. Ich untersuche es nach meinen Erfahrungen und mit neuen Argumenten. Hätte ich Russells Formel um jeden Preis vermeiden wollen, hätte ich stilistische Ziererei erzeugt.
3) Wikipedia nennt von meinen etwa 40 Vorlesungen an der Ruhr-Universität Bochum nur diese einzige: Warum ich kein Christ bin. Sie stellt es so dar, als habe es sich um einen zweistündigen Abschiedsvortrag gehandelt, aber es war eine vielstündige zweisemestrige Vorlesung. Die Angabe erzeugte einen Rattenschwanz von Anfragen. Immer wieder wollte jemand wissen, wo mein Text zu kaufen wäre. Ich konnte nicht alle Anfragen einzeln beantworten. Ich bitte dafür um Nachsicht und gebe hier eine Kurzfassung meiner Gründe. Sie richtet sich nicht zuerst an Fachtheologen, sondern an jeden, der sich seines Glaubens gewiß oder ungewiß ist. Ich berichte und argumentiere. Ich erzähle ein wenig von meinem Leben, denn ich beschreibe mein privates Nachdenken und begründe meine persönliche Entscheidung. Der Hauptton liegt auf den Argumenten, die den Abschied zur Folge hatten. Ich verfolge sie nur soweit, wie sie dem allgemein-interessierten Leser dienlich sind.
Ich will den Fachjargon vermeiden, besonders dort, wo ich von Augustin und von mittelalterlichen Autoren spreche, aber auch beim Beschreiben des Schöpfungsberichts und anderer Bibelstellen.
Ich lade meine Leser ein, sich darüber ein Urteil zu bilden. Übrigens gibt es auch Christen, die eine Debatte darüber besser finden als die konventionelle Selbstverständlichkeit, wir seien alle Christen.
4) Kann man vernünftigerweise Christ sein oder bleiben? Dies sorgfältig zu erörtern, liegt, scheint mir, im allgemeinen Interesse. Es gibt viele Zweifler; die Zeit homogenen Volksglaubens ist in Europa vorbei. Es hagelt Kirchenkritik, aber die kirchlichen Lehren erfreuen sich großer Schonung. Viele reduzieren sie auf Nächstenliebe und lassen alles, was darüber hinausgeht, auf sich beruhen. Gerade darüber, also über die Wahrheit des christlichen Glaubens, möchte ich Unterhaltungen anregen. Es geht nicht um ‹Religion› im allgemeinen, sondern um christliche Ansprüche hier und heute. Sie fordern öffentlich politischen und gesellschaftlichen Einfluß, zum Beispiel auf die Gesetzgebung des Bundestags, auf die Gesundheits-, die Schul- und Medienpolitik. Schon deshalb sind sie in Ruhe zu prüfen.
Ich grabe, wo ich stehe. Ich rede nicht vom Buddhismus und nicht vom Islam. Über diese höre ich mir nur Leute an, die Dokumente dieser Religionen in der Originalsprache studieren. Ich rede vom katholischen und protestantischen Christentum in Europa. Ich untersuche seine Wahrheitschancen in der Gegenwart und blicke, wo nötig, auf die Vergangenheit, aus der es kommt.
Mainz, 12. März 2013 Kurt Flasch
Einleitend
1.Rechenschaft
Ich, mit 83 Jahren, gehe mit kräftigen Schritten aufs Ende meines Lebens zu. Ich nutze die Gelegenheit, hier Bilanz zu ziehen über meine Erfahrungen. Zu ihnen gehört die christliche Religion. Sie war nicht das einzige Thema meines Lebens, noch nicht einmal sein Hauptinhalt. Politik und Philosophie, Geschichte und Literatur waren genausowichtig. Aber ich kam in wechselnden Formen immer wieder auf sie zurück und fasse kurz mein Resultat zusammen.
Ich habe sie früh unter den denkbar günstigen Bedingungen kennengelernt, nicht zur Zeit ihres Triumphs, sondern in einer kleinen Gruppe, die litt und verfolgt wurde. Ein Onkel von mir steht im Verzeichnis der katholischen Märtyrer des 20. Jahrhunderts. Später konnte ich ihre größten intellektuellen und künstlerischen Hervorbringungen in Ruhe und Unabhängigkeit studieren. Ich habe ihr Kleingedrucktes gelesen und mit Kardinal Joseph Ratzinger im Großen Amphitheater der Sorbonne über ihre Wahrheit diskutiert. Das Ergebnis war nicht Haß, sondern ruhige, sogar heitere Distanz. Ich bin kein Christ mehr. Hier möchte ich erklären, warum.
Es geht mir, wie gesagt, um die christliche Lehre. Aber schon höre ich den Einwand, das Christentum sei nicht in erster Linie Lehre, sondern Leben. Wo es wirklich Leben ist, werde ich es nicht kritisieren. Aber es ist inzwischen 2000 Jahre alt. Es hatte lange die Macht und konnte zeigen, was es bewirkt. Es ergriff jede Gelegenheit zu erklären, worum es ihm geht. Gleichwohl halten viele Mitmenschen sich für Christen, kümmern sich aber wenig oder gar nicht darum, was das Christentum über sich sagt. Das hat gute Gründe; es ist ihnen nicht vorzuwerfen, daß christliche Lehren das Leben kaum noch erreichen. Aber den Spott Fichtes haben sie verdient, nicht wenige Christen redeten sich und anderen ein, «sie glaubten etwas, wenn man bloß nichts dagegen hat, und es ruhig an seinen Ort gestellt sein läßt.» Die christlichen Kirchen selbst haben sich in ihren drei Hauptformen – östliche Orthodoxie, römischer Katholizismus und protestantische Kirchen – unendlich oft selbst dargestellt. Sie haben Glaubensformeln und Konzilsbeschlüsse, Bekenntnisschriften, Lebensregeln und Rituale geschaffen; Synoden und Lehrämter haben die Lehre des Christentums verbindlich festgelegt. Bis ins 20. Jahrhundert hinein besaß es zudem die Liebenswürdigkeit, der Klarheit halber hinzuzufügen, wer seiner Lehre widerspreche, sei für immer verdammt. Es gebrauchte die Formel der Verwerfung so oft, daß es für sie eine eigene Abkürzung erfand. In älteren theologischen Büchern liest man dann nur a. s., anathema sit, er sei verdammt. Es gab auf die Fragen: «Was wollt ihr denn? Was glaubt ihr?» Antworten im Übermaß.
Die Auskünfte fallen nicht übereinstimmend aus. Der christliche Glaube hat eine Geschichte voller Streit und Divergenzen. Wer heute fragt, was Christen glauben, bekommt hundert Antworten. Aber sie zeigen Gemeinsamkeiten. Und die holen sich die verschiedenen Gruppen aus der fernen Vergangenheit, aus Büchern, die um das Jahr 100 entstanden sind, auch aus Beschlüssen von Kirchenversammlungen des 4. und 5. Jahrhunderts und von Bekenntnisschriften des 16. Jahrhunderts. Sie verleugnen das gelegentlich. Sie wollen jünger aussehen als sie sind. Kleine Gruppen brechen Einzelteile aus dem alten Gebäude heraus. Aber sie sagen, sie böten das ‹ursprüngliche› Christentum; auch sie beziehen das christliche ‹Leben› auf ‹Tradition›.
Die Kirchenoberen, die wir am meisten sehen, treten museal auf. Das ist kein Zufall. Sie denken ungefähr so, wie sie sich zeigen – mit Titelpomp wie ‹Seine Heiligkeit›, altertümelnd und exotisch, mit Gewändern und Wortungetümen wie ‹Superintendent›. Das repräsentative kirchliche Leben pflegt seine sklerotisierte Form. Wir sehen mit Vorliebe ältere Herren in urtümlicher Kleidung und hören eine altmodische Sprache. Einige von ihnen fühlen den Druck, die museale Tonart abzulegen. Der eine oder andere Theologe liefert aktualisierte Abschwächungen. Ein frommer Pater spricht Mut zu; er verlegt sich auf Seelenpflege; Lutheraner weichen gern in die Umwelt aus. Aber die Ausbruchsversuche bleiben wie mit Fußfesseln ans Vergangene gebunden. Wer das Christentum der Gegenwart kennenlernen will, kommt um seine altertümelnden Selbstauslegungen nicht herum. Ich bestreite nicht, daß es irgendwo christliches Leben gibt. Mit Papstbegräbnissen und Reformationsjubiläen wird es niemand verwechseln. Auseinandersetzungsfähig sind die historisch vorliegenden Selbstfestlegungen. Daher muß, wer heute über das Christentum nachdenkt, sich oft an alten Bestandstücken orientieren, am besten an dem Glaubensbekenntnis, das Katholiken wie Protestanten feierlich ablegen.
Es liegt nicht an mir, daß das Christentum alt aussieht. Seine Anfänge liegen 2000 Jahre zurück. Natürlich hat es nicht schon deswegen unrecht, weil es antik ist. Die Geometrie ist noch älter. Die griechische Philosophie ebenso. Auch sie hat ihre Traditionslast.
Auch von dieser muß hier die Rede sein, denn Philosophie und Geschichtsforschung haben meine Kinderzweifel am christlichen Glauben großgezogen. Nicht, als hätte ich eine vorhandene antichristliche Philosophie übernommen. Die Infektion geschah subtiler: Philosophen stärkten die in mir aufkeimende Überzeugung, ich sei für meine Ansichten verantwortlich, ich sollte und dürfe sie überprüfen und bewerten. Geschichtsforscher und Gräzisten zeigten mir, wie man genau liest; Philosophen lehrten mich, auch die christlichen Dokumente nach Für und Wider zu durchdenken. Sie machten mir Mut zur Revision von Überzeugungen. Sie schlugen die Zweifel nieder, ob ich, der ich schwankte, es mir überhaupt erlauben dürfe, die feierlichsten Sätze selbständig zu untersuchen. Sie zeigten mir: Gläubige stellen sich genau wie Ungläubige unvermeidlich als urteilendes Ich der Tradition gegenüber. Auch wer sie übernimmt, selbst wer lehrt, kein Erdenwurm dürfe sich beurteilend über Gottes Wort stellen, richtet über sie; er erklärt sie für übernehmenswert und weist andere Traditionen zurück. Nicht christentumsfeindliche philosophische Thesen, die im Umlauf waren, erzeugten die Reibung, sondern ich erzeugte sie selbst. Ich sah mich ermutigt, Weltauslegungen eigenwillig-distanziert zu untersuchen. Nichts, was mir wichtig war, sollte als selbstverständlich gelten, zunächst – die Verbrecher waren noch an der Macht – nichts Politisches, dann nichts vom Schulstoff, nichts aus allen wilden Lektüren und zuletzt nicht die christliche Religion, die mir dazu verholfen hat, mich als ein Ich zu begreifen, das für Wahrheit und Unwahrheit zuständig ist.
Zufälle der Geburt, der Geschichte und der Umgebung, von denen ich erzählen muß, halfen mit; sie machten mein Leben und Denken zu einem individuellen Beispiel für das heutige Verhältnis von Philosophie und Religion. Dies vereinfacht darzustellen ist das Ziel dieses Buches. Ich verschweige nicht die individuelle Konstellation. Sie zu wiederholen ist weder möglich noch wünschenswert. Jeder Leser kann prüfen, was davon er in seine Überlegungen einführt oder abweist. Auf den Zusammenhang von Individualität und Wahrheit komme ich zurück; einleitend gebe ich diese Überlegung Goethes in Dichtung und Wahrheit zu bedenken:
Der Mensch mag seine höhere Bestimmung auf Erden oder im Himmel, in der Gegenwart oder in der Zukunft suchen, so bleibt er doch innerlich einem ewigen Schwanken, von außen einer immer störenden Einwirkung ausgesetzt, bis er ein für allemal den Entschluß faßt, zu erklären, das Rechte sei das, was ihm gemäß ist.
Nicht, als handle es sich beim Sprechen für den christlichen Glauben nur um rein individuelle Seelenaffären. Einiges läßt sich objektiv sagen, sowohl vom Christentum wie von der Philosophie. Um mit der Philosophie zu beginnen: Es läßt sich überprüfbar belegen, daß und wie sie früh in Konflikt trat mit der Götterwelt der Hellenen. Daß sie ihren Bildungsvorrang gegen Dichtung und Religion polemisierend durchsetzte, oft mit rohen Worten:
Heraklit wollte, Homer sollte ausgepeitscht werden. Denn Homers viele, rivalisierende Götter täuschten über die eine, göttlich-naturhafte Realität. Die Griechen müßten umerzogen werden. Die Götter Homers und Hesiods, sagten die frühen Philosophen, seien Erfindungen von Menschen.
Platon kritisierte diese Götter. Seine Philosophie sollte das korrupte Leben Athens korrigieren, das private wie das öffentliche. Sie sollte das richtige Leben durchsetzen, auch gegen volkstümliche Religionsvorstellungen. Notfalls, indem sie diese uminterpretierte. Manche von ihnen enthalten wahre Ahnungen wie die Sprüche des Orakels, aber das Übermaß der Korruption, das zur Hinrichtung des gerechtesten Menschen geführt hat, beweist, daß es an der Zeit ist, begründende Rechenschaft zu geben von lebensleitenden Überzeugungen.
Sokrates hat gezeigt, wie das aussieht: Ein Einzelner sieht sich verantwortlich für das, was er denkt und sagt. Er nimmt sich nicht mehr nur als Produkt seiner Verhältnisse; er stellt sich ihnen gegenüber. Nichts, was lebensbestimmend wichtig ist, steht ihm unbefragt fest, außer, daß er dies alles prüfen muß. Keineswegs will er alles prüfen, wohl aber alles, was allgemein als gut gilt. Diese Prüfung regt einige junge Leute an zu Enthusiasmus, erzeugt aber auch Haß. Sokrates zeigt, wie unsicher die bestehenden Meinungen über das richtige Leben sind; er sucht nach neuen. Diesen Eigensinn nimmt man ihm übel. Er trägt die Kosten des Verfahrens, bis zum Tod.
Der Konflikt bestand schon in vorsokratischer Zeit. Das belegt Heraklits Fragment B 42. Anaxagoras erklärte, Helios, die Sonne, sei kein Gott, sondern ein Haufen glühender Steine. Er griff die herrschende Religion an, um den neuen Anspruch des Wissens gegen die Tradition durchzusetzen. Die Frommen reagierten mit dem Prozess wegen Gottlosigkeit.
Auch Xenophanes sprach distanziert von der Volksreligion. Er relativierte: Die Äthiopier behaupten, ihre Götter seien schwarz und stumpfnasig, die Thraker, sie seien blauäugig und rothaarig (B 16). Oder er argumentierte: Wenn Ochsen, Pferde und Löwen Hände hätten und malen könnten, dann würden die Pferde pferdeähnliche, die Ochsen ochsenähnliche und die Löwen löwenähnliche Götter malen (B 15).
Der Kampf tobte früh. Und mit scharfen Worten. Gerade weil es Gemeinsames gab zwischen Philosophie und Religion. Beide gaben große Themen vor. Sie erzählten, was am Anfang war. Sie nannten Ursprünge und teilten Zeiten ein. Sie gliederten sie nach Epochen: Goldenes Zeitalter, vor dem Fall, nach dem Fall. Dichter, die über die Götter nachdachten, theologêsantes, waren die ersten Philosophierenden. Sie haben Geschichten erzählt, mythoi, und gaben zu denken. Mit solchen Worten berief Aristoteles sich am Anfang seiner Metaphysik auf sie. Sie waren der Anfang, den Philosophen zu achten und zu verlassen hatten. Die Ganzalten gaben Bilder vor, regten an zum Denken über den Kosmos, seinen Ursprung und seine Zukunft, aber das waren für Aristoteles unbeholfene Anfänge.
Die alten Religionen gaben Völkern eine kulturelle Form, sicherten ihre Lebensart, halfen Zusammenbrüche zu überleben. Kein Wunder, daß sie verteidigt wurden. Oft mit Klauen und Zähnen. Daher hebe ich noch einmal die Gemeinsamkeit mit den Philosophen hervor: zunächst die gemeinsame alte Herkunft. Die griechische Religion war älter als die Philosophie. Beide redeten von umfassenden Themen: sie berührten Ethik und Heilkunst, Magie und Naturerklärung; beide beanspruchten private und politische Lebensleitung. Beide traten oft in Konkurrenz. Im Laufe der Neuzeit mußten sie beide bestimmte Kompetenzen abtreten; sie wurden zu Randgebieten, zu Ressorts für Spezielles. So entstand die geschichtliche Situation, vor der heute Religiöse wie Irreligiöse stehen.
Es geht mir um die realgeschichtliche und intellektuelle Situation, in der heute Religion und Religionskritik stehen. Mein Thema ist nicht die Religion im allgemeinen, weder ihr Wesen noch ihre Zukunft. Beides weiß ich nicht. Ich zweifle, ob andere beides oder auch nur eins von beiden wissen. Viele reden heute von der Zukunft des Glaubens; ich kenne sie nicht und rede daher nicht davon. Zwar komme auch ich nicht ohne allgemeine Annahmen über Religionen aus. Das war nicht einmal bei meinen ersten Einleitungsworten der Fall, aber sie waren vorläufig, mehr experimentell formuliert. Sie kommen auf den Prüfstand. Und es geht nicht um meine Ausgangsformeln, nicht um den allgemeinen Begriff von Religion, sondern ums Christentum, weil es die einzige Religion ist, die ich umfassend aus den Quellen und als Realität in der heutigen Welt kenne. Ich will wissen, ob ich Gründe habe, sie als wahr anzuerkennen oder nicht. Ich äußere mich zwar zum Konzept von Wahrheit, das dabei mitspielt, aber nicht zum allgemeinen Begriff von Religion.
Dieser Einschränkung liegt folgende Beobachtung zugrunde: Wer erst einen allgemeinen Begriff der Religion entwickelt und dann übergeht zur Bewertung einer einzelnen, z.B. des Christentums, arbeitet aus zwei oder drei historischen Religionen gemeinsame Merkmale heraus. Er entwickelt sie z.B. anhand ihrer Ethik oder beschreibt ihre Sprache. In der Regel kennt er nur eine oder zwei Religionen gründlich; dann beruhen solche ‹Wesensbeschreibungen› der Religion auf fragwürdig-bruchstückhaften Tatsachenannahmen, oft auf schwachen Sprachkenntnissen. Die so gewonnene Definition von Religion enthält oft verborgen eine begünstigende oder eine distanzierende Religionsbeschreibung; wer sie dann aufs Christentum anwendet, erhält leicht das erwünschte Resultat. Ich traue bei historischen Gegenständen solchen generellen Phänomenbeschreibungen nicht. Sie fingieren Neutralität.
Was ‹Wahrheit› in meinen Sätzen bedeutet, das kann und muß ich theoretisch begründen; aber was beispielsweise der Islam ist und wie eine vorfabrizierte Religionsdefinition auf ihn paßt, das fordert langes Studium, das selbst Islamwissenschaftlern nicht durchweg gelingt, teils weil sie von ihren westlichen Vorannahmen nicht loskommen, teils weil sie das Selbstverständnis nur einzelner Gruppen für das Islamische halten, teils weil sie die Entstehung des Islam nicht als ihre Forschungsaufgabe sehen. Dies würde syrische, aramäische und vermutlich noch andere Sprachkenntnisse sowie archäologische und numismatische Studien voraussetzen. Also beschränke ich mich aufs Christentum. Dieses hat bekanntlich allein schon viele, teils sich widersprechende Formen. Darauf komme ich bald zu sprechen.
Zuvor noch ein kurzes Wort zur Art meiner Untersuchung: Sie dient meiner Selbstverständigung und bleibt philosophisch, auch wo sie theologische Themen berührt. Da das Christentum ein historischer Gegenstand ist, nehme ich alles Historische genau. Ich gehe von den gegenwärtigen Präsentationen des Christentums auf die alten Glaubensbekenntnisse und teilweise auch auf die Bibel zurück. Es soll das Bild einer geschichtlichen Bewegung entstehen, nicht das einer abstrakten, mir entgegenstehenden These. Ich argumentiere überprüfbar, philologisch, ohne mich in die Einzelheiten zu vertiefen, die bei Spezialuntersuchungen nötig sind. Aber ohne Details geht es nicht. Das philosophische Denken wird nicht gründlicher, wenn es sich keine präzisen Wahrnehmungen verschafft. Wahrnehmungen muß man sich verschaffen; die Objekte fallen nicht in uns hinein. Gewiß gibt es Leute, die sich zu viele Wahrnehmungen verschaffen, die nur sammeln und wenig denken. Ich versuche Philosophie mit Historie zu verbinden; also über Wahrheit nachzudenken, ohne wichtige Texte der Bibel oder Entwicklungen im Denken Augustins oder Luthers zu übersehen. Ich will die Quellen des christlichen Denkens genau lesen und fragen, wo heute für mich einlösbare Wahrheitschancen liegen. Ich will als Philosoph aus Interesse an Wahrheit historisch exakt über das Christentum als geschichtlich vorgegebene Serie von Komplexen sprechen. Wer historisch arbeitet, legt nicht seine Herzensangelegenheiten in die Dokumente der christlichen Religion. Skepsis verdienen philosophierende Autoren, die erst das Christentum verändern, verbessern, also reformieren wollen, um es dann von ganzem Herzen zu bejahen. Sie sagen, das Kirchenchristentum verstehe seine eigene Intention nicht recht. Diese müsse man ihm klarmachen, und dann werde es zur Religion der Zukunft, deren Stunde jetzt schlage. Meist wollen sie ihm das buchstäbliche Selbstverständnis abgewöhnen. Sie hätten es gern freier, bildlicher, und menschlicher; sie halten nur das von ihnen ausgedachte Christentum für das wahre. Solche Philosophen, die auch Theologen sein können, wollen eigentlich eine andere Kirche gründen. Aber das ist nicht die Aufgabe von Philosophen; das gelingt außerdem nicht.
Ein Beispiel solcher Wohlgesinnter ist Gianni Vattimo. Er liebt seine katholische Kirche und will sich nicht von ihr trennen. Nur soll sie anders über Frauen und Homosexuelle denken als sie es tut. Vattimo verlangt noch mehr von ihr: Sie soll den ‹Objektivimus› ihres Wahrheitskonzepts aufgeben und eine neue Auslegung ihrer Botschaft erlauben. Sie soll ihre Dogmen metaphorisch deuten.
Es sieht nicht danach aus, als wolle die römische Kirche Vattimos Wünsche erfüllen. Sie waren schon 1965 illusionär. Die Frage ist, ob sie das überhaupt könnte, wenn sie es selbst wollte. Vattimo kommt mir vor wie ein freundlicher und sensibler junger Mann, der aus Familientradition in einen Anglerverein geraten ist – es gibt übrigens in Deutschland noch Fischerzünfte, in die man hineingeboren wird und in die kein Fremder kommt –, der aber dann seine Sympathie für Fische entdeckt und vorschlägt, der Anglerverein soll sich in Zukunft mit dem Häkeln von Tischdeckchen statt mit dem Töten von Fischen befassen. Ich bewundere die seelische Feinheit solcher junger Männer, aber Erfolgsaussichten versprechen kann man ihnen nicht. Ihr Herzenswunsch beweist noch keine besondere philosophische Qualifikation. Philosophisch kohärent wäre, den Anglerverein zu verlassen, ohne ihn zu verfluchen, denn er zeigt nur das übliche Beharrungsvermögen, dem alte Vereine ihren Fortbestand verdanken.
2.Was heißt hier ‹Christ›?
«Wenn man’s so hört,
möcht’s leidlich scheinen,
Steht aber doch immer schief darum;
Denn du hast kein Christentum.»
Margarete zu Faust, Goethe, Faust I, Marthens Garten, Vers 346ff.
Wer sagt, er sei kein Christ, muß wohl hinzusagen, was er unter ‹Christsein› versteht. Das ist gar nicht so leicht. Denn es gibt nicht das Christentum, sondern Christentümer. Zum Glück brauche ich nicht zu entscheiden, wer das Recht hat, sich ‹Christ› zu nennen. Der Titel scheint begehrt und sein Besitz umstritten zu sein. Ich möchte nur sagen, in welchem Sinn von Christsein ich keiner bin.
Das Wort ‹Christ› läßt sich verschieden auslegen. Mancher Mann gilt schon als ‹Christ›, weil er keine Schecks fälscht und seine Frau nicht schlägt. Andere verstehen unter einem ‹Christen› einen Menschen, der sich um seine Nächsten sorgt. Das ist schon besser, reicht aber nicht. Es gibt eine Palette von weiterführenden Bestimmungen, ich gehe von der einfachen zur vollständigeren.
Mancher nennt sich ‹Christ› und verbindet damit die Minimalvorstellung, Gott meine es gut mit ihm oder überhaupt mit den Menschen. Frage ich ihn, was das mit Christus zu tun habe, fügt er vielleicht hinzu, Christus habe die Botschaft gebracht, daß Gott nicht zornig sei und keine blutigen Opfer verlange; Gott sei gütig, sogar die Liebe selbst. Ein Christ wäre demnach ein metaphysischer Optimist; sein Glaube bestünde darin, daß er auf die Güte Gottes baut.
Ein zweiter Typus von Christ vertraut auf Gott und erhofft nach dem Tod ein besseres Leben in einer gerechteren Welt. Er fügt seinem Glauben die Jenseitshoffnung hinzu und das Motiv der Gerechtigkeit, wenn nicht für dieses Leben, dann doch fürs Jenseits. Auf Befragen antwortet er vielleicht, er nenne sich ‹Christ›, denn Christus habe ihm den Zugang zu Gott eröffnet.
In dritter Version sagt ein Christ: Er glaube der Bibel. Er nehme an, Gott habe die Welt erschaffen. Vielleicht nicht in sechs Tagen, aber immerhin habe er dem Menschen eine hohe Stelle zugedacht. Er behaupte nicht, die Geschichten von Adam und Eva erzählten den faktischen Anfang der Menschheitsgeschichte; er verstehe sie ‹bildlich›. Er wisse nicht, ob die Menschheit von einem einzigen Paar abstamme. Fragt man, was diese Ansicht mit Christus zu tun hat, dann antwortet er vielleicht, Christus habe dies bestätigt und uns gelehrt, zum Schöpfergott ‹Vater› zu sagen. Ihm verdankten wir ein vertrautes, ein vertrauliches Verhältnis zum Schöpfer.
Eine vierte, nun schon sehr besondere Gruppe gibt Gründe an, warum sie mit Recht glaube. Sie verteidigt ihre Orthodoxie, ihre Rechtgläubigkeit. Heute sagt sie es nicht mehr so laut, aber sie denkt, Muslime glaubten leichtfertig, Christen glaubten mit guten Gründen. Für die Glaubwürdigkeit dieses christlichen Glaubens weiß sie sich im Besitz sicherer philosophischer und historischer Beweise. Diese dienten als rationale Hinführung zum Glauben. Sie nennt sie praeambula fidei. Darunter versteht sie zwei Gruppen von Beweisen, die das Christentum glaubwürdig machten: Die erste Gruppe bildeten die philosophischen Argumente, mit denen die natürliche, allgemeinmenschliche Vernunft beweise, daß Gott ist und daß die Seele den Tod übersteht. Die zweite Gruppe beweise historisch, daß Gott sich de facto in Christus offenbart hat.
Nicht nur Katholiken stützten den christlichen Glauben durch philosophische Argumente für Theismus und Seelenunsterblichkeit. Das taten auch Muslime, sobald sie mit der griechischen Philosophie vertraut wurden. Auch Protestanten betrieben bis etwa 1800 ‹natürliche Theologie›, die sich auf rationale Einsichten berief. Ich erinnere nur an Leibniz, gestorben 1716. Auch Kant brach nicht in letzter Konsequenz mit dieser Tradition. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde sie zunehmend zum Sondergut der römischen Katholiken. Das Erste Vatikanische Konzil behauptete sie als verbindliche christliche Lehre und dekretierte, die rechte Vernunft beweise die Grundlagen des Glaubens, cum recta ratio fidei fundamenta demonstret.[1] Diese Position stützte sich sowohl auf Philosophie wie auf Geschichtsforschung. Sie rechtfertigte den Glauben mit philosophischen und historischen Argumenten.
Die fünfte Ansicht ist der soeben genannten entgegengesetzt. Diese Christenart verlangt für ihren Glauben keine Beweise; sie beruft sich auf ihr Herz und ihr Gefühl. Sie nimmt an, es gebe keine sicheren Beweise zugunsten der Glaubensentscheidung, der Christ wage den Sprung des Glaubens.
Diese Theorie entstand als Ablehnung der Religionsphilosophie des deutschen Idealismus und verbreitete sich im Lauf des 20. Jahrhunderts besonders unter protestantischen Theologen. Der Gott der Philosophen war bei ihnen in Verruf geraten; die Metaphysik der unsterblichen Seele galt als überholt; sie haben im November 1918 mit Wilhelm II. ihren Pontifex maximus verloren, sie lernten in der Not beten und suchten ihre Zuflucht jetzt mehr beim stärkeren Arm des himmlischen Herrn. Diese Glaubensgruppe beruft sich gern auf Pascal und Kierkegaard, sie hält sich für die gegenwartsgeeignetere, die fortgeschrittene Version; sie nimmt ihre Verlegenheit zum Anlaß, sich des großherzigen Verzichts auf Metaphysik und Polizei zu rühmen. Die vierte Christensorte strotzte vor Erkenntniszuversicht in Sachen der philosophischen Theologie und überforderte die Geschichtsforschung, von der sie den Beweis für ‹Glaubenstatsachen› verlangte; sie unterschied Glauben und Glaubwürdigkeit und konstruierte diese rationalistisch als die rationale Vorbereitung des Glaubens. Ganz anders die fünfte Variante. Sie verhält sich skeptisch zur philosophischen Gotteserkenntnis und zur Metaphysik der Seele; sie setzt auf den Glauben als Sprung. Sie deutet ‹Glauben› als persönliche Beziehung, als Vertrauen auf Gott, nicht als gehorsame Zustimmung zu einer Gruppe von Sätzen, die von der Kirche vorgelegt wird. Sie versteht sich als vernunft- und kulturkritisch. Während die Christen der vierten Variante darauf bestanden, daß ihre Botschaften historische Tatsachen mitteilen, nimmt die fünfte Konzeption die Glaubensbotschaften vorwiegend bildlich, gerät aber in die Schwierigkeit, einen klaren Trennungsstrich zu ziehen zwischen dem, was sie bildlich versteht und dem, was faktisch, historisch real sein soll. Und so erzeugt sie in ihren Reihen eine Protestgruppe, die zur buchstäblichen Auslegung, also zu einer ‹Theologie der Tatsachen› zurückwill. Jetzt muß das Grab Jesu wieder leer sein.
So geht es mit der Frage der Metaphorik oder Allegorie mehrfach hin und her. Man entgeht ihr nicht. Ganz ohne metaphorische Deutung kommt kein Bibelleser aus. Dafür gibt es zwei schöne Beweise:
Erstens: Jesus nennt in Lukas 13,32 Herodes einen ‹Fuchs›. Muß der Christ nun glauben, der Gottessohn habe in diesem Augenblick den König in einen Fuchs verwandelt? Oder hat er eine Metapher gebraucht und nur gemeint, Herodes sei schlau wie ein Fuchs? Aber wenn Jesus beim Letzten Abendmahl vom Brot sagt: «Das ist mein Leib», dann lehren Thomas von Aquino und Luther, das Brot sei nicht mehr vorhanden oder nur zum Schein da, Jesus habe inzwischen das Brot in seinen Leib verwandelt. Warum beim Fuchs bildlich, beim Brot buchstäblich? Wo und warum gerade dort liegt die Grenze der metaphorischen Auslegung? Der einfache Glaube kann das offenlassen, aber Theologie, die als Wissenschaft auftreten wollte, konnte das nicht und schuf endlose Konflikte. Sie wird weder friedlicher noch klarer, wenn sie sich verbindet mit sozialethischen oder ‹spirituellen› Motiven.
Das zweite Argument ergeben die sechs Tage, in denen nach dem ersten Buch der Bibel Gott die Welt erschaffen haben soll. Ein gegenwärtiger Religionsverteidiger nennt jeden einen ‹Fundamentalisten›, der die sechs Tage wörtlich nimmt. Aber die Bibel selbst präsentiert sie wörtlich; sie gibt in keiner Weise zu verstehen, daß diese Darstellung dem Wirken Gottes nicht angemessen ist. Aber schon in der Antike haben Juden und Christen den philosophischen Gottesbegriff dagegen geltend gemacht und die sechs Tage ‹symbolisch› genommen. Ihr Gott war zeitlos; sein Wirken zählte nicht nach Tagen. In diesem Fall wurde die Bibel so früh allegorisiert, daß der buchstäbliche Sechs-Tage-Glaube heute als Kennzeichen des ‹biblischen Fundamentalismus› durchgeht.
Ich bin in keiner der charakterisierten Bedeutungen Christ. Am wenigsten harmoniere ich mit Mischungen dieser Versionen, die im deutschsprachigen Raum – außer in strengnormierten Zirkeln – das Normale geworden zu sein scheint.
Ich nehme also das Christentum nicht als Einheit, sondern differenziere. Vielleicht veranlasse ich den einen oder anderen christlichen Leser zu der Frage, zu welcher dieser Varianten er tendiert. Er könnte damit seinen Ideenhaushalt schon ein wenig aufräumen. Indem ich sage, ich teile keine dieser fünf Versionen, behaupte ich nicht, sie seien Unsinn. Ich nenne keine von ihnen ‹Unsinn›, ich mache nur von keiner dieser Hypothesen Gebrauch. Meine Position ist konsequent agnostisch, nicht atheistisch. Denn ein Atheist traut sich zu, er könne beweisen, daß kein Gott sei. So zuversichtlich bin ich nicht.
Daher bin ich auch nicht verpflichtet, an die Stelle des christlichen Glaubens etwas Besseres zu setzen. Wenn ich sage, daß ich kein Christ bin, werde ich oft gefragt, ob ich etwa Buddhist geworden sei. Ich antworte: Nein, ich brauche keinen Ersatz. Ich lasse die Stelle leer. Ich leide nicht an Phantomschmerz. Ich habe kalt und ersatzlos abgeschlossen. Die Geschichte des Christentums, seine Kunst und Literatur interessieren mich wie zuvor, aber alles Dogmatische geht mich nur historisch etwas an. Argumentativ interessiert mich, was heute behauptet wird. Wer das Christentum bewußt aufgegeben hat, verlangt nichts von all dem, was als Religionsersatz üblich ist: Nationalismus, Sieg über die Konkurrenz, Rekordsucht im Sport, Wirtschaftswachstum, Wissenschaft oder Gelderwerb. Er kann von allem, was sich als Letztwert aufspreizt, so skeptisch und analytisch sprechen, wie früher es radikale Jenseitsgläubige taten. Zum Beispiel Augustin, der das Römische Reich herunterredete und ihm nicht einmal zugestand, ein Gemeinwesen (civitas) zu sein.
Es hat sich inzwischen abgezeichnet, was ich unter ‹Philosophie› verstehe, nämlich das Nachdenken über allgemeine Voraussetzungen des alltäglichen und des wissenschaftlichen Sprechens. Zugleich ist sie wirksames Movens zum Aufsuchen zurückgedrängter Fakten. Dabei verwandelt Philosophie sich sehenden Auges in Philologie, natürlich phasenweise, nicht für immer. Sie braucht, meine ich, heute beide Bewegungsrichtungen, die zum abstrakten Argument und die zum philologisch-historischen Detail. Beide möchte ich etwas näher beschreiben:
Philosophie ist heute ein unübersichtliches Universitätsfach. Ich selbst beteilige mich an ihren spezialistischen Debatten, zum Beispiel über die Zeittheorie des Aristoteles, fasse aber hier, im Zusammenhang dieses Buches, ‹Philosophie› einfacher und allgemeiner, nämlich als die Aufforderung an mich, bei aufkommenden Zweifelsfragen kohärent zu bleiben. In diesem Fall liegt der Ausgangspunkt nicht bei kleinen Detailfragen, sondern bei etwas, das vor aller Augen liegt. Das können sehr verschiedene Themen sein, z.B. Schulorganisation oder Sterbehilfe oder Rüstungsexporte. Bei Diskussionen über solche allgemeinen Themen sucht der Philosophierende ihre allgemeinen Voraussetzungen auf; er analysiert und bewertet sie. Das Philosophieren kommt in Gang durch den Beschluß, Zweifeln nachzugehen, die allgemeine Dinge betreffen. Im Alltag widmen wir aufkommenden Zweifeln, z.B. über Konzepte von ‹Natur›, von Gesundheit und Tod, keine lange Zeit. Wir huschen darüber hinweg. Wer philosophiert, macht bei ihnen Halt. Es setzt voraus, ihre Klärung sei nützlich, gar notwendig; sie diene dem Gemeinwesen. Das verlangt niemand bei fachinternen Diskussionen, z.B. über die Zeittheorie des Aristoteles. Aber Philosophie im hier gemeinten Sinn geht von dieser Erwartung aus. Sie klinkt sich aus dem abgegriffenen Sprachgebrauch der flüchtigen Sprachbenutzer aus und insistiert: Du feierst Weihnachten, sag mir warum. Weihnachten ist heute ein gewaltiges ökonomisches, soziales und psychologisches Phänomen von komischer und nicht selten tragischer Größe. Wer behauptet, es beruhe auf Wahrheit, oder auch wer das bestreitet, setzt ein bestimmtes Konzept von Wahrheit voraus. Und danach in argumentierenden Unterhaltungen zu suchen, ist die Sache der Philosophie, wie sie hier gemeint ist.
Sie setzt voraus, daß ein Mensch so fragen darf. Sie käme auch nicht in Gang, stünde von vornherein fest, daß sie zu keinem Ergebnis kommen kann. Beide Voraussetzungen – also ihre Erlaubtheit und ihre Aussichten – sind wert, eigens untersucht zu werden; sie sind umstritten. Hier muß genügen, sie genannt zu haben. Aber auch die bescheidenste Teilnahme an solchen Überlegungen setzt voraus, daß der Leser sich ein Urteil bilden darf und kann. Er muß sich als ‹Subjekt› verstehen. Er muß seinen Glauben wie seinen Unglauben als seine Gedanken erkennen, die er bewerten darf und kann. Das heißt keineswegs, daß er alles beurteilen darf und kann, wohl aber das, was er sich zu eigen gemacht hat und von dem er sich fragt, wie er es heute sieht. Dann bleibt Dunkles genug. Das Leben steckt voller Überraschungen, aber über seine eigenen Anschauungen steht ihm ein Urteil zu, freilich auch nicht über alle, also z.B. kann er in der Regel nicht wissen, ob homöopathische Arzneien helfen. Er wird entscheiden, welche Anschauungen für ihn wesentlich sind, vielleicht nur jetzt, nicht für sein ganzes Leben. Manches, was ihm vor fünf Jahren wesentlich war, wird heute nebensächlich. Das gilt auch für religiöse Annahmen. Ich sage nicht, sie gehörten zur bleibenden Natur des Menschen; das weiß ich nicht. Ich weiß nur, daß einige Menschen in unseren Breiten sie noch behaupten und daß andere sie diskutieren. Zudem haben sie gesellschaftlichen und politischen Einfluß; sie haben sogar ökonomische Bedeutung, nicht nur für Wallfahrtsorte. Daher lasse ich mir nicht einreden, ich dürfe sie gar nicht in Frage stellen. Ich weiß, daß fromme Christen ihren Glauben als Wirkung Gottes sehen, die sie nicht zu verantworten haben. Wenn sie damit begründen wollen, daß sie ihn nicht diskutieren können, beenden sie die philosophische Unterhaltung. Ich verstehe hier ‹Philosophie› als die entschiedene Ansicht, für meine Annahmen selbst verantwortlich zu sein. Folglich bin ich nicht verletzt, wenn ein anderer sie nicht teilt. Ich beharre aber darauf, ein ‹Subjekt› sein zu dürfen, das beurteilen kann, was ihm wichtig ist. Zugleich weiß ich, daß ich ein ‹Subjekt› unter Subjekten bin. Deswegen interessiere ich mich für sie und nehme ihre Selbstdarstellungen so peinlich genau, daß oberflächliche Zuschauer meine Vorgehensweise als ‹positivistisch› verwerfen. Was ich wirklich tue, ist momentane Selbstverwandlung des philosophischen Impulses in historisch-philologische Recherche. Diese ist bei einem geschichtlichen Gegenstand, wie es das Christentum ist, unentbehrlich. Mein Nachdenken sucht etwas zu entscheiden, was jetzt bei mir zur Entscheidung ansteht und achtet deshalb sorgfältig auf meine Zeitstelle – was mehr ist als deren bloß korrekte Datierung – und macht sich dazu die geschichtliche Differenz zum Untersuchten klar, hier zu den geschichtlich gewachsenen Formen des Christentums und zu ihrer gegenwärtigen Rolle.
Man sieht, wie heikel die Frage werden kann, was ein Christ ist. An der Eigentumslosigkeit, also am Liebeskommunismus, erkennt man die Christen schon lange nicht mehr. Kaum auch noch am Herbeisehnen des Jüngsten Gerichts. Diese uralten Versionen sind de facto verschwunden oder bringen sich nur an Rändern in Erinnerung. Sie zeigen, daß es im ‹Christentum› so etwas wie geologische Schichten gibt.
Was das Christentum sagt, bestimmt nicht der, der sich für es entscheidet. Gewiß gibt er ihm seine eigene Note, denn er entscheidet sich unter seinen Bedingungen; er fügt es in das Gesamt seiner Erwartungen und Ansichten ein; er sieht es aus seiner individuellen Situation. Und doch liegt ein differenzierter geschichtlicher Stoff vor ihm. Früher hat das Christentum sich lebhaft bewegt und ganze Völker in seinen Strudel gerissen. Heute steht es erstarrt, aber wohlgeschichtet vor uns, denn früher haben die Kirchen ihre Ansichten als Alleinstellungsmerkmale mit schneidender Klarheit definiert. Ich gehe von ihren Selbstdarstellungen aus, nicht von der Selbstcharakteristik einzelner Christen. Das ist ein gewaltiger Stoff in seiner historischen Breite vom ersten Paulusbrief bis zu den kirchlichen Verlautbarungen der letzten Jahre, auch wenn ich außer der Bibel nur Urkunden des westlichen Christentums heranziehe. Diesen Stoff wird nicht los, wer sich mit ausgewählten Punkten der christlichen Botschaft – wie mit dem Leiden Jesu, der Nächstenliebe oder der Gnade – identifiziert. Ich gehe von den geschichtlichen Quellen des Christentums aus. Das erzeugt vermutlich den Eindruck, was ich ablehnte, sei nur ein veraltetes, ein heute kaum noch vertretenes Christentum. Das muß so aussehen bei Christen, die nur ein abgespecktes Christentum, eine ‹Orthodoxie light› kennen. Ich behaupte, es sei die Altertümlichkeit des unverkürzten Christentums selbst. Ob das stimmt, kann nur der Gang zum einzelnen Lehrpunkt und seinen Quellen entscheiden. Damit zeichnet sich der Weg ab, den mein kleines Buch nimmt:
Zuerst kommt ein kurzes autobiographisches Intermezzo. Ich erzähle ein wenig von meiner christlichen Sozialisation. Mit dem ersten Kapitel beginnt die sachliche Argumentation. Es beschreibt geschichtliche Lebensbedingungen des modernen Christentums, realgeschichtliche und intellektuelle. Es handelt von den historischen Einschnitten, die es seit dem 18. Jahrhundert mehr umgeformt haben, als seine Bekenner gewöhnlich wissen. Mancher wird mir zugeben, das Christentum sei ein historischer Gegenstand, aber ich möchte diese Redensart in konkrete Anschauung und Begriffe umwandeln. Auch die Sichtweise, mit der wir es sehen, hat sich verändert. Einen scharfen Einschnitt brachte die historisch-kritische Methode. Ich stelle sie daher im ersten Kapitel kurz vor.
Das zweite Kapitel zeigt: Seit etwa 1800 reagierten europäische Christen mit neuen Glaubensbegründungen auf die Verluste seit dem 18. Jahrhundert. Sie empfehlen die Annahme des christlichen Glaubens unter erschwerten Bedingungen. Aber sagen uns die neuen Verteidiger des Glaubens, warum er wahr ist? Ich frage, was es heißen kann, wenn jemand sagt, das Christentum sei ‹wahr› oder wenn er seine Wahrheit bestreitet. Ich halte diese abstrakte Frage für notwendig, auch um zu einem klareren Konzept von ‹Fundamentalismus› zu kommen, fasse sie aber so kurz wie möglich und gehe im dritten Kapitel zu anschaulicheren Themen über: Ich prüfe die traditionellen Argumente der Glaubensverteidiger; das waren Weissagungsbeweise und Wunderberichte.
Der zweite Teil geht die Hauptinhalte des christlichen Glaubens durch. Er bespricht zuerst die Christenlehre über Gott. Kapitel IV geht auf die Gottesbeweise ein und konfrontiert den Gott der Philosophen mit dem gar nicht so zärtlichen ‹Gott der Väter›. Kapitel V kommt zu seinem Verhältnis zur Welt, also zum alten Problem der Theodizee: Widerlegt das Übel in der Welt die Ansicht vom guten und allmächtigen Schöpfer?
Danach gehe ich konkreter auf die Glaubenslehre ein und frage nach dem christlichen Konzept der Erlösung (Kapitel VI). Es folgt eine kurze Kritik der christlichen Ethik, auch der Sexualethik (Kapitel VII). Schließlich kommen die ‹Letzten Dinge›, Tod und Unsterblichkeit; ich besehe das Schicksal der Seelen in Himmel und Hölle (Kapitel VIII). Am Ende antwortet das neunte und letzte Kapitel auf die Frage, wie es sich anfühlt, kein Christ zu sein.
3.Ein bißchen Autobiographie
Muß ein Autor sich dafür entschuldigen, wenn er ein ‹ernsthaftes Buch› damit beginnt, indem er ein wenig aus seinem Leben erzählt? Jedenfalls ist es schwer zu vermeiden, wenn ich erklären soll, warum ich kein Christ bin. Ich bekomme jetzt schon Briefe, in denen der fromme Schreiber sich für Biestigkeiten entschuldigt, die seine Glaubensgenossen mir angetan hätten. Anders denn als Reaktion auf mitchristlichen Ärger kann er sich meinen Unglauben nicht erklären. Er kennt seine Glaubensgenossen besser als mich. Dem Manne kann geholfen werden, aber nur mit ein bißchen Biographie. Denn ich bin dem Christentum abhanden gekommen, nicht weil die Kirche mich gedemütigt, gequält oder mißbraucht hätte, sondern während sie mich verwöhnt hat. Das kommt ziemlich selten vor und muß daher erzählt werden.
Gedanken entspringen dem Leben. Sie kommen aus ihm hervor, springen ihm aber davon. Sie stellen sich dem Leben gegenüber und beurteilen es. Sie sind nicht eine Funktion des vorhandenen Lebens; sie lassen sich nicht ableiten aus der Biographie. Gedanken kommen aus Gedanken.
Der Unglaube wurde mir nicht an der Wiege gesungen, als ich 1930, noch in der Weimarer Republik, in Mainz zur Welt kam, ziemlich genau dort, wo der Main in den Rhein fließt.
Wir waren eine katholische Familie. An ihrer religiösen Orientierung gab es keinen Zweifel, aber ich muß sofort hinzusagen, was für eine Art von Katholizismus das war. Wir waren ‹gut katholisch›, warm, klar und mit Leidenschaft, aber nicht ‹streng katholisch›. Es könnte zu Mißverständnissen führen, wenn ich sagen würde, wir waren ‹liberal katholisch›, jedenfalls war es ein städtischer, ein kulturell offener und ein politischer Katholizismus. Goethe stand in der kleinen Büchersammlung; Fastnacht war wichtiges Lebenselement; wir Kinder durften zu Kirche und Glauben Fragen stellen, auch leicht spöttische. Wir sprachen heiter über religiöse Fragen. Zum Beispiel fragte – es dürfte 1941 gewesen sein – meine große Schwester beim Mittagessen die Mutter, was sie denn machen würde, wenn Gott auf den Gedanken käme, Hitler in den Himmel aufzunehmen. «Dann will ich nicht hinein», platzte sie heraus sie und löste damit vergnügliche Gespräche über ihren theologisch bedenklichen Eigensinn aus. Aber die Lage wurde ab 1937 immer ernster, denn wir gehörten zu der Gruppe, welche die Nazis den ‹politischen Katholizismus› nannten; das waren die kleinen Teile der Zentrumspartei, die nicht zu den Braunen umschwenkten. Mein Vater, mittlerer Bahnbeamter und kein Parteimitglied, wurde als ‹politisch unzuverlässig› schikaniert und beruflich benachteiligt; 1943 wurde er nach Schlesien an einen kleinen Bahnhof strafversetzt. Bis dahin war mein Vater der dritte Mann in einer nicht ganz alltäglichen Skatrunde. Deren andere Mitspieler waren der Bischof von Mainz, Albert Stohr (1890–1961), und dessen Freund, der Pfarrer von Mainz-Kastel, Domkapitular Johannes Schwalbach. Mein Vater war mit Schwalbach befreundet, der wiederum Jahrgangsgenosse von Stohr war. Stohr schickte seinem Freund das beste Personal, über das er verfügte.
Der Bischof war von 1931 bis 1933 Abgeordneter der Zentrumspartei im Hessischen Landtag gewesen, und dort war sein Fraktionsvorsitzender mein Onkel, der Reichstagsabgeordnete Dr. Fritz Bokkius. In den 1970 gedruckten Memoiren des Reichskanzlers Brüning (1885–1970) berichtet Brüning, er habe den Dr. Fritz Bockius gebeten, als erster demokratischer Politiker mit Hitler persönlich wegen einer eventuellen Koalition in Hessen zu verhandeln, übrigens ergebnislos. Bockius amtierte als Rechtsanwalt in Mainz; er wurde nach dem 20. Juli 1944 verhaftet und in Mauthausen umgebracht.