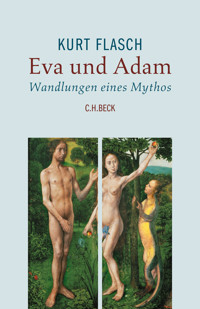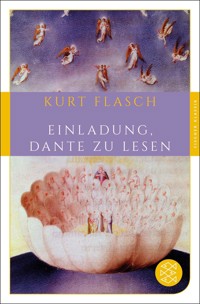19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Reclams Universal-Bibliothek
- Sprache: Deutsch
1986 erschien Kurt Flaschs Darstellung der mittelalterlichen Philosophie erstmals. Seine umfassende Einführung bleibt nah an den Texten, stellt einzelne Philosophen und wichtige Werke vor und entwickelt daraus das große Panorama des mittelalterlichen Denkens bis ins 15. Jahrhundert. Inzwischen ist sie zum Standardwerk geworden. Für die 3. Auflage 2013 wurde der Band vom Autor vollständig überarbeitet, auf den neuesten Stand der Forschung gebracht und um drei neue Kapitel ergänzt. Diese bisher nur als Hardcover lieferbare Ausgabe kommt jetzt auch in die Universal-Bibliothek.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1135
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Kurt Flasch
Das philosophische Denken im Mittelalter
Von Augustin zu Machiavelli
Unter Mitarbeit von Fiorella Retucci und Olaf Pluta
Reclam
RECLAMS UNIVERSAL-BIBLIOTHEK Nr. 19479
1986, 2013 Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG,
Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Gestaltung: Cornelia Feyll, Friedrich Forssman
Gesamtherstellung: Reclam, Ditzingen
Made in Germany 2017
RECLAM, UNIVERSAL-BIBLIOTHEK und
RECLAMS UNIVERSAL-BIBLIOTHEK sind eingetragene Marken
der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN 978-3-15-960238-7
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-019479-9
www.reclam.de
Für Cesare Vasoli und Nidia Danelon
in Freundschaft
Inhalt
Vorwort
Vorwort zur 2. Auflage
Vorwort zur 3. Auflage
Einleitung
Erster TeilGrundlegung der mittelalterlichen Philosophie
1. Die geschichtliche Situation
2. Augustin
3. Boethius
4. Dionysius Areopagita
5. Der Problemstand zu Beginn des Mittelalters
Zweiter TeilEntwicklungsstadien der mittelalterlichen Philosophie
I Neue Rahmenbedingungen
6. Das Christentum
7. Die lateinische Sprache
8. Das Bildungssystem
9. Die Bibliotheken
II Karolingische Reform
10. Ökonomie – Politik – Kultur
11. Johannes Eriugena
III Der Aufbruch: Das 11. Jahrhundert
12. Eine neue imperiale Kultur: Die Ottonen – Gerbert von Reims
13. Der ökonomische Aufschwung
14. Berengar von Tours und Anselm von Canterbury
IV Das 12. Jahrhundert
15. Eine geschichtliche Wasserscheide
16. Die Kirche und die Ketzer
17. Das neue Wissen
18. Zwei neue Wege nach Anselms Tod
19. Selbstbewusstsein in Wissen und Handeln
20. Abaelard
21. Chartres
22. Natura
23. Offene Fragen am Jahrhundertende
V Das 13. Jahrhundert
24. Die geschichtliche Situation
25. Klerikerwissen und die Anfänge einer laikalen Wissenschaft. Die Mendikanten
26. Die Universität und ihre literarischen Formen
27. Die islamische Herausforderung
28. Jüdische Anregungen
29. Natur, Gesellschaft und Wissenschaft nach der Aristoteles-Rezeption
30. Aristotelismus und Platonismus
31. Albert der Große
32. Thomas von Aquino
33. Bonaventura
34. Roger Bacon
35. Radikale Aristoteliker: Siger von Brabant und Boethius von Dacien
VI Das 14. Jahrhundert
36. Die geschichtliche Situation
37. Die Verurteilung von 1277 und ihre Folgen: Die Situation am Jahrhundertende
38. Ein radikaler Franziskaner am Jahrhundertende: Olivi
39. Raimundus Lullus
40. Dietrich von Freiberg
41. Meister Eckhart
42. Kontrastierende Philosophien am Jahrhundertanfang: Duns Scotus als Übergang
43. Durandus a S. Porciano
44. Wilhelm von Ockham
45. Apriorismus in London – Empirismus in Paris: Thomas Bradwardine und Nicolaus von Autrecourt
46. Johannes Buridan
47. Staat – Gesellschaft – Kirche: Marsilius von Padua
48. Neue Naturwissenschaft
49. Humanismus
50. Petrarca: Ein Philosoph des 14. Jahrhunderts
VII Das 15. Jahrhundert: Zwischen Mittelalter und Moderne
51. Die geschichtliche Situation
52. Gestalten des Übergangs
53. Florenz als Mittelpunkt einer neuen Welt
54. Leonardo Bruni und das Unionskonzil
55. Lorenzo Valla
56. Nikolaus von Kues
57. Florenz und seine Exilierten
58. Florentinischer Platonismus
Dritter TeilDie neue Zeit
59. Mittelalter, Renaissance, Reformation
60. Leonardo da Vinci
61. Machiavelli und Luther
Anhang
Verzeichnis der Abkürzungen und Siglen
Anmerkungen
Zeittafel
Nachbemerkung
Personenregister
Sachregister
Zum Autor
Vorwort
1. Dieses Buch entwickelt die Geschichte des philosophischen Denkens im Mittelalter. Es versucht, nicht vom Schulbegriff der »Philosophie« auszugehen, sondern die Texte der mittelalterlichen Denker zu lesen als Dokumente ihrer Auseinandersetzung mit realen Erfahrungen in Natur und Geschichte.
Handbuchartige Vollständigkeit habe ich nicht beabsichtigt. Ich wollte mich auf die wichtigen Entwicklungspunkte beschränken. Auch dann blieb noch ein gewaltiger Stoff, den ein einzelner Autor nicht vollständig durchdringen konnte. Dieses Buch ist ein Anfang. Doch macht es, wie ich hoffe, die intellektuelle Entwicklung des Westens und ihren Zusammenhang mit der Realgeschichte sichtbar.
Ich wollte ein Lese- und Arbeitsbuch schreiben, das, wie Lessing forderte, »nach den Quellen schmeckt«. Einschränkend muss ich hinzufügen, dass ich die arabischen und jüdischen Quellen des Mittelalters nur in ihrer lateinischen Fassung kenne.
2. Das mittelalterliche Denken gehört der Geschichte an. Und bei geschichtlichen Themen fordert man zu Recht, die Methodendiskussion dürfe die Darstellung nicht überwuchern. Daher habe ich meine Ansichten über Verfahrensfragen in der Einleitung nur knapp angedeutet. Wer gleich »zur Sache« kommen will, mag sie nachträglich lesen. Er kann mit der Situationsbeschreibung der Spätantike (↑) oder auch des karolingischen Aufschwungs (↑) beginnen. Er darf freilich nicht glauben, die Geschichte des mittelalterlichen Denkens ließe sich »naiv«, ohne theoretische Vorüberlegung und ohne Einwirkung unserer Gegenwart, hererzählen.
Ob man sich für das Mittelalter interessiert und was man darin sucht, hängt ab von den Bedingungen der jeweiligen Gegenwart. Man kennt das Kommen und Gehen der Mittelalter-Begeisterungen. Goethe sah 1810 eine dieser Wende-Wogen kommen und bemerkte mit Gelassenheit: »Ich will diese ganze Rücktendenz nach dem Mittelalter und überhaupt nach dem Veralteten recht gerne gelten lassen, weil wir sie vor 30 oder 40 Jahren auch gehabt haben und weil ich überzeugt bin, dass etwas Gutes daraus entstehen wird; aber man muss mir nicht glorios damit zu Leibe rücken.«1
Wer heute an der Erforschung des Mittelalters arbeitet, mag es gerne sehen, wenn sich seit dem Ende der siebziger Jahre das Publikum wieder herandrängt, nachdem das Mittelalter von 1945 bis 1953 seine Rolle bei den bundesrepublikanischen Restaurationsbestrebungen gespielt hat. Schließlich hat auch Goethe nicht das Interesse am Mittelalter verworfen, selbst wenn es in modischen Wogen heranschwappte. Freilich droht die Inszenierung des Mittelalters zum Zweck alt-neuer Geborgenheit. Die genauere Beschäftigung mit dem Mittelalter und seinem Denken zerstört die Idylle. Vielleicht enttäuscht sie die Trosterwartung des Publikums. Indem ich das Mittelalter als konfliktreiche Zeit zeichne, verletze ich das Goldgrundbedürfnis vieler Zeitgenossen. Aber dafür kann ich mich noch einmal auf Goethe berufen: »Die größte Achtung, die ein Autor für sein Publikum haben kann, ist, dass er niemals bringt, was man erwartet, sondern was er selbst auf der jedesmaligen Stufe eigener und fremder Bildung für recht und nützlich hält.«2
Mainz, den 14. November 1985
Kurt Flasch
Vorwort zur 2. Auflage
1. Dieses Vorwort gibt mir Gelegenheit, den Akzent hervorzuheben, um den es in diesem Buch geht. Es zeigt: Die unpersönlichsten Theorien und die erhabensten Themen sind an Zeiten und Landschaften gebunden. Daher behandle ich das mittelalterliche Wissen nicht nur als abstrakte Spekulation, sondern immer auch im Rahmen seiner Lebenswelt. Dazu gehören seine Zeitstelle und sein Bezug auf eine kulturelle Region. Nicht, als habe es zu einem bestimmten Zeitpunkt und an einem geographischen Ort nur eine bestimmte Theorie geben können; einen solchen Determinismus wird man in diesem Buch nicht finden, auch nicht in der ersten Auflage. Wohl aber sind Theorien, auch theoretische Konflikte, an vorausgehende Diskussionen und an bestimmte Voraussetzungen gebunden, z. B. an das Vorhandensein von Texten und Bildungseinrichtungen, an ein Minimum ökonomischer, sozialer und politischer Organisation. Das Denken des Mittelalters differenziert sich nach Regionen, nach Autoren, nach deren Erfahrungen, Lektüren und Entwicklungsstadien. Wer nach einer einheitlichen Scholastik sucht oder wer nur den Ursprung der Moderne in ihm nachweisen will, beseitigt seine Lebendigkeit. Der erste Schritt in Richtung auf die tatsächlich vorhandene Vielfalt im mittelalterlichen Denken besteht in der Wahrnehmung der kulturellen Regionen. Es gab nicht nur Paris; es gab auch Köln und Krakau, Neapel und Chartres, Bologna und Oxford. Von dieser Vielfalt, zu der auch Laon und Pavia, Fulda und Prag, Córdoba und Erfurt gehören, verschaffe man sich eine Anschauung, am besten durch Reisen, jedenfalls aber mit einem Geschichtsatlas.
Mein Buch bricht mit der Vorstellung, das Denken sei im Mittelalter eine Einheit gewesen, die sich auf wenige Richtungsnamen beschränken oder gar in Thesen zusammenfassen ließe. Inzwischen ist die Forschung in dieser Richtung weitergegangen: Ruedi Imbach hat die sozialen Schichten der Urheber und Adressaten des mittelalterlichen Wissens behandelt und gezeigt, dass es sich nicht nur um Klerikerwissen gehandelt hat: Ruedi Imbach, Laien in der Philosophie des Mittelalters, Amsterdam 1989; ders., Dante, la philosophie et les laïcs, Fribourg/Paris 1996. Loris Sturlese hat die Regionalgeschichte der Philosophie bereichert: Die deutsche Philosophie im Mittelalter. Von Bonifatius bis zu Albert dem Großen, München 1993; Alain de Libera hat eine neue synthetische Darstellung vorgelegt, die gerade die Vielfalt der Orte und Kulturen, der Themen und Antworten sichtbar macht: La philosophie médiévale, Paris 1993. Es sind neue Textausgaben hinzugekommen; eine Fülle neuer Untersuchungen, vor allem aus dem angelsächsischen und dem italienischen Sprachraum, sind erschienen. Ich habe davon so viel aufgenommen, wie es die Architektur meines Buches und der äußere Rahmen gestatteten; es sollte bei einem Band in Reclams Universal-Bibliothek bleiben.
2. Für diese Neufassung habe ich meinen Text überprüft, korrigiert und an vielen Stellen erweitert. Einige Kapitel sind aufgrund fremder und eigener Forschung weitgehend umgestaltet. Dies gilt vor allem für das 12. Jahrhundert. Dessen Vielfalt und Ideenreichtum haben mich beim Abfassen der ersten Auflage in eine Art Torschlusspanik versetzt, so dass ich auf Abschluss drängte und selbst von Autoren schwieg, mit denen ich mich zuvor intensiv befasst hatte.
Inzwischen habe ich eine Reihe von Themen an anderer Stelle weiterverfolgt; ich nenne auswählend einige meiner Arbeiten, im Hinblick auf die ich mich bei der Neubearbeitung kurz fassen konnte:
Kurt Flasch, Einführung in die Philosophie des Mittelalters, Darmstadt 1987, 31994; ders., Aufklärung im Mittelalter? Die Verurteilung von 1277, Mainz 1989; ders., Was ist Zeit? Augustinus von Hippo. Das XI. Buch der Confessiones. Historisch-philosophische Studie, Text, Übers., Komm., Frankfurt a. M. 1993; ders., Logik des Schreckens. Augustinus von Hippo. Die Gnadenlehre von 397, 2., verbesserte Auflage mit Nachwort, Mainz 1995; ders. / Udo Reinhold Jeck (Hrsg.), Das Licht der Vernunft. Die Anfänge der Aufklärung im Mittelalter, München 1997; ders. (Hrsg.), Interpretationen. Hauptwerke der Philosophie. Mittelalter, Stuttgart 1998; ders., Nikolaus von Kues. Geschichte einer Entwicklung, Frankfurt a. M. 1998.
3. Ich danke meinen Lesern der ersten Auflage, auch den meisten Rezensenten. Sie haben meine Sicht und Schreibart zu schätzen gewusst. Sie haben sie »quellennah, frisch, nicht professoral« genannt. Dabei hatte ich beim Schreiben nur an meine Bochumer Studenten und an mich selbst gedacht: Ich wollte – oft mit angehaltenem Atem – ausprobieren, ob man textorientiert durch 1200 Jahre intensiver Denkgeschichte »durchkommen« kann. Mir war die Unmöglichkeit fühlbarer als der Erfolg. Daher danke ich Freunden und Lesern für die Ermutigung.
Im Rückblick auf die erste Auflage freut mich am meisten, dass ich sie Cesare Vasoli (Florenz) gewidmet habe. Damals, bei beginnender Freundschaft, überwog mein Respekt für seine Humanität, seine immense Gelehrsamkeit und klassische Rhetorik. Ohne ihn hätte ich den Abschnitt über das 15. Jahrhundert nicht schreiben können. Inzwischen hat sich über allen gelehrten Austausch hinaus die Freundschaft vertieft und schließt auch seine Frau Nidia ein. Daher widme ich die neue Fassung ihnen beiden – in dankbarer Erinnerung an herzliche Zuwendung und an toskanisch-gewürzte heitere Unterhaltungen bei vielen Gelegenheiten, in Florenz, in Rom und anderswo.
Gaeta, den 14. Juni 1999
Kurt Flasch
Vorwort zur 3. Auflage
1. Die Vergangenheit steht nicht still; ihr Bild verändert sich. Auch unsere Kenntnis von der Geschichte der Wissenschaften und des philosophischen Denkens bleibt, wenn es recht zugeht, im Fluss.
Das Buch, das ich dank des stetigen Interesses meiner Leser zum zweiten Mal erweitert und verbessert vorlegen kann, folgt seit Jahrzehnten dem Wandel der Auffassungen und dem Gang der Forschung, soweit dies einem Einzelnen möglich ist. Es verstand sich von Anfang an als Gegenentwurf zur starren Vorstellung einer einheitlichen Scholastik, und Assistenten an Konkordatslehrstühlen taten etwas für ihre Karriere, indem sie es dafür heftig tadelten. Es zeigte Vielfalt und analysierte Konflikte. Es hob die Divergenzen der Weltsichten hervor; es widersetzte sich der konventionellen Zurechtlegung, die nur von den ›großen‹ Philosophen zu sprechen vorgab. Es würdigte Außenseiter wie Berengar, Lull oder Nikolaus von Autrecourt. In dem Vierteljahrhundert, das seit dem Ersterscheinen verflossen ist, wurde die Forschung reicher und bewegter. Neue Themen, neue Texte tauchten auf: Differenzen zwischen Laien und Professionellen wurden thematisiert; die Rolle von Institutionen und der Zensur trat scharf hervor; Nachbardisziplinen traten ins Blickfeld, nicht nur Theologie, sondern auch Medizin und Mathematik, und selbst, auf den Spuren von Aby Warburg, ›Magie‹, Alchemie und Astronomie/Astrologie, sogar Baukunst und Dichtung. Vernachlässigte Themen drängten vor: Sterne und Träume, Fürstenspiegel und Regenbogen, das Bild und das Sehen, Impetus und Inquisition, Geschlechterrolle und Emotion, der Einfluss von Medien und literarischen Formen. Einzelne Autoren bekamen ihre individuelle Denkentwicklung zurück, andere wurden von der einheitsscholastischen Zwangsjacke befreit, in die man sie zu stecken versucht hatte; heute macht niemand mehr Meister Eckhart oder Dante zum Thomisten.
2. Das Bild ist freier und vielfältiger geworden. Das legte nahe, eine Mehrzahl von Spezialisten mit kleinen Überblicksartikeln zu beauftragen und so einen Gesamtüberblick zu geben. Ich tadle solche Unternehmen nicht, denn ich profitiere von ihnen, z. B. von den umfangreichen Enzyklopädien von Robert Pasnau (Cambridge 2010) und Henrik Lagerlund (Dordrecht 2011), aber ich ahme sie auch nicht nach. Ich bleibe bei meiner Intention: ein quellennahes Lesebuch zum Nachdenken über das philosophische Denken zu schreiben, kein Handbuch im Lexikonstil, ohne das Idol der Vollständigkeit, das selbst die großen neuen Nachschlagewerke nicht erreichen. Es sollte bei einem einzigen Band bleiben. Dies begrenzte die Möglichkeit umfassender Neuaufnahmen. Immerhin habe ich die philosophische Entwicklung der Jahrzehnte von 1250 bis 1380 neu gestaltet. Um einen lebendigen Eindruck von Forschungsarbeiten über diese Zeit zu geben, habe ich zwei Forscher, die daran maßgeblichen Anteil haben, gebeten, ihre Autoren im Stil dieses Buches vorzustellen, und zwar Durandus von St. Porcain und Buridan. Daher schreibt Fiorella Retucci über den von ihr edierten Antithomisten und Dominikaner Durandus, Olaf Pluta über Buridanus, den wohl einflussreichsten Philosophen des 14. Jahrhunderts. Das Bild dieser Zeit wird so reicher und konkreter. Die betreffenden Kapitel wurden mit mir abgestimmt und sind ganz das Werk der beiden Verfasser.
3. Sollte ich nicht auch andere Autoren ähnlich neu einführen? Ich habe es oft überlegt, aber dann doch nicht getan; es hätte zu viel Raum gekostet und hätte die Struktur des Buches zerstört. Ich glaube, auch Weglassen ist eine Kunst. Es ist mir besonders schwergefallen, wenn es sich um Philosophen handelte, mit denen ich mich jahrelang befasst hatte. Ich habe mich entschieden, sie lieber an anderer Stelle getrennt, textnahe und mit narrativer Ruhe zu behandeln. Dies geschah mit Julian von Eclanum, dem Kontrahenten Augustins, in meinem Buch Kampfplätze der Philosophie. Große Kontroversen von Augustin bis Voltaire, Frankfurt a. M. 2008, S. 11–41, mit Averroes und Albert dem Großen in Meister Eckhart. Die Geburt der ›Deutschen Mystik‹ aus dem Geist der arabischen Philosophie, München 2007, mit Thomas von Aquino, Heinrich von Gent, Gottfried von Fontaines und Aegidius Romanus in dem umfassenden Panorama über Dietrich von Freiberg. Philosophie, Theologie und Naturforschung um 1300, Frankfurt a. M. 2007, mit dem soeben erstmals vollständig kritisch edierten Gesamtwerk Meister Eckharts in dem Buch Meister Eckhart – Philosoph des Christentums, München 2010, und insbesondere mit Dante in der Einladung, Dante zu lesen, Frankfurt a. M. 2011, mit Cusanus und seinen Quellen in Nikolaus von Kues. Geschichte einer Entwicklung, Frankfurt a. M. 1998.
Einen kleinen, neu edierten Text behandelt mein Buch Was ist Gott? Das Buch der 24 Philosophen, München 2010.
Der Ertrag dieser Studien ließ sich nur andeutungsweise ins vorliegende Buch integrieren. Die Bibliographie habe ich auf den neuesten Stand gebracht. So hoffe ich denn, dass dieses Werk auch in Zukunft als Lese- und Arbeitsbuch dienlich bleibt.
4. Es bleibt die angenehme Aufgabe, Freunden für Unterstützung zu danken. Besonders verbunden bin ich Frau Fiorella Retucci und Herrn Olaf Pluta für die sachkundige und präzise Kooperation. Fiorella Retucci hat wertvolle Beiträge zur Erneuerung der Bibliographie geleistet. Wie immer stand mir Ruedi Imbach (Paris) zur Seite. Er hat mir zahlreiche gute Ratschläge gegeben und insbesondere das Kapitel über Petrarca gefördert. Ihnen allen sei herzlich gedankt.
Mainz, den 12. März 2012
Kurt Flasch
Einleitung
1. Die Philosophie des Mittelalters war der Versuch Einzelner und ganzer Gruppen, sich in ihrem Leben denkend zu orientieren. Sie wollten wissen, ob die Bilderverehrung vernünftig ist oder wie die Pest entsteht. Dabei verwickelten sie sich in allgemeinere Fragen, denn sie mussten z. B. entscheiden, ob es ein zulässiges Argument war, wenn ein Erzbischof die Bilderverehrung damit begründen wollte, sein Archidiakon sei in einem Traum dazu aufgefordert worden. Oft hatten sie einfache Ausgangsfragen: War die Monarchie besser als die Volksherrschaft? Sollten möglichst alle wie die Mönche leben? War jeder Handel und jeder Kriegsdienst Sünde? Aber diese Fragen verwandelten sich in komplexe Theorien, denn die mittelalterliche Zivilisation begann unter primitiven Bedingungen und war auf antike Muster angewiesen, auch in ihren Wissensformen. Gewiss besaßen die Experten die Bibel. Sie lasen sie in jeder Einzelheit unterschiedslos als Wort Gottes, auch das Alte Testament. Dabei stießen sie auf Differenzen und Widersprüche, die wir heute historisch, aus der jahrhundertelangen Entstehung dieser Bücher, erklären. Sie sahen darin zeitlose Wahrheit und erklärten die Unebenheiten »logisch«, das heißt: nach den Regeln der spätantiken Dialektik. Da sie voraussetzten, die Heilige Schrift enthalte alle Wahrheit, legten sie hinein, was sie brauchten, und bedienten sich dabei wiederum spätantiker Auslegungskünste. Dadurch wurde der einfache Ausgangspunkt vielfach überlagert. Die Auslegungen und die Dispute wurden kompliziert und wirken auf den heutigen Leser abstrakt – eine verständliche Begleiterscheinung einer sekundären Zivilisation.
Auch die Erörterung scheinbar rein theoretischer Fragen stand in praktisch-politischen Zusammenhängen. Versuchte ein Autor des lateinischen Westens, die Wahrheit des Christentums mit philosophischen Argumenten zu beweisen, dann versicherte er damit den lateinischen Christen, sie seien im Besitz einer überlegenen Wahrheit und daher eines legitimen Anspruchs auf Macht und Expansion. Dies wiederum hatte Folgen für die Stellung des Klerus in der Gesellschaft. Disputierten sie z. B. darüber, ob alle menschliche Erkenntnis mit den Sinnen beginne, so verknüpfte sich diese Diskussion mit der ethisch-politischen Frage, ob die Bücher der heidnisch-griechischen, der arabischen oder auch der byzantinischen Gelehrten denen des christlichen Westens vorzuziehen seien. Konnte es sein, dass die heidnischen und die islamischen Denker der Wahrheit nähergekommen waren als die Väter der Kirche? So blieben Debatten über das abstrakt klingende Thema des Ursprungs der menschlichen Erkenntnis keine akademisch-erkenntnistheoretischen Diskussionen. Als seit dem 12. Jahrhundert die Autorität der sichtbaren Kirche und ihre Forderung nach Gehorsam und Zehntzahlung mehr und mehr in Zweifel gezogen wurden, verteidigte sie die sichtbare Gnadenvermittlung mit dem Argument, alle menschliche Erkenntnis fange mit den Sinnen an.
Die »scholastisch« und »überzeitlich« anmutende Frage hatte also ihren präzisen »Sitz im Leben«. Ihn gilt es wieder zu sehen. Denn nicht »Ideen« oder »Probleme« standen am Anfang, sondern Menschen, die für die Konflikte ihrer Zeit Antworten suchten. Oft haben gesellschaftliche und politische Gruppen sich erst konsolidiert, indem sie sich theoretische Positionen als Zugehörigkeitsmerkmale schufen. Das gilt insbesondere für die religiösen Orden des Spätmittelalters; sie suchten ihre Identität nach Innen und ihre Schlagkraft nach Außen zu sichern, indem sie eine Hausphilosophie vorschrieben. In diesen Fällen ist es skurril, wenn moderne Philosophiehistoriker nach dem rein theoretischen Gehalt dieser Positionen fahnden.
Dies ist oft genug vorgekommen. Philosophen (vor allem deutsche) haben zu lange »Ideen« hypostasiert und »Probleme« zu selbständigen Trägern der Geschichte erhoben. Der vorliegende Text ist ein Versuch, sich von ihnen durch eine andere Forschungspraxis und Darstellungsweise zu distanzieren. Schlagworte wie »Nominalismus« oder »Realismus«, »Aristotelismus« oder »Platonismus« erfassen nicht das geschichtliche Leben der Philosophie im Mittelalter. Das Denken dieser Epoche bestand nicht primär im Ringen dieser Richtungen miteinander. Das Verstehen ihrer Werke besteht nicht darin, ihnen vorab bereitliegende Parteinamen als Etiketten aufzukleben. Ich möchte nicht darauf verzichten, einzelne Argumente als »platonisch« oder »aristotelisch« zu charakterisieren. Aber dies tue ich nur behelfsweise und in einleitender Analyse, um dann eine Philosophie als Antwort auf eine geschichtliche Situation zu lesen, als eine Antwort, die ihrerseits die Situation mitbestimmte und Strukturen für die Folgezeit schuf. Eine »Ableitung« von Philosophien aus gegebenen geschichtlichen Umständen scheint mir ebenso unmöglich wie ihre Abtrennung vom historischen Kontext. Diese Abtrennung hat in der deutschen geisteswissenschaftlichen Tradition, aber auch bei gelernten Neuscholastikern und im Restaurationsdenken der Nachkriegszeit einseitig dominiert. Es wäre reizvoll, die entgegengesetzte Perspektive stark zu machen. Doch damit wäre eine neue Einseitigkeit geschaffen, während es darum geht, mit der vulgäridealistischen Hochstilisierung des »mittelalterlichen Geisteslebens« zu brechen und zugleich die Rückwirkung des Denkens auf die Realverhältnisse des Mittelalters zu suchen. Mit dieser Interessenrichtung stehe ich nicht allein; ich verweise auf einen Meister des Faches wie R. W. Southern, Scholastic Humanism and the Unification of Europe, Bd. 1, Oxford 1995.
2. Allerdings setzen heute immer noch viele Erforscher des mittelalterlichen Denkens die Abgetrenntheit der philosophischen Probleme stillschweigend voraus. Ein feinsinniger Gelehrter wie Clemens Baeumker hatte sie 1909 noch als eine Voraussetzung deklariert, die einer Begründung bedürfe; nur war seine Begründung falsch. Er schrieb: »Wenn wir von der mittelalterlichen Weltanschauung reden, so sehen wir hier ganz davon ab, zu untersuchen, wie das mittelalterliche Leben in seinen Gesinnungen und Motiven, in seinen Bestrebungen und Zuständen sich tatsächlich gestaltete. An dieser Stelle halten wir uns allein an das, was die führenden Geister, und zwar diese, soweit sie zugleich als philosophische Denker auftreten, als ideale Forderung aufstellen und durch ihre wissenschaftliche Spekulation zu begründen trachten« (Sperrungen im Original).1
Dass diese Vorentscheidung problematisch ist, liegt auf der Hand: Eine lebendige Philosophie erschöpft sich nicht darin, »wissenschaftliche Spekulation« oder »ideale Forderung« zu sein. Als »ideale Forderung« verliert sie das Salz, wenn sie sich nicht auf das tatsächliche Leben bezieht. Dies übersah Baeumker, als er die Ausschließung des tatsächlichen mittelalterlichen Lebens zum Programm erhob für die geschichtliche Darstellung der mittelalterlichen Philosophie.
Er hätte, meine ich, unterscheiden sollen zwischen einer philosophiehistorischen Spezialuntersuchung und einer historischen Gesamtdarstellung. Wenn ich untersuche, was Siger von Brabant zur aristotelischen Definition der Zeit gesagt hat, dann klammere auch ich sozial- und kulturgeschichtliche Hintergründe methodisch aus. Will ich hingegen – wie im vorliegenden Buch – die Geschichte des mittelalterlichen Denkens schreiben, muss vom Ottonischen Imperium, vom Programm päpstlicher Weltherrschaft, aber auch von Landwirtschaft und Städtebildung die Rede sein, nicht um von ihnen irgendetwas abzuleiten, sondern um bestehende Zusammenhänge zu zeigen. Für die Geschichtsschreibung gelten andere Regeln als für die Detailstudie.
Andererseits: Wenn Individuen, nicht Ideen, der Ausgangspunkt geschichtlichen Wissens sind, so ist das Verhältnis von Denkinhalt und Individualität doch problematisch bis zur Paradoxie. Wenn gedacht wird, gehört das Gedachte nicht nur einem Individuum an. Ferner agieren und theoretisieren Individuen unter geschichtlichen Rahmenbedingungen. Von diesen gilt, was Hermes Trismegistus von den Sternen sagte: Sie drängen, aber sie zwingen nicht. Sie bilden unvermeidliche Dispositionen; sie ermöglichen und begrenzen das Sagbare, aber sie determinieren nichts. Von ihnen, nicht von »Leben und Werk« der Individuen, muss die Darstellung der mittelalterlichen Philosophie ausgehen. Dann aber vertieft sie sich in individuelle Konstellationen, einschließlich der Biographien, um schließlich konkret der Bewegung individueller Denker zu Ansprüchen von höchster Allgemeinheit mitdenkend zu folgen. Wer hier von Determinismus, Soziologismus oder Reduktionismus spricht, beweist nur, dass er nicht imstande ist, Wechselwirkung zu denken, da ihm alles entweder Substanz oder Akzidens, entweder Basis oder Überbau ist. Diese klötzchenhaften Wirklichkeitsauffassungen verfehlten das geschichtliche Leben, sowohl in ihrer schularistotelischen wie in ihrer vulgärmarxistischen Form. Beide Schemata behinderten das historische Denken und waren theoretisch unhaltbar.
3. Es geht nicht darum, die Philosophie des Mittelalters in ihrem sachlichen Gehalt zu rechtfertigen, sondern ihren sachlichen Gehalt im geschichtlichen Kontext zu sehen und damit unseren Begriff des »sachlichen Gehalts« und der »Rechtfertigung« zu problematisieren. Es ist unbeholfene Apologetik, von einem mittelalterlichen Theorem beweisen zu wollen, es sei »aktuell« und habe »uns heute noch etwas zu sagen«. So mögen moderne Prediger reden, nicht Philosophen. Daher verschwende ich keine Energie darauf, im Gewesenen »bleibende Kerne« zu ermitteln oder von mittelalterlichen Doktrinen zu behaupten, sie seien späteren Systembildungen gleichwertig oder gar überlegen. Dies hieße, dem Jahrmarkt der Meinungen zu viel Respekt zu erweisen. Damit verliert die historische Erforschung der mittelalterlichen Philosophie aber keineswegs ihre inhaltliche Relevanz. Nur suche ich diese Relevanz nicht metahistorisch in direkten Kontinuitätselementen, sondern in der Analyse der Entstehungs-, Erhaltungs- und Untergangsbedingungen der Theoriebildungen einer Epoche. Das Studium dieser Verflechtungen einer geschichtlichen Welt mit den höchsten Ansprüchen menschlicher Theorie kann, denke ich, nicht ohne Rückwirkung auf unseren Begriff von Theorie überhaupt bleiben. Die mittelalterliche Philosophie war, einer antiken Einteilung folgend, primär Logik, Physik und Ethik, aber sie war auch in diesen Disziplinen Metaphysik. Ihre historische Untersuchung macht die Zusammenhänge dieser Metaphysik mit den Formen menschlicher Herrschaft über die Natur und über Menschen sichtbar. Sie illustriert somit konkret das Konzept dieser Metaphysik, die für die neuzeitliche Metaphysik und Metaphysikkritik grundlegend wurde. Nicht indem wir die Denkoperationen der mittelalterlichen Metaphysiker in der Gegenwart fortzusetzen versuchen, sondern indem wir deren Fortgang historisierend unterbrechen, stellen wir uns der sachlichen Relevanz ihrer Argumente.
Auch die quellennahe, selbst die »positivistisch« gehaltene Untersuchung hat für die Relevanz kein anderes Kriterium als ein gegenwärtiges. Auch wenn wir direktes Aktualisieren vermeiden wollen, hängen wir ab von gegenwärtigen Beurteilungskriterien. So entspringt das Interesse an der historisch-gesellschaftlichen Funktion des mittelalterlichen Denkens einem gegenwärtigen Problembewusstsein. Dies gilt auch, wenn wir die Rolle der Sprache oder die philosophische Beurteilung der Logik als Problem thematisieren. Ich möchte an Elementen der mittelalterlichen Philosophie zeigen, dass sie das Wissen einer Welt war, in der es Kaiser und Könige, Feudalherren und Bauern, weltbeherrschende Päpste und religiöse Bettelbewegungen gab. Dies heißt natürlich nicht, das philosophische Denken habe diese Welt abgebildet.
»Hierarchie« war ein betont mittelalterliches, explizit metaphysisches Konzept. Dies lässt sich seit der Krise der Hierarchievorstellung konkreter beschreiben als vorher. Das Bewusstsein, philosophische Bezugspunkte in der Gegenwart zu haben, verhindert nicht notwendigerweise, sondern befördert möglicherweise die historische Untersuchung. Das Ziel solcher Recherchen ist die philosophische Explikation der historischen Erfahrung des Abstands.
4. Das Wort »Mittelalter« war ein polemischer Einfall eines Humanisten. Es sollte eine fremdartige Zwischenzeit von etwa 1000 Jahren bezeichnen. Das Wort stellt künstlich eine Einheit her, die nie existiert hat. Man vergegenwärtige sich, dass dazu die »Weisheit« der jüdischen Gelehrten des 11. Jahrhunderts ebenso gehört wie die philosophischen Überzeugungen des Erasmus von Rotterdam. Zwischen der für die Ausbildung der königlichen Beamten errichteten Universität Neapel und dem Generalstudium der Dominikaner in Köln bestanden Unterschiede, die in unserer Rückschau zu rasch zusammenfließen. Zwar war die Lebensdeutung der Menschen zwischen 500 und 1500 in Europa relativ einheitlicher als im 20. Jahrhundert. Aber die Erfahrung der intellektuellen Zerrissenheit der Gegenwart erzeugte im 19. und 20. Jahrhundert eine harmonisierende Tendenz, die das Denken des Mittelalters ungebührlich vereinheitlichte. Gegenüber dieser Uniformierungstendenz gilt es geschichtlich zu verfahren, d. h. die Vielfalt zu belassen und die Mannigfaltigkeit innerhalb der gemeinsamen Strukturen zu sehen.
Die Erforschung eines so großen Zeitraums wie des Mittelalters erfordert einen ständigen Wechsel der Sehweise. Es ist wie bei der Erkundung einer großen alten Stadt, etwa Venedigs. Aus der Ferne erscheint sie einem einheitlichen Stilwillen entsprungen. Prägnant hebt sie sich von anderen italienischen Städten ab; ihre Charakterzüge sind unverwechselbar. Begibt man sich aber in das Gewirr der Straßen, Häuser und Kanäle, stößt man auf die Unterschiede der Quartiere, der sozialen Gruppen und auf die nicht reduzierbare Vielheit der einzelnen Menschen. So zeigt auch die Philosophie des Mittelalters für den entfernteren Betrachter einheitliche Charaktere, die sich bei näherer Betrachtung auflösen und die dennoch keine reine Fata Morgana sind, wenn auch an ihnen nostalgische Bedürfnisse nachweisbar mitzeichnen. Die Erkenntnis der Philosophie des Mittelalters beginnt dann, wenn man die distanzierte Betrachtung aus dem historischen Abstand verbindet mit der Versenkung in ausgewählte exemplarische Einzelheiten. Sie muss die allgemeinen Lebensbedingungen, die umfassenden geschichtlichen Grundlagen, die markantesten Stadien der Entwicklung sowie die wichtigsten Resultate der Philosophie des Mittelalters ermitteln. Sie muss Einsicht verschaffen in die Lebensfunktion der mittelalterlichen Theorien. Sie muss die Entstehung der modernen Welt aus ihrem spätmittelalterlichen Ursprung vor Augen stellen. Dies möchte ich versuchen, ohne in generalisierende Schemata zu fallen. Dabei beziehe ich das Wort »Mittelalter« geographisch auf den lateinischen Westen. Aber dieses Gebiet verdankte der jüdischen und der islamischen Welt Wesentliches, ebenso der Beziehung zu Byzanz. Eine prestigereiche und auch von mir dankbar benutzte Bibliotheksgeschichte schiebt die arabische Zivilisation ab mit der Erklärung: »Die islamische Welt ist etwas Neues und dem Abendlande ihrem Wesen nach fremd.«2
Da ich einem so unbedachten Gebrauch des Wortes »Wesen« und der abendländlerischen Abwehr des arabischen Einflusses nicht zustimmen konnte, musste ich in Kauf nehmen, auch von der arabischen Welt zu sprechen, wenn auch, zugegeben, aus zweiter Hand schöpfend.
5. Historische Erkenntnis hängt immer auch ab von dem Betrachter, der sie vollzieht. Daher ist es nützlich, wenn der Verfasser in der Einleitung seinen subjektiven Ausgangspunkt scharf markiert. Ich möchte drei kurze Thesen formulieren, die ich anderswo3 ausführlich begründet habe:
Erstens: Ich stelle die Philosophie des Mittelalters nicht mit der Absicht vor, mein Leser sollte in ihr seine intellektuelle Heimat finden. Auch die heftigste Kritik an der Gegenwart reicht nicht aus, einen solchen Fluchtversuch zu begründen. Gerade indem wir uns ein Rückkehren versagen, gewinnt das Mittelalter an historischem und zugleich an philosophischem Interesse. Für die intellektuelle Orientierung in der Gegenwart könnte es sich als nützlich erweisen, die Funktion der Philosophie in einem untergegangenen, aber fortwirkenden Zeitraum zu analysieren. Im Anschluss wird man das Verhältnis von Theorie, Natur und Gesellschaft anders sehen können. Probleme der Metaphysik und der Religionsphilosophie treten in ein neues Licht, wenn man die mittelalterliche Welt kennt, der sie entsprachen. Dabei kommt es darauf an, die vermeintlich einheitliche »mittelalterliche Welt« nach Regionen, nach Zeitabschnitten und literarischem Kontext zu differenzieren. Nur dadurch könnte es gelingen, etwa Hildegard von Bingen oder Meister Eckhart vor Zudringlichkeiten und Verwertungsabsichten zu bewahren.
Zweitens: Zionswächter rufen mir regelmäßig zu, die mittelalterlichen Autoren seien Theologen gewesen und ich, sagen sie, würde ihnen Gewalt antun, indem ich sie als Philosophen behandle. Es stört sie in ihrem frommen Eifer nicht, dass ich eingehend nachgewiesen habe, dass zum Beispiel Nikolaus von Kues unter »Theologie« eine philosophische Operation angebbaren Typs, nämlich eine platonisierende Ideentheorie verstanden hat. So sehr sind sie von der Immergültigkeit ihrer Haustheologie überzeugt, dass sie übersehen, dass Boethius und eine mächtige mittelalterliche Tradition die theologia der obersten, abstraktesten Erkenntnisstufe zugeordnet haben. Diese ältere Art von theologia hat nichts mit Hören, nichts mit Gehorchen und Erinnern zu tun; sie ist der denkende Aufstieg zur Welt der reinen Formen, also philosophische Ideenlehre.
Außerdem ist hier eine Unterscheidung nötig: Ich bestreite nirgends den jüdischen, den muslimischen oder christlichen Glauben meiner Autoren. Die Frage ist nur, wie sie argumentiert haben. Ein frommer Mathematiker kann sehr wohl beten, bevor er seine Rechnungen beginnt; er kann uns versichern, er rechne zur Ehre Gottes, der rechnend die Welt begründet habe; wir werden dieses Glaubensbekenntnis respektvoll zur Kenntnis nehmen, aber seine Ergebnisse mathematisch und nicht etwa theologisch überprüfen. In einer vergleichbaren Lage ist der Historiker der mittelalterlichen Philosophie. Die Autoren, von denen er zu sprechen hat, haben vielfach ihr Denken als die Anwendung einer philosophischen Theorie auf die Daten ihres jüdischen, muslimischen oder christlichen Glaubens verstanden; ich lese sie dann als Religionsphilosophen, nicht im Sinne einer neuscholastischen oder lutherischen Theologie. Wenn sie sich »Theologen« nannten, dann ungefähr in dem Sinne, in dem Paul Tillich sich als Theologen verstand. Die anderen heutigen Theologiebegriffe wähnen sich zeitlos, sind aber vom Mittelalter sachlich wie zeitlich viel weiter entfernt als mein beweglicher, für religionsphilosophische Themen (wie Erschaffung, Trinität und Inkarnation) durchaus offener Philosophiebegriff.
Die späteren Trennungen von Theorie und Praxis, von »Scholastik« und »Mystik«, von »Philosophie«, »Theologie« und »Naturwissenschaft« lege ich dem Mittelalter nicht an. Die Trennung dieser Disziplinen ging erst aus der spätmittelalterlichen Entwicklung hervor; sie darf nicht als mittelalterliche Voraussetzung unterstellt werden.
Drittens: Zwar gab sich die mittelalterliche Philosophie vielfach als reine Theorie. Doch war sie es nach dem Bewusstsein ihrer Urheber weniger, als dies in den modernen Darstellungen der mittelalterlichen Philosophie zum Ausdruck kommt, welche die Probleme der praktischen Vernunft nicht selten vernachlässigen. Dagegen habe ich mir vorgenommen, auch die Wertungen zu beachten, die in mittelalterlichen Theoriebildungen zum Ausdruck kommen.
6. Es kam mir darauf an zu zeigen, dass die Philosophie des Mittelalters eine wirkliche Geschichte hat. Verbal wird das jeder zugestehen. Ich wollte versuchen, diese Einsicht zu realisieren. Sie bedeutet, dass die mittelalterliche Philosophie eine ähnliche Entfaltungsbreite zeigt wie die Kunst dieser Zeit: Zwischen einer merowingischen Fibel, der Architektur von St. Michael in Hildesheim und Masaccios Fresken von 1422 liegen jeweils Welten. Solcherart Unterschiede wollte ich für die intellektuelle Entwicklung herausarbeiten. Keine spätere Stufe galt mir als das normative Ziel einer früheren. Es ging mir darum, Entwicklung sichtbar zu machen. Aber ich verstehe »Entwicklung« nicht länger als pflanzenartiges Wachstum auf eine ideale Gestalt hin, sondern als geschichtlichen Prozess, in dem offene Situationen in Konflikten entschieden werden und in dem die Vielfalt individueller Sichtweisen bis zuletzt ihr Recht behauptet.
Die Metaphern von »Hoch«- und »Spät«-Scholastik habe ich mir daher versagt. Von »Blüte« und »Verfall« ist nicht die Rede. Dagegen wollte ich zeigen: Nach 1050 kam es zu einer relativ kontinuierlichen Entwicklung; sie erreichte an bestimmten historischen Knotenpunkten eine besondere Dichte, so zwischen 1050 und 1130 und wiederum zwischen 1277 und 1350. Dieser letzte Zeitabschnitt, weit davon entfernt, eine Epoche des bloßen Zerfalls zu sein, erweist sich als der Ursprung entscheidender Alternativen des frühneuzeitlichen Denkens. Da es bei der Geschichte des mittelalterlichen Denkens auch um die Genesis der modernen Welt geht, galt meine besondere Aufmerksamkeit dem 14. und 15. Jahrhundert.
7. Das Wort »Mittelalter« ist eine Konvention. Es bezeichnet ein Arbeitsfeld, mehr schlecht als recht. Zu seinen Nachteilen zählt, dass selbst manche Fachleute es als einen Begriff behandeln, aus dem sich mangels empirisch-historischer Daten Erkenntnisse gewinnen lassen. Ich lade den Leser ein, bei sich selbst die Probe zu machen, ob er zu diesem Fehler neigt. Er stelle sich vor, er finde auf meinem Arbeitstisch ein mittelalterliches Buch über den Regenbogen. Nehmen wir an, von diesem Traktat seien etwa 20 Manuskriptseiten verlorengegangen. Neigt er zu der Annahme, in den verlorenen Partien habe der Verfasser – ein Mönch der Zeit um 1300 – vom Regenbogen als dem Zeichen der Versöhnung zwischen Gott und den Menschen gesprochen? Wenn ja, ist er in die Falle gegangen, die das Wort »Mittelalter« ihm stellt. Denn der Text ist vollständig erhalten, er stammt tatsächlich aus der Zeit kurz nach 1300 und spricht mit keinem Satz von der religiös-symbolischen Deutung des Regenbogens; er behandelt das Problem seiner Entstehung streng optisch. Er analysiert das Phänomen, ausgehend von der Bewegung des Lichtstrahls im einzelnen Wassertropfen. Dieses unterkühlte Absehen von Offenbarung, Seelenheil und Symbolik gab es im Mittelalter de facto, aber es passt nicht recht in die Phantasiebilder, die das Wort »mittelalterlich« suggeriert.
Ich möchte ein zweites Beispiel bringen: Die Pestkatastrophe des Jahres 1348/49 bedeutete einen ungeheuren Einschnitt im mittelalterlichen Leben. Kann man sich vorstellen, dass ein mittelalterlicher Autor, ein Kleriker zumal, diese Schreckenszeit bis ins einzelne schildert, aber dabei vergisst, den christlichen Glauben als Trost im Leiden auch nur zu nennen? Kann man sich vorstellen, dass er vergisst zu erwähnen, dass dieses Leiden auch von Gott kommt? Viele Menschen, selbst brave Fachleute, verneinen die Frage. Aber auch sie sind in die Mittelalter-Falle gegangen. Denn Boccaccio schildert um 1350 die Pest bis in alle grausamen Einzelheiten; er erwähnt auch religiöse Zeremonien und Gebete, aber er erwähnt sie als Leerlauf, der so wenig zu etwas führte wie die hilflosen Aktionen der Ärzte. Boccaccio versichert gar, er wisse nicht, ob die Pest dem Zorn Gottes oder der Ungunst der Sterne entsprungen sei; er erwähnt die astrologische Deutung gleichberechtigt neben der theologischen.
Die radikal-optische Deutung des Regenbogens bei Dietrich von Freiberg und die theologisch neutrale Schilderung der größten Katastrophe des 14. Jahrhunderts warnen davor, aus dem Wort »mittelalterlich« irgendetwas zu folgern. Die Sache wird auch dann nicht besser, wenn man sagt, diese methodische Beschränkung bei Dietrich und die skeptische Bemerkung Boccaccios seien »moderne« Züge in mittelalterlichen Schriften. Denn das Wort »modern«, samt den Substantiven »die Moderne«, »Post«- und »Prämoderne«, hat denselben Behelfscharakter wie die Vokabel »mittelalterlich«: Es dient zur vorläufigen Markierung, es erspart fürs erste umständliche Chronologien, aber es bietet keine sachhaltige Erkenntnis. Martin Luther, bekanntlich ein Schriftsteller des 16. Jahrhunderts, war sehr viel »mittelalterlicher« als Boccaccio. Das heißt: Unsere Epochenbezeichnungen, die gewiss irgendwann reale Erfahrungen des Andersseins aussprachen, können für uns nur den Charakter äußerlicher Einteilung haben, sie erwecken aber, besonders in ihrer adjektivischen Verwendung, den Anschein inhaltlicher Bestimmtheit. Sie hemmen die konkrete Forschung, und sie ermöglichen Scheindiskussionen etwa über den religiösen Charakter der Renaissance. Ich habe meine Darstellung des mittelalterlichen Denkens nicht mit Ockham oder Cusanus beendet; ich habe im einzelnen gezeigt, dass im 15. Jahrhundert wirklich Entscheidendes geschehen ist, dessen Neuheit ich nicht bestreiten kann und nicht bestreiten will, wenn ich auf den verbalen Gegensatz von »Mittelalter« und »Renaissance« nicht erst eingehe.
Im Ober- und Mittelitalien des 15. Jahrhunderts ist qualitativ Neues entstanden, überdies hat die Erfindung des Buchdrucks das Lesen und Lernen, aber auch das Selbstverständnis der Lesenden und die Ausübung von Macht verändert; aber zwischen 1080 und 1150 fand ein vergleichbarer Umbruch statt, den ich allerdings nicht als »Renaissance« bezeichnen möchte, um dieses ohnehin verbrauchte Wort nicht noch mehr durch Ausweitung zu schwächen. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts zeichnete die neue Physik (Galileis und Descartes’) einen entscheidenden Trennungsstrich zum Mittelalter; das Ende dieses Jahrhunderts brachte die intensive Neuentwicklung der durch Lorenzo Valla, Machiavelli und Erasmus begründeten historischen Forschung – bei Pierre Bayle, Jean LeClerc, Richard Simon, Antonio Ludovico Muratori, bei Vico und Voltaire. Die historische Objektivierung vermehrte die Kenntnis der vorausliegenden Zeit, aber schuf auch Abstand zu ihr, den dann die Industrialisierung und die Französische Revolution weltgeschichtlich markierten.
Im Bewusstsein dieser Distanz schreibe ich die Geschichte des philosophischen Denkens von Augustin bis Machiavelli.
Erster Teil
Grundlegung
der mittelalterlichen Philosophie
1. Die geschichtliche Situation
Das Mittelalter war kein radikaler Neubeginn; es hat sich von Anfang an auf antike Formen bezogen. Es war zunächst die christliche Spätantike, die ihm Lebensmuster und Auslegungsformen gab. Was sich anbot, waren vor allem die Werke Augustins, sodann die Schriften des Boethius und des Dionysius Areopagita. Um die philosophische Entwicklung des Mittelalters zu verstehen, muss man herausfinden, was in diesen Texten philosophisch erreicht war, denn sie bildeten den geschichtlichen Ausgangspunkt für Bemühungen, die über das Kompilationsstadium hinausführen.
Nun lässt sich für die vorliegende Einleitung das Denken Augustins, des Boethius und des Dionysius nicht in der wünschenswerten Ausführlichkeit darstellen. Ich beschränke mich auf eine grobe Charakterisierung ihrer gedanklichen Welt und ihrer geschichtlichen Stellung. Sie stammten alle aus der Zeit zwischen dem Ende des 4. und dem Anfang des 6. Jahrhunderts. Durch ihre charakteristische Verschiedenheit schufen diese drei Autoren eine legitimierte, christlich-philosophische Verschiedenheit. Alle drei schrieben innerhalb des Rahmens, den die wirtschaftliche, die soziale und die politische Entwicklung der Spätantike geschaffen hatte. Die philosophischen Konzepte und die Werttafeln der Antike waren für sie noch erreichbar; aber sie waren durch die dogmengeschichtliche und die religionspolitische Entwicklung in Frage gestellt.
Der einheitliche Kulturraum der Mittelmeerwelt begann zu zerbrechen: Konstantin hatte seit 324 seinen Sitz in das von ihm gegründete Konstantinopel verlegt. Er hatte damit eine Entwicklung bestätigt und beschleunigt, welche die östliche und die westliche Reichshälfte zunehmend trennte. Besonders seit dem Ende des 4. Jahrhunderts, also gerade seit dem Beginn des uns interessierenden Zeitraums, vertiefte sich die politische und die kulturelle Trennung: Es gab im Westen immer weniger Menschen, die griechische Bücher lesen konnten; auch Augustin hat dies nicht mehr getan. Damit riss die Verbindung zur klassisch-griechischen Wissenschaft und Philosophie ab; nur unter besonders günstigen Ausnahmebedingungen – wie bei Boethius – konnte sie noch einmal geknüpft werden. Aber die allgemeine Tendenz ging auf Trennung der Reichshälften: Im Osten blühten noch immer der Fernhandel und die Städte; der Abstand zwischen Reichen und Armen blieb immer noch fein abgestuft, während im Westen die soziale Polarisierung voranschritt. Hier hörten die Städte auf, für die Reichen attraktiv zu sein. Die Besitzenden flohen aufs Land, arrondierten ihren Grundbesitz und erhielten, da die zentrale Verwaltung immer schwächer wurde, hoheitliche Rechte: Jurisdiktion, Steuereintreibung und Verteidigung fielen mehr und mehr in die Zuständigkeit regionaler und lokaler Instanzen. Die Folge war die einsetzende Verländlichung der spätantiken Zivilisation; das Feudalzeitalter bereitete sich vor. Gleichzeitig sanken die Einnahmen aus der Landwirtschaft; die Sklavenhaltung wurde teurer; die Anbaufläche ging zurück. Um seinen aufgeblähten Beamtenapparat und die steigenden Militärlasten zu finanzieren, musste der spätantike Staat bei zunehmendem Produktionsschwund der Wirtschaft mit ruinösem Steuerdruck reagieren. Eine Reglementierung und Bürokratisierung des gesamten Lebens war die Folge. Die rhetorisch herausgehobene absolute Macht des Kaisers setzte sich immer weniger effektiv durch. Die Menschen der unteren Schichten identifizierten sich immer weniger mit diesem Staat, den ein Althistoriker wie Matthias Gelzer einen »Zuchthausstaat« genannt hat – wegen der Starrheit der Strukturen, der Zunahme des Zwangs und des Erlöschens privater Initiativen. Die handwerklichen Berufe wurden kastenartig organisiert. Man fürchtete die Abwanderung und machte handwerkliche Berufe erblich. Die individuelle Lebensgestaltung wurde zunehmend erschwert. Die öffentlichen Ämter waren mit derart hohen Abgaben belastet, dass niemand mehr sie freiwillig anstrebte; man musste sie ebenfalls erblich machen. Einen Ausstieg aus diesem starren System boten das Eremitentum, die Rhetorik und die klerikale Laufbahn. Die philosophische Idee der Selbstbestimmung und der in der eigenen Tätigkeit zu erreichenden Eudämonie konnte allenfalls in diesen Lebensformen einen Nachklang haben. Die Philosophie konnte dazu dienen, individuelle Resignation und Abstand vom gesellschaftlichen Betrieb auszudrücken; sie konnte weiterleben als klerikales Selbstverständnis oder als rhetorischer Dekor. Gegenüber der klassischen Tradition war dies eine Verkürzung; sie schnitt sowohl die Dimension der polisbezogenen Praxis wie die der dialektischen Entwicklung der Vernunftinhalte ab. Was als »vernünftig« galt, gerann zur dogmatischen Position. Dies galt für den Osten wie für den Westen. Nur trat in dem verarmten und unsicheren Westen das vernünftige Selbstbewusstsein in einen unaufhebbaren Gegensatz zum irrational erscheinenden Lauf der realen Geschichte. Sollten vernunftgemäßes und wahres Leben den Menschen überhaupt zu eigen werden, dann nur im Jenseits.
Die militärische Bedrohung, die den Westen mit seiner extrem langen Grenze empfindlicher traf als den Osten, führte täglich die Hinfälligkeit der Welt vor Augen. Der göttliche Glanz des Kaisers bot keinen realen Schutz mehr. Was nahe war, das waren die angestammten Bedrücker oder die barbarischen Unterdrücker. Zudem wirkten die militärischen Niederlagen auf die innenpolitische, die soziale und die ökonomische Position des Westens zurück. Eine Schlacht wie die spektakuläre Niederlage des Kaisers Gratian gegen die Goten (378) – Augustin war damals 24 Jahre alt – hatte vielfache Folgen: Der Steuerdruck nahm zu, aber da längst keine Kriegsgefangenen mehr auf den Sklavenmarkt kamen und die Handarbeit immer teurer wurde, sanken die Rentabilität des Grundbesitzes und damit die Staatseinnahmen. Die Bevölkerungszahl nahm ab. Die Germanenstämme, die wir uns nicht zu groß vorstellen dürfen – höchstens etwa 20 000 Kampffähige –, verwüsteten Städte und zerstörten Verkehrsverbindungen. Dies erschwerte den Handel und förderte die Dezentralisierung und somit die Machtbefugnisse der Großgrundbesitzer. Schon unter dem Druck der Rezession in der Landwirtschaft hatten sich gegen 400 – es sind die Jahre, in denen Augustin die Gnade über den freien Willen siegen ließ – freie Bauern in die Hand von Latifundienbesitzern begeben, um, von der Steuererpressung befreit, auf deren Gütern zu arbeiten: Sie tauschten Unabhängigkeit gegen ein wenig Sicherheit, individuelle Freiheit gegen die Gunst eines Mächtigen ein. Als die Eroberer plündernd durchs Land zogen, suchten die Bauern Schutz vor ihnen bei ihren Herren. Kolonen gerieten so in eine Situation, die der von Sklaven ähnlich war. Wo die Ausbeutung zu schroff und die Hoffnung auf eine Wende noch nicht ganz verschwunden war – in Afrika, Gallien und Spanien –, kam es zu Bauernaufständen. Diese internen Auseinandersetzungen wiederum beschleunigten den militärischen Zusammenbruch.1
Wenn in dieser Gesamtsituation das Denken überhaupt noch die Kraft hatte, den rein individuellen Ausstieg aus der allgemeinen Misere zu nehmen – den Weg der Wüstenväter – oder die Aufrechterhaltung einer brüchig gewordenen Kulturfassade – die Welt der Rhetorik – zu kritisieren, so musste es angesichts der allgegenwärtigen Unsicherheit dazu tendieren, Gewissheit, Wertfülle und richtiges Leben in eine jenseitige Welt bzw. in die Vorbereitung dafür zu verlegen. Wieweit sich diese Tendenz durchsetzte, wieweit sie in der Nachwirkung der antiken Philosophie und Wissenschaft noch aufzuhalten oder umzuformen war, dies muss für jeden Autor der christlichen Spätantike differenzierend untersucht werden.
2. Augustin
Die erste Konzeption des Christlichen (386–395)
Alle Schriften, die von AUGUSTIN († 430) erhalten sind, hat er nach seiner Taufe (Ostern 387) geschrieben. Aber die »Bekehrung«, die der Taufe vorausging (386), war nicht der einzige Umbruch in Augustins intellektueller Entwicklung. Seit er im Jahre 397 in einer dem Mailänder Bischof Simplician gewidmeten Schrift (Quaestiones ad Simplicianum) seine Gnadenlehre entwickelt hatte, sah er seine Veröffentlichungen des Jahrzehnts von 386 bis 396 als korrekturbedürftig an. Drei Jahre vor seinem Tod veröffentlichte er eine Schrift mit dem Titel Revisionen (Retractationes). In ihr ging er sein literarisches Werk kritisch durch. Die Kritik am eigenen Werk war als Einführung in das Studium seiner Schriften gedacht; sie erfüllt diese Funktion noch heute. Denn sie legt sowohl die Vielfalt seiner Ansätze wie das Leitmotiv seiner letzten Entwicklungsphase offen. Dem am Mittelalter interessierten Leser gibt er damit einen Überblick über die Bandbreite der Möglichkeiten, die sich auf sein Werk berufen konnten.1
Augustin kritisiert an den Werken seiner Anfangszeit vor allem, in ihnen fehle die richtige Lehre von der Gnade, nämlich »Gnade« als unvorgreiflicher Akt des souveränen Gottes, der zum Heil und zum Unheil auswählt, wen er will, ohne auf die sittliche Willensqualität des zu Begnadenden zu achten. Damals habe er, Augustin, dem menschlichen Willen eine von der Gnade unabhängige Selbständigkeit zugesprochen. Er habe deswegen den Glauben als einen spontanen Anfang missverstanden, den der Mensch von sich aus setzen könne.
Im einzelnen beanstandete Augustin:
– Er habe die Philosophen zu hoch geschätzt.
– Er habe vom Himmelreich des Evangeliums in Ausdrücken gesprochen, die dem platonischen Gegensatz von sinnlicher und geistiger Welt angemessen sind.
– Er habe Jesus wegen seiner Gewaltlosigkeit gerühmt. In Wirklichkeit habe sich Jesus nicht auf Lehren und das Zureden beschränkt, sondern Gewalt angewendet, körperliche Gewalt.
– Er habe gelehrt, das glückselige Leben bestehe darin, »dem Geist gemäß« zu leben, während es in Wahrheit darin bestehe, »Gott gemäß« zu leben.
Diese Beanstandungen richteten sich also nicht etwa auf die Zeit, da er zuerst von Cicero, dann vom Manichäismus, zuletzt vom antiken Skeptizismus abhängig war. Seine Kritik galt der Art, wie er nach seiner »Bekehrung« Philosophie und Christentum zu verbinden gesucht hat. Nach 397 schien ihm diese Verbindung zu sehr von der Seite der Philosophie her konzipiert. Sie brachte nicht hinreichend zum Ausdruck, was jetzt für Augustin das Charakteristische am Christentum war: die grundlos freie Berufung einer kleinen Anzahl von Menschen zum ewigen Heil in einer geschichtlich bevorstehenden, auch das irdische Leben mit umfassenden Neuordnung aller Dinge. Alle erhaltenen Werke Augustins sind »christlich« konzipiert. Aber die Gnadenlehre von 397 markierte einen Bruch in der Konzeption des Christentums. Von 386 bis 391 waren die christlichen Glaubensinhalte aus dem Grunde wahr, weil sie auf die neuplatonisch gefasste wahre, d. h. intelligible Welt verwiesen. Das Christentum war eine weise pädagogische Einrichtung, um innerhalb der sichtbaren Welt die Menschen auf ihr eigenes Inneres zurückzuwenden, das durch Einsicht und Tugend seine Verwandtschaft mit dem göttlichen Geist realisieren sollte.
Augustins erste Konzeption des Christlichen war durch folgende Motive des spätantiken Denkens bestimmt: Ciceros Begriff der Weisheit als das Wissen von göttlichen und menschlichen Dingen, d. h. als Naturkenntnis und als vernünftige Gestaltung des ethisch-politischen Lebens, sollte sich im Leben des christlichen Intellektuellen realisieren, da diese »Weisheit« nicht nur Gott und Mensch im Denken verband, sondern auch – in Jesus – sichtbare Person und – in der Kirche – eine pädagogische Institution geworden war. Das elitäre Ideal der Weisheit sollte jetzt allen zugänglich werden, entweder direkt im intellektuell-willentlichen Aufstieg zur göttlichen Weisheit oder indirekt durch den willentlichen Bezug auf die unanschaubare geistige Welt und das entschlossene Festhalten der Formeln und Symbole, die auf sie verwiesen. Christus war auf dieser Stufe der augustinischen Entwicklung die göttliche Weisheit, der Inbegriff des Richtigen, an dem durch intellektuelle Anstrengung oder autoritative Bindung Anteil zu gewinnen den Sinn des menschlichen Lebens ausmachte. Was die göttliche Weisheit ist, ließ sich vorzüglich in der Sprache der Neuplatoniker sagen: Sie ist das »Wort«, der denkende Inbegriff der Ideenwelt, also das eigentliche Leben und die wahre Wirklichkeit; die sinnliche Welt ist nur ihr Abbild. Der Mensch hat, sofern er denkt, eine ausgezeichnete Beziehung zu diesem »Wort«; »Denken« ist nichts anderes als der bewegte Nachvollzug der ewig-unveränderlichen Gesamtheit der Grundstrukturen der Dinge, d. h. der »Ideen«. Nach dem Neuplatonismus ging das »Wort« hervor aus dem göttlichen Einen oder dem »Guten selbst«, das in neidloser Mitteilung sich verströmt, zuerst an den Logos, dann durch die allesbewegende »Weltseele« an die Natur, vor allem aber an den Menschen, der durch Einsicht und rechte Lebensführung zu dem Ursprung von allem zurückkehrt. Das neuplatonische Schema von göttlicher Weltbegründung (Erschaffung) und ethisch-intellektueller Rückkehr zum Guten als dem Ursprung war schon vor Augustin zur Deutung des Christlichen verwendet worden, vor allem bei Origenes, dem Ambrosius viel verdankte, und bei Marius Victorinus, dem berühmten römischen Rhetor, dessen Übertritt zum Christentum in der Jugendzeit Augustins Aufsehen erregte. Für den Augustin des Jahres 386 hatte die Beschäftigung mit den neuplatonischen Büchern eine individuelle Funktion; sie ermöglichte ihm eine relativ einfache Auseinandersetzung mit der antiken Skepsis, die in letzter Zeit über ihn Macht zu gewinnen drohte. Er konnte unterscheiden: Sinnestäuschungen, Irrtümer und verwirrende Meinungsvielfalt bezogen sich auf die täuschende sinnliche Welt; die Beziehungen der Ideen waren, wie die mathematischen Gewissheiten zu beweisen schienen, von solchen Zufälligkeiten nicht betroffen; es gab also »Wahrheit«. Die neuplatonischen Bücher, insbesondere die z. T. ins Lateinische übersetzten Werke Plotins, aber auch Porphyrius’, boten dem jungen Augustin vor allem einen Ausweg aus dem Manichäismus, dem er neun Jahre lang angehangen hatte.
Der Manichäismus war eine religionsphilosophische Strömung, welche die Erfahrung des Zwangscharakters der spätantiken Gesellschaft radikal artikulierte. Sie ergriff seit dem Tod Manis (275) die verschiedenen spätantiken Religionsgruppen und fand auch innerhalb des Christentums zahlreiche Anhänger. Sie sprach den Grundsatz aus, der allen Erlösungsreligionen zugrunde liegt, dass das jetzige, hiesige Leben noch nicht unter der Herrschaft des wahren Gottes steht, dass in »dieser Welt« der »Herrscher der Finsternis« regiert und dass Erlösung darin besteht, die Vorherbestimmten (Prädestinierten) aus dem Reich des Todes in das Reich des Lichtes hinüberzuretten – dank des Abstiegs des Boten des Lichtreiches. Das Reich der Finsternis hält die Erwählten, die Kinder des Lichtes, gefangen. Aber wenn diese, vom Boten des Lichtes aufgeweckt, der sichtbaren Welt absterben, durch geschlechtliche Enthaltsamkeit und durch Verzicht auf Fleischgenuss, so kehren sie zurück zum Vater des Lichts. Abgesehen von dieser Erlösungsmöglichkeit, herrscht ein radikaler Gegensatz von Oben und Unten, Licht und Finsternis, Geist und Fleisch. Die sichtbare Welt ist das Werk eines bösen Demiurgen, den die Manichäer mit dem Gott des Alten Testaments identifizierten.
Für den jungen Augustin bedeutete der Manichäismus eine große Faszination; er vereinigte logische Konsequenz mit philosophischer Liberalität und ethischem Rigorismus. In vielfältigen Bilderreden sprach er das Bewusstsein aus, dass die Welt zerbrochen war, dass sie Dissonanzen enthielt, die zu harmonisieren die Kraft des Einzelnen überstieg. Er brachte intensiv zum Ausdruck, dass ein Nachdenklicher in der gegebenen Welt der Spätantike nicht zu Hause sein konnte; er formulierte ein universales Heimweh.
Die neuplatonische Philosophie sicherte für Augustin die Freiheit des menschlichen Willens. Sie überwand die Zweiteilung der Menschen. Sie bot für Augustin die Möglichkeit, das Bewusstsein festzuhalten, in der sichtbaren Welt, zumal in der korrupten Welt des Mailänder Hofs – für den er damals als Rhetoriklehrer tätig war –, nicht zu Hause zu sein und dennoch die gedanklichen Schwierigkeiten eines Dualismus, also einer Zwei-Prinzipien-Lehre, wie er sie im Manichäismus kennengelernt hatte, zu vermeiden. Das neuplatonische Denken erlaubte ihm, aus dem radikalen Gegensatz von himmlischer und sichtbarer Welt eine Abstufung zu machen. Vor allem stellte sich ihm nun das Problem des Bösen in einer theoretisch und emotional befriedigenderen Weise. Es war kein Weltgrund mehr, dem man in der sichtbaren Welt nicht entkommen konnte; es verlor seine Selbständigkeit, Substantialität und Unvermeidlichkeit. Jetzt musste man nur das Licht des Logos aufnehmen und das Böse vermeiden wollen. Man konnte, aber man brauchte es auch nicht völlig zu leugnen; es ließ sich einordnen. Die kausale Ordnung der Welt, die im manichäischen Denken den Charakter einer tödlich-fremden Weltmechanik hatte, schloss im neuplatonischen Weltkonzept auch das Böse ein. Der Rhetor Augustin behielt immer ein Organ für ästhetische Valeurs; er verglich jetzt das Böse mit den dunklen Farbflecken, die der Künstler einem guten Gemälde lassen muss. Das Böse, so sagte er jetzt in neoplatonisierender Manier, ist nichts Substantielles, sondern nur das Fehlen von Etwas an einer Substanz; es ist Mangel, »Beraubtsein«, privatio. Diese Theorie bedeutete zwar nicht die gedankenlose Verflüchtigung des Bösen – sie bedeutete nur die eindeutige Vorrangstellung des Guten vor dem Bösen und die Seinslosigkeit eines radikal Bösen –, aber es gereicht dem Denker Augustin doch zur Ehre, dass er es bei dieser Lösung nicht bewenden lassen konnte.
Zunächst bot sie außerordentliche Vorteile: Indem sie die Zwei-Prinzipien-Lehre zerstörte, brachte sie die Ein-Prinzipien-Lehre zur Geltung, die Parmenides zur philosophischen Tradition gemacht, die Plotin mit seiner Lehre vom Einen erneuert hatte und die mit dem Monotheismus der jüdischen und der christlichen Tradition zusammenstimmte. »Gott« konnte nur einer sein, und er musste gut sein; damit war die von Sokrates und Platon begründete moralische Weltkonzeption gerettet. Plotin hatte in feiner, theoretisch wohlbegründeter Unterscheidung vom Einen gesagt, es stehe jenseits des Denkens, des Geistes bzw. des Logos. Aber er ließ den Geist aus dem Einen hervorgehen, und wenn man ihn ungenau, sozusagen im eiligen Hinblick auf die weltanschaulichen Resultate seines Denkens las, konnte man meinen, seine Philosophie bestehe vor allem in der These, Gott und Seele seien nicht stofflich. So las Augustin seinen Plotin bzw. Porphyrius und entnahm ihnen, Gott könne, da er immateriell sei, nicht passiv in eine Auseinandersetzung verwickelt sein; der manichäische Gedanke eines Kampfes der beiden Prinzipien sei also mit der reinen Geistigkeit Gottes unvereinbar. So lief für den Augustin des Jahres 386 die Beschäftigung mit dem Neuplatonismus darauf hinaus, gegen den Manichäer in sich selbst die Immaterialität Gottes und der Seele, die Unzerstörbarkeit der kosmischen Ordnung, den Privationscharakter des Bösen und die Möglichkeit freier Willensentscheidung zu entdecken. In der antiken Tradition lag es, das richtige Leben, zu dem sich jeder Einzelne entscheiden können sollte, als ein vernünftiges Leben, als ein Leben im Kontakt mit der unwandelbaren Wahrheit, folglich als ein Leben mit Gott und als glückseliges Leben zu beschreiben. Dies sind die Hauptthemen des augustinischen Denkens vor 391, dem Jahr, in dem er Priester wurde. Dieses Datum bedeutet nicht wie 386 und 397 einen Umbruch, aber von da an traten Fragen der Kirchenorganisation ins Bewusstsein Augustins.
In Afrika war die Mehrheit der Christen Donatisten. Der Donatismus war eine lokal-afrikanische, in den nicht romanisierten unteren Volksschichten beheimatete Bewegung, die eine Kirche der Reinen anstrebte. Vor allem wollte sie die Kirche vom Staat getrennt halten; sie machte die Gültigkeit der kirchlichen Sakramente abhängig von der sittlichen Reinheit des Spenders. Augustin reagierte zunächst diskutierend und als Schriftsteller; dies zwang ihn, die afrikanische Tradition der Kirchenschriftsteller zu studieren; Fragen der Bibelauslegung und der Kirchengeschichte, die in seinem neuplatonischen Konzept von Philosophie keinen Ort hatten, gewannen an Bedeutung. Als er schließlich sah, dass das Diskutieren gegen die donatistischen Mitchristen nichts nutzte (besonders nach 411), rief er die kaiserliche Polizei und das Militär zu Hilfe. Seine Auffassung von Institution und Individuum hatte sich nach 397 also prinzipiell verschoben. Nach dieser für das christliche Denken und die mittelalterliche Welt entscheidenden Wendung zur Institutionalisierung des menschlichen Wahrheitsbezugs und zur Sakramentalisierung des christlichen Lebens wurden Wahrheit und Glückseligkeit, die Augustins Frühschriften noch in der vernünftigen Unterhaltung philosophierender Freunde zu erreichen suchten, zur jenseitigen Erfüllung der wenigen Auserwählten; für die Zeit der irdischen Pilgerschaft verwalteten dann Autorität und Tradition die wesentlichen Interessen der Menschen.
Diese Wandlung lässt sich zunächst einmal aus dem Kampf gegen die Donatisten verstehen. Vor allem aber muss die Philosophie der augustinischen Frühschriften theoretische Schwächen gehabt haben, die ihrem Urheber nahelegten, sie aufzugeben. Sie überschätzte den Einfluss vernünftiger Beschlüsse auf den realen Lauf des Lebens. Sie konzentrierte sich auf den Einzelnen, besonders den »Weisen«, und unterbewertete die übergreifenden Gemeinschaften, denen er angehört. Vor allem konnte sie nicht erklären, wieso in der Welt des guten und allmächtigen Gottes die Unschuldigen, also vor allem die Kinder, leiden. Augustins Schriften hatten vor 395 die Philosophie aufgefasst als den Hafen, in dem die intellektuellen und affektiven Irrfahrten enden; sie hatten die neuplatonische Philosophie mehr von ihrem gedanklichen Resultat als von ihrem argumentativen Niveau und ihrem Problemsinn her aufgenommen. Die Tradition der griechischen Philosophie war für den jungen Augustin nur noch bruchstückhaft zugänglich – die westliche Reichshälfte begann, sich von der griechischen Welt abzusondern; schon Augustin war auf Übersetzungen angewiesen. Auf weltanschauliche Beruhigung versessen, kombinierte er philosophische Strömungen der Spätantike, besonders Neuplatonismus und Stoa, ohne deren Vereinbarkeit gründlich zu prüfen; so setzte er Kosmosvorstellungen, die im stoischen Materialismus ihren ursprünglichen Sinn hatten, neben die einseitig als Spiritualismus ausgelegte neuplatonische Philosophie. Vom Platonismus blieb dabei nur dieser Rest:
– Die Welt geht aus der göttlichen Vernunft, welche die Ideen als Urbilder der Dinge denkt, hervor.
– Unsere Vernunft, wenn sie sich vom Sinnlichen freimacht, erfasst diese göttlichen Ideen.
– Diese Ideen sind das Bleibende, Wahre – die Sinnesdinge sind vergänglich, folglich unwahr, nicht wirklich seiend.
– Der Mensch, der sich von den trügenden Körperdingen abwendet, findet in der Betrachtung der wahren, ewigen Welt sein Glück.
Diese Konzeption beruhte darauf, durch Verzicht auf irdische Erfüllungen und durch die Fixierung der Vernunft auf das Bleibende, Untrügliche das Glück des Menschen zu sichern. Dass der Mensch dies selbst zu leisten habe, dass er es aufgrund seiner dem Göttlichen verwandten Vernunft auch tatsächlich leisten könne, dies war für den Augustin der Jahre 386 bis 395 unbestrittenes Erbe der antiken Philosophie. Er glaubte, das Christentum sei psychologisch, also de facto, für die Realisierung dieses Zweckes notwendig, weil es den Menschen in seiner sinnlichen Welterfahrung aufsuche, um ihn an das Übersinnliche zu verweisen. Das Christentum war ihm damals kein Anlass, am neuplatonischen Vernunftkonzept und seiner Übertragbarkeit auf Gott, der nach dem Johannesevangelium das Wort ist, zu zweifeln. So zweifelte Augustin weder an dessen nicht-dialogischem intuitionistischem Erkenntnisbegriff noch an der einseitigen Orientierung des Wissens am ideenhaft Bleibenden noch an dem elitären Primat des kontemplativen Lebens noch an der Durchsetzbarkeit dieser intellektualistischen Glückseligkeit in einem irdischen, sinnengebundenen Leben. Augustin arbeitete damals an der kulturellen Assimilierung der Christen an die antike Zivilisation: Das System der spätantiken Bildung, festgeschrieben im Curriculum der »Sieben Freien Künste«2, sollte voll erhalten bleiben; Augustin plante, ein Lehrbuch der Artes zu verfassen; die Dialektik und die Musik hat er teilweise fertiggestellt. Die wissenschaftliche Betätigung sollte die Seele daran gewöhnen, über das sinnlich Gegebene hinauszudenken auf seinen nicht-sinnlichen, bleibenden Grund. Politische Probleme erörterte Augustin zu dieser Zeit so gut wie nicht. Es scheint, als habe er geglaubt, die Geschichte der Kirche wie des Einzelnen seien in der Hand eines christlichen Kaisers wie Theodosius († 395) gut aufgehoben. Die Vernunft schien Macht zu haben, im öffentlichen wie im privaten Leben, bis hinunter zur rigorosen Beherrschung der sexuellen Begierde, die für Augustin immer etwas Bedrohliches an sich hatte.
Die Wende von 397. Die Gnadenlehre
Im Jahre 397 schrieb Augustin seine Schrift an Simplician. Sie enthielt erstmals die neue Gnadenlehre. Fast zur selben Zeit wurde Augustin Bischof; er verwickelte sich zunehmend in kirchenpolitische Händel, forderte staatliche Hilfe gegen abweichende Mitchristen; er lernte aber auch mehr die sozialen, rechtlichen und politischen Probleme der Zeit kennen.