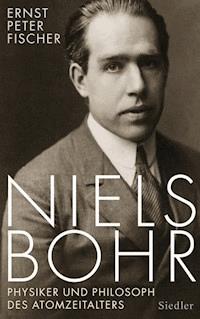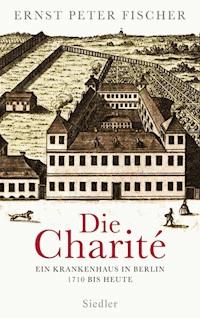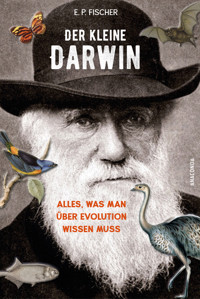Inhaltsverzeichnis
Titel
Widmung
VORKLANG
Die kleinen und die großen Fehler
MENSCHLICHES
Kopernikus hat den Menschen aus der Mitte vertrieben
Einstein war ein schlechter Schüler und hielt nicht viel von Gott
Alexander Fleming hat das Penicillin entdeckt
Der Nobelpreis für Wissenschaft wird immer gerecht verliehen
»Ohne Shakespeare gäbe es seine Werke nicht, aber ohne Einstein gäbe es seine Theorien«
Die Wissenschaft kennt keine Klassiker
Galileo Galilei ging es nur um die Wahrheit
Die Wissenschaft macht die Religion überflüssig
Die Kirche hat die Wissenschaft dauernd behindert
Der gesunde Menschenverstand hilft in der Wissenschaft
METHODISCHES
Die Wissenschaft funktioniert logisch
»In der Logik kann es nie Überraschungen geben«
Wissenschaft gibt es nur von wiederholbaren Ereignissen
Wissenschaft liefert nur klare Antworten
Das Buch der Natur ist in der Sprache der Mathematik geschrieben
Die Hypothese der Evolution ist nicht widerlegbar
Je präziser man vorgeht, desto besser wird das Ergebnis
Wissenschaft kennt keine Moden
KULTURELLES
Die Naturwissenschaften haben keinen Einfluss auf die Kultur
Wissenschaft ist keinesfalls romantisch
Die Wissenschaft ist für ihre Folgen verantwortlich
Die moderne Wissenschaft hat die westliche Welt säkularisiert
»Wissenschaft gehört nicht zur Bildung«
Wissenschaft ist schwerer zu verstehen als Philosophie
Im Mittelalter glaubten die Menschen, die Erde sei eine Scheibe
Die erste Eisenbahn machte den Menschen Angst
Es gibt keine Witze über die Wissenschaft
PRAKTISCHES
Menschen sollten viele Liter Wasser am Tag trinken
Wir nutzen nur einen Bruchteil unseres Gehirns
Haare und Fingernägel wachsen nach dem Tod weiter
Durch Rasieren wachsen Haare schneller und dunkler nach
Lesen bei schwachem Licht schadet den Augen
Mobiltelefone stören Geräte im Krankenhaus
Die meiste Körperwärme verlieren wir über den Kopf
Essen in der Nacht macht dick
Im Schlaf sind wir passiv
Das Immunsystem führt einen Krieg im Körper
Viren sind Feinde des Menschen
Krankheiten haben immer mit einem Verlust an Ordnung zu tun
Gene programmieren das Leben
Das menschliche Genom ist komplett sequenziert
Eine Biene opfert sich, indem sie ihren Stachel stecken lässt
Menschen sind unterschwellig beeinflussbar
NACHKLANG
Vom richtigen Umgang mit einer Macht ohne Mandat
Literaturhinweise
Danksagung
Personenregister
Copyright
Für Heinz und Karin, die wissen, wo man ein solches Buch gut lesen kann.
VORKLANG
Die kleinen und die großen Fehler
In seinem Roman Kaltenburg erinnert sich Marcel Beyer an ein vertracktes Problem seiner Kindheit. Ihm fiel es schwer »anzuerkennen, dass die Seeschwalbe keine Schwalbe ist«. Aber das war nicht alles: »Die Krähenrabe ist mit der Krähe nicht verwandt, die Alpenkrähe keine Krähe, so wenig wie die Alpendohle eine Dohle ist, die Wasseramsel keine Amsel, der Wachtelkönig keine Wachtel« – und erst recht kein König, wie man hinzufügen könnte. Als Junge weigert sich der Autor, den vogelkundlichen Auskünften seiner Eltern Glauben zu schenken. Er wusste doch: »Der Bergfink lebt nicht in den Bergen, der Austernfischer ernährt sich nicht von Austern, die Schnatterente schnattert nicht, mit Eis hat der Name des Eisvogels nichts zu tun, und das Gefieder des Purpurhuhns ist durch und durch blau.«
Als erwachsener Mann kann Beyer die Fehler zwar erklären – zum Beispiel als Übersetzungsfehler aus einem griechisch-lateinischen Mischmasch -, aber er hat mit dem fehlinformierenden Wortsalat vor allem gelernt, dass es nötig ist, jeden Fall in Augenschein zu nehmen, um das jeweils Richtige höchstselbst in Erfahrung zu bringen. Man sollte nicht einfach nachbeten, was man vorgesagt bekommt, auch dann nicht, wenn niemand die Absicht hat, einen hereinzulegen oder anzuschmieren.
Diese Maxime soll auch für dieses Buch gelten. Es geht um die kleinen und die großen Fehler, die sich im öffentlichen Verständnis der Naturwissenschaften breitgemacht haben, sich hartnäckig als Mythen und Legenden halten und ein allgemeines Verstehen von Wissenschaft – das eigentliche Public Understanding of Science (PUS) – blockieren und mehr oder weniger verhindern. In vielen Fällen verbreitet sich ein Mythos durch einen falschen Namen, wie wir ihn in Beyers Roman bei den Vögeln finden. So spricht man zum Beispiel auch von der Spanischen Grippe, die als Pandemie seit dem Mai 1918 in Europa wütete und bis 1919 weltweit 25 bis 50 Millionen Menschen den Tod brachte. Die Bezeichnung erweckt den Eindruck, dass die Grippe von der Iberischen Halbinsel ausgegangen ist, was aber keineswegs der Fall ist. Der Infektionsherd der Spanischen Grippe lag vielmehr im amerikanischen Kansas, und zwar in einem Ausbildungslager der US-Armee. Von da brachten Soldaten die virulente pathogene Variante des Virus nach Europa, wo der Erreger auf eine durch Krieg und Kälte geschwächte Bevölkerung traf, die sich nur höchst mangelhaft ernähren konnte und unter verheerenden hygienischen Bedingungen lebte.
Nun lässt sich leicht argumentieren, dass die Bezeichnung Spanische Grippe zwar irreführend ist, doch wohl kaum dem richtigen Verständnis für den Krankheitsverlauf im Weg steht. Das trifft für das medizinisch relevante Geschehen bei den betroffenen Patienten möglicherweise zu, aber es macht uns zugleich ziemlich blind für die Tatsache, dass die mit einem europäischen Namen verknüpfte Infektion auch in den USA Menschenopfer forderte. Darüber hinaus löste sie eine Hysterie unter der dortigen Bevölkerung aus, in deren Verlauf viele unschuldige Menschen – Amerikaner wie Europäer – gelyncht wurden. Hätte jemand solche Gräueltaten mit einer Grippe in Verbindung gebracht?
Popeyes Kraftfutter
In vielen Fällen lohnt es sich also, genauer hinzusehen und Fehler aufzudecken, vor allem wenn dadurch möglicherweise Schaden von vielen Menschen abgewendet werden kann – etwa von den Kindern, die hierzulande immer noch mit Spinat vollgestopft werden, weil dieses Gemüse dem Vernehmen nach viel Eisen enthalten soll und dadurch angeblich superstark macht.
Übrigens: Warum und wie soll Eisen jemanden stark machen? Überträgt der gesunde Menschenverstand da einfach nur die Eigenschaften des Verspeisten (eines harten Metalls) auf den Speisenden und geht nach dem Motto vor: »Man ist, was man isst«?
Wie dem auch sei: Die Legende vom Kraftfutter Spinat verdankt ihre Verbreitung einer in den frühen 1930er Jahren auf Kinoleinwänden erscheinenden Comicfigur, die als Seemann Popeye mit Kapitänsmütze, Anker-Tattoo auf dem linken Unterarm, einem schiefen, verkniffenen Gesicht, Pfeife im Mundwinkel und einem zugekniffenen Auge bekannt geworden ist. Immer dann, wenn Popeye finstere Gestalten verprügeln oder irgendwelche Kraftakte starten will, futtert er eine Dose Spinat leer, und er beweist mit seinem jeweils unvermeidlichen Triumph, dass Spinat so stark macht wie der Zaubertrank der Gallier, mit dessen Hilfe Asterix und Co. die Römer in Schach halten. Und unsere Eltern haben dann gleich die dazugehörige Pseudoerklärung mitgeliefert, die sie weiß Gott wo herhatten (nur nicht aus ihrer Schulzeit). Sie besagte, dass Spinat den Seemann so stark macht, weil er so viel wertvolles Eisen enthält, das dann auf wunderbare Weise die Blutbildung – und mit ihr zugleich den Muskelumfang – fördert. Bei Popeye sehr imposant am Bizeps.
So klar es ist, dass Popeye den Spinatkonsum gefördert hat, so unklar bleibt, wie sein Schöpfer, der amerikanische Zeichner Elzie C. Segar, von der vorgeblich stärkenden und muskelbildenden Wirkung des Grünzeugs erfahren hat oder überzeugt wurde, die heute in das Reich der Legende zu verweisen ist. Wir können nur vermuten, dass er von der ersten Laboranalyse erfahren hat, die ein Chemiker in der Schweiz mit dem Spinat 1890 unternommen hat und bei der ein Eisengehalt gefunden wurde – 35 Milligramm Eisen in 100 Gramm getrocknetem Spinat -, der zwar zehnmal höher als der heute akzeptierte Wert lag, der damals aber sogleich von allen Ernährungsratgebern übernommen wurde. Sie schwangen sich auf diese quantitative Weise zu gefragten Experten auf, die anschließend Generationen von Müttern dazu gebracht haben, ihren Kindern das von den lieben Kleinen oft als ekelig empfundene Gemüse aufzutischen (was aber ganz sicher keinen Schaden angerichtet hat).
Warum die Panne passiert ist und der Eisengehalt bei der ersten Analyse viel zu hoch angegeben worden ist, bleibt im Dunkel der Geschichte verborgen. Gerüchten zufolge soll es sich einfach um einen Schreibfehler gehandelt haben: Der zuständige Wissenschaftler wollte 3,5 schreiben, vergaß aber das Komma. 3,5 Milligramm Eisen pro 100 Gramm Spinat wäre angemessen und vielleicht sogar richtig gewesen. Damit enthält das Blattgemüse allerdings weniger Eisen als Schokolade oder Leberwurst, um nur zwei Beispiele zu nennen, die gegensätzlicher nicht sein könnten. Wenn man Spinat empfehlen will – was hier trotz allem gern geschehen soll -, dann kann man dies wegen seines Geschmacks – wenn man ihn mag – und einiger Ballaststoffe und Vitamine tun, aber die kann man auch durch andere Nahrungsmittel zu sich nehmen, wie man leicht herausfinden kann.
Kleine und große Fehler
Natürlich haben einige Kinder den aufgetischten Spinat hinuntergewürgt, weil ihre Eltern durch wissenschaftliche Analysen überzeugt waren, etwas Gutes für ihre Schützlinge zu tun. Aber wir wollen dies als einen kleinen und leicht verzeihlichen Fehler ansehen, ebenso wie die oftmals gehörte Behauptung, Schokolade mache glücklich. Wer dies in unseren an neurologischen Abläufen besonders interessierten Zeiten sagt, versucht den kausalen Zusammenhang von Schokolade und Glücklichsein oft sogar mit der Biochemie des Körpers und des Gehirns zu erhärten und zu beweisen. Demnach braucht ein Mensch ein bestimmtes Hormon, um glücklich zu sein: Dieser molekulare Glücksbringer in unseren Nervenzellen trägt den Namen Serotonin. Wer Schokolade isst, so hört man immer wieder, steigert seinen Serotoninpegel und damit seine Stimmung. Das ist gar nicht so falsch, allerdings: Kartoffeln und Müsli bewirken dasselbe, und zwar ohne die (manchmal unglücklich machende) Nebenwirkung, die bei vielen Schleckermäulern als Rettungsgürtel um die Hüften herum zum Vorschein tritt. In der Tat – wenn jemand sich biochemisch glücklich machen will, sollte er eher auf Kartoffeln als auf Schokolade setzen. Auf Letztere sollte man dennoch nicht verzichten, vor allem dann nicht, wenn sie einem so gut schmeckt wie dem Autor (der weißer Schokolade mit ganzen Nüssen nicht widerstehen kann).
Wer sich anders verhält, begeht wissenschaftlich betrachtet bestenfalls einen kleinen Fehler. Dem steht allerdings direkt der große Fehler gegenüber, den auch das Spinatbeispiel erkennen lässt. Den ernst zu nehmenden und nachwirkenden Fehler begehen wir dadurch, dass wir meinen, Tatsachen seien unveränderlich, und zwar vor allem dann, wenn es sich um sogenannte wissenschaftliche Tatsachen handelt, die durch möglichst viele Zahlen untermauert werden (wozu in unseren Tagen die Ergebnisse von PISA-Bildungstests gehören, deren Resultate tatsächlich derart von Bildungsforschern als in Stein gemeißelte Offenbarung angebetet werden, dass man sich über deren eigene Bildung wenigstens etwas wundern darf).
Was von Experten präzise gemessen worden ist und mit ihrem Namen versehen schwarz auf weiß gedruckt vorliegt, das muss und wird für alle Zeiten stimmen – so denkt man fröhlich und irrt gewaltig. Die deutschen »Tatsachen« beinhalten wie die angelsächsischen »facts« (Fakten) in dem sie bezeichnenden Wort das Machen und Tun, das sie auszeichnet. »Facio, feci, factum« hat man früher im Lateinunterricht gelernt und unter anderem mit »ich fertige an« übersetzt. Ein »Faktum« ist etwas, das Menschen angefertigt haben, und dabei können sie bekanntlich irren. Mit anderen Worten: Gerade Tatsachen können sich dauernd ändern, und sie tun dies im Lauf der Geschichte immer wieder, manchmal sogar massiv und entscheidend – auch dann, wenn sie schon länger in Lehrbüchern stehen und an die Studierenden als wissenschaftliche Wahrheiten mit Ewigkeitsanspruch vermittelt werden.
Ein Beispiel dafür findet sich in der Entdeckung der Struktur des Erbmaterials DNA. Die berühmte Doppelhelix stand den beiden Molekularbiologen James Watson und Francis Crick erst in dem Moment vor Augen, als sie von den Tatsachen Abstand nahmen, die Chemielehrbücher ihrer Zeit – der frühen 1950er Jahre – über das Aussehen der Bausteine verbreiteten, aus denen die Erbsubstanz besteht. Ein anderes Beispiel hat mit sogenannten Cepheiden zu tun, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts als veränderlich leuchtende Sterne am Himmel entdeckt worden waren und durch ihre Helligkeitsschwankungen die Möglichkeit boten, kosmische Entfernungen – etwa von der Erde zum Polarstern – zu bestimmen. Als man anfing, aus den dabei gewonnenen Daten das Alter des Weltalls zu ermitteln, tauchte das paradoxe Ergebnis auf, dass einzelne Sterne älter waren als der Kosmos, zu dem sie gehören. Aufgelöst wurde dieser Knoten durch eine Veränderung von Tatsachen. Man erkannte, dass es zwei Klassen von Cepheiden gab, und wenn man dies angemessen berücksichtige, rückten sich die Dinge am Himmel zurecht.
Man könnte noch viele falsche Tatsachen aufzählen, die wir der Wissenschaft verdanken – etwa die zu hoch ermittelte Menge an Gold, die Ozeane enthalten und mit der Deutschland die Reparationen nach dem Ersten Weltkrieg bezahlen wollte, oder die immer noch angenommene und am Ende dieses Buches widerlegte Möglichkeit, Menschen ließen sich durch unterschwellige (»subliminale«) Signale beeinflussen. Daraus lässt sich der Schluss ziehen, dass es sich lohnt, immer wieder aufmerksam zu sein, skeptisch zu bleiben und bei allem Zusichern Zweifel zu bewahren. Wissenschaft liefert zwar möglichst gute Daten, aber das bedeutet nicht, dass nicht eines Tages bessere auftauchen können, die ein Umdenken erfordern.
Damit haben wir die Bühne nicht nur für einen großen, sondern für einen grandiosen Irrtum über die Wissenschaft bereitet. Er hat damit zu tun, dass wir denken, Wissenschaft bringe Erklärungen zustande, mit deren Hilfe etwas verstanden wird und wodurch das Fragen dann zum Abschluss kommt. Wissenschaft – so denkt man – verwandelt eine geheimnisvolle Natur in eine korrekte und technisch nutzbare Lösung.
Genau dies ist nicht der Fall, wie leicht einzusehen ist, wenn man sich erinnert, was große und kleine Forscher ständig unter dem ermunternden Nicken des Publikums sagen. Mit jeder Antwort, so kann man da erfahren, stellen sich neue Fragen, und zwar mehr als vorher. Wissenschaft ist ein offener Vorgang, ein Bildungsprozess, den man in einer etwas paradox klingenden Formulierung so beschreiben kann: Wissenschaft verwandelt eine geheimnisvolle Natur in eine noch geheimnisvollere Erklärung. Sie vertieft das Geheimnis. Deshalb bleibt die Wissenschaft auch dann spannend, wenn wir sie schon länger zu kennen meinen.
MENSCHLICHES
Kopernikus hat den Menschen aus der Mitte vertrieben
Bei Kopernikus scheint alles seine Richtigkeit zu haben. Wir kennen uns aus. Der deutsch-polnische Astronom hat im 16. Jahrhundert erkannt, dass nicht die Erde, sondern die Sonne im Mittelpunkt unseres Planetensystems steht und dass die Erde nur einer der um die Sonne kreisenden Planeten ist. Der mit dieser Annahme des Weltbilds eingeleitete Wandel des menschlichen Bewusstseins wird als kopernikanische Wende bezeichnet. Obwohl dieser Gedanke so leicht zu fassen ist, rief er den Unmut der Kirche hervor, die deshalb Kopernikus’ 1543 erschienenes, lateinisch verfasstes Werk über die Umläufe der Himmelskörper – De Revolutionibus Orbium Coelestium – auf den Index setzte und verbot. Wie so oft kämpfte die Kirche dabei gegen die wissenschaftlich erwiesene Wahrheit an.
Mit seinem heliozentrischen Modell konnte Kopernikus die beobachteten Himmelsbewegungen anderer Planeten viel leichter erklären als seine Vorgänger, die sich an die antiken Vorstellungen des geozentrischen Weltbilds anlehnten. Er erschütterte das seit etwa tausenddreihundert Jahren unbestrittene und den religionsideologischen Bedürfnissen der katholischen Kirche entsprechende Weltbild des griechischen Mathematikers, Geografen und Astronomen Ptolemäus (um 100 – um 175 n.Chr.). Indem er die Menschen aus der Mitte der Welt entfernte und sie an den eher bedeutungslosen Rand schob, eröffnete Kopernikus eine bis in das 20. Jahrhundert reichende Folge von Kränkungen, die der wissenschaftliche Geist dem Menschen zugefügt hat.
So ungefähr lässt sich das zusammenfassen, was immer noch mit dem Namen Kopernikus verbunden ist – aber fast alles davon ist falsch und unsinnig. Die Tatsache, dass diese Denkfehler offenbar schwer zu korrigieren sind, ist ganz schön deprimierend.
Der Sachverhalt
Kopernikus fand trotz der Doppelbelastung als Domherr und Arzt Zeit für die Erkundung des Himmels. Er entwickelte dabei die Vorstellung von der Sonne als Mittelpunkt des Planetensystems und der von den Planeten um sie beschriebenen Kreisbahnen. Bei der Erde stellte er sogar zwei kreisförmige Drehbewegungen fest, eine längere um die Sonne (einmal im Jahr) und eine kürzere um ihre eigene Achse (einmal am Tag). Nicht die erste Drehbewegung, sondern die Rotation der Erde um ihre eigene Achse hat den Namen kopernikanische Wende bekommen, und zwar durch Immanuel Kant, der dabei die Philosophie der Erkenntnis im Sinn hatte.
Diese modern wirkende Überschreitung der disziplinären Grenzen beeinträchtigt keineswegs die Bedeutung der ersten Drehung, die es sogar doppelt in sich hat. Zum einen kann keine Rede davon sein, dass die von Kopernikus postulierte Umkreisung der Sonne leicht zu begreifen ist, denn tatsächlich sehen wir mit unseren Augen etwas anderes, wenn wir zum Beispiel abends zum Himmel blicken, nämlich einen Sonnenuntergang. So etwas darf es bei Kopernikus gar nicht geben. In seinem Modell geht unser Zentralgestirn ja weder unter noch auf, es ruht vielmehr in der Mitte des Planetensystems, und wir müssen diesen scheinbaren Widerspruch auflösen. Und zum andern kann erst recht nicht behauptet werden, dass Kopernikus durch die Vergabe einer neuen Position an die Erde die auf ihr wohnenden Menschen erniedrigen oder gar beleidigen wollte. Er unternimmt vielmehr genau das Gegenteil: Kopernikus erhöht die Menschen durch die neue Position und rückt sie näher an die (antiken) Götter oder den (christlichen) Gott heran, weil beide stets außen angesiedelt und über allen Sphären schwebend gedacht wurden.
Dies kann man unter anderem in der Göttlichen Komödie nachlesen, in der Dante die antiken Vorstellungen vom Aufbau des Kosmos übernimmt und christlich auflädt. Bei ihm trifft man auf Gott in einem Empyreum, einem Feuerhimmel, der sich über alle anderen Sphären wölbt. Wer jetzt fragt, was denn die Kirche an alldem auszusetzen und warum sie das Werk von Kopernikus verboten hat, dem sei versichert, dass die katholische Geistlichkeit in diesem Fall sehr vernünftig gehandelt und der Wissenschaft kein Hindernis in den Weg gestellt, sondern ihr vielmehr einen Dienst erwiesen hat, wie später noch geschildert wird.
Der Mann mit dem Maiglöckchen
Der Vater von Nikolaus Kopernikus (1473 – 1543) hieß Niklas und schrieb sich noch Koppernigk, solange er es nicht geschafft hatte, zu den wohlhabenderen Bürgern (Kaufleuten) von Thorn zu gehören, dem Städtchen, in dem unser Protagonist geboren wurde. Thorn lag im Ermland und galt demnach als preußisch. 1466 war es an Polen abgetreten worden, was Kopernikus von Geburt an amtlich zu einem Polen machte, obwohl er seine Werke auf Deutsch oder Lateinisch schrieb.
Das bekannteste Porträt von Kopernikus zeigt ihn mit einem Maiglöckchen, und das Blümchen soll der Welt zeigen, dass sich Kopernikus als Arzt verstanden hat. Festzuhalten ist, dass er die Ausübung dieses Berufs ebenso wenig als seine Hauptaufgabe angesehen hat wie seine Bemühungen um die Erforschung des Himmels. Tatsächlich hatte Kopernikus seit 1510 hauptamtlich eine Domherrenstelle in Frauenburg inne, die aber keine geistlichen Aufgaben mit sich brachte, sondern von ihrem Inhaber vor allem juristische Qualifikationen und ab und zu auch einige medizinische Tätigkeiten verlangte. Kopernikus hatte sich auf diese Vielfalt an Pflichten durch seine Studienzeit vorbereitet, die er unter anderem in Krakau, Padua und Bologna verbracht hatte und in deren Verlauf er sich um die Gesetze des Körpers (Medizinisches) und des Staates (Juristisches) bemühte und schließlich sogar zum Doktor des Kirchenrechts promovierte. Daneben beschäftigte ihn die Astronomie, die ihn im Verlauf des 16. Jahrhunderts immer mehr in ihren Bann schlug – wozu sowohl ein Leseerlebnis als auch eine Enttäuschung mit anschließender Herausforderung beigetragen haben.
Das Leseerlebnis verdankte Kopernikus der Tatsache, dass während seines Italienaufenthalts am Ende des 15. Jahrhunderts die erste gedruckte Ausgabe des Almagest von Ptolemäus erschien und von Kopernikus emsig studiert wurde. Mit der hierdurch erworbenen Kenntnis beeindruckten ihn zunächst eine Konjunktion (Ausrichtung) von Saturn und Mond und eine Mondfinsternis, die beide im Jahr 1500 zu beobachten waren. Kopernikus sah nun voller Erwartung dem Jahr 1503 entgegen, in dem eine Konjunktion der Hauptplaneten zu erwarten war. Sie fand tatsächlich statt – allerdings sehr viel später, als die Astronomen vorhergesagt hatten. Das war die Enttäuschung, die nur einen Schluss zuließ, nämlich den, dass vielleicht doch etwas nicht ganz stimmen konnte mit der seit mehr als einem Jahrtausend angenommenen Beschreibung der Himmelsbewegungen – wie sich auch Martin Luther zu bemerken nicht versagen konnte, als er in seinen Tischreden die »Unordnung« am Firmament beklagte.
Die heliozentrische Idee
Kopernikus wollte diese Unstimmigkeiten klären, und die kosmischen Gedanken reiften in aller Stille mehr als ein Jahrzehnt in ihm heran. In der Abgeschiedenheit seiner Domherrenstelle konnte er in aller Ruhe die Planeten ganz genau beobachten – natürlich noch ohne Hilfsmittel wie etwa Fernrohre, die erst rund hundert Jahre später zur Verfügung standen. Erst 1514 war Kopernikus in der Lage, seine neuen Vorstellungen der Himmelsordnung in Worte zu fassen: Er verfasste einen kleinen Kommentar – einen Commentariolus -, in dem es unter anderem kurz und bündig heißt: »Alle Sphären drehen sich um die Sonne, die im Mittelpunkt steht. Die Sonne ist daher das Zentrum des Universums.«
In diesen Sätzen sind ein neuer und ein alter Gedanke zu erkennen, die es beide zu beachten gilt. Der alte steckt in den Sphären, die Kopernikus nach wie vor als die bewegten Elemente des Himmels betrachtet (und deren kreisförmige Drehung keine physikalische Erklärung braucht, auch wenn man sich wundern könnte, warum eine Sphäre so viel länger braucht als eine andere, um sich zu drehen). Kopernikus hielt daran bis zum Ende seines Lebens fest, das zeitlich zufällig mit dem Erscheinen seines Hauptwerks zusammenfiel, in dem er seine kosmischen Vorstellungen sogar durch eine hübsche Illustration veranschaulichte.
Der neue Gedanke kommt in der Position der Sonne zum Ausdruck, wobei anzumerken ist, dass er bereits in der Antike geäußert wurde – ohne allerdings Anhänger zu finden.
Der Hauptgrund, der Kopernikus veranlasste, das geozentrische System des Ptolemäus durch ein heliozentrisches Modell zu ersetzen, war sicher das geschilderte Versagen der überlieferten Astronomie. Daneben muss es aber noch andere Beweggründe gegeben haben, von denen einige vermutlich ästhetischer Natur waren. Es war einfach schöner, die strahlende Sonne ins Zentrum der Welt zu stellen, und zudem bestand mit diesem Schritt die Hoffnung, »eine vernünftigere Art von Kreisen zu finden«, wie Kopernikus in seinem kleinen Kommentar schrieb. Damit deutete er an, dass er vor den vielfach verschachtelten und höchst künstlich wirkenden Konstruktionen des Ptolemäus, die man Epizyklen nannte, zurückschauderte. Schon in der Antike gab es viele Beobachtungen von Planetenbewegungen, die mit einer Handvoll von Kreisen nicht zu fassen waren, und so stellte man sich vor, die Planeten würden ihre Bahn entlang eines kleinen Kreises, des Epizykels, ziehen, der sich seinerseits wiederum entlang eines größeren Kreises, des deferierenden Kreises, bewegte.
Kopernikus meinte, es müsse möglich sein, den Lauf der Planeten einfacher und eleganter darzustellen, und deshalb schlug er seine neue Ordnung am Himmel mit der Sonne in der Mitte vor, was wir bis in unsere Tage als heliozentrische Revolution feiern. Doch so schön sein Vorschlag ist, es trifft nicht zu, wenn man behauptet, Kopernikus käme bei seinem Schema mit weniger Hilfskonstruktionen als Ptolemäus aus und er könne genauer als jener die zahlreichen Himmelsbewegungen vorhersagen. Tatsächlich bleibt das heliozentrische System quantitativ ebenso unbefriedigend wie sein geozentrischer Vorläufer. Signifikant reduzieren konnte Kopernikus die Zahl der zusätzlichen Kreisbewegungen nicht, die auch im heliozentrischen System nötig sind, um die beobachteten Positionen und vielfach merkwürdigen Verläufe der Planeten berechnen zu können.
Es liegt noch ein zweiter schwerer Irrtum vor: die vor allem in den Schriften von Sigmund Freud verkündete Behauptung, Kopernikus habe mit seinem Modell den Menschen aus der Mitte vertrieben und an den Rand der Welt gedrängt. Freud redet gar von einer der großen Beleidigungen für die Menschheit, und niemand nimmt zur Kenntnis, wie unsinnig die Darstellung des begnadeten Wiener Psychoanalytikers ist, der sich selbst wohl für die Mitte der geistigen Welt hielt.
Die Behauptung, Kopernikus habe die Menschen erniedrigt, kann nur aufstellen, wer das Zentrum für einen bevorzugten und erstrebenswerten Ort ansieht. Das mag heute so sein, es war damals aber gerade nicht der Fall. Die Mitte wurde – im Gegenteil – als der tiefste Punkt angesehen, zu dem man herabsinken konnte. Im Zentrum der Welt war man so weit wie möglich von den Göttern entfernt, deren Platz bekanntlich außen war. Indem Kopernikus den Menschen aus der Mitte holte und in eine Umlaufbahn um die Sonne brachte, rückte er ihn näher an die Götter heran. Mit anderen Worten – Kopernikus befreite die Menschen aus der demütigenden Lage, der Bodensatz – der Abtritt – der Welt zu sein. Der französische Essayist Michel de Montaigne (1533 – 1592) hat dies durch die deutlichen Worte ausgedrückt, dass der Mensch – vor Kopernikus – »im Schlamm und Kot der Welt, (…) im niedrigsten Stock des Hauses, am weitesten vom Himmelsgewölbe entfernt« untergebracht war – aber nur, bis ihn das heliozentrische Schema in engere Tuchfühlung mit den Göttern brachte, die sich vielleicht nun sogar großzügig dazu herabließen, auf ihn aufmerksam zu werden.
Mit diesen Bemerkungen erledigt sich der dritte Irrtum um Kopernikus schon fast von selbst, der mit dem kirchlichen Verbot zu tun hat, das untersagte, sein Werk in den Seminaren der Hochschulen zu lesen. Dieses Verbot gibt es zwar – es ist tatsächlich 1616 ausgesprochen worden -, aber es hat nichts damit zu tun, dass die Lehre des Kopernikus eine Gefahr für irgendein Dogma darstellen würde. Die päpstlichen Hüter der Lehre waren berechtigterweise über etwas ganz anderes besorgt: über die unvorstellbar große Zahl der Fehler, die sich in dem Buch fanden – »innumerabilis errores«, wie sie es ausdrückten. Es ging also um Fehler, nicht um Irrtümer. Und die Fehlermenge des legendären Buchs lässt sich leicht erklären: Kopernikus erhielt nämlich das erste Exemplar erst, als er auf dem Totenbett lag, und da konnte er auch beim besten Willen keine Korrekturfahnen mehr lesen. Als 1620 endlich eine verbesserte Ausgabe der Revolutiones vorlag, durfte sie – fast ist man geneigt, hier »selbstverständlich« einzufügen – im kirchlichen Lehrbetrieb benutzt werden. Das Buch enthielt jetzt weniger Fehler – und immer noch keine Irrtümer.
Die kopernikanische Wende
Das heliozentrische Weltbild brachte eine Konsequenz mit sich, die lange übersehen wurde und darum vielleicht einen festen Platz im allgemeinen Denken gefunden hat: Durch die kopernikanische Verschiebung wurde unser Planet zu einem Himmelskörper unter anderen, wodurch die tradierte antike Unterscheidung zwischen irdischer und himmlischer Materie hinfällig wurde. Es gab von nun an nicht mehr die zwei Welten (das »Duoversum«), die Aristoteles eingeführt hatte und die sich an der Mondsphäre schieden, sondern nur noch eine Welt, in der es überall physikalisch zuging – sublunar und supralunar. Und diesen neuen Kosmos würde man bald mit dem neuen Wort Universum bezeichnen.
Zwar ist das schon aufregend genug, doch bei Kopernikus gibt es etwas, das noch mehr Spannung in die Geschichte des Himmels bringt: eine zweite Bewegung, die der Frauenburger Domherr unserer kosmischen Heimat zumutete beziehungsweise zutraute. Sie nimmt ihren Ausgangspunkt in der Drehung der Fixsterne am Firmament, die bekanntlich leicht zu beobachten ist und erklärt werden muss. Kopernikus kommt auf die wahrhaft wunderbare und erstaunliche Idee, die sich dem Augenschein mitteilende Kreisbewegung der Fixsterne als etwas zu betrachten, das es nur dem Schein nach gibt. Was unsere Sinne melden, wird vielmehr durch unseren Standpunkt als Beobachter auf der Erde bedingt und wahrgenommen. Nicht die Fixsterne drehen sich, schlägt Kopernikus vor, sondern die Erde, und dieses Rotieren um eine Achse (die wir heute vom Nord- zum Südpol laufen lassen) lässt uns die kreisförmigen Bewegungen am Himmel beobachten, die nur scheinbar stattfinden und uns von unseren Sinnen vorgespielt werden. Er drückt das im fünften Satz des bereits zitierten Commentariolus folgendermaßen aus: »Alles, was an Bewegung am Fixsternhimmel sichtbar wird, ist nicht von sich aus so, sondern von der Erde aus gesehen. Die Erde also dreht sich mit den ihr anliegenden Elementen in täglicher Bewegung einmal um ihre unveränderlichen Pole. Dabei bleibt der Fixsternhimmel unbeweglich als äußerster Himmel.«
Leider erlaubt uns Kopernikus keinen Einblick in den tieferen Grund, der ihn zu dieser Umkehrung geführt hat. Eine Überlegung, die ihn geleitet haben könnte, ging vielleicht von dem seit dem Spätmittelalter nachweisbaren Bemühen aus, die Distanz zwischen der Erde und den Fixsternen abzuschätzen. Man war dabei zu dem Ergebnis gekommen, dass die Entfernungen für den menschlichen Geist unfassbar sind. Wenn die Abstände so immens waren, dann mussten im All gigantische Körper sein, da sie sichtbar waren, und diese Riesen mussten zudem unvorstellbare Wege für ihre Drehbewegungen bewältigen. Das war alles unfassbar.
Wenn hingegen wir selbst es waren, die sich drehten, dann war alles nicht nur einfacher vorstellbar, dann konnte Kopernikus zudem ein die damalige Kirche ärgerlich bedrängendes Problem besser lösen: das Datum des Osterfests genau zu bestimmen. Wie Kopernikus nämlich zu seinem Verdruss feststellte, wurde die Auferstehung des Herrn zu seiner Zeit bereits neun Tage später gefeiert, als es von den Kirchenvätern auf dem Konzil von Nicäa (im Jahr 325) beschlossen worden war. Kopernikus wollte den kirchlichen Festkalender reformieren, und dazu diente ihm die tägliche Drehung der Erde, die wir zwar nicht spüren, wenn wir auf ihr stehen, die wir aber trotzdem als Bewegung der Fixsterne sinnlich registrieren können, wenn wir dem Vorschlag des Frauenburger Domherrn folgen.
Die philosophische Wende
Viele Zeitgenossen sind ihm gefolgt, und im 18. Jahrhundert hat die zweite Drehung des Kopernikus ihre eigentliche Bedeutung durch den Philosophen Immanuel Kant (1724-1804) bekommen, der wie sein astronomischer Vorgänger einen Standortwechsel vollziehen wollte, und zwar in der Philosophie der Erkenntnis. Kant hielt es für besser, davon auszugehen, dass die Naturgesetze von uns Menschen stammen und der Natur gewissermaßen vorgeschrieben werden, als zu denken, dass die Naturgesetze in der Natur selbst liegen und dort von uns gefunden werden. In seiner Kritik der reinen Vernunft heißt es: »Es ist hiermit ebenso als mit den (…) Gedanken des Kopernikus bewandt, der, nachdem es mit der Erklärung der Himmelsbewegungen nicht gut fortwollte, wenn er annahm, das ganze Sternenheer drehe sich um den Zuschauer, versuchte, ob es nicht besser gelingen möchte, wenn er den Zuschauer sich drehen und dagegen die Sterne in Ruhe ließ. In der Metaphysik kann man nun, was die Anschauung der Gegenstände betrifft, es auf ähnliche Weise versuchen«, nämlich, wie oben angedeutet, indem man sagt, dass die Gesetze der Natur nicht aus ihr, sondern aus uns kommen. Wir machen sie. Wir erfinden die Form, mit der wir die Natur verstehen.
Es ist dieser Gedanke aus der Kritik der reinen Vernunft, der in der Philosophie als kopernikanische Wende bezeichnet wird – und der nichts mit dem heliozentrischen Umbau zu tun hat -, und die Frage lautet, ob dies eine passende Beschreibung ist. In den meisten Fällen besteht eine kopernikanische Wende darin, den Menschen aus einer Mitte zu entfernen. Kant unternimmt aber das Gegenteil. Er setzt den Menschen erneut in das Zentrum des Geschehens. Er führt also eher so etwas wie eine ptolemäische Gegenrevolution aus, die man dann umdeuten kann, wenn eingeräumt wird, dass der Mensch seine Erkenntnisfähigkeit zunächst in Anpassung an die Natur – von ihr – bekommen hat. Dies gelingt im Rahmen einer evolutionären Epistemologie, die den Menschen wieder aus der zentralen Position herausnimmt, die Kant ihm zugewiesen hat, um ihn zu einem Teil des gesamten kosmischen Geschehens zu machen. Kopernikus hätte diese Wendung gefallen, und wir sollten uns ihr anschließen.
Das ästhetische Erkennen
Damit kommen wir zum letzten Punkt, dem Widerspruch zwischen dem, was wir sinnlich erfassen, und dem, was wir begrifflich benennen. Während wir sehen, dass die Sonne auf-und untergeht, mit der Betonung auf dem Gehen, das eine Bewegung meint, wissen wir, dass sie im heliozentrischen Modell des Kosmos gerade nicht unterwegs ist, sondern ruht. Wenn jetzt jemand fragt, was denn nun der Fall ist: »Bewegt sich die Sonne oder bewegt sie sich nicht?«, dann müssen wir erneut von den Phänomenen absehen und auf den Menschen schauen, der sich um sie bemüht. Dabei verfügt er über zwei Hilfsmittel, seine Sinne und seine Ideen, seine Anschauung und seine Begriffe, um auf Kants Unterscheidung zurückzugreifen. Kopernikus und sein kosmisches Modell zeigen uns, dass wir zwei gleichberechtigte Weisen haben, die Welt zu erfassen, und man könnte sie poetisch und wissenschaftlich oder logisch nennen. Der letzte Vorschlag stammt von Kant, der die subjektive von der objektiven Wahrheit so unterschieden hat: »Dass die Sonne in den Ozean taucht, ist wahr nach den Gesetzen der Sinnlichkeit und Erscheinung, aber nicht logisch, nicht objektiv.« Und der Philosoph fügt hinzu: »Die Sonne taucht sich ins Wasser, sagt der Poet; würde er sagen, die Erde dreht sich um ihre Achse, so wäre er ein Logiker und kein Poet.«
»Wahrnehmung« heißt im Griechischen »aisthesis«, weshalb man auch sagen kann, dass es das ästhetische und das begriffliche Wissen, eine ästhetische und eine objektive Wahrheit gibt, dass wir die Welt erleben oder erklären können. Kopernikus zeigt, dass Menschen beide Fähigkeiten in sich vereinen. Vielleicht kann ja das Erklären zum Erlebnis werden. Wir können am Himmel beginnen, der sich über uns wölbt.
Einstein war ein schlechter Schüler und hielt nicht viel von Gott
Der Name von Albert Einstein (1879 – 1955) scheint allgemein bekannt zu sein. Und die meisten meinen, auch schon einmal die wesentliche Einsicht gehört zu haben, die wir ihm verdanken: »Alles ist relativ.« Außerdem ist der hübsche Satz »Gott würfelt nicht« fast schon ein geflügeltes Wort geworden, das aus einer großen Idee einen billigen Jakob zu machen scheint, den Einstein nicht in sein Leben eingreifen lassen wollte. Und dann fällt vielen Menschen noch ein, dass Einstein ein schlechter Schüler war, und wenn davon die Rede ist, lächeln die um den Stammtisch Herumsitzenden und denken an ihre eigenen Zeugnisse und an die ihrer Kinder. Vielleicht wird aus ihnen doch noch etwas, ein zweiter Einstein. Immerhin war der Mann des 20. Jahrhunderts, zu dem ihn das TIME-Magazin gekürt hat, doch ein glühender Pazifist. Oder? Er war jedenfalls ein hochanständiger Mensch, der sich anderen gegenüber nur einwandfrei verhalten hat, selbst wenn er uns am Ende seines Lebens die Zunge herausgestreckt hat.
Der Sachverhalt
Das Bild ist als Postkarte oder Poster weltweit verbreitet – Einstein streckt die Zunge raus. Aber er meinte damit nicht die Menschheit, sondern die etwas aufdringlichen Fotografen, die ihn unentwegt ablichteten, als man seinen zweiundsiebzigsten Geburtstag feierte. Damals war die Atombombe längst