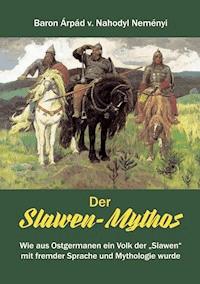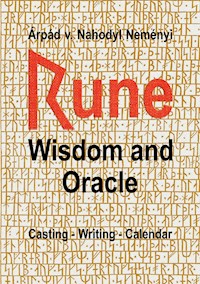Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
In unseren Märchen leben uralte Erinnerungen an die vorchristliche heidnische Zeit fort, die in vielen Jahrhunderten mündlich weitererzählt wurden und uns schließlich in den heutigen Märchenfassungen vorliegen. In 18 Kapiteln werden in diesem Buch die bekanntesten Märchen aus der Sammlung der Gebrüder Grimm unter Berücksichtigung älterer Überlieferungen und ihrer Varianten mythologisch gedeutet. Die in den Märchen auftretenden Figuren werden als ursprüngliche Gottheiten oder Priester und Schamanen des vorchristlichen Kultes gedeutet und der in den Märchen enthaltene und oft nicht mehr erkennbare ursprüngliche Sinn wird entschlüsselt. Mithilfe dieses Wissens wird die Kenntnis eines Märchens umfassend und vollständig, das Märchen wandelt sich von einem bloßen Unterhaltungstext für Kinder zu einer mythologischen Erzählung voller bisher verborgener Weisheit unserer Vorfahren, deren Intention uns nun erst verständlich werden kann. Das Buch deutet ausführlich Märchen wie „Frau Holle“, „Hänsel und Gretel“, „Dornröschen“, „Rapunzel“, „Schneewittchen“, „Aschenputtel“, „Rotkäppchen“, „Tischlein deck dich“, „Rumpelstilzchen“ und viele andere. Die jeweiligen Märchentexte sind vollständig enthalten und mit vielen Bildern illustriert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 655
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Der Bärenhäuter
Tischlein deck dich
Das tapfere Schneiderlein
Frau Holle
Der Teufel mit den drei goldenen Haaren
Jorinde und Joringel
Rapunzel
Dornröschen
Sneewittchen
Rumpelstilzchen
Hänsel und Gretel
Der Eisenhans
König Drosselbart
Gevatter Tod
Aschenputtel
Einäuglein, Zweiäuglein und Dreiäuglein
Rotkäppchen
Weitere Märchen
Anmerkungen
,
Abbildungsnachweis
,
Literatur
Vorwort
Den meisten Menschen ist das Märchen schon aus ihrer Jugendzeit bekannt und vertraut, es fasziniert mit seinen undurchschaubaren, „märchenhaften“ Figuren aber auch Erwachsene. Wir dringen in eine geheimnisvolle Welt voller Zauberei ein, wo es Prinzessinnen genauso wie Menschenfresser gibt. Das Märchen unterscheidet sich damit sehr deutlich von der modernen, rationalen Welt der Technokraten und spricht seelische Bereiche unserer Persönlichkeit an, die oft vernachlässigt oder verdrängt werden.
Wenn ich in diesem Buche von Märchen spreche, dann sind damit immer nur die uralten Volksmärchen gemeint, jene Erzählungen, deren Verfasser uns unbekannt sind und die sich − anders als die Sagen -auch keinem eindeutigen Handlungsort zuordnen lassen. Derartige Märchen wurden lange Zeit mündlich erzählt und schließlich irgendeinmal aufgeschrieben.
Ganz anders ist es bei den sogenannten „Kunstmärchen“. Hierbei handelt es sich um Dichtungen, also freie Erfindungen bekannter Verfasser (z. B. Andersen). Sie dürften eigentlich gar nicht „Märchen“ genannt werden, es sind Erzählungen oder Kurzgeschichten ohne mythischen oder mythologischen Wert.
Mit den Märchen befaßt sich eine eigene Abteilung innerhalb der Sprach- und Literaturwissenschaft. Moderne Märchendeutungen allerdings kommen über eine einfache psychologische Ebene meist nicht hinaus. Der Hauptgrund ist, daß die heutige Wissenschaft die Märchen in einzelne Motive zerlegt und nur die Herkunft dieser Motive genauer analysiert. Ein Märchen besteht demnach also nur aus mehr oder weniger zufällig aneinandergereihten Motiven. Damit aber wird der eigentliche mythische Zusammenhang eines Märchens vernachlässigt. Zwangsläufig bleibt nur noch die Motivation der handelnden Personen übrig, die gedeutet werden kann. Der Sinn des Märchens gerät in Vergessenheit.
Es ist also höchste Zeit, sich einmal mit diesem eigentlichen Inhalt der Märchen zu befassen. Ich gehe davon aus − und da weiß ich mich einig mit namhaften Mythologen wie z. B. den Brüdern Grimm, Wilhelm Mannhardt, Wilhelm Wägner oder Karl Simrock, − daß in den meisten Märchen uralte Mythen aus heidnischer Zeit enthalten sind. Oft stehen hinter den heute bekannten Personen der Märchen heidnische Gottheiten. Göttermythen oder Schilderungen von Initiationen sind oft die Vorlagen eines späteren Märchens. Nachdem die heidnische Religion vom Christentum verdrängt wurde, haben die Menschen sich dennoch ihre Mythen weitererzählt; mit der Zeit ging aber oft das Verständnis des Mythos oder die Kenntnis der Gottheiten verloren, so daß diese ursprünglichen heiligen Überlieferungen zum Volksmärchen wurden. Fremde Bestandteile wurden mit eingemischt und alte, unverstandene Dinge weggelassen. Damit kam natürlich auch die Denkweise der Märchenerzähler mit hinein, die vielleicht unklare Handlungsmotivationen wegließen oder änderten. Von Gottheiten und ihren Mythen zu erzählen, war nach der Missionierung natürlich erst recht nicht mehr ungestraft möglich. Die einfachen Menschen wollten aber weiterhin ihre alten Geschichten hören, vielleicht nun weniger zur Belehrung, als vielmehr zur Unterhaltung oder aus alter Gewohnheit. Schließlich gab es noch keine elektronischen Medien (Radio, Fernsehen, Rechner), man war auf die Erzählungen der alten Leute angewiesen oder mußte warten, bis Spielleute in das Dorf kamen, die Geschichten erzählen konnten. Ein weiteres Element der Veränderung war der Sprachgebrauch der Erzähler. So wurde z. B. aus dem ursprünglichen „Tüchlein deck dich“ durch den schwäbischen Dialekt der Erzähler ein „Tischlein deck dich“ usw.
Um ein Märchen zu deuten, ist es notwendig, die möglichst älteste und ursprünglichste Fassung dieses Märchens zu finden; bekanntlich haben alle Sammler und Aufzeichner von Märchen willkürlich Teile verändert, entfernt oder hinzugefügt. Schon die Erzähler haben wahrscheinlich Veränderungen vorgenommen. Beim Märchen ist es leider nicht immer so, daß die älteste Veröffentlichung auch die älteste Fassung dieses Märchens ist. Oft enthalten jüngere Märchensammlungen eine ältere Märchenfassung. Meist ist es aber auch so, daß es nicht klar ist, welche Fassung eines Märchens die ursprünglichste ist. Hier muß der Deuter selbst interpretieren und kann dabei Fehler machen. Ausschließen kann man jedenfalls Veränderungen, die sich gut belegen lassen und die willkürlich eingefügt wurden. Ich gebe daher in diesem Buch die mir bekanntgewordenen Varianten und ältesten Veröffentlichungen an. Oft enthalten auch die späteren Auflagen der Märchenbücher Unterschiede zu der Erstveröffentlichung, die sinnvoll sind, etwa, wenn weitere Varianten oder ältere Fassungen eines Märchens neu aufgenommen worden sind.
Im vorliegenden Buch habe ich mich auf eine Deutung einiger der bekanntesten Märchen aus der Sammlung der Gebrüder Grimm beschränkt, weil diese den meisten Lesern bekannt sein dürften und die Deutung eines bekannten Märchens besonders interessant ist. Für diejenigen, die ein Märchen nicht kennen, oder denen Einzelheiten eines Märchens oder ggfls. die Urfassung nicht bekannt sind, habe ich bei jeder Deutung den Text mit angeführt. Viele Menschen kennen Märchen auch oft nur aus den Verfilmungen, die sich in der Regel nur wenig an das Original halten, oder aus Nacherzählungen für Kinder, deswegen mußten die hier behandelten Märchen wenigstens in einer Fassung vollständig wiedergegeben werden. Zusammen mit den Parallelfassungen sind die für eine Deutung notwendigen Einzelheiten damit bekannt.
Da ich nicht annehmen kann, daß jeder Leser sich mit der germanischen Mythologie gut auskennt, habe ich mythologische Parallelstellen möglichst im Wortlaut aus den nordischen Quellen, z. B. den beiden Eddas (11. Jh.) zitiert..
Dabei will ich keineswegs behaupten, daß meine Deutung immer die richtige und einzig mögliche ist. Tatsächlich handelt es sich bei den Märchen um ursprüngliche Mythen, und Mythen lassen sich bekanntlich auf verschiedenen Ebenen deuten. Darum will mein Buch, welches schon 1998 zu zwei Drittel fertiggestellt war und danach laufend ergänzt wurde, zuerst eine Anregung sein, die Mythen im Märchen zu erkennen und nach ihrer Bedeutung weiter zu forschen.
1.
Der Bärenhäuter
>Es war einmal ein junger Kerl, der ließ sich als Soldat anwerben, hielt sich tapfer und war immer der vorderste, wenn es blaue Bohnen regnete. Solange der Krieg dauerte, ging alles gut, aber als Friede geschlossen war, erhielt er seinen Abschied, und der Hauptmann sagte, er könne gehen, wohin er wollte. Seine Eltern waren tot, und er hatte keine Heimat mehr; da ging er zu seinen Brüdern und bat, sie möchten ihm so lange Unterhalt geben, bis der Krieg wieder anfinge. Die Brüder aber waren hartherzig und sagten: „Was sollen wir mit dir? Wir können dich nicht brauchen, sieh zu, wie du dich durchschlägst“. Der Soldat hatte nichts übrig als sein Gewehr, das nahm er auf die Schulter und wollte in die Welt gehen. Er kam auf eine große Heide, auf der nichts zu sehen war als ein Ring von Bäumen; darunter setzte er sich ganz traurig nieder und sann über sein Schicksal nach. Ich habe kein Geld, dachte er, ich habe nichts gelernt als das Kriegshandwerk, und jetzt, weil Friede geschlossen ist, brauchen sie mich nicht mehr; ich sehe voraus, ich muß verhungern. Auf einmal hörte er ein Brausen, und wie er sich umblickte, stand ein unbekannter Mann vor ihm, der einen grünen Rock trug, recht stattlich aussah, aber einen garstigen Pferdefuß hatte. „Ich weiß schon, was dir fehlt“, sagte der Mann, „Geld und Gut sollst du haben, soviel du mit aller Gewalt durchbringen kannst, aber ich muß zuvor wissen, ob du dich nicht fürchtest, damit ich mein Geld nicht umsonst ausgebe“. – „Ein Soldat und Furcht, wie paßt das zusammen?“ antwortete er, „du kannst mich auf die Probe stellen“. – „Wohlan“, antwortete der Mann, „schau hinter dich“. Der Soldat kehrte sich um und sah einen großen Bären, der brummend auf ihn zutrabte. „Oho“, rief der Soldat, „dich will ich an der Nase kitzeln, daß dir die Lust zum Brummen vergehen soll“, legte an und schoß den Bären auf die Schnauze, daß er zusammenfiel und sich nicht mehr regte. „Ich sehe wohl“, sagte der Fremde, „daß dir's an Mut nicht fehlt, aber es ist noch eine Bedingung dabei, die mußt du erfüllen“. – „Wenn mir's an meiner Seligkeit nicht schadet“, antwortete der Soldat, der wohl merkte, wen er vor sich hatte, „sonst laß ich mich auf nichts ein“. – „Das wirst du selber sehen“, antwortete der Grünrock, „du darfst in den nächsten sieben Jahren dich nicht waschen, dir Bart und Haare nicht kämmen, die Nägel nicht schneiden und kein Vaterunser beten. Dann will ich dir einen Rock und Mantel geben, den mußt du in dieser Zeit tragen. Stirbst du in diesen sieben Jahren, so bist du mein, bleibst du aber leben, so bist du frei und bist reich dazu für dein Lebtag“. Der Soldat dachte an die große Not, in der er sich befand, und da er so oft in den Tod gegangen war, wollte er es auch jetzt wagen und willigte ein. Der Teufel zog den grünen Rock aus, reichte ihn dem Soldaten hin und sagte: „ Wenn du den Rock an deinem Leibe hast und in die Tasche greifst, so wirst du die Hand immer voll Geld haben“. Dann zog er dem Bären die Haut ab und sagte: „Das soll dein Mantel sein und auch dein Bett, denn darauf mußt du schlafen und darfst in kein anderes Bett kommen. Und dieser Tracht wegen sollst du Bärenhäuter heißen“. Hierauf verschwand der Teufel.
Abb. 1. Der Soldat erschießt den Bären.
Der Soldat zog den Rock an, griff gleich in die Tasche und fand, daß die Sache ihre Richtigkeit hatte. Dann hing er die Bärenhaut um, ging in die Welt, war guter Dinge und unterließ nichts, was ihm wohl und dem Gelde wehe tat. Im ersten Jahr ging es noch leidlich, aber in dem zweiten sah er schon aus wie ein Ungeheuer. Das Haar bedeckte ihm fast das ganze Gesicht, sein Bart glich einem Stück grobem Filztuch, seine Finger hatten Krallen, und sein Gesicht war so mit Schmutz bedeckt, daß, wenn man Kresse hineingesät hätte, sie aufgegangen wäre. Wer ihn sah, lief fort, weil er aber allerorten den Armen Geld gab, damit sie für ihn beteten, daß er in den sieben Jahren nicht stürbe, und weil er alles gut bezahlte, so erhielt er doch immer noch Herberge. Im vierten Jahr kam er in ein Wirtshaus, da wollte ihn der Wirt nicht aufnehmen und wollte ihm nicht einmal einen Platz im Stalle anweisen, weil er fürchtete, seine Pferde würden scheu werden. Doch als der Bärenhäuter in die Tasche griff und eine Handvoll Dukaten herausholte, so ließ der Wirt sich erweichen und gab ihm eine Stube im Hintergebäude; doch mußte er versprechen, sich nicht sehen zu lassen, damit sein Haus nicht in bösen Ruf käme. Als der Bärenhäuter abends allein saß und von Herzen wünschte, daß die sieben Jahre herum wären, so hörte er in einem Nebenzimmer ein lautes Jammern. Er hatte ein mitleidiges Herz, öffnete die Türe und erblickte einen alten Mann, der heftig weinte und die Hände über dem Kopfe zusammenschlug. Der Bärenhäuter trat näher, aber der Mann sprang auf und wollte entfliehen. Endlich, als er eine menschliche Stimme vernahm, ließ er sich bewegen, und durch freundliches Zureden brachte es der Bärenhäuter dahin, daß er ihm die Ursache seines Kummers offenbarte. Sein Vermögen war nach und nach geschwunden, er und seine Töchter mußten darben, und er war so arm, daß er den Wirt nicht einmal bezahlen konnte und ins Gefängnis sollte gesetzt werden. „Wenn Ihr weiter keine Sorgen habt“, sagte der Bärenhäuter, „Geld habe ich genug“. Er ließ den Wirt herbeirufen, bezahlte ihn und steckte dem Unglücklichen noch einen Beutel voll Gold in die Tasche.
Als der alte Mann sich aus seinen Sorgen erlöst sah, wußte er nicht, womit er sich dankbar beweisen sollte. „Komm mit mir“, sprach er zu ihm, „meine Töchter sind Wunder von Schönheit, wähle dir eine davon zur Frau. Wenn sie hört, was du für mich getan hast, so wird sie sich nicht weigern. Du siehst freilich ein wenig seltsam aus, aber sie wird dich schon wieder in Ordnung bringen“. Dem Bärenhäuter gefiel das wohl, und er ging mit. Als ihn die älteste erblickte, entsetzte sie sich so gewaltig vor seinem Antlitz, daß sie aufschrie und fortlief. Die zweite blieb zwar stehen und betrachtete ihn von Kopf bis zu Füßen, dann aber sprach sie: „Wie kann ich einen Mann nehmen, der keine menschliche Gestalt mehr hat? Da gefiel mir der rasierte Bär noch besser, der einmal hier zu sehen war und sich für einen Menschen ausgab, der hatte doch einen Husarenpelz an und weiße Handschuhe. Wenn er nur häßlich wäre, so könnte ich mich an ihn gewöhnen“. Die jüngste aber sprach: „Lieber Vater, das muß ein guter Mann sein, der Euch aus der Not geholfen hat; habt Ihr ihm dafür eine Braut versprochen, so muß Euer Wort gehalten werden“. Es war schade, daß das Gesicht des Bärenhäuters von Schmutz und Haaren bedeckt war, sonst hätte man sehen können, wie ihm das Herz im Leibe lachte, als er diese Worte hörte. Er nahm einen Ring von seinem Finger, brach ihn entzwei und gab ihr die eine Hälfte, die andere behielt er für sich. In ihre Hälfte aber schrieb er seinen Namen, und in seine Hälfte schrieb er ihren Namen und bat sie, ihr Stück gut aufzuheben. Hierauf nahm er Abschied und sprach: „Ich muß noch drei Jahre wandern, komm ich aber nicht wieder, so bist du frei, weil ich dann tot bin. Bitte aber Gott, daß er mir das Leben erhält“.
Die arme Braut kleidete sich ganz schwarz, und wenn sie an ihren Bräutigam dachte, so kamen ihr die Tränen in die Augen. Von ihren Schwestern ward ihr nichts als Hohn und Spott zu Teil. „Nimm dich in acht“, sagte die älteste, „wenn du ihm die Hand reichst, so schlägt er dir mit der Tatze darauf“. − „Hüte dich“, sagte die zweite, „die Bären lieben die Süßigkeit, und wenn du ihm gefällst, so frißt er dich auf“. − „Du mußt nur seinen Willen tun“, hub die älteste wieder an, „sonst fängt er an zu brummen“. Und die zweite fuhr fort: „Aber die Hochzeit wird lustig sein; Bären, die tanzen gut“. Die Braut schwieg still und ließ sich nicht irremachen.
Der Bärenhäuter aber zog in der Welt herum, von einem Orte zum andern, tat Gutes, wo er konnte, und gab den Armen reichlich, damit sie für ihn beteten. Endlich, als der letzte Tag von den sieben Jahren anbrach, ging er wieder hinaus auf die Heide und setzte sich unter den Ring von Bäumen. Nicht lange, so sauste der Wind, und der Teufel stand vor ihm und blickte ihn verdrießlich an; dann warf er ihm den alten Rock hin und verlangte seinen grünen zurück. „Soweit sind wir noch nicht“, antwortete der Bärenhäuter, „erst sollst du mich reinigen“. Der Teufel mochte wollen oder nicht, er mußte Wasser holen, den Bärenhäuter abwaschen, ihm die Haare kämmen und die Nägel schneiden. Hierauf sah er wie ein tapferer Kriegsmann aus und war viel schöner als je zuvor.
Als der Teufel glücklich abgezogen war, so war es dem Bärenhäuter ganz leicht ums Herz. Er ging in die Stadt, tat einen prächtigen Sammetrock an, setzte sich in einen Wagen mit vier Schimmeln bespannt und fuhr zu dem Hause seiner Braut. Niemand erkannte ihn, der Vater hielt ihn für einen vornehmen Feldobrist und führte ihn in das Zimmer, wo seine Töchter saßen. Er mußte sich zwischen den beiden ältesten niederlassen; sie schenkten ihm Wein ein, legten ihm die besten Bissen vor und meinten, sie hätten keinen schönern Mann auf der Welt gesehen. Die Braut aber saß in schwarzem Kleide ihm gegenüber, schlug die Augen nicht auf und sprach kein Wort. Als er endlich den Vater fragte, ob er ihm eine seiner Töchter zur Frau geben wollte, so sprangen die beiden ältesten auf, liefen in ihre Kammer und wollten prächtige Kleider anziehen, denn eine jede bildete sich ein, sie wäre die Auserwählte. Der Fremde, sobald er mit seiner Braut allein war, holte den halben Ring hervor und warf ihn in einen Becher mit Wein, den er ihr über den Tisch reichte. Sie nahm ihn an, aber als sie getrunken hatte und den halben Ring auf dem Grunde liegen fand, so schlug ihr das Herz. Sie holte die andere Hälfte, die sie an einem Bande um den Hals trug, hielt sie daran, und es zeigte sich, daß beide Teile vollkommen zueinander paßten. Da sprach er: „Ich bin dein verlobter Bräutigam, den du als Bärenhäuter gesehen hast, aber durch Gottes Gnade habe ich meine menschliche Gestalt wieder erhalten und bin wieder rein geworden“. Er ging auf sie zu, umarmte sie und gab ihr einen Kuß. Indes kamen die beiden Schwestern in vollem Putze herein, und als sie sahen, daß der schöne Mann der jüngsten zu Teil geworden war, und hörten, daß das der Bärenhäuter war, liefen sie voll Zorn und Wut hinaus; die eine ersäufte sich im Brunnen, die andre erhenkte sich an einem Baume. Am Abend klopfte jemand an der Türe, und als der Bräutigam öffnete, so war's der Teufel in grünem Rock, der sprach: „Siehst du, nun habe ich zwei Seelen für deine eine“.<
Das vorstehende Märchen ist die bei den Brüdern Grimm in den späteren Auflagen der „Kinder- und Hausmärchen“ (KHM) als Nr. 101 wiedergegebene Geschichte vom Bärenhäuter. Das gleiche Märchen behandelt auch die Nr. 100 „Des Teufels rußiger Bruder“. In der Urfassung 1812 finden sich die beiden Märchen im 2. Band als Nr. 15 „Der Teufel Grünrock“ und Nr. 14 „Des Teufels rußiger Bruder“.
Abweichende Fassungen.
Grimms Fassung von 1812 „Der Teufel Grünrock“ stammt aus dem Paderbornischen. Hier sind es drei Brüder, die den jüngsten verstoßen. Dieser setzt sich unter den Ring von Bäumen auf der Heide, der Teufel mit einem grünen Rock und Pferdefuß erscheint mit einem Brausen. Der Teufel gibt ihm seinen grünen Rock, in dessen Taschen immer Geld ist, und stellt die bekannten Bedingungen (sieben Jahre nicht Waschen, Beten, Kämmen usw.). Der Bruder hilft nun dem alten Mann und erhält dafür eine der drei Töchter des Alten. Die älteste erschreckt, daß sie einen solchen Menschen, der wie ein Bär aussehe, heiraten soll und läuft fort, desgleichen die zweite Tochter, die jüngste wird dem Bruder verlobt, der sie nach drei Jahren holt, nachdem er die Prüfungen bestanden hatte. Der Teufel muß in dieser Version den Bruder nicht waschen und scheren.
Im Märchen „Des Teufels rußiger Bruder“ begegnet dem Soldaten, der hier Hans heißt, der Teufel als kleines Männchen, der Ring der Bäume wird nicht erwähnt. Hans wird Knecht des Teufels, muß die gleichen Bedingungen erfüllen und in der Hölle unter den Kesseln das Feuer schüren und überall auf Ordnung sehen, er darf aber nicht in die Kessel sehen. Diese Aufgaben erfüllt der Soldat, schließlich aber schaut er heimlich in einen Kessel, sieht seinen ehemaligen Unteroffizier darin und schürt daraufhin das Feuer. In den andern Kesseln sieht er seinen Fähnrich und seinen General, und auch hier legt er extra Holz unter die Kessel. Der Teufel weiß davon, verzeiht ihm aber, weil er Holz nachgelegt hatte. Die sieben Jahre waren für Hans so kurz, daß er meinte, es wäre nur ein halbes Jahr gewesen. Er erhält als Lohn den Kehrdreck und soll in seiner schmutzigen Gestalt nach Hause gehen. Der Kehrdreck wird im Ranzen zu Gold, und der Soldat kehrt in einem Wirtshaus ein, wo ihm der Wirt den Ranzen stiehlt. Der Soldat geht wieder in die Hölle, wird vom Teufel frisiert, gewaschen usw. und erhält neuen Kehrdreck. Nun geht Hans wieder zum Wirt und fordert sein Gold zurück, was ihm auch gegeben wird, da er den Wirt mit dem Teufel schreckt. Als reicher Mann kauft er sich einen einfachen Linnenkittel und geht herum und macht Musik, denn das hatte er in der Hölle gelernt. Der König ist von der Musik so gerührt, daß er ihm seine jüngere Tochter zur Frau gibt, später wird der Soldat selbst König. Diese Fassung haben die Grimms aus Zwehrn.
Beide Märchenvarianten behandeln die alte Sage vom Bärenhäuter, welche schon im Simplicissimus1 erzählt wird2. Dort erhält der Bärenhäuter vom Wirt eine der Töchter, wegen der künstlerischen Bilder, die der Geist für ihn gemalt hatte. Der Soldat lernt in der Hölle Musik, er dient dem Teufel nur eine Zeit und ist dann frei und glücklich.
Verwandt mit dem Märchen ist eine alte Volkssage, die im dänischen Volksbuch als „Broder Ruus“3 erscheint, aber auch in Brunonis Seidelii paroemiae ethicae4 als „frater Rauschius“. Auch im Englischen gibt es den „friar Rush“5. Dieser „Bruder Rausch“ ist aus der Hölle gekommen und wird selbst als ein Teufel dargestellt, er geht in ein Kloster, verdingt sich da zum Koch, und stiftet mancherlei Böses, weil er ja eingentlich ein Kriegsheld ist.
Auch Fischart6 führt einen „rußig Schultheiß aus Mohrenland“ an.
In einer Sage, die Hebbel erzählt7 erscheint der Teufel auch als ein Grünrock, und der sich ihm ergibt, braucht nur in die Tasche zu greifen, so hat er einen Taler.
In der Märchensammlung von Ludwig Bechstein (dieses Märchen erschien zuerst in der 12. Auflage von 1853) trägt unser Märchen den Titel „Rupert, der Bärenhäuter“8. Hier wird der Name des Soldaten „Rupert“ genannt. Der Soldat trifft im Wald den Teufel, erlegt einen Bären, geht die bekannten Bedingungen ein und erhält den grünen Rock als Gewand, das Bärenfell aber als Mantel und Schlafdecke. Ansonsten ist das Märchen mit der Grimmfassung identisch.
Im Schweizer Märchen „Der Teufel als Schwager“9 ist ein armer Bursche im Wirtshaus und kann nicht schlafen, weil er die Zeche nicht bezahlen kann. Da erscheint ihm der Teufel und bietet den bekannten Handel an. Eine Bedingung ist, daß er die sieben Jahre in diesem Wirtshaus verbringen muß. Er führt die Bedingungen aus, und im 6. Jahre kommt der verarmte Kaufmann, der ihm eine seiner drei Töchter verspricht, und dem der Bursche dafür mit seinem Gelde hilft. Zwei Töchter lehnen den Burschen ab, nur die jüngste nicht. Als die sieben Jahre um sind, wäscht und frisiert sich der Bursche und heiratet die jüngste Tochter. Die anderen Töchter bringen sich aus Ärger um. Auf dem Weg von der Kirche ins Dorf sieht der Bursche den Teufel, der ihm sagt: „Weißt, Schwager, es ist so: Du hast eine und ich hab zwo“
In Rußland heißt das Märchen „Der Ungewaschene“10. Hier setzt sich der Soldat an einem See − dem uralten Zugang in die Unterwelt − nieder, aus dem dann ein Teufelchen kommt. Er muß die Bedingungen (nicht Waschen usw.) ganze 15 Jahre durchhalten. Der Teufel bringt ihm immer Gold aus diesem See. Der Soldat nutzt aber das Gold, um den Armen zu helfen. Schließlich benötigt auch der Zar Gold, und erhält von dem Soldaten zwölf Lastwagen voll unter der Bedingung, daß eine der drei Zarentöchter ihn heiratet. Ein Bild von ihm wird angefertigt und der ältesten Tochter gezeigt. Diese möchte lieber mit den Teufeln gehen, als den Soldaten zu heiraten, desgleichen die mittlere Tochter. Nur die jüngste Tochter ist bereit, ihr Schicksal anzunehmen. Als die Hochzeitsfeier gerade abgehalten werden soll, sind die 15 Jahre um. Der Teufel zerhackt den Soldaten in kleine Stücke, wirft ihn in einen Kessel und läßt ihn kochen. Er kocht ihn ab, nimmt ihn heraus und legt alles zusammen, wie sichs gehört, Knochen zu Knochen, Gelenk zu Gelenk, Sehne zu Sehne. Dann spritzt er Wasser des Todes und Wasser des Lebens darauf und der Soldat steht als schmucker Bursche da. Hier ist ganz eindeutig ein alter Wiedergeburtsmythos verarbeitet. Schon bei den Celten kannte man eine Gottheit, die in ihrem großen Kessel die Menschen sterben und wiedergeboren werden ließ (s. Abb. 2) − ein Motiv, das sich bis zu dem mittelalterlichen Jungbrunnen erhalten hat. Da diese Gottheit in Hosen dargestellt ist und sich zu ihren Füßen ein kleiner Hund oder Wolf befindet, könnte es sich um einen dem Wodan entsprechenden Gott handeln.
Auch das genaue Zusammenlegen der Knochen erinnert stark an einen Wiedergeburtsmythos. In der jüngeren Edda wird eine ähnliche Wiederbelebungsszene erzählt (Gylfaginning 44):
Abb. 2: Wiedergeburtsszene auf der Innenseite des Kessels von Gundestrup, Dänemark, 2./1. Jh. v. u. Zt: Eine Gottheit taucht die Toten in den Kessel und macht sie so zu lebendigen Kriegern, die auf Pferden fortreiten.
>Zu Nacht nahm Thórr seine Böcke und schlachtete sie; darauf wurden sie abgezogen und in den Kessel getragen. Und als sie gesotten waren, setzte sich Thórr mit seinen Gefährten zum Nachtmahl ... Da legte Thórr die Bocksfelle neben denn Herd, und sagte, der Bauer und seine Hausleute möchten die Knochen auf die Felle werfen ... Thórr aber blieb die Nacht da, und am Morgen stund er auf vor Tag, kleidete sich, nahm den Hammer Mjöllnir und erhob ihn, die Bocksfelle zu weihen. Da standen die Böcke auf.<
Das russische Märchen endet damit, daß der Oberteufel dem Teufelchen zürnt, weil es ihm trotz des vielen Goldes nicht gelungen war, die Seele des Soldaten zu bekommen. Dieses verteidigt sich aber dadurch, daß es ja die zwei Seelen der Zarentöchter bekommen hat.
Deutung.
In der nordischen Ynglinga saga11 lesen wir über die Berserkir-Krieger:
>Odins Männer gingen ohne Panzer und waren toll wie Hunde oder Wölfe, bissen in ihre Schilde und waren stärker als Bären oder Stiere. Sie erschlugen die Leute, aber sie selbst verwundete weder Feuer noch Eisen; das nannte man Berserksgangr (Berserkerwut)<.
Der Soldat, also ein bewährter Krieger, geht in einen Ring von Bäumen. Dieser Ring von Bäumen ist eine alte, heidnische Kult- und Opferstätte. Hier sinnt er über sein Leben nach und macht sich Gedanken über sein Dasein als Krieger. Da erscheint ihm mit einem Wind (Brausen) der Teufel, ursprünglich eine heidnische Gottheit, die er doch wohl angerufen hatte, denn das war der Sinn des Betretens einer Kultstätte. Der Teufel vertritt ja in zahllosen Sagen und Märchen heidnische Gottheiten und hat sogar Attribute (Pferdefuß, Bocksfuß, Gestalt) von heidnischen Gottheiten übernommen. Denkbar ist auch, daß hier ein Priester als Vertreter der Gottheit wirkt. Der grüne Rock, den der Teufel trägt, bedeutet nach Meinung der Grimms, daß er ein „Weltkind“, also ein Mensch des Diesseits, der irdischen Welt, ist. Ich aber glaube, daß das Grün des Gewandes der Gottheit die Natur selbst symbolisiert − denn der Soldat beginnt nun eine Ausbildungszeit, die in erster Linie in der freien Natur durchgeführt wurde. Die Gottheit gibt sich mit dem grünen Rock als Natur- und Wachstumsgottheit zu erkennen. Dieser grüne Rock, die Natur, die Pflanzenwelt, ernährt den Soldaten während der Ausbildungszeit. Da der Teufel mit Brausen kommt, kann man an den ursprünglichen Wind- und Totengott Wodan (Ódinn) denken, der ja der Hauptgott der Berserker ist.
Abb. 3: Tiergestaltige Krieger auf wendelzeitlichen Helmblechen aus Torslunda (Öland, Schweden), 6. /7. Jh. u. Zt.
Der Soldat muß mit einer Probe seinen Mut und seine Geschicklichkeit beweisen, er muß einen Bären erschießen, der zufällig gerade hinter ihm erscheint (siehe Abb. 1, S. →). Ursprünglich, als es noch keine Feuerwaffen gab, mußte er den Bären erlegen. Nur im direkten Kampf Mann gegen Bär ist es wirklich eine Mut- und Kraftprobe, das bloße Erschießen des Bären mit dem Gewehr erscheint als Probe nicht glaubwürdig. Wir können also erahnen, daß dieses Märchen schon lange vor der Erfindung der Feuerwaffen existiert haben muß, als die Bärentötung noch eine echte Mutprobe war. Der Soldat erhält nun den grünen Rock, der ihn ernährt; dies u. a. auch deswegen, weil in seinen Taschen immer Reichtum ist − der Reichtum der Natur, und er muß darüber das abgezogene Bärenfell tragen − so in der oben wiedergegebenen Märchenfassung. Schon auf vendelzeitlichen schwedischen Helmblechen (6./7. Jh.), z. B. aus Torslunda (Öland) finden wir Darstellungen maskierter Krieger (Abb. 3). Wie alt dieser Kult schon ist, belegen die Höhlenbilder mit Fell und Maske versehener Schamanen der Höhle Trois Frères (Ariège), ca. 10000 − 30000 Jahre vor u. Ztr. (Abb. 4, S. →).
Wir kommen hier in einen uralten Bereich des kultischen, schamanischen Kriegertums. Die Initiation und Ausbildung dieser Krieger besteht darin, daß sie eine bestimmte Zeit − bei den Wikingern waren es drei Jahre − im Walde, in der Natur leben müssen. Hier verbinden sie sich mit ihrer Klangottheit und dem heiligen Tier des Kriegerklans, welches sie als erste Mutprobe erlegen müssen. Sie trinken das Blut oder essen das Herz des Tieres, auch wohl die Leber, um so selbst zum Tiere zu werden, die Kraft der Gottheit durch das der Gottheit heilige Tier aufzunehmen. Sie gewinnen den Geist des Tieres als Schutzgeist und hängen sich das Fell um. Auch der nordische Volksheld Sigurdr (Siegfried) erlegte einen Drachen, aß dessen Herz und legte sich die Drachenhaut als Rüstung um. Nur an der Verschlußstelle am Rücken war er allein noch verwundbar. Die Vorstellung, daß er sich die Drachenhaut umlegt, ging in den jüngeren Sagenvarianten verloren, wo er nur noch im Blute des Drachen badet und ein Lindenblatt die verwundbare Stelle bringt. Verbunden mit bestimmten Ekstasetechniken, z. B. Rauschdrogen, Trancereisen usw. erhalten die Krieger das Gefühl der Unverwundbarkeit. Diese Ekstase wird vor einem Kampf künstlich herbeigeführt; man hat festgestellt, daß die Berserkerwut (Berserksgangr) die Berserker immer am Abend oder in der Nacht überkam, häufig nach dem Genuß von Bier. So vermutet man bestimmte pflanzliche Zusätze im Biere, vor allem Bilsenkraut (daher „Bilsener“ und die Stadt „Pilsen“, wo das Bilsenkraut angebaut wurde) und Sumpfporst, die noch im Spätmittelalter einer breiten Schicht von Menschen bekannt waren. Diesen drogenähnlichen Zusätzen sollte das Bayerische Bierreinheitsgebot des 16. Jhs. ein Ende bereiten, denn chemische Zusätze im Bier gab es damals noch gar nicht.
Nun wird auch der in den anderen Fassungen des Märchens erhaltene Name des Soldaten, „Bruder Rausch“, verständlich; der Krieger versucht, einen Rausch- oder Ekstasezustand zu erreichen, um in die „an dere“ Welt blicken zu können. Wodan ist ja auch der Gott der kultischen Ekstase (Wodan oder Ódinn bedeutet „Wut, Raserei, Ekstase“). In der bechsteinschen Fassung heißt der Soldat „Rupert“; dieser Name hängt mit dem Namen des im Volksglauben bekannten „Knecht Ruprecht“ zusammen. Ruprecht, „hruod-peraht“, d. i. wie „Rupert“ der „Ruhmumglänzte“ ist ein Name des Göttervaters Wodan. Der Soldat hat also einen besonderen Bezug zu Wodan, was in seinem Namen zum Ausdruck kommt. Ruprecht bzw. Wodan (Ódinn) ist auch die heidnische Vorlage des bekannten christlichen Heiligen Nikolaus. Das belegt unter anderem ein alter thüringer Kindervers12:
Abb. 4: Maskierter Tänzer aus der Höhle Les Trois Frère (Ariège, Frankreich), 10000 - 30000 Jahre v. u. Zt.
>Wer kommt denn da geritten?
Herr Wude, Wude Nikolaus!
Laß mich nicht lange bitten
Und schüttle deinen Beutel aus.<
Und in der Nikolauslegende gibt es nun gerade einen Zug, den wir auch in unserem Märchen finden. In dem mittelalterlichen Nikolausspiel „Tres filie“ (Drei Töchter) aus dem Kloster von Fleury, Frankreich, ist die folgende legendarische Erzählung vom Bischof Nikolaus von Myra überliefert13:
>Einst wurde ihm erzählt, daß zu Patara ein Mann vom Adel so sehr verarmt sei, daß er sich entschlossen habe, die Unschuld seiner drei gut erzogenen Töchter dem Laster preiszugeben, um sich, der sich des Bettelns schämte, vor dem Hungertode zu retten. In der nächsten Nacht suchte er das Haus des unglücklichen Vaters auf und warf durch das offene Fenster eine große Summe Geldes hinein, womit der bekümmerte Mann seine älteste Tochter versorgte. Dieses wiederholte er zum zweiten und dritten Male, um auch die Unschuld der beiden andern Töchter zu retten. Aber die dritte Nacht hatte der Vater geflissentlich mit Wachen zugebracht, um den unbekannten Wohltäter kennenzulernen. Als der Heilige sein drittes Geschenk in die Kammer warf, eilte ihm der Vater schnell nach und warf sich ihm voll Dankbarkeit zu Füßen, um ihm seinen Dank auszudrücken. Aber Nikolaus hob ihn auf, sagte ihm, er habe nur die Pflicht eines Christen erfüllt, und forderte von ihm, niemandem etwas davon zu offenbaren<.
Nikolaus wirft dem Mann drei Mal einen Klumpen Gold durchs Fenster. Dies ist der Grund, daß drei goldene Kugeln oder drei goldene Äpfel zu Attributen des Heiligen wurden. Natürlich bedeuten die drei Goldkugeln oder -äpfel viel mehr (siehe Seite →ff). Das nächtliche Werfen durchs Fenster zeigt, daß es ursprünglich eine Gottheit war, von der die Gaben stammten, nämlich Wodan (Ódinn), dessen Beinamen „Nikarr“ und „Nikudr“ durch „Nikolaus“ ersetzt wurden. Das bedeutet nicht, daß es einen Bischof Nikolaus nicht auch real gegeben habe, aber daß er zu einem Heiligen und mit Legenden und Attributen Wodans versehen wurde, ist ein deutlicher Versuch, den populären Kult dieses Gottes auch in das Christentum zu integrieren. Im Märchen gibt der Soldat, der in seiner siebenjährigen Zeit selbst ein Geistwesen verkörpert, dem alten Mann mit den drei Töchtern das Geld, um dessen Schulden zu bezahlen.
Ein alter Wodans-Mythos, der sich nur noch in der christlichen Fassung als Nikolauslegende erhalten hat, findet sich also in unserem Märchen angedeutet, welches sich gerade auf diesen Gott und die Initiation eines seiner Anhänger bezieht.
Heidnisches Kriegertum.
Nach der Erlegung des Klantieres beginnt erst die mehrjährige Lehrzeit, wobei die Krieger oft in Gruppen zusammengefaßt sind. In der Sagaliteratur finden wir häufig gerade 12 Berserker, die zusammengehören (z. B. in der Egils saga Skallagrímssonar, der Vatnsdoela saga, der Hrólfs saga Kráka). Noch bis ins 17. Jh. hinein gab es „geschulte Diebe“, Räuberverbände, die in den Wäldern lebten und deren maskierte Mitglieder strenge Prüfungen bestehen mußten. Die heutigen Perchtengilden sind aus solchen Kriegerverbänden entstanden14.
Diese Krieger wurden übrigens meist überall gerne aufgenommen und bewirtet, da sie auch den Segen ihrer Gottheit mitbrachten. Die Krieger standen der Gottheit näher, als andere Menschen. Berichte über die „Wilde Jagd“ des Wut- und Ekstasegottes Wodan (Ódinn) gehören hierher und sind zuweilen durchaus als Realschilderungen heidnischer Kriegergruppen zu werten.
Es gab übrigens nicht nur die Berserker und Ulfhednar, also Bären- und Wolfskrieger. Jene waren vielmehr die Elitekrieger. Der Normalfall waren wohl Kriegergruppen mit anderen Klantieren, meist Eber und Hirsch und Wildschaf. Der maskierte Tänzer aus der Höhle Les Trois Frères (Abb. 4) trägt ja ein Hirschgeweih, und noch um 1616 stellte man germanische Krieger als nackte Kämpfer mit Hirschfellen dar (siehe Abb. 5).
Im Märchen werden dem Soldaten nun die Bedingungen genannt, die er als Berserkeranwärter zu erfüllen hat: Nicht waschen, kämmen, schnippen, keine Nägel und Haare abschneiden und kein Wasser aus den Augen wischen. Der Soldat soll also verwildern, um ihm damit den Kontakt zu den Geistern und Göttern zu ermöglichen, zu den noch „wild“ lebenden Urgewalten. Das Verbot des Haareschneidens rührt daher, daß im Haar die magische Kraft lokalisiert wird (siehe Seite →ff).
Auch die Götter selbst lassen sich die Haare wachsen, wenn sie eine besondere Aufgabe lösen wollen und dafür eine starke magische Kraft benötigen. In der Völuspá der älteren Edda (Vers 34) und den Vegtamsqvida (Vers 11) heißt es über den Gott Wale (Váli):
Abb. 5: Germanische Krieger mit Tierfellen. Abbildung aus Philipp Klüwers „Germania Antiqua“ 1616.
>Die Hände nicht wusch er, das Haar nicht kämmt' er Eh er zum Bühle trug Baldrs Töter.<
Der Norwegerkönig Haraldr nannte sich Harald Wirrhaar, denn er hatte das Gelübde abgeschlossen, sich erst dann wieder die Haare zu schneiden, wenn er sich ganz Norwegen unterjocht hätte. Als das gelungen war, nannte er sich Harald Schönhaar (hárfagr).
Und der Römer Tacitus schreibt in der Germania (Kap. 31)15:
>Eine Sitte, die auch bei andern Völkern der Germanen vorkommt, aber nur selten und als Beweis der Tatenlust einzelner, die ist bei den Chatten allgemein geworden, sobald sie ins Jünglingsalter getreten sind, Haupthaar und Bart wachsen zu lassen, und erst nach Erlegung eines Feindes die der Tapferkeit gelobte und verpflichtete Gestaltung ihres Antlitzes wieder abzulegen (...) Sehr vielen Chatten gefällt dieses Äußere, und sie haben oft schon bei grauem Haar noch diese Auszeichnung und sind deshalb wie bei den Feinden, so bei ihren Landsleuten auch hoch angesehen. In allen Schlachten machen sie den Anfang, sie sind stets die erste Schlachtreihe, ein befremdender Anblick; nimmt ihr Antlitz doch in Frieden selbst kein milderes Ansehen an. Keiner hat eine Wohnung oder ein Feld oder irgendein Geschäft: Zu wem sie gerade kommen, von dem werden sie ernährt, Verschwender fremden Gutes, des eigenen Verächter, bis kraftloses Alter sie zu so rauher Kriegsmannweise unfähig macht<.
Wir finden hier wiederum das Elitekriegertum („vorderste Schlachtreihe“), das Leben in der Natur („keine Wohnung“) wie beim Grünrock, das Einkehren bei anderen Menschen (im Märchen ist es der Wirt), wo sie ernährt werden.
Im Märchen dauert diese magische Zeit sieben Jahre, sie kommt dem Soldaten aber wie ein halbes Jahr vor. Nach vier Jahren findet die Verlobung statt, so daß der Soldat drei Jahre auf die Hochzeit warten muß. Gerade aber drei Jahre dauerte auch die Zeit der Wíkingerzüge, die eine jüngere Form dieser „Bewährung“ waren. In den Sagas, z. B. der Kormaks saga, finden wir häufig die Verlobung und dann das Ausziehen des Kriegers auf Wíkingfahrt. Drei Jahre später kehrt der Krieger heim und heiratet.
Auf dem Ding, der Volksversammlung, wurden die Totschläger „geächtet“, d. h. sie mußten drei Jahre außer Landes gehen. Taten sie das nicht, verfielen sie der lebenslangen Ächtung. Die dreijährige Verbannungszeit geht auf die dreijährige Initiationszeit zurück, denn der Totschläger hat sich gegen die göttliche Ordnung gestellt, er hat sein Heil und seinen Götterbeistand verloren. In den drei Jahren soll er den Kontakt zu den Göttern in der Natur wieder herstellen um sein Heil zurückzugewinnen.
Wenn der Krieger sich bewährt hatte, seine Lehrzeit beendet war, dann wurden ihm die Haare geschnitten und er wurde gewaschen und neu eingekleidet. Er erhielt meist auch einen neuen Namen. Auch bei den Rittern war dies Brauch; nach der Zeit als Knappe (= Knabe) und der Bewährung erhielt er eine Rüstung, ein Lehen und einen neuen Namen. Bei der Aufnahme eines Novizen in ein Kloster war es ähnlich, der neue Mönch wird eingekleidet und ihm werden die Haare geschnitten (Tonsur), dazu erhält er seinen Mönchsnamen. Bei allen Aufnahmen finden wir diese Riten in abgewandelter Form.
Daß der Soldat in der einen Variante des Märchens direkt in der Hölle dienen muß, ist ein Hinweis auf seine Zeit in der Andernwelt, im Tempel (wo das ewige Tempelfeuer brannte) oder im Heiligtum. Bedingung in einer Variante des Märchens ist, daß er im Wirtshause wohnen muß. Dieses Wirtshaus steht für das Heiligtum oder den Tempel, in welchem die Kultfeste mit großen Gelagen stattfanden. Der Wirt ist dabei der Priester des Tempels, der Teufel, der in der Nacht im Wirtshaus erscheint, ist die Gottheit, zu der der Soldat den Kontakt herstellt. In einer Variante dient er sogar in einem (heidnischen?) Kloster, also in einer Art Kultgemeinschaft bzw. Kultstätte. Und daß Berserker sogar durchs Feuer gehen konnten und Glut essen, ist in den schriftlichen Überlieferungen des Nordens bezeugt. Darum werden im Märchen die Feuer der Hölle erwähnt. Der Kessel in der Hölle ist schließlich ein schwacher Abglanz der einstigen Kultkessel, die sich in den Heiligtümern befanden, und in denen das Blut der Opfertiere aufgefangen wurde. Die Hölle steht somit für das Reich der Götter, Helheim (Frau Holles Reich) oder Walhall (Valholl), wo Wodan und Frick herrschen. Daß der Soldat dort das Musizieren erlernte, erinnert an Kultmusik, -gesänge und -tänze im Heiligtum. Musik hat darüberhinaus einen eigenen Zauber, der bewirkt, daß Menschen „entrückt“ werden. So lockte auch Musik den Tannhäuser in den Berg der Frau Venus. Der Teufel wird häufig als Geiger dargestellt, während die frühe Kirche und der Islam das Musizieren mit Instrumenten ablehnten. So ist es auch in unserer Zeit schon vorgekommen, daß Islamisten Musikinstrumente absichtlich zerstörten.
Abb. 6: Sibirischer Schamane in Tierverkleidung und mit Trommel. Aus: Nicholas Witsen, Noord en Oost Tartarye, 1705.
Da diese Form des germanischen Kriegertums sehr ähnlich dem Schamanismus anderer Völker ist, können wir der Musik im Märchen die Aufgabe der Tranceherbeiführung zusprechen. Schamanenheiler oder Schamanenkrieger bringen sich mithilfe von Musik, meist Liedern und Trommelklängen, in den für ihre Arbeit wichtigen Trance. Die Abb. 6 zeigt einen mit einem Hirschfell samt Geweih bekleideten tanzenden tartarischen Schamanen, der eine Handtrommel schlägt und singt. Das Bild (es ist ein Ausschnitt) stammt aus dem Jahre 1705.
Der Soldat war kein junger Bursche, der erst zum Krieger werden mußte, der Soldat im Märchen ist bereits bewährter, gestandener Krieger. Er wird nun zum Elitekrieger, der sich einer Gottheit verschreibt. Es ist in diesem Sinne eine zweite, höhere Initiation, die aber nach dem gleichen Initiationsschema abläuft.
Falls der Soldat aber seine Bedingungen nicht erfüllt hätte, würde seine Seele der Gottheit gehören, der er sich geweiht hat (im Märchen durch den Teufel ersetzt). Somit würde er auch in diesem Falle das höchste Ziel erreichen, die Rückkehr zur Gottheit. So er aber die Prüfungen besteht, hat er darüberhinaus noch die Möglichkeit, auf dieser Erde weitere Aufgaben zu erfüllen und somit noch weiter auf seinem Weg fortzuschreiten.
Werwölfe.
Werwölfe (= Mann-Wölfe) sind im Volksglauben Männer, die sich zu bestimmten Zeiten in Wölfe verwandeln. Schon Herodot erwähnte im 5. Jh. v. u. Zt. Menschen des baltischen Stammes der Neuren, die die Fähigkeit besaßen, sich alljährlich einige Tage in Wölfe zu verwandeln. In der Vorstellung ist der Mann mit dem Wolf bereits fest verwachsen, er verwandelt sich in einen Wolf. Die ältere Vorstellung, die in unserem Märchen noch vorhanden ist, geht davon aus, daß der Krieger oder Schamane das Fell des Tieres (also z. B. eines Wolfes) überlegt. Auf diese Weise will er zum Tier oder Tiergeist werden. Schamanen ahmen daher sogar ihr jeweiliges Tier nach, machen entsprechende Bewegungen und die Laute des Tieres. Sie wollen mit dem Tier identisch werden, ja selbst zum Tier werden. Dies sehen wir bereits beim Maskentänzer aus der Höhle Les Trois Freres (Abb. 4, S. →), denn sein Kopf ist eindeutig kein menschlicher Kopf, sondern ein Tierkopf. Der Schamane ist also zum Tier geworden und wird entsprechend dargestellt.
Beim Werwolf ist es nun ähnlich, nur daß hier das Krafttier immer ein Wolf ist. Letztendlich entspricht der mittelalterliche Werwolf dem ursprünglichen Ulfhednar (Wolfshäuter) der nordischen Überlieferungen. In der Darstellung wird der Werwolf ähnlich wie der Maskentänzer von Les Trois Frères nicht mehr als verkleideter Mensch, sondern als Mensch mit Wolfskopf und Wolfsfell dargestellt (siehe Abb. 7).
Die Werwolfvorstellung bekam auch Nahrung von zuweilen vorkommenden Haarmenschen, also Menschen mit extremer Körperbehaarung (siehe Figur).
Abb. 7: Werwolf.
Im Jahre 1550 beschrieb Olaus Magnus in seiner „Historia de gentibus septentrionalibus“ Werwölfe in Preußen und dem Baltikum, die am Weihnachtsabend Überfälle auf Menschen und Vieh veranstalteten und außerdem in die Bierlager gingen, wo sie dann Wein und Met tranken. Hier finden wir also deutliche Hinweise auf kultische Kriegerbünde, die in der heiligen Zeit des Julfestes herumzogen, sich Fleisch zum Essen und Bier und Met beschafften und die bei einzelnen Menschen einkehrten. Mythologische Grundlage ist die Vorstellung des Geister- oder Totenheeres, der „wilden Jagd“, die in den Winterstürmen durch die Lüfte zieht. Die Werwolfkrieger brachten aber sowohl dem Hof, wo sie sich niederließen, als auch den Feldern Segen und Frucht-barkeit, da sie als Vertreter der Götter und Geister angesehen wurden. Heute ziehen zur Weihnachtszeit noch maskierte Perchten umher, die auf kultische Männerbünde zurückgeführt werden.
Weitere verwandte Motive.
Auch das bekannte Märchen „die Schöne und das Tier“, welches 1756 von Jeanne-Marie Leprince de Beaumont (1711-1780) in ihrem „Magasin des enfans“ in London veröffentlicht wurde, ist nur eine Variante unseres Bärenhäuter-Themas. Sie beruht auf einer Erzählung in Madame de Villeneuves Roman „La Jeune Ameriquaine et les Contes Marins“ (La Haye 1740).
Ein verarmter Kaufmann verirrt sich im Wald in einem menschenleeren Schloß und bricht dort für seine jüngste Tochter eine Rose, die diese sich gewünscht hatte, während die älteren Töchter nur Reichtum wollten. Der Besitzer des Schlosses, ein Tier, fordert den Tod des Kaufmanns oder stellvertretend einer seiner Töchter. Die jüngste ist bereit, für den Vater in das Schloß zu gehen, und verliebt sich dort in das Tier. Als sie im Zauberspiegel sieht, daß ihr Vater zu Hause erkrankt sei, darf sie zurück, muß aber in einer bestimmten Frist zurückkehren. Die bösen Schwestern überlisten sie aber, so daß die Frist verstreicht. Sie sieht im Traum das sterbende Tier, kehrt nun zu ihm in das Schloß und will dort für immer bleiben. Damit ist das Tier erlöst, wird zum schönen Prinzen, während eine Fee die bösen Schwestern zu Steinbildern verwandelt.
Das Tier im Waldschloß ist der Bärenhäuter in Heiligtum bzw. Wirtshaus, wo er seine Initiation durchmacht, der arme Kaufmann entspricht dem armen Mann, dem der Bärenhäuter hilft und von dem er darum eine Tochter bekommen soll. Lediglich die Eingangsschilderung von der Gottheit, die den Prinzen oder Soldaten in diese Tiergestalt bringt und von den Bedingungen, die dieser nun einzuhalten hat, ist in dieser Fassung des Märchens nichts mehr erhalten. Die deutsche Überlieferung vom Bärenhäuter steht also der ursprünglichen Schilderung viel näher, als diese französische Variante.
Es finden sich in diesem Märchen auch Motive des Mythos von Amor und Psyche, den Apulejus (geb. 130 u. Zt.) zuerst niedergeschrieben hatte. Venus beschloß, Psyche („Seele“) wegen ihrer großen Schönheit, man nannte sie „zweite Venus“, zu verderben und schickte ihren Sohn Amor („Liebe“), der Psyche in den verworfensten Menschen verliebt machen sollte. Er aber verliebte sich selbst in Psyche und lebte mit ihr glücklich in einem Palast, besuchte sie aber nur nachts, so daß sie ihn nie sah. Als einmal Psyches Schwestern sie besuchten, redeten diese ihr aus Neid ein, sie sei mit einem Ungeheuer zusammen, welches sie töten müßte. Als Psyche in der Nacht das vermeintliche Ungeheuer töten wollte, nahm sie eine Lampe und sah den schönen Amor, den sie natürlich nun nicht mehr töten wollte. Dieser erwachte und mußte sie verlassen, weil sie sein Gebot (ihn nicht zu sehen) mißachtet hatte. Psyche machte sich auf die Suche und kam auch in Venus' Palast, wo sie fast unerfüllbare Aufträge für Venus erfüllen mußte, die auf ihren Untergang abzielten. Aber mit Amors unsichtbarer Hilfe schaffte sie alles und wurde von Zeus dadurch erlöst, daß sie unsterblich wurde und Amor heiratete.
2.
Tischlein deck dich
>Vor Zeiten war ein Schneider, der drei Söhne hatte und nur eine einzige Ziege. Aber die Ziege, weil sie alle zusammen mit ihrer Milch ernährte, mußte ihr gutes Futter haben und täglich hinaus auf die Weide geführt werden. Die Söhne taten das auch nach der Reihe. Einmal brachte sie der älteste auf den Kirchhof, wo die schönsten Kräuter standen, ließ sie da fressen und herumspringen. Abends, als es Zeit war heimzugehen, fragte er: „Ziege, bist du satt?“ Die Ziege antwortete:
„Ich bin so satt,
Ich mag kein Blatt: Meh! Meh!“
„So komm nach Haus“, sprach der Junge, faßte sie am Strickchen, führte sie in den Stall und band sie fest. „Nun“, sagte der alte Schneider, „hat die Ziege ihr gehöriges Futter?“ − „Oh“, antwortete der Sohn, „die ist so satt, sie mag kein Blatt“. Der Vater aber wollte sich selbst überzeugen, ging hinab in den Stall, streichelte das liebe Tier und fragte: „Ziege, bist du auch satt?“ Die Ziege antwortete:
„Wovon sollt ich satt sein?
Ich sprang nur über Gräbelein
Und fand kein einzig Blättelein: Meh! Meh!“
„Was muß ich hören!“ rief der Schneider, lief hinauf und sprach zu dem Jungen: „Ei du Lügner, sagst, die Ziege wäre satt, und hast sie hungern lassen?“ Und in seinem Zorne nahm er die Elle von der Wand und jagte ihn mit Schlägen hinaus. Am andern Tag war die Reihe am zweiten Sohn, der suchte an der Gartenhecke einen Platz aus, wo lauter gute Kräuter standen, und die Ziege fraß sie rein ab. Abends, als er heim wollte, fragte er: „Ziege, bist du satt?“ Die Ziege antwortete:
„Ich bin so satt,
Ich mag kein Blatt: Meh! Meh!“
„So komm nach Haus“, sprach der Junge, zog sie heim und band sie im Stalle fest. „Nun“, sagte der alte Schneider, „hat die Ziege ihr gehöriges Futter?“ − „Oh“, antwortete der Sohn, „die ist so satt, sie mag kein Blatt“. Der Schneider wollte sich darauf nicht verlassen, ging hinab in den Stall und fragte: „Ziege, bist du auch satt?“ Die Ziege antwortete:
„Wovon sollt ich satt sein?
Ich sprang nur über Gräbelein
Und fand kein einzig Blättelein: Meh! Meh!“
„Der gottlose Bösewicht!“ schrie der Schneider, „so ein frommes Tier hungern zu lassen!“ lief hinauf und schlug mit der Elle den Jungen zur Haustüre hinaus.
Die Reihe kam jetzt an den dritten Sohn; der wollte seine Sache gut machen, suchte Buschwerk mit dem schönsten Laube aus und ließ die Ziege daran fressen. Abends, als er heim wollte, fragte er: „Ziege, bist du satt?“ Die Ziege antwortete:
„Ich bin so satt,
Ich mag kein Blatt: Meh! Meh!“
„So komm nach Haus“, sagte der Junge, führte sie in den Stall und band sie fest. „Nun“, sagte der alte Schneider, „hat die Ziege ihr gehöriges Futter?“ − „Oh“, antwortete der Sohn, „die ist so satt, sie mag kein Blatt“. Der Schneider traute nicht, ging hinab und fragte: „Ziege, bist du auch satt?“ Die Ziege antwortete:
„Wovon sollt ich satt sein?
Ich sprang nur über Gräbelein
Und fand kein einzig Blättelein: Meh! Meh!“
„O die Lügenbrut!“ rief der Schneider, „Einer so gottlos und pflichtvergessen wie der andere! Ihr sollt mich nicht länger zum Narren haben!“ Und vor Zorn ganz außer sich, sprang er hinauf und gerbte dem armen Jungen mit der Elle den Rücken so gewaltig, daß er zum Haus hinaussprang. Der alte Schneider war nun mit seiner Ziege allein. Am andern Morgen ging er hinab in den Stall, liebkoste die Ziege und Sprach: „Komm, mein liebes Tierlein, ich will dich selbst zur Weide führen“. Er nahm sie am Strick und brachte sie zu grünen Hecken und zu Schafrippe und was sonst die Ziegen gerne fressen. „Da kannst du dich einmal nach Herzenslust sättigen“, sprach er zu ihr und ließ sie weiden bis zum Abend. Da fragte er: „Ziege, bist du satt?“ Sie antwortete:
„Ich bin so satt,
Ich mag kein Blatt: Meh! Meh!“
„So komm nach Haus“, sagte der Schneider, führte sie in den Stall und band sie fest. Als er wegging, kehrte er sich noch einmal um und sagte: „Nun bist du doch einmal satt!“. Aber die Ziege machte es ihm nicht besser und rief:
„Wovon sollt ich satt sein?
Ich sprang nur über Gräbelein
Und fand kein einzig Blättelein: Meh! Meh!“
Als der Schneider das hörte, stutzte er und sah wohl, daß er seine drei Söhne ohne Ursache verstoßen hatte. „Wart“, rief er, „du undankbares Geschöpf, dich fortzujagen ist noch zu wenig; ich will dich zeichnen, daß du dich unter ehrbaren Schneidern nicht mehr darfst sehen lassen!“ In einer Hast sprang er hinauf, holte sein Bartmesser, seifte der Ziege den Kopf ein und schor sie so glatt wie seine flache Hand. Und weil die Elle zu ehrenvoll gewesen wäre, holte er die Peitsche und versetzte ihr solche Hiebe, daß sie in gewaltigen Sprüngen davonlief.
Der Schneider, als er so ganz einsam in seinem Hause saß, verfiel in große Traurigkeit und hätte seine Söhne gerne wiedergehabt, aber niemand wußte, wo sie hingeraten waren.
Der älteste war zu einem Schreiner in die Lehre gegangen; da lernte er fleißig und unverdrossen, und als seine Zeit herum war, daß er wandern sollte, schenkte ihm der Meister ein Tischchen, das gar kein besonderes Aussehen hatte und von gewöhnlichem Holz war − aber es hatte eine gute Eigenschaft. Wenn man es hinstellte und sprach: „Tischchen, deck dich“, so war das gute Tischchen auf einmal mit einem sauberen Tüchlein bedeckt, und stand da ein Teller, und Messer und Gabel daneben, und Schüsseln mit Gesottenem und Gebratenem, soviel Platz hatten, und ein großes Glas mit rotem Wein leuchtete, daß einem das Herz lachte. Der junge Gesell dachte: Damit hast du genug für dein Lebtag, zog guter Dinge in der Welt umher und bekümmerte sich gar nicht darum, ob ein Wirtshaus gut oder schlecht und ob etwas darin zu finden war oder nicht. Wenn es ihm gefiel, so kehrte er gar nicht ein, sondern im Felde, im Wald, auf einer Wiese, wo er Lust hatte, nahm er sein Tischchen vom Rücken, stellte es vor sich und sprach: „Deck dich“, so war alles da, was sein Herz begehrte.
Endlich kam es ihm in den Sinn, er wollte zu seinem Vater zurückkehren, sein Zorn würde sich gelegt haben, und mit dem „Tischchen deck dich“ würde er ihn gerne wieder aufnehmen. Es trug sich zu, daß er auf dem Heimweg abends in ein Wirtshaus kam, das mit Gästen angefüllt war; sie hießen ihn willkommen und luden ihn ein, sich zu ihnen zu setzen und mit ihnen zu essen, sonst würde er schwerlich noch etwas bekommen. „Nein“, antwortete der Schreiner, „die paar Bissen will ich euch nicht vom Munde nehmen, lieber sollt ihr meine Gäste sein“. Sie lachten und meinten, er triebe seinen Spaß mit ihnen. Er aber stellte sein hölzernes Tischchen mitten in die Stube und sprach: „Tischchen, deck dich!“ Augenblicklich war es mit Speisen besetzt, so gut, wie sie der Wirt nicht hätte herbeischaffen können und wovon der Geruch den Gästen lieblich in die Nase stieg. „Zugegriffen, liebe Freunde“, sprach der Schreiner, und die Gäste, als sie sahen, wie es gemeint war, ließen sich nicht zweimal bitten, rückten heran, zogen ihre Messer und griffen tapfer zu. Und was sie am meisten verwunderte, wenn eine Schüssel leer geworden war, so stellte sich gleich von selbst eine volle an ihren Platz. Der Wirt stand in einer Ecke und sah dem Dinge zu; er wußte gar nicht, was er sagen sollte, dachte aber: Einen solchen Koch könntest du in deiner Wirtschaft wohl brauchen. Der Schreiner und seine Gesellschaft waren lustig bis in die späte Nacht, endlich legten sie sich schlafen, und der junge Geselle ging auch zu Bett und stellte sein Wünschtischchen an die Wand. Dem Wirte aber ließen seine Gedanken keine Ruhe; es fiel ihm ein, daß in seiner Rumpelkammer ein altes Tischchen stände, das geradeso aussähe − das holte er ganz sachte herbei und vertauschte es mit dem Wünschtischchen. Am andern Morgen zahlte der Schreiner sein Schlafgeld, packte sein Tischchen auf, dachte gar nicht daran, daß er ein falsches hätte, und ging seiner Wege.
Zu Mittag kam er bei seinem Vater an, der ihn mit großer Freude empfing. „Nun, mein lieber Sohn, was hast du gelernt?“ sagte er zu ihm. „Vater, ich bin ein Schreiner geworden“. − „Ein gutes Handwerk“, erwiederte der Alte, „aber was hast du von deiner Wanderschaft mitgebracht?“ − „Vater, das Beste, was ich mitgebracht habe, ist das Tischchen“. Der Schreiner betrachtete es von allen Seiten und sagte: „Daran hast du kein Meisterstück gemacht, das ist ein altes und schlechtes Tischchen“. − „Aber es ist ein Tischchen deck dich“, antwortete der Sohn, „wenn ich es hinstelle und sage ihm, es soll sich decken, so stehen gleich die schönsten Gerichte darauf, und ein Wein dabei, der das Herz erfreut. Ladet nur alle Verwandten und Freunde ein, die sollen sich einmal laben und erquicken, denn das Tischchen macht sie alle satt“. Als die Gesellschaft beisammen war, stellte er sein Tischchen mitten in die Stube und sprach: „Tischchen, deck dich“. Aber das Tischchen regte sich nicht und blieb so leer wie ein anderer Tisch, der die Sprache nicht versteht. Da merkte der arme Geselle, daß ihm das Tischchen vertauscht war, und schämte sich, daß er wie ein Lügner dastand. Die Verwandten aber lachten ihn aus und mußten ungetrunken und ungegessen wieder heimwandern. Der Vater holte seine Lappen wieder herbei und schneiderte fort, der Sohn aber ging bei einem Meister in die Arbeit.
Der zweite Sohn war zu einem Müller gekommen und bei ihm in die Lehre gegangen. Als er seine Jahre herum hatte, sprach der Meister: „Weil du dich so wohl gehalten hast, so schenke ich dir einen Esel von einer besonderen Art; er zieht nicht am Wagen und trägt auch keine Säcke“. − „Wozu ist er denn nütze?“ fragte der junge Geselle. „Er speit Gold“, antwortete der Müller, „wenn du ihn auf ein Tuch stellst und sprichst 'Bricklebrit', so speit dir das gute Tier Goldstücke aus, hinten und vorn“. − „Das ist eine schöne Sache“, sprach der Geselle, dankte dem Meister und zog in die Welt. Wenn er Gold nötig hatte, brauchte er nur zu seinem Esel „Bricklebrit“ zu sagen, so regnete es Goldstücke, und er hatte weiter keine Mühe, als sie von der Erde aufzuheben. Wo er hinkam, war ihm das Beste gut genug, und je teurer, je lieber, denn er hatte immer einen vollen Beutel. Als er sich eine Zeit lang in der Welt umgesehen hatte, dachte er: Du mußt deinen Vater aufsuchen; wenn du mit dem Goldesel kommst, so wird er seinen Zorn vergessen und dich gut aufnehmen. Es trug sich zu, daß er in dasselbe Wirtshaus geriet, in welchem seinem Bruder das Tischchen vertauscht war. Er führte seinen Esel an der Hand, und der Wirt wollte ihm das Tier abnehmen und anbinden, der junge Geselle aber sprach: „Gebt Euch keine Mühe, meinen Grauschimmel führe ich selbst in den Stall und binde ihn auch selbst an, denn ich muß wissen, wo er steht“. Dem Wirt kam das wunderlich vor, und er meinte, einer, der seinen Esel selbst besorgen müßte, hätte nicht viel zu verzehren; als aber der Fremde in die Tasche griff, zwei Goldstücke herausholte und sagte, er sollte nur etwas Gutes für ihn einkaufen, so machte er große Augen, lief und suchte das Beste, das er auftreiben konnte. Nach der Mahlzeit fragte der Gast, was er schuldig wäre; der Wirt wollte die doppelte Kreide nicht sparen und sagte, noch ein paar Goldstücke müßte er zulegen. Der Geselle griff in die Tasche, aber sein Gold war eben zu Ende. „Wartet einen Augenblick, Herr Wirt“, sprach er, „ich will nur gehen und Gold holen“, nahm aber das Tischtuch mit. Der Wirt wußte nicht, was das heißen sollte, war neugierig, schlich ihm nach, und da der Gast die Stalltüre zuriegelte, so guckte er durch ein Astloch. Der Fremde breitete unter dem Esel das Tuch aus, rief „Bricklebrit“, und augenblicklich fing das Tier an, Gold zu speien von hinten und vorn, daß es ordentlich auf die Erde herabregnete. „Ei der tausend“, sagte der Wirt, „da sind die Dukaten bald geprägt! So ein Geldbeutel ist nicht übel!“ Der Gast bezahlte seine Zeche und legte sich schlafen, der Wirt aber schlich in der Nacht hinab in den Stall, führte den Münzmeister weg und band einen andern Esel an seine Stelle.
Den folgenden Morgen in der Frühe zog der Geselle mit seinem Esel ab und meinte, er hätte seinen Goldesel. Mittags kam er bei seinem Vater an, der sich freute, als er ihn wiedersah, und ihn gerne aufnahm. „Was ist aus dir geworden, mein Sohn?“ fragte der Alte. „Ein Müller, lieber Vater“, antwortete er. „Was hast du von deiner Wanderschaft mitgebracht?“ − „Weiter nichts als einen Esel“. − „Esel gibt's hier genug“, sagte der Vater, „da wäre mir doch eine gute Ziege lieber gewesen“. − „Ja“, antwortete der Sohn, „aber es ist kein gemeiner Esel, sondern ein Goldesel − wenn ich sage 'Bricklebrit', so speit Euch das gute Tier ein ganzes Tuch voll Goldstücke. Laßt nur alle Verwandten herbeirufen, ich mache sie alle zu reichen Leuten“. − „Das laß ich mir gefallen“, sagte der Schneider, „dann brauch ich mich mit der Nadel nicht weiter zu quälen“, sprang selbst fort und rief die Verwandten herbei. Sobald sie beisammen waren, hieß sie der Müller Platz machen, breitete sein Tuch aus und brachte den Esel in die Stube. „Jetzt gebt Acht“, sagte er und rief „Bricklebrit“, aber es waren keine Goldstücke, was herabfiel, und es zeigte sich, daß das Tier nichts von der Kunst verstand, denn es bringt's nicht jeder Esel so weit. Da machte der arme Müller ein langes Gesicht, sah, daß er betrogen war und bat die Verwandten um Verzeihung, die so arm heimgingen, als sie gekommen waren. Es blieb nichts übrig, der Alte mußte wieder nach der Nadel greifen und der Junge sich bei einem Müller verdingen.