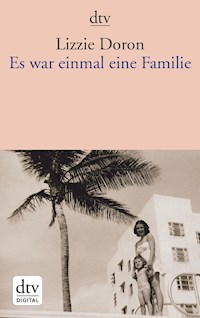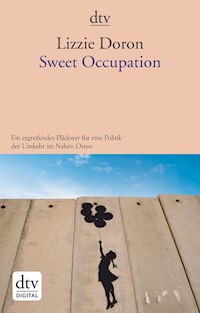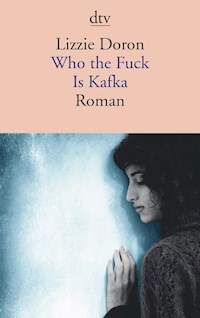9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte eines in letzter Minute wiedergefundenen Freundes Am Abend ein Anruf aus dem Hospiz: Yigal, ein Kindheitsfreund, den Lizzie Doron vierzig Jahre lang nicht gesehen hat, bittet sie, sein letzter Besuch zu sein. Aber warum ausgerechnet sie? Yigals Erfahrungen in der israelischen Armee machten ihn zum Aktivisten gegen die Politik seines Heimatlandes. Als Tochter einer Holocaust-Überlebenden hielt auch Lizzie ihn für einen Verräter und wandte sich von ihm ab. Jetzt stellt sie sich der Frage, wer damals wen verraten hat. In den frühen Morgenstunden macht Lizzie sich auf den Weg. In der Hoffnung, den Kindheitsfreund noch ein letztes Mal sehen zu können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 118
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Lizzie Doron
Was wäre wenn
Roman
Aus dem Hebräischen vonMarkus Lemke
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Dezember 2018
19:00 Uhr
Abends.
Zu Hause.
Ich bin zurück aus dem Hospiz.
Yigal Ben Dror wird morgen sterben.
Er hat seine letzten Tage genau geplant. Ausgerechnet mich hat er gebeten, der letzte Mensch zu sein, den er trifft, bevor er sich aus diesem Leben verabschiedet. Nach vielen Jahren der Funkstille und kurzem Zögern bin ich hingefahren. Einem, der im Sterben liegt, schlägt man keine Bitte ab.
Eine Stunde nachdem ich seine Aufforderung erhalten hatte, irrte ich bereits über die Flure des Hospizes und wollte wissen, wo Ben Dror liegt.
»Ben Dror? Haben wir nicht«, antwortete mir eine Schwester.
Für einen Moment kam mir der aberwitzige Gedanke, ich könnte Opfer eines Streichs geworden sein. Aber eine solche Aufforderung konnte kein Scherz sein.
»Aber ich habe doch eine Nachricht bekommen. Haben Sie denn vielleicht einen Yigal?«
Die Schwester sah noch einmal nach. »Raum Nummer 4.«
Kurze Zeit später stand ich in einem Türrahmen. »Ben Dror?«, fragte ich.
»Unter Dobrinsky hättest du mich schneller gefunden«, flüsterte er.
Ich blieb weiter in der Zimmertür stehen. Da lag er, kahler Schädel, geschlossene Augen, ein Aquarium mit Fischen, ein Papagei im Käfig, sonst nur Stille und Weiß. Viel Weiß.
Ich atmete tief ein, nahm all meinen Mut zusammen und trat ein, näherte mich ihm, lächelte. Und so wahr ich lebe, mit eigenen Augen sah ich, dass auch er lächelte, obwohl die seinen geschlossen waren.
19:14
Ich trage immer noch meine Jacke. Achtlos lege ich sie beiseite und gehe weiter in die Küche. Schalte den Wasserkocher an und schneide mir eine tröstliche Scheibe vom Schokoladenhefezopf ab. Yigal Ben Dror. Nur ein paar gelegentlich aufflackernde Erinnerungen trage ich von ihm mit mir herum. In den letzten vierzig Jahren ist er nicht allzu häufig in meinen Gedanken aufgekreuzt.
Und ausgerechnet mich wollte er heute Abend treffen.
Ich kriege keine Luft mehr. Das ist der Hefezopf. In einem Hustenanfall verteile ich die Kuchenkrümel keuchend in alle Richtungen, mache, kaum wieder zu Atem gekommen, Gesicht und Tisch sauber und stutze erneut. Yigal und ich, was ist das für eine Geschichte?
Ich habe ihn nicht gefragt: »Warum ausgerechnet ich?«
Habe auch nicht gefragt: »Wie geht es dir?«
Wie es ihm geht, ist ihm schließlich auf den Leib geschrieben.
Um der Verlegenheit Herr zu werden, wollte ich wissen: »Wen hast du noch eingeladen?«
»Jeden, d-der …« Das Sprechen fiel ihm schwer.
Danach habe nur ich geredet.
Bevor ich gegangen bin, hat er die Augen aufgeschlagen, hat mich angesehen und gesagt: »Es tut nicht weh.« Und »Danke« hat er auch gesagt. Und ich habe gesagt, »Bye« – als würden wir uns morgen wiedersehen.
November 1956
Ich bin drei Jahre und drei Monate alt.
Es ist Nacht.
Sirenen.
Draußen tobt der Sinaikrieg.
Mutter hebt mich hastig aus dem Bett, nimmt mich auf den Arm. Im Eingang des zur Straße offenen Treppenhauses bleibt sie stehen. Die Nachbarinnen kommen aus ihren Häusern, auch sie halten ihre kleinen Kinder an die Brust gedrückt.
»Wenigstens sterben wir im Lande Israel«, sagt eine von ihnen.
»Und wir werden ein Grab haben«, sagt eine andere.
»Eine größere Wonne gibt es nicht«, fügt meine Mutter hinzu. »Gepriesen … der uns am Leben erhalten, uns beschützt und diese Tage hat erreichen lassen.« Sie wirft diese Worte in die lastende Stille, die alle dort im Treppenhaus überkommt. Keine Ahnung, ob das wirklich eine Erinnerung ist, die sich mir damals eingebrannt hat, oder bloß eine Geschichte, die ich später gehört habe. Jedenfalls war es danach kalt und stockfinster und über uns war das Dröhnen der Flugzeuge.
Der Krämer, der Schuster, der Galanteriewarenladen, die Krankenkasse und der Kindergarten. Ein Wirbelstrom aus Worten füllt meinen Kopf, und die Bilder ziehen wie ein Stummfilm vor meinen Augen vorüber.
Das Haus, der Hof, die Pfade, sandige Gassen und ein Geruch nach Schimmel, nach Naphthalin, nach Taya-Shampoo und Velveta-Creme, nach Hühnersuppe.
Meine Nase leidet unter Insuffizienz, und meine Mutter platzt im geblümten Kleid in meine Erinnerung, geht mit mir im Kinderwagen auf einem sandigen, holprigen Weg spazieren und singt »Oyfn veg shteyt a boym« und »Stiller, stiller lomir shweygn, Kvorim – Gräber – wachsen do«. Im Schreib- und Spielwarenladen kauft sie mir eine weinende Puppe und einen schweigsamen Teddy, und als ich vier werde, bekomme ich überraschend einen Hund aus dem Tierheim.
»Damit noch jemand im Haus ist, der schnauft und bellt«, sagt sie und hält einen hinkenden rötlichen Kläffer auf dem Arm, der mit dem Schwanz wedelt und winselt.
Dezember 2018
19:20
Ich bin allein zu Hause. Der Kühlschrank summt, die Waschmaschine rumpelt. Von draußen höre ich den Aufzug. Es ist die Stunde, in der die Gerätschaften das Wort ergreifen.
Nach und nach füllt sich die Küche mit Toten. Die Gesichter von einigen sind mir noch gegenwärtig, an ihre Namen erinnere ich mich nicht mehr. Sie scharen sich um mich: ein Mädchen, das überfahren wurde; ein Junge mit Krücken; ein Soldat, der im Krieg gefallen ist; eine Frau, die sich das Leben genommen hat; die Kosmetikerin, die wollte, dass wir alle schöner aussehen, und sich an unserer Akne verging. Und meine Mutter. Die möchte, dass ich einschlafe, und mir »Nacht, Nacht, drei Reiter sind auf der Wacht« vorsingt.
Bald wird sich auch Yigal zu ihnen gesellen.
Sie wissen es nur noch nicht.
Yigal Ben Dror. Yigal Dobrinsky.
Ich durchstreife das Haus auf der Suche nach mehr Erinnerungen. Am Ende des Flurs liegt mein Arbeitszimmer. Dort ziehe ich ein Album mit Fotos aus meiner Kindheit aus dem Regal, schwarz-weiß. Ich beginne, darin zu blättern. Ich mit einer Chanukkakerze auf dem Kopf, ich mit einer Israelfahne in der Hand am Unabhängigkeitstag, mit einem Clownshut zu Purim und mit einem weißen Band um den Kopf zum Wochenfest. Hängen bleibe ich bei einem Foto aus dem Tierpark. Ich bin vielleicht ein Jahr alt, und meine Mutter hält mich auf dem Arm. Sie blickt zum Himmel, und dort, auf Wolkenhöhe, erfasst das Objektiv noch den Kopf einer Giraffe. Dann ein Bild vom Strand, ich sitze in einem Schwimmreifen im Sand, und Mutter baut mir eine Burg.
Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Ich erkenne mich auf dem Foto kaum wieder.
Ich lasse die Alben auf dem Schreibtisch liegen und mache mir in der Küche noch ein Glas Tee. Lasse die warme Flüssigkeit in mich einsickern. Das macht mir ein angenehmes Gefühl im Bauch, ein bisschen wie damals im Kindergarten. Ich habe eine blaue Stofftasche, darin ein belegtes Brot mit Quark, Gurkenscheiben und Paprikaschnitzen, eine Flasche mit Himbeersaft und ein paar Stückchen Schokolade. Ich trage halbhohe Schuhe und einen Pullover, für den Fall, dass es schon im September kühl wird. Tova, die Kindergärtnerin, und acht weitere Kinder warten auf mich. Alle weinen, und Tova singt uns Lieder vor: »Unser Garten«, »Das Bärenlied«, »Ich habe das schönste Eis« und »Ein gutes neues Jahr dem Helden, dem Onkel auf der Wacht, und jedem Wächter in Stadt und Land einen Gruß dargebracht«.
Kein Zweifel – ich verstand nichts.
In der Kreativitätsstunde stellen wir Kleber aus Mehl und Wasser her, malen mit Fingerfarben und spielen im Sand. Meine Mutter ist die Einzige, die alle zwei Stunden kommt, um nachzusehen, ob alles in Ordnung ist. Der Kindergärtnerin sagt sie, sie habe ja nur mich. Die Kindergärtnerin verspricht, im Lande Israel werde keinem etwas passieren.
Eines Tages kommt eine Schwester von der Krankenkasse in den Kindergarten. Sie untersucht uns auf Läuse. Meine Mutter wird beinahe ohnmächtig. Läuse gibt es in Auschwitz. »Wie kann es im Lande Israel Läuse geben?«, fragt sie. Die Kindergärtnerin hat darauf keine Antwort.
Mutter will mich daraufhin aus dem Kindergarten nehmen und zu Hause behalten. Die Kindergärtnerin erklärt ihr, es bestehe Kindergartenpflicht und es gebe keine andere Wahl. Aber noch am selben Tag will auch ich nach Hause und nie wieder in den Kindergarten. Ich versuche, mit einer Plastikharke einen geheimen Fluchttunnel zu graben. Nach ein paar Tagen, als ich schon fast resigniere, geschieht ein kleines Wunder und ich finde ein Loch im Zaun. Ich fliehe aus dem Kindergarten und weiß vor Freude gar nicht, wohin mit mir. Und auch den Weg nach Hause kenne ich nicht.
Aber in dem Viertel, in dem ich aufgewachsen bin, geht man nicht verloren. Der Mann aus Sobibor kennt die Frau aus Bergen-Belsen gut, und sie bringt mich zu der Frau aus dem Ghetto Krakau, die mich schließlich zu der richtigen Mutter aus Auschwitz zurückbringt.
Meine Mutter schimpft mit mir und schreit, aber nicht allzu viel.
Ich stelle das leere Teeglas in der Küche in die Spüle. Es gibt Erinnerungen, die sind hartnäckig wie Hundszahngras. Eine elementare Angst packt mich. Wir waren Kinder, und das ist lange her. Jetzt sind wir fünfundsechzig – und die Zeit der Abschiede hat begonnen. Yigal, ein Wiedersehen von neununddreißig Minuten.
In meinen Gedärmen eine Revolte.
Eine scharfe Kurve im Herzen.
1974
Es ist einer jener Frühlingstage, an denen Jasminwind weht. Ich bin auf dem Weg nach Hause, als ein röhrendes Motorrad quietschend neben mir hält. Ein junger, ganz in Schwarz gekleideter Mann sitzt darauf. Ich mache einen Satz zurück.
»Ich bin’s, Ben Dror, erkennst du mich nicht«, sagt er und steckt sich mit seinem Feuerzeug eine Zigarette an. »Ich bin wieder da«, fügt er überflüssigerweise hinzu, den Blick auf die Feuerzeugflamme in seinen Händen gerichtet.
Ich stehe wie angewurzelt. Frage: »Was machst du hier?«, anstatt: »Wie geht es dir?«
»Und du?« Ich nehme ein nicht zu unterdrückendes Zittern in seiner Stimme wahr.
»Ich komme gerade von der Universität.« Wie spricht man mit jemandem, der aus der Gefangenschaft kommt? Ich habe keine Ahnung.
»Rauchst du?«, fragt er und bietet mir eine Zigarette an.
»Nein. Aber möchtest du vielleicht auf einen Kaffee mit raufkommen?«, frage ich, ohne es wirklich zu meinen.
»Zu deiner Mutter? Jetzt hat sie wirklich einen Grund, mich rauszuwerfen, ich bin ein Bandit, der im Gefängnis gesessen hat.«
Ich brauche noch einen Moment, um seinen Blick unter dem Helm zu deuten. Seine Augen sind auf den Boden gerichtet.
»Also, was machst du hier?«
»Einen kurzen Abstecher zum Markt, um meinem Vater Schalom zu sagen.«
»Und was ist mit deiner Mutter?«
»Hast du einen Freund?«
»Ja«, erwidere ich mit einem Lächeln, das von der ganz großen Liebe kündet.
»Und kenne ich ihn?«
»Nein, wir haben uns an der Universität getroffen. Er studiert Ingenieurwissenschaften und wohnt im Norden von Tel Aviv.« Wieso gebe ich so bereitwillig Details preis?
»Und wie lange geht das schon?«
»Fünf Monate.« Plötzlich regt sich eine grausame Freude in mir. »Und du?«
»Komisch«, sagt er wie zu sich selbst, aber laut und vernehmlich. »Dass ich mit Anfang zwanzig das Gefühl habe, der beste Teil meines Lebens ist schon vorüber.«
Unsere Blicke treffen sich nicht, und etwas in mir wird weich.
»Triffst du noch jemanden von den anderen?«, frage ich.
»Die Toten, meinst du?« Er klingt bitter und verärgert. »Und du?«
»Nein.«
Das Gespräch beginnt, uns beide zu erschöpfen, und er scheint die Geduld zu verlieren. Bevor er seine Maschine anlässt, wünscht er mir noch ein gutes weiteres Leben, und ich, in einer typischen Geste oder aus Gewohnheit, trete einen Schritt vor, um ihn zu umarmen. Er wedelt mit den Armen, um mich auf Abstand oder selbst das Gleichgewicht zu halten, aber ich kann die Bewegung meines Körpers schon nicht mehr aufhalten.
»Ich kann nicht. Das geht nicht, wegen der Narben, die haben mir die Haut abgeschält.«
Als wir uns voneinander lösen, schaue ich in sein Gesicht und habe das Gefühl, ein Teil von ihm sei der Mensch, den ich kannte, und ein Teil nicht, und dass auch er mich ansieht und neu einschätzt.
»Ich dachte, du würdest mir beibringen, wie man liebt«, sagt er mit schwacher, ungeschützter Stimme.
Jetzt bin ich es, die beide Augen zu Boden richtet.
Er ist jemand, den ich zu einer anderen Zeit gekannt habe.
Ich stehe so, dass die schräg einfallenden Sonnenstrahlen mich blenden und ich die Augen nicht aufschlagen kann. Schon ist er weg. Mit seinem Motorrad wirbelt er den Sand in den Gassen auf.
Als er verschwunden ist, nehmen meine Füße scheinbar leicht und unbeschwert die Treppe, aber mein Herz sinkt in mir wie ein Stein. Ich trete in die Wohnung und schließe mich in meinem Zimmer ein.
Am nächsten Tag finde ich in unserem Briefkasten einen Brief:
Ich bin verurteilt, die Last der Ketten meiner Generation zu tragen.
Ich tue daraufhin, was ich noch nie getan habe. Ich suche im Telefonbuch nach seiner Nummer und rufe ihn an. Eine beunruhigte Stimme antwortet mit einem schwachen »Hallo«, und noch ehe ich dazu komme, etwas zu sagen, ist schon wieder aufgelegt worden.
Man erzählt mir, nachts brause er auf seinem Motorrad an der Baracke der Pfadfinder vorbei, an seinem Haus, um den Markt, über den Hof der Grund- und der Mittelschule, rase an dem Falafelstand vorbei. Und an dem Haus, das damals meines gewesen ist.
1957
Ich bin vier Jahre alt.
Meine Mutter übergibt sich in einen Eimer.
Ich betrachte den säuerlichen Auswurf und erstarre.
Der Hausarzt, ein Spezialist mit Diplom für Darmerkrankungen und Hämorriden von der Universität Warschau, fürchtet, sie sei sehr krank. Er überweist sie ins Krankenhaus. Ich bin an ihrer Seite. Sie hat niemanden, bei dem sie mich lassen könnte.
Ich höre die Ärzte besorgt sagen, sie drohe zu dehydrieren. Sie bekommt Infusionen, und ich renne über die Flure und schreie, »Mama stirbt«. Eine nette Krankenschwester nimmt mich mit ins Schwesternzimmer und schenkt mir ein Set mit Spritzen und Kanülen. Sie packt alles in ein Erste-Hilfe-Täschchen und erklärt mir, so könne ich meine Mutter retten.
Mutter kommt nach Hause, liegt noch ein paar Tage im Bett, spricht mit sich selbst. Wenn ich verstohlen in ihr Zimmer schaue, sagt sie, sie rede mit Verwandten, aber mit solchen, die man nicht sehen kann.
Besorgte Nachbarn bieten an, auf mich aufzupassen, ja sogar, mich zu adoptieren.
Ich packe meine Kindergartentasche und teile Mutter mit, ich würde dorthin gehen, wo wir eine echte Familie hätten. Und ich wolle nicht die Tochter der Nachbarn sein. Aber Mutter schließt die Augen und schläft ein, und die allernervigste Nachbarin von allen bringt mich am nächsten Morgen in den Kindergarten.
Ich habe keine Ahnung, ob all das wirklich passiert ist.