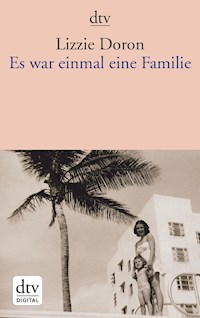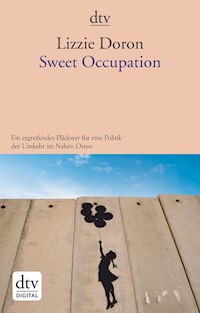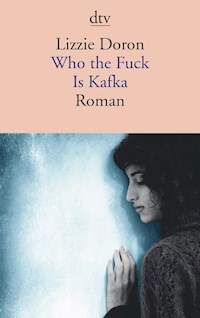8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Dass am Ende einer israelischen Radiosendung plötzlich »ein Schlager aus dem Lager« gespielt wird, hat Folgen. Und eine Vorgeschichte: Die Moderatorin Amalia Ben Ami ist mit diesem Lied aufgewachsen, ebenso Chesi und Gadi, die beiden Männer, die sie während der gemeinsamen Jugend in einem Tel Aviver Viertel liebten. Alle drei sind Kinder von Überlebendender Shoah. Jetzt, vierzig Jahre später, führt das Lied das Trio von damals wieder zusammen. Hinreißend komisch und tief erschütternd ist Lizzie Dorons Roman. Mit abgründigem Humor erzählt sie von Amalia, Chesi und Gadi, die, egal, wo und wie sie ihr Glück suchen, sich den Schatten der Geschichte noch immer stellen müssen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 294
Ähnliche
Lizzie Doron
Der Anfang von etwas Schönem
Roman
Aus dem Hebräischen von Mirjam Pressler
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Amalia
Ich bin nicht auf der Welt, um jemandem Freude zu machen
1
»Was ist das?«, fragte mich der Zollbeamte am Flughafen.
»Grabsteine«, antwortete ich.
Er betrachtete die Marmorsteine. »Wer hat die in Ihre Tasche gepackt?«, wollte er wissen.
»Ich.«
»Haben Sie mit Antiquitäten zu tun?«
»Nein, mit Verrückten«, erwiderte ich ihm.
Ich war mit dem Nachtflug von Polen nach Israel zurückgekommen, zusammen mit hundert Schülern von der Berufsschule in Nahariya, alle in blauen Hemden mit dem Davidstern und der Aufschrift »Das Volk Israel lebt«, begleitet von Lehrern und Erziehern. Schon über Zypern hatten sie angefangen zu singen: »Wir bringen euch Frieden.« Viereinhalb Stunden lang war ich gegen meinen Willen Teil einer patriotischen Delegation gewesen, die vom Besuch der Lager zurückkam.
Als wir landeten, atmete ich erleichtert auf. Ich lief so schnell wie möglich Richtung Ausgang, doch ein Zollbeamter hielt mich zurück. Er zog ein Stück Marmor aus meiner Tasche und versuchte zu lesen, was darauf eingemeißelt war. »Was haben Sie mit diesen Steinen vor?«, fragte er.
»Ein Denkmal für Chesi«, antwortete ich. Ich wollte weg, aber der Zollbeamte holte im Schneckentempo alle Steinstücke aus meiner Tasche und prüfte eines nach dem anderen. »Suchen Sie Verwandte?«, fragte ich.
»Ich habe noch nie erlebt, dass jemand verdreckte Grabsteinstücke aus dem Ausland mitbringt«, zischte er einem klein gewachsenen Beamten zu, der sich der Kontrolle angeschlossen hatte, und sein Gesicht verzog sich zu einem Ausdruck, der sagen sollte: Mit der da stimmt was nicht.
Den Zwergenhaften ließen die Steine vollkommen gleichgültig, er wollte nur meine persönlichen Daten wissen.
»Ich bin Amalia Ben Ami«, stellte ich mich vor.
»Wer?«
»Amalia Ben Ami, aus dem Radio.«
»Wer?«, fragte er noch einmal, bis er nach einem Blick in meinen Pass feststellte, dass ich wirklich ich war, und mich gehen ließ.
Ich eilte davon. Ich wusste, dass Michaela, meine Schwester, schon auf mich wartete. Das hatte sie versprochen, als ich sie um Mitternacht angerufen hatte, um ihr mitzuteilen, dass ich zurückkomme.
Sie stand in der Ankunftshalle, in einem Gucci-Kostüm, auf Pfennigabsätzen und mit all dem Glitzerschmuck unserer Mutter behängt. Wie zu erwarten, Gucci am Morgen. Die Lady hat nichts anderes zum Anziehen.
Als sie mich sah, erschrak sie. »Was ist mit dir passiert? Du siehst schrecklich aus.«
Ich bedankte mich für das Kompliment.
Sie reagierte auf meinen Ton. »Oho! Ich verstehe, deine Romanze mit Chesi ist zu Ende.«
Wozu brauchte ich sie? Warum hatte ich sie gebeten, mich abzuholen? Hatte etwa jemand alle Taxis vor dem Flughafen verbrannt?
Die Straße war leer. Michaela steuerte ihren Jeep und schwieg. So war sie, eine Kopie unserer Mutter, genau wie Mutter presste sie die Lippen zusammen und schwieg, ihr schönes Gesicht völlig starr, wie in Formalin konserviert.
»Malinka, wir sind ein Wunder«, hörte ich Chesi sagen. »Wir sind der Anfang von etwas Schönem.«
Warum habe ich ihm geglaubt? Verzweiflung packte mich.
Ich begann, das Wiegenlied unserer Mutter zu summen, die Hymne unserer Kindheit. »Still, still, mein Kind, schweig still, hier wachsen Gräber.« Damit regte ich Michaela auf.
»Du singst wie Mutter«, sagte sie. Der Eyeliner und die Wimperntusche liefen ihr über die rosigen Wangen, ihre kleinen Nasenlöcher bebten. Wie schnell Michaela Chens porzellanartige Verpackung Risse bekommt. Normalerweise beherrscht sie die Situation. Bei ihr ist immer alles in Ordnung. Der Mann, die Töchter, die Galerie.
Bis wir nach Hause kamen, summte ich vor mich hin, und sie hörte mir zu. Am Eingang blieb ich einen Moment stehen. Zwei Wochen war ich nicht hier gewesen, und jetzt sah der Himmel über mir blauer aus und das Gras um mich herum grüner. Ich sog den Morgenduft ein.
»Was hast du mitgebracht?«, fragte Michaela, als wir die schwere Tasche hineinschleppten.
»Schau es dir an«, schlug ich vor.
Sie öffnete die Tasche, noch bevor wir im Haus waren. »Was ist das?«, fragte sie entsetzt.
»Grabsteine«, antwortete ich.
»Du bist verrückt.«
Aus den Augenwinkeln sah ich schon die Gladiolen, die sie in eine Vase gestellt hatte. Ich ahnte, dass sie mir zu Ehren auch ihren ultimativen Schokoladenkuchen gebacken hatte. Warum betritt sie mein Haus, wenn ich weggefahren bin? Sie ist vor fast dreißig Jahren ausgezogen, und bis heute benimmt sie sich, als ob wir beide hier wohnen, so wie früher, zusammen mit unserer Mutter, mit Sarke und mit dem hinkenden Gadischke. Ich betrat das Wohnzimmer und sah, dass ein weiterer Kristallkrug aus der Vitrine verschwunden war. Nach jedem Besuch verlässt Michaela das Haus mit einem Erbstück, sie nimmt Sachen aus meinem Haus mit und macht aus ihnen Installationen für ihre Galerie. Wenn sie nur schon gegangen wäre!
»Wenn unsere Malinka heiratet«, hörte ich meine Mutter sagen, »könnt ihr das Haus verkaufen und euch das Geld teilen. Bis dahin gehört es euch beiden.«
Ich wurde wütend. »Das heißt, dass ich das Haus nicht verkaufen kann!«
»Du brauchst ja nur zu heiraten«, antworteten beide im Chor.
»Es wird Zeit, dass wir das Haus verkaufen«, fing ich wieder mit diesem abgedroschenen Thema an. Ich konnte es schon nicht mehr ertragen. Aber Michaela zog es vor, meine Worte zu ignorieren. Sie setzte sich in die Küche und rief ihren Roni an. »Frag nicht«, hörte ich sie flüstern. »Kein Paris, keine Liebe, sie ist nervös, sie ist völlig erledigt.«
Ich schüttelte sie. »Ich spreche mit dir! Sag mir, wann wir endlich das Haus verkaufen!«
»Aber ich habe Mutter versprochen …«, stammelte sie.
Ich erhob meine Stimme. »Mutters Launen sind dir wichtiger als mein Leben.«
Michaela nahm ihre Tasche und verschwand. Typisch. Wenn ich wütend bin, haut sie ab.
Ich zerrte die schwere Tasche mit den Steinen in die Mitte des Zimmers. Danach erbrach ich mich in die Kloschüssel. Erbrechen ist meine zweite Natur. Mit großem Vergnügen trennte ich mich von den letzten Resten polnischen Essens, von Chesi Sonnenschajn und Co., von meinem Zorn auf Michaela und begann, die Tasche auszupacken. Die Steine stapelte ich auf einen großen Haufen neben der Vitrine mit Mutters Kristallgeschirr. Aus Verzweiflung schuf ich für mich selbst eine Installation, wie meine Schwester, die Künstlerin, es so gern nennt.
Zumindest die Kristallsachen können sich freuen, dachte ich, ich habe ihnen Freunde aus Polen mitgebracht.
2
»Zum Ende des Nachtprogramms spiele ich Ihnen einen Schlager aus dem Lager«, hatte ich vor einem Jahr meinen Hörern verkündet, und Boris, dem Tontechniker, »Ponar« hingeschoben.
»Still, still, mein Kind, schweig still, hier wachsen Gräber« erklang.
»Heute ist nicht der Tag der Schoah«, schrie Liora Magen, die Redakteurin. »Verschone wenigstens die Hörer mit deinen Verrücktheiten. Hier wachsen Gräber – jetzt, mitten in der Nacht!«
»Würdest du ›Es brennt, Brüder, es brennt‹ vorziehen?«, fragte ich.
Boris bog sich vor Lachen. Liora wurde rot und verkündete, sie würde den Intendanten bitten, mir die Moderation wegzunehmen. Boris versuchte mich zu verteidigen: »Was hast du gegen sie?«, fragte er.
Liora zählte meine Mängel auf: »Sie ist unberechenbar, sie ist nicht verantwortungsbewusst, sie hat kein Urteilsvermögen.«
»Das stimmt«, bestätigte Boris und grinste von einem Ohr zum anderen. Ich brach in Gelächter aus. Genau in diesem Moment kam das Fax.
»Schalom, Amalia Ben Ami, ich bin aus Paris zur Beerdigung meines Vaters gekommen. Es hat mich sehr gerührt, in Ihrem Programm ›Hier wachsen Gräber‹ zu hören, das Lied, das mein Vater so liebte. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie mir an diesem schweren Tag einen Moment des Trostes geschenkt haben. Bitte rufen Sie mich an, Chesi.«
Gleich nach der Sendung rief ich Chesi an. Er wusste sofort Bescheid. »Amalia aus dem Radio!«
»Ich möchte mich für das Fax bedanken«, sagte ich.
»Das Vergnügen war ganz meinerseits«, gab er höflich zur Antwort. »Ich würde mich gern mit Ihnen unterhalten, aber ich stecke in einem Riesentohuwabohu, das können Sie bestimmt verstehen. Ich muss die ganzen Beerdigungsformalitäten erledigen.«
Mit einer Beerdigung konnte ich nicht konkurrieren. »Mein herzliches Beileid«, sagte ich und beendete das Gespräch.
Sein idiotisches Fax hing mit einem Magneten an meinem Kühlschrank, ich zerriss es in viele Stücke und warf es in den Mülleimer. Warum hatte ich ihn angerufen? Wer ruft um Mitternacht jemanden an, den er nicht kennt? Dumme Gans.
Chesi rief nach der Trauerwoche an. »Ich bin’s, Chesi Sonnenschajn«, sagte er und weckte eine alte Erinnerung in mir: Chesinka Sonnenschajn, der Sohn der Schwerhörigen. Der telefonische Kontakt zwischen uns brachte ihn ganz aus dem Häuschen. »Malinka Zuckmayer!«, rief er.
»Ich bin schon seit vielen Jahren Amalia Ben Ami«, korrigierte ich ihn.
Ich war dreizehn, als er mit seinen Eltern unser Viertel verließ. Seither hatte ich nichts mehr von ihm gehört, ich hatte ihn nicht wiedergesehen und wusste nichts über ihn, und um die Wahrheit zu sagen, ich hatte auch nicht an ihn gedacht.
»Uns ist ein Wunder geschehen«, rief Chesi begeistert und bat um ein Treffen.
Ich glaube nicht an Wunder, aber ich war neugierig und gab dem Wunder eine Chance.
3
Ich betrachtete die Kristallvitrine unserer Mutter, kniff die Augen zusammen wie früher, als ich ein Kind war, suchte die glänzenden Lichtstrahlen, die durch das Zimmer huschten.
»Malinka, wir sind der Anfang von etwas Schönem«, hörte ich Chesis Stimme.
Ich ging in mein Zimmer, eine Nische, die früher einmal eine Veranda gewesen war und später das Zimmer meines Vaters. Hier fand ich immer Ruhe. Ich schloss die Läden und die Fenster. Ich wollte Ruhe, ich wollte Dunkelheit, ich hoffte auf Schlaf, Schlaf, Schlaf.
Ich legte mich im Trainingsanzug aufs Bett. Aber Mutter betrachtete mich von dem Bild, das schon seit Jahren an der Wand über mir hing. Sogar auf dem Foto lächelte sie mich nicht an. Ich stand auf, nahm sie von der Wand und steckte sie in die Schublade. Heute brauchte ich eine ermutigende Umgebung. Aus der Schublade, wie um mich zu ärgern, lächelte mich ein mit einer Schleife geschmücktes Baby an: Michaela, ein Jahr alt. Vielleicht hätte ich nicht über sie herfallen sollen, dachte ich. Aber warum hat sie überhaupt nicht gefragt, was mir passiert ist, was mit Chesi passiert ist?
»Kein Paris, keine Liebe, nervös, völlig erledigt …« Das Echo ihres Geflüsters am Telefon hallte in meinen Ohren.
Noch vor ihrer Geburt war mir klar gewesen, dass ich Probleme haben würde. Ich war acht, als der Bauch meiner Mutter anschwoll und alle Kinder mich auslachten, weil meine Eltern gefickt hatten. Alle im Viertel waren Einzelkinder, nur meine Eltern machten mir Schande, waren fruchtbar und vermehrten sich. Ich beneidete sogar den hinkenden Gadischke Grin, den Sohn von Sarke, unserer Nachbarin, der wie alle anderen ein Einzelkind blieb.
»Nun, wenn sie jetzt einen Bruder oder eine Schwester bekommt, wird sie bestimmt ein braves Mädchen werden«, sagte Sarke zu meiner Mutter, und ich warf die Behälter für Zucker, Salz und Pfeffer um, die auf ihrem Tisch standen.
»Nach der Entbindung«, sagte sie beruhigend zu meiner Mutter, »wird unsere Malinka erwachsener werden, es bleibt ihr nichts anderes übrig.«
Und ein paar Wochen später verkündete mir Sarke: »Herzlichen Glückwunsch, du hast eine Schwester! Endlich wird deine Mutter ein bisschen Freude haben.«
Während meine Mutter im Krankenhaus war, hatte man mich bei Sarke und Marek Grin untergebracht, unseren Nachbarn.
»Iss«, schimpfte diese Hexe, wenn wir am Tisch saßen und sich meine Speiseröhre bei ihrem fetten Essen zusammenkrampfte. »Iss, du bist so dünn wie ein Muselmann.«
»Was ist ein Muselmann?«, fragte ich.
Sarkes Beschreibung war ausführlich. Sie sprach von Skeletten mit geschwollenen Bäuchen, die hinter Stacheldrahtzäunen eingesperrt waren, in Gaskammern gebracht wurden und sich in Staub und Asche verwandelten, und ich übergab mich.
Sie brachte mich auch zu ihrem Friseur. »So kurz wie möglich«, flüsterte sie ihm zu. »Was kann man mit so einem Stroh, wie sie auf dem Kopf hat, schon anfangen?«
Ich floh aus dem Laden.
»Wildes Ding« war ihr Kosewort für mich, und als ich in meinem Zimmer alle Bücher vom Regal warf, fragte sie: »Wer wird dich mal heiraten?«
»Ich werde sie heiraten«, rief ihr Gadischke begeistert.
»Um Gottes willen, du findest hoffentlich eine Bessere«, sagte Sarke.
Als Sarke meine Mutter im Krankenhaus besuchte, überredete ich Gadi, die Hausaufgaben bleiben zu lassen und stattdessen mit mir zu spielen. Ich brachte ihm Mikado bei, Murmelspiele und Canasta. »Ich liebe dich«, sagte er.
Ich warf die Decke von mir und ging in die Küche, ich war schweißüberströmt. Wenn Chesi doch tot wäre. Er war schuld, dass ich sogar im Zimmer meines Vaters keine Ruhe fand. Ich holte Michaelas Schokoladenkuchen aus dem Kühlschrank und aß mit dem Löffel Löcher in ihn hinein und wusste, dass ich mich übergeben würde, aber ich konnte nicht aufhören.
»Wir haben dir ein Geschenk mitgebracht«, sagte Vater, als sie Michaela nach Hause brachten.
»Ich will kein Geschenk«, sagte ich böse.
Vater zog eine Tafel Schokolade aus der Manteltasche. Ich zertrat sie. Er kaufte mir bunte Ballons. Ich ließ sie zerplatzen und weinte. Er setzte sich neben mich und nahm meine Hände in seine.
»Du bist ein Geschenk für mich und Mutter«, sagte er, »und Michaela ist unser Geschenk für dich.«
Ich glaubte ihm. Ich hörte auf zu weinen.
»Nimm sie weg«, bat meine Mutter meinen Vater. Und als ich mich Michaelas Bettchen näherte, schrie sie: »Nimm sie weg!«
Dabei wollte ich Mutters Freude nur betrachten, ich versprach ihr, Michaela nicht fallen zu lassen, sie mit beiden Händen festzuhalten. Mutter hörte nicht zu. »Nimm sie endlich weg!«
Vater ging mit mir in den Spielwarenladen. Er kaufte mir große Zeichenblätter, Pinsel und Wasserfarben.
»Komm, wir malen zusammen, eine Überraschung für Mutter und Michaela«, schlug er vor.
»Sie macht immer nur Schmutz«, sagte Mutter und drängte: »Geh doch mit ihr hinaus.«
Ich warf die Blätter, die Farben und die Pinsel in den Mülleimer und schrie: »Ich werde nie wieder malen!«
Am nächsten Morgen kaufte mir Vater eine große, schöne Puppe mit blonden Zöpfen und blauen Augen, die auf- und zugingen, und mit einem geblümten Kleid. Ich nannte sie Mimi-stirb, grub ein Loch im Garten und legte sie hinein. Als ich meine Puppe mit Erde bedeckte, rief Mutter nach ihrer Sarke. »Was wird bloß aus ihr werden?«, fragte sie. »Sag doch, was?«
»Nimm sie weg«, sagte Mutter am Vorabend von Jom Kippur zu Vater, als ich Sarkes Hühnersuppe auf die weiße Tischdecke kippte. Mutter zitterte. »Deinetwegen wird uns Sarke nicht mehr einladen.« Vater nahm mich an der Hand. Wir gingen hinaus.
Ich bekam keine Luft. Dieses Haus erstickte mich. Eine Veränderung des Ortes verändert die Gedanken, sagte ich mir und ging hinaus in den Garten. Mir kam alles so verfahren vor, alles war wie früher. Ein gottverlassenes Viertel im Süden von Tel Aviv. Reihen einstöckiger Häuser und wir am Rand. Zwei aneinanderklebende Häuser: Familie Zuckmayer im westlichen und Familie Grin im östlichen. Ein gemeinsamer Garten, ein gemeinsamer Hof und für jede Familie ein kleines Haus mit zwei Zimmern und einer Veranda. Marek, Sarke und Gadi Grin in Nummer sechs. Mutter Etka, Vater Arthur, ich und Michaela in Nummer acht. Wie ein Blitz fuhr mir die Erinnerung an Chesis Haus durch den Kopf, das Haus der Familie Sonnenschajn. Von unserem Garten aus sah man ihre Veranda.
»Ich weiß nicht, was soll es bedeuten,
Dass ich so traurig bin;
Ein Märchen aus alten Zeiten,
Das kommt mir nicht aus dem Sinn.«
Vater und ich liefen durch die wegen Jom Kippur leeren Straßen. Vater deklamierte für mich Gedichte auf Deutsch, und Chesi Sonnenschajn stand auf der Veranda und betrachtete uns. Bestimmt beneidet er mich, dachte ich aufgeregt.
»Malinka Zuckmayer?«
»Nein, Amalia Ben Ami.« Ich rekonstruierte mein zweites Telefongespräch mit Chesi Sonnenschajn.
»Ich erinnere mich nicht an deinen Vater«, sagte er. »Aber an deine Mutter, Frau Zuckmayer, erinnere ich mich noch ganz genau. Sie hat gern mit meiner Mutter in der Küche gesessen. Stundenlang haben sie zusammengesessen und sich nach Ustrzyki gesehnt.«
»Wonach?«
»Ustrzyki Dolne, das war ihr Heimatstädtchen«, sagte er verwundert, weil ich das nicht wusste. »Sie sind im selben Städtchen geboren worden. Wir stammen beide aus demselben Ort …« Das erfuhr ich von dem Jungen, der damals auf der Veranda gestanden hatte, dem Jungen, der damals König des Viertels gewesen war. »Vor so vielen Jahren haben wir uns aus den Augen verloren, und jetzt werden wir uns bald wiedersehen. Malinka, das ist ein Wunder. Uns ist ein Wunder geschehen.«
»Die Luft ist kühl und es dunkelt,
Und ruhig fließt der Rhein;
Der Gipfel des Berges funkelt
Im Abendsonnenschein.«
»Das ist die Sprache der Nazis!«, schrie Sarke meinen Vater an, wenn sie hörte, wie er mir Gedichte auf Deutsch aufsagte.
»Es ist auch die Sprache von Heine, von Mozart und von meiner Mutter«, antwortete er ihr.
»Pfui!« Sie spuckte auf den Boden und ließ uns stehen.
4
»Ich bin hier«, verkündete mir Chesi am Telefon. »Heute Abend ist die Feier zum dreißigsten Trauertag für meinen Vater.«
Abends erkannte er mich sofort. »Malinka Zuckmayer!« Er umarmte mich innig.
»Amalia Ben Ami«, beharrte ich.
Wir hielten uns nicht lange auf. Ich wollte wie die anderen Gäste den Saal betreten. Auf der Bühne stand ein Conferencier, der sich als Herr Katzenellbogen vorstellte. Ich erinnerte mich nur undeutlich daran, dass er damals der Held der Polen des Viertels war.
»Verehrtes Publikum«, begrüßte er uns mit dramatischer Stimme, »wir haben uns heute Abend zur Erinnerung an Jerucham Sonnenschajn versammelt, der von uns gegangen ist.« Herr Katzenellbogen sprach mit viel Pathos über den Verstorbenen, der »sein ganzes Leben seiner Arbeit bei der israelischen Post widmete und keinen einzigen Arbeitstag versäumte«.
Als Herr Katzenellbogen die Bühne verließ, stieg ein Chor von alten Überlebenden hinauf und fing an, jene Oh-weh-Lieder zu singen, die meine Mutter, sie ruhe in Frieden, so geliebt hatte. Ich hielt das für einen passenden Moment, von dort zu verschwinden, aber Chesi – charmant wie Alain Delon – schaute mich von der Bühne aus an. »Lauf nicht weg«, las ich von seinen Lippen.
Ich hätte eine ganze Reihe alter Leute aufscheuchen müssen, um hinauszukommen. Ich hatte keine Wahl, ich musste bleiben.
»Schade, dass es vorbei ist«, weckte mich am Ende des Abends eine freundliche Frau, die neben mir saß. Ich war nicht ganz ihrer Meinung. »Nun, was sagst du zu Chesi?«, fuhr sie begeistert fort. »Was für ein Junge! So begabt, so schön. Schade, dass er keine Frau hat, keine Kinder, weißt du.« Ich war wirklich nicht die Richtige für ihre Klagen.
Im Taxi auf dem Weg vom Veranstaltungssaal zum Restaurant saßen wir umarmt. Im Restaurant am Strand von Tel Aviv hob er das Glas: »Auf unser Wiedersehen!« Und die Erinnerungen strömten aus ihm heraus. »Malinka, weißt du noch, wie wir aus Fischs Garten die Mispeln geklaut haben? Erinnerst du dich noch an den Fackelzug? An den hinkenden Gadischke? Und wie die Kinder bei uns im Garten gespielt haben?«
Ich machte ihm klar: »Für mich ist die Vergangenheit vorbei.«
Chesi begriff es und breitete sofort seine Zukunftspläne aus. Er erzählte, er sei Leiter eines Projekts zum Wiederaufbau jüdischer Stätten in Europa. »Wir sind eine Gruppe von Architekten und Historikern, die etwas von der Rekonstruktion von Gebäuden verstehen, die im Zweiten Weltkrieg zerstört wurden. Im letzten Jahr haben wir Grabsteine in Polen restauriert, in Olésnica eine ehemalige Synagoge wiedererbaut, in Czchów eine Mauer renoviert, die aus den Bruchstücken jüdischer Grabsteine erbaut war. Und natürlich haben wir vor, unser Ustrzyki wiederzuerrichten.«
Allein die Namen, die er nannte, fand ich amüsant, ganz zu schweigen von dem exklusiven Hobby, das er für sich gefunden hatte. Chesi gefiel mir. »Ich fliege noch heute Nacht nach Paris zurück«, beendete er unser idyllisches Beisammensein.
Mein Gesicht blieb völlig ausdruckslos. Ich reagiere ausgezeichnet auf Enttäuschungen.
Er wand sich. »Ich wünschte, ich könnte bleiben. Malinka, ich werde mich darum kümmern, dass du bald zu mir und zu meinem Team kommst. Du wirst die Sprecherin des Films sein, der unsere Tätigkeiten dokumentiert, meine und die der Gruppe.« Er streichelte meine Wange und schaute mich mit grauen, sehnsüchtigen Augen an.
»Yaron Zahavi hat also einen Erben, es gibt eine Generation, die die Abenteuer seines Chasamba-Geheimbunds fortsetzt«, sagte ich.
Aber meine Worte zeigten keinerlei Wirkung. »Wir lassen unser Wunder nicht verlöschen, wir werden unser Ustrzyki gemeinsam aufbauen«, fuhr er begeistert fort, und ich schwieg, was so gar nicht meine Art war. Ich erzählte ihm noch nicht einmal, dass das Fax, das er an den Sender geschickt hatte, Liora dazu bewegt hatte, mich doch nicht zu feuern. Ich hörte ihm zu und sagte mir, vielleicht sieht so ein Wunder aus. Ich vergaß, dass es auf der Welt keine Wunder gibt.
5
Als Vater und ich zur Feier meines vierzehnten Geburtstags Ballons aufbliesen, klopfte es. Vor der Haustür standen zwei Fremde, die mit Vater sprechen wollten. Ich blieb im Zimmer mit acht Ballons, die an einer Schnur hingen, und wartete. Nachdem die beiden gegangen waren, lief ich in die Küche. Vater saß auf dem Stuhl und sah aus wie eine Mumie.
»Sie sollte schon längst im Bett sein«, murmelte Mutter. Sie öffnete und schloss Schranktüren, holte Mehl, Zucker und Kakaopulver für meinen Geburtstagskuchen heraus. »Wo ist das Backpulver?« Mit zitternden Händen suchte sie in den Schubladen. »Geh schlafen, morgen hast du Geburtstag«, sagte sie zu mir und schickte mich aus der Küche.
Vater schwieg. Sein glasiger Blick erschreckte mich. Ich ging in mein Zimmer und konnte nicht einschlafen.
Am Morgen fragte ich Mutter, was diese beiden Leute gewollt hatten. Sie antwortete nicht, sie knetete mit schnellen Bewegungen den Kuchenteig und schaute mich nicht an.
Ich ließ nicht locker. »Mutter, was haben sie zu Vater gesagt?«
Sie drückte mir den Kochlöffel, mit dem sie den Schokoladenteig gerührt hatte, in die Hand. »Ist das süß genug?«
»Werden sie noch mal kommen?«, fragte ich. Mutters Gesicht war ausdruckslos und noch starrer als sonst. Ich bestand auf einer Antwort. »Nicht wahr, sie werden noch mal kommen?«
Vater trat in die Küche. Er sah anders aus.
»Nimm sie weg«, bat Mutter.
Ich lief hinaus.
Als ich aus der Schule kam, stand der Geburtstagskuchen auf dem Tisch. Mutter und Sarke füllten Tütchen mit Süßigkeiten. Der lahme Gadischke saß in meinem Zimmer und malte mir eine Geburtstagskarte mit einem roten Herzen. Aber ich suchte Vater.
»Dein Vater schläft«, teilte Sarke mir mit, und Mutter versprach: »Er wird rechtzeitig zur Feier aufwachen.«
Als Vater aufwachte, rief Sarke ihn in die Küche, wo sie mit Mutter saß. »Wann hörst du endlich auf, dir um deine Kommunisten Sorgen zu machen?«, schimpfte sie ihn. »So geht es doch nicht weiter.«
Die Kinder aus meiner Klasse kamen. Im Wohnzimmer türmten sich die Geschenke.
Sarke schrie weiter: »Was hast du bei denen verloren, ihr Name sei ausgelöscht! Ich kenne Etka besser als du, ich kenne sie von Auschwitz. Unsere Etka wird dort sterben! Du und deine Freunde von der kommunistischen Partei, ihr träumt doch nur!«
Ich hörte, wie Vater ihr ruhig und mit seinem korrekten Hebräisch antwortete: »Sarke, dein Geschrei nützt überhaupt nichts.«
»Bist du verrückt geworden«, schrie Sarke weiter, »es gibt kein anderes Leipzig!«
Sie stand in der Küchentür, hob die Arme zum Himmel und rief laut: »Etka, es ist nicht zu ändern, dein Arthur liebt die Nazis, es sind die Nazis, die er liebt.«
Im Haus breitete sich Stille aus.
»Der Geburtstag ist vorbei, geht nach Hause!«, schrie ich die Kinder an.
Dann verkroch ich mich in meinem Zimmer, schloss die Tür zu und zerbrach alles, was sich zerbrechen ließ. Gadi drückte sich draußen an die Tür und flehte, ich solle ihn doch einlassen.
»Gadischke, komm nach Hause«, hörte ich Sarke rufen. »Du weißt doch, was für einen Dickkopf dieses wilde Ding hat.«
Ich verließ mein Zimmer erst, als alle Gäste gegangen waren. Vater hatte sich wieder schlafen gelegt, Michaela packte die Geschenke aus, die ich bekommen hatte, und Mutter putzte mit roten Augen und zusammengepressten Lippen das Haus.
»Warum schläft Vater die ganze Zeit?«, fragte ich sie.
Sie rückte die Stühle zurecht, die um den Tisch standen.
»Was will Sarke von Vater?«
Mutter fegte den Schmutz auf die Schippe.
»Warum hat Sarke gesagt, dass Vater die Nazis liebt?«
Mutter warf den Schmutz in den Mülleimer.
Warum hatte sie mir damals nicht geantwortet? Ich war wütend auf meine stumme Mutter. Warum hast du nie etwas gesagt? Bis heute streite ich noch mit den Toten.
»Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin.« Wieder kam mir das Gedicht in den Sinn. Es gelingt mir nicht, es zu vergessen, und dabei hasse ich Erinnerungen.
»Die schönste Jungfrau sitzet
Dort oben wunderbar,
Ihr goldnes Geschmeide blitzet,
Sie kämmt ihr goldenes Haar.
Sie kämmt es mit goldenem Kamme,
Und singt ein Lied dabei;
Das hat eine wundersame,
Gewaltige Melodei.«
Dieses Gedicht quälte mich, meine Toten wurden lebendig.
Ich ging in mein Zimmer zurück und rollte mich auf dem Bett zusammen. Früher, vor vielen Nächten, fühlte ich mich nur hier geborgen. Hier war vor vielen Jahren mein Vater gegenwärtig, sein Duft hing noch im Bettzeug, hier stellte ich mir seine Bewegungen vor, die Züge seines Gesichts. Jahrelang erwähnte ihn keiner, sogar seine Alben und seine Bücher waren aus den Regalen entfernt worden. Plötzlich sah ich sein Gesicht genau vor mir: Wenn er mich anlächelte, wurden seine Augen zu Strichen.
»Malinka, dein Vater ist nicht da«, verkündete mir Sarke, als ich von der Schule nach Hause kam.
»Wo ist er?« Ich verstand nicht, was los war. Alle Nachbarn und die Schulkrankenschwester saßen in unserem Wohnzimmer und schwiegen. In der Küche spielte Michaelas Kindergärtnerin mit ihr und brachte sie zum Lachen. Meine empfindsame Schwester durfte sich nicht aufregen oder traurig sein.
»Wo ist mein Vater?« Ich suchte ihn im anderen Zimmer.
»Er ist weit weg gefahren«, zischte Sarke mit zusammengepressten Lippen.
Ich zitterte am ganzen Körper. »Wann kommt er wieder?«
»Er wird nicht wiederkommen«, sagte Sarke.
Meine Mutter weinte. Auch die Nachbarn sagten kein Wort.
»Warum sagt mir niemand, wann er zurückkommt?«, rief ich.
»Weißt du, du solltest sie vielleicht in einen Kibbuz schicken«, schlug die Schulschwester meiner Mutter vor. »Mit zweien wirst du es schwerhaben, und Malinka ist kein einfaches Mädchen.«
»Sie wird nicht in einen Kibbuz gehen«, entschied Sarke für mich. »Sie bleibt zu Hause.« Sarke packte mich am Arm und schob mich ins Schlafzimmer. »Setz dich«, befahl sie mir.
Ich setzte mich. Sarke machte die Tür zu.
»Malinka«, sagte sie, »ich kenne deine Mutter, sie ist eine gute Frau. Aber die Deutschen haben sie fertiggemacht, sie versteht nichts von diesem Leben.«
»Sag mir, wo Vater ist«, bettelte ich.
Sarke breitete die Arme aus. »Malinka, du musst auf deine Mutter aufpassen.«
Ich hatte das Gefühl, als drehe sich das Zimmer um mich, als öffne sich der Boden, als stürze ich in ein schwarzes Loch. Ich brach in Tränen aus.
Sarke hob die Stimme: »Du musst stark sein, nun, da dein Vater nicht mehr da ist, musst du deiner Mutter helfen.«
Ich erbrach mich auf ihre Hausschuhe.
»Verdammter Mist!«, brüllte sie.
Ich floh in den Garten. Ich setzte mich unter den Mispelbaum und fragte mich, wie es geschehen könne, dass Menschen einfach plötzlich verschwinden. Ich dachte, auch ich könne eines Tages plötzlich nicht mehr da sein, und wunderte mich, dass mir dieser Gedanke keine Angst machte. Ich saß im Gras, in Gedanken versunken, und rupfte Halme heraus, Sauerklee und Malve, bis Michaela kam und mich ins Haus rief. Plötzlich erinnerte ich mich an Mimi, die Puppe, die Vater mir geschenkt hatte.
»Ich hole dir eine Puppe aus der Erde«, versprach ich Michaela.
»Ein Zaubertrick!« Michaela machte einen Luftsprung und strahlte. »Du machst für mich einen Zaubertrick!«
»Ja, einen Zaubertrick«, sagte ich.
Ich machte die Erde mit einem Schlauch nass, damit sie weicher wurde, und wir fingen ohne Schippe an zu graben, mit den Händen. Michaela war begeistert, aber nach drei Minuten hatte ich keine Kraft mehr. Ich streckte mich auf dem schlammigen Boden aus und drückte mein Gesicht in die feuchte Erde.
»Malinka, warum legst du deinen Kopf in den Schlamm?«, fragte Michaela.
Ich antwortete ihr nicht.
Michaela erschrak. »Malinka, was ist mit dir?«
»Der Zaubertrick hat nicht geklappt«, sagte ich. »Meine Puppe ist für immer gestorben.«
Michaela wischte sich noch nicht mal den Schlamm ab. So wie sie war, rannte sie heulend zu Mutter.
»Was ist mit dir?«, fragte Sarke, angewidert vom Schmutz.
»Malinka hat mich dreckig gemacht«, beklagte sich Michaela, das Porzellanpüppchen, unter Tränen.
Die Nachbarn, die gekommen waren, um Mutter Mut zuzusprechen, fanden keine Worte zu ihrem Trost. Alle schauten mich an. Plötzlich fiel mir auf, dass auch mein Gesicht und meine Kleider voller Schlamm waren.
»Was hast du gemacht?«, schrie Sarke mich an.
Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. »Morgen gehe ich in den Kibbuz«, rief ich verzweifelt.
Alle schauten meine Mutter an, um zu sehen, wie sie reagierte.
»Er wird zurückkommen«, murmelte sie. »Malinka, er hat versprochen, dass er zurückkommt.«
Ach, Mutter, was für ein Vorbild warst du für mich, genau wie du sitze ich heute im Haus und warte auf den Träumer, den ich liebe.
In jener dunklen Nacht konnte ich nicht einschlafen. Ich ging hinaus in den Garten, ich weckte Gadi, ich stand unter dem Fenster seines Zimmers und überredete ihn, am nächsten Tag mit mir in den Kibbuz zu gehen. Aber am Morgen verkündete Sarke, ihr Gadi würde in keinen Kibbuz gehen.
»Dort herrscht Gesetzlosigkeit«, erklärte sie. »Nur Banditen wohnen dort.«
Ich war vierzehn Jahre und drei Monate alt, als ich das Haus verließ. Ich verabschiedete mich von niemandem, nicht von meinen Klassenkameraden, nicht von meinen Lehrern, nicht von Sarke. Auch nicht von Gadi.
6
Ich rief Chesi an. Ich wollte nicht mit ihm sprechen, ich wollte nur kontrollieren, ob mein Telefon funktionierte. Schon nach dem ersten Klingelton legte ich auf.
»Malinka, wir waren schon als Kinder ein Paar«, hörte ich ihn sagen, und ich hörte ihn singen: »Was kann wachsen, wachsen ohne Regen? Was kann brennen ohne Unterlass?«
»Malinka, ich muss nach Paris zurück«, hatte er unser idyllisches erstes Treffen abrupt beendet. Ich begleitete ihn zum Flughafen. Als ich nach Hause kam, erwartete mich vor der Tür ein riesiger Rosenstrauß. »Wir sind der Anfang von etwas Schönem, Dein Chesi.«
Monate voller romantischer E-Mails und nächtlicher Telefongespräche überzeugten mich, dass ich eine Liebe hatte.
Chesi verstärkte das Gefühl meines Herzens und schickte mir ein Flugticket. »Ich erwarte dich in Paris«, schrieb er.
Ich war ganz durcheinander vor Glück und wusste nicht, was ich machen sollte. Ein riesiges Metronom schwenkte mich hin und her – bei Tick wollte ich fahren, bei Tack hierbleiben.
»Wir werden uns trennen«, sagte ich zu Liora. Und erschrak. Gleich darauf sagte ich zu Boris, dass ich nicht vorhatte zu fahren.
»Ich kenne dich«, Boris lachte. »Wenn du Nein sagst, wirst du fahren.«
Zwanzig Jahre lang hatten wir ein Verhältnis.
Ich brachte ihn zum Schweigen: »Ich habe eine Liebe gefunden. Jetzt wird deine Olga endlich Ruhe geben.«
Am Abend rief ich Michaela an. »Du kannst das Haus verkaufen«, verkündete ich ihr.
»Was ist passiert?«, fragte sie verblüfft.
»Ich fahre nach Paris und heirate Chesi.«
»Wer ist der Bräutigam?«, fragte Roni, der von seiner neurotischen Frau zu mir geschickt worden war.
»Chesi Sonnenschajn.«
»Den kenne ich nicht.«
Ich lachte. »Das ist sicher ein Vorteil.«
»Was machen seine Eltern?«, wollte er wissen.
»Er ist vierundfünfzig«, antwortete ich.
»Beruf?«
»Professor für Geschichte an der Sorbonne, unverheiratet und Vollwaise«, sagte ich. »Sogar Sarke wäre heute stolz auf meine Wahl.«
Roni war noch immer besorgt. »Ich glaube, für Michaela wird es schwer, wenn du wegfährst.«
Ich drückte ihm mein tief empfundenes Mitgefühl aus.
»Michaela denkt, wenn du zum Beispiel Gadischke geheiratet hättest, würde unser aller Leben anders aussehen. Schade, dass du ihn nicht geheiratet hast.« Er konnte es nicht lassen, mir das unter die Nase zu reiben.
»Schade, dass sie ihn nicht geheiratet hat.« Damit beendete ich das Gespräch.
Michaela rief an. »Was ist mit diesem Chesi? Du kennst ihn doch kaum. Was soll das? Ein paar Telefonate, ein gemeinsames Essen, einige E-Mails, das war alles, und schon beschließt du zu heiraten? Das reicht, dass du deine Arbeit aufgibst, bist du noch normal? Wer lässt in deinem Alter alles stehen und liegen, einfach so? Was wirst du dort überhaupt machen?«
»Freude«, sagte ich. »Ich werde Mutter Freude machen.«
»Du spinnst ja«, schimpfte sie, und ich nahm meine Kraft zusammen, brach das Gespräch ab und wusste, dass ich diesmal weggehen würde. Nach Paris.
»Frau Ben Ami«, sagte Liora wütend. »So geht das nicht mit Ihren seltsamen Launen und Überraschungen. Es gibt keinen Urlaub von einem Tag auf den anderen, auch wenn Sie es sind und auch wenn es Paris ist.«
Sie schrie, und ich hatte das Gefühl, dass niemand auf der Welt mir etwas gönnte.
»Ich bin jetzt über dreißig Jahre hier, ich wohne sozusagen im Sender, jeden Abend, gesund oder krank, ich bin hier, ohne Urlaub, ohne Ehemann, der ein Sabbatical nimmt, ohne kranke Kinder, ich arbeite und arbeite und arbeite!« Ich erinnerte sie daran, dass ich die Dumme vom Dienst war, die immer einsprang, wenn jemand heiratete, Kinder bekam oder sich scheiden ließ, krank wurde oder eine Depression bekam. »Ich habe mir Paris verdient«, sagte ich. »Paris und Anerkennung.«
Zum ersten Mal in meinem Leben bat ich um Urlaub, und Liora passte das nicht. Sie würde auch noch von mir verlangen, dass ich ihr den Tag meines Todes vorher ankündigte. Auch Ben Elijahu, der Intendant, ärgerte sich und ließ mich zu einem Gespräch kommen, aber ich blieb hart, ich war entschlossen zu fahren.
7
»Im Lande Israel entstand das jüdische Volk. Hier prägte sich sein geistiges, religiöses und politisches Wesen. Hier lebte es frei und unabhängig. Hier schuf es eine nationale und universelle Kultur …«, las ich vor allen Schülern laut aus der Unabhängigkeitserklärung vor, an jenem Tag, als ich in den Kibbuz kam, und Chawale, die Lehrerin für Gemeinschaftskunde, schaute mir tatsächlich in den Mund und fragte: »Woher hast du denn solch eine Stimme?«
Ich blieb ihr nichts schuldig. »Und woher hast du denn solche Beine?« Die Klasse lachte.
»Du hast die Stimme einer Radiosprecherin«, sagte sie begeistert. »Du bist genau richtig für die Zeremonie am Jom Ha-Sikaron, dem Tag der Erinnerung.« Jetzt verstand ich, dass sie es als Kompliment gemeint hatte.
Nach dem Unterricht versammelten sich die Kinder aus allen Klassen, um diese neue Schülerin zu begutachten, die von draußen gekommen war. »Ich bin nicht von draußen«, beharrte ich. »Ich bin aus Tel Aviv.«
»Und was macht dein Vater?«, fragte mich der dickste Junge aus der Klasse.
Ich wurde rot. »Er ist tot«, sagte ich mit erstickter Stimme.
»Ihr Vater ist tot, ihr Vater ist tot«, sang einer der Idioten, und alle lachten.
»Bist du neidisch?«, fauchte ich und brachte ihn damit zum Schweigen.
Beim Abendessen kam Boas zu mir, einer von den Großen. »Du hast wirklich sehr schöne Haare«, sagte er.
»Was kann man mit so einem Stroh, wie sie auf dem Kopf hat, schon anfangen?«, hörte ich Sarkes Stimme. Ich schaute Boas an. »Was für ein Kompliment hast du noch auf Lager?«
Ich war auf Streit aus. Boas schluckte. »Und eine tolle Figur.«
»Wie ein Muselmann«, hörte ich Sarke sagen.
»Ich möchte dein Freund sein«, erklärte Boas.
Nun war ich verwirrt.
»Aber unter einer Bedingung«, fuhr er fort, »dass man dich Amalia nennt. Malinka klingt polnisch, es ist der Name von einem Seifenmädchen.« Er wollte mir einen Kuss geben, und ich verpasste ihm eine Ohrfeige.
Am Tag darauf sah ich ihn einen Traktor fahren. Er lächelte mir zu. Seine Haare flogen im Wind. »Ich gebe nicht auf«, sagte er. Am Abend gingen wir zusammen spazieren. Das Licht unserer Taschenlampen fiel auf den Weg, und die Luft war erfüllt vom Duft der Orangenhaine. Wir gingen durch die Plantage und betraten den Hühnerstall und den Kuhstall.
»Nun, sind wir Freunde?«, fragte er.
Ich konnte ihm nicht antworten.
»Ja, Amalia?«, fragte er und küsste mich.