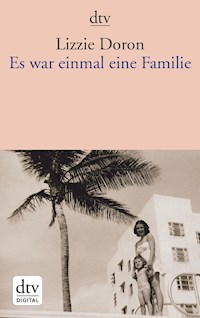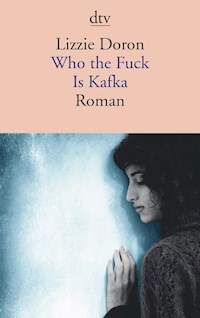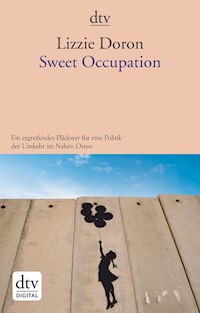
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die Begegnung mit dem Fremden – eine Begegnung mit dem Fremden in sich selbst Fünf Männer in der Mitte ihres Lebens: Die verurteilten ehemaligen Terroristen Muhammad, Suleiman und Jamil aus den besetzten Gebieten sowie die Israelis Chen und Amil, die den Dienst an der Waffe verweigert haben. Männer, die im Gefängnis saßen und, nachdem sie wieder freikamen, die »Friedenskämpfer-Bewegung« gründeten, entschlossen, ihrem Leben eine entschieden andere Richtung zu geben. Muhammad nahm Kontakt zu Lizzie Doron auf, und so traf sie diese Männer: Feinde, Widersacher. Palästinenser, die die Juden töten wollten, und Israelis, die sich geweigert hatten, ihr Land zu verteidigen. Ein Jahr lang hörte sie ihren Kindheitserinnerungen zu, lernte ihre Gefühle kennen, ihre Träume und Ängste, erfuhr von dem Moment, als sie anderen das Leben nahmen. Entstanden ist ein ergreifendes Dokument über einst Radikale, die dem sinnlosen Hass eine Perspektive entgegensetzen: Worte sind stärker als Molotowcocktails, Handgranaten oder Steine. Und Rettung bringen oft diejenigen, die nicht mit dem Strom schwimmen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 212
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Über das Buch
Fünf Männer, die im Gefängnis saßen und, nachdem sie wieder frei kamen, eine Friedenskämpfer-Bewegung gründeten: Die ehemaligen palästinensischen Terroristen Muhammad, Suleiman und Jamil aus den besetzten Gebieten sowie die israelischen Refuseniks Chen und Amil, die den Dienst an der Waffe verweigert haben. Lizzie Doron traf diese Männer. Ein Jahr lang hörte sie ihren Kindheitserinnerungen zu. Sie lernte ihre Träume und Ängste kennen, sie erfuhr von dem Moment, als sie anderen das Leben nahmen. Entstanden ist ein ergreifendes Dokument über einst Radikale, die dem sinnlosen Hass eine Perspektive entgegensetzen.
Von Lizzie Doron ist bei dtv außerdem lieferbar:
Das Schweigen meiner Mutter
Who the Fuck Is Kafka
Warum bist du nicht vor dem Krieg gekommen
Ruhige Zeiten
Es war einmal eine Familie
Der Anfang von etwas Schönem
Lizzie Doron
Sweet Occupation
Aus dem Hebräischenvon Mirjam Pressler
Für Jamils Mutter,Hemda Jamil Abdallah
Selbst nachdem sie einen Sohn verloren hatte, kämpfte sie darum, Frieden ohne Gewalt zu erringen. Sie wollte, dass keine Mutter, auch nicht die Mutter des Feindes, die Tragödie erleide, Söhne zu verlieren. Sie war es, die für Jamil und seine Freunde den Weg für einen gewaltlosen Kampf ebnete. Bis der Frieden kommt.
Prolog
All die Wechselbäder der Gedanken und Gefühle endeten nicht mit dem Tag, an dem ich das Manuskript ins Lektorat und zur Übersetzung gab.
Um dieses Buch zu schreiben, traf ich mich mit Terroristen und Verrätern, ich verbrachte mehr als ein Jahr mit Menschen, die im Gefängnis gesessen hatten.
Ich sagte mir, du wirst eine interessante Geschichte haben.
Die vermeintlich klare Wirklichkeit, an die ich glaubte, zerbrach allerdings schon bei meiner ersten Begegnung mit Mohammed, Suliman, Jamil, Chen and Emil.
Die Gespräche mit ihnen zerstörten die Geschichte, die ich mir selbst erzählt hatte. Die Geschichte, die ich von vielen meiner Freunde übernommen hatte – eine Geschichte, die jener tagtäglichen Wirklichkeit entsprang, der ich mein ganzes Leben lang ausgesetzt war: Kriege, Straßen voller Blutlachen – auf Fernsehbildschirmen, in Zeitungen, in Reden der Politiker, in Gesprächen mit Freunden.
Die Treffen mit diesen Menschen entzogen mich der vertrauten und bequemen Balance. Ich wurde von einem Strom ergriffen. Ich war gezwungen, meine Denkmuster zu überprüfen, das rechte Wort zu finden, Fragen zu stellen, die ich nie zuvor gestellt hatte.
Wie sitzt du mit jemandem, der einen deiner Freunde getötet haben könnte?
Wie stellst du die Frage, sag mir, wen du getötet hast?
Wie bezeichnest du einen Terroristen, der dein Freund wurde?
Wie trinkst du einen Kaffee mit einem, der sich weigert, in der Armee zu dienen und unser Land zu schützen?
Wie kommst du zurecht mit dem Schrei, dem Zorn, der Anschuldigung, der Scham oder der Angst?
Und dann mit der Sympathie, mit Freundschaft und Liebe?
Ist irgendwas schiefgelaufen mit mir?
Oder bin ich durch sie vielleicht zu meinen abgeriegelten innersten Bezirken vorgedrungen, meinen Schranken, meiner ursprünglichsten Angst, meinen Vorurteilen?
Meine Bekanntschaft mit ihnen und die Wahrnehmung meiner Welt haben die Grenzen meiner Seele neu bestimmt. Ich konnte mich der bewussten Bezwingung meiner Haltungen, meiner Gefühle und meines Verhaltens nicht widersetzen.
Jemand, der mein Feind war, lehrte mich, dass ich das, was ich bislang dachte, nicht zwingend auch morgen noch denken musste. Ich lernte, meine Angst zu überwinden, es zu wagen, bereit zu sein, einer Geschichte zuzuhören, die parallel zu meiner verläuft, und dennoch nach Schnittpunkten mit ihr zu suchen.
Viele meiner Freunde warfen mir vor, ich sei zu weit gegangen, habe rote Linien überschritten, Verleger meines Landes warnten mich, dieses Buch werde womöglich nie in Israel erscheinen.
Aber ich hatte keine Alternative.
Lizzie Doron, Tel Aviv 2017
Vorabend des Gedenktages
Mai 2014
Es ist halb sechs Uhr abends. Ich überquere die Straße, laufe zu Salims Restaurant hinüber, nicht weit von unserem Haus. Ich weiß, Salim wird mich mit einem Lächeln empfangen und mir verkünden, dass er mir ganz frischen Hummus zubereitet habe, für die Feier des Unabhängigkeitstages morgen Abend.
Für mich gehört das zu den Festvorbereitungen, ich bin für den Hummus zuständig.
Im Restaurant warten außer mir noch drei weitere Leute, bestimmt gehört Salims Hummus auch für sie zum Feiern dazu.Alle haben es eilig, die Zeit drängt. Laut Gesetz müssen Vergnügungsstätten und Restaurants am Vorabend des Gedenkens um sechs Uhr schließen. Man muss sich beeilen, um noch etwas zu kaufen oder die Bestellungen abzuholen. Während ich an das Fest denke, tritt ein weiterer Kunde ein.
Ist das eine flüchtige Erinnerung oder ein Irrtum?
Habe ich diesen Mann nicht in Silwan getroffen? Ist er Nadims Nachbar?
»Ich glaube, ich kenne Sie, aber vermutlich irre ich mich«, sage ich verwirrt, als mir klar wird, dass er bemerkt hat, wie ich ihn anstarre.
Er lächelt. »Vielleicht auch nicht.«
»Was machen Sie hier?«, frage ich, fast etwas unhöflich.
»Ich kaufe Hummus.«
Salim reißt überrascht die Augen auf. »Kennt ihr euch?«
»Sie hat ein Buch über meinen Nachbarn und über Silwan geschrieben«, antwortet der Mann, an dessen Namen ich mich nicht erinnere.
»Wallah«, sagt Salim und lächelt mich an, »zehn Jahre bist du schon hier und ich weiß nichts über dich.«
»Doch! Zwei Kilo Hummus für den Unabhängigkeitstag.«
Die anderen Kunden haben das Lokal jetzt verlassen, nur wir drei sind noch da.
An der Tankstelle nebenan warten Autos in einer Reihe, die meisten sind mit einem israelischen Fähnchen geschmückt.
Bald wird sie da sein, die bedrückte Stimmung, die zum Gedenktag für die Gefallenen gehört.
»Ich habe gehört, dass Ihr Buch über Nadim in Deutschland sehr erfolgreich ist«, sagt der Mann, während Salim meinen Hummus einpackt.
»Jallah, Mohammed, sag, was du möchtest, ich muss gleich schließen.« Salim unterbricht uns, als er fertig ist, und deutet auf seine Uhr.
Mohammed! Wie konnte ich das vergessen? Nadim hat mir viel über ihn erzählt. Er gehört zu den Gründern der »Friedenskämpfer«. Auf ihrer Seite sind das ehemalige Terroristen und auf unserer Leute, die den Kriegsdienst in den besetzten Gebieten verweigern, sie haben zusammen eine Bewegung gegründet, die sich für Frieden ohne Gewalt einsetzt. Jetzt verstehe ich auch, warum er hier ist: Die israelisch-palästinensischen Gedenkfeierlichkeiten finden auf der anderen Straßenseite statt, auf dem Messegelände.
Ich merke, dass ich ihn wieder anstarre, und binde, um beschäftigt zu wirken, die Schlaufen der Plastiktüte zusammen, in die Salim die Hummusbecher gestellt hat.
»Haben Sie Lust, heute Abend zu unserer Zeremonie zu kommen?«, fragt Mohammed, als könne er meine Gedanken lesen, während er darauf wartet, dass Salim auch seine Bestellung einpackt.
Also wirklich. Das ist, wie zusammen mit den Mördern weinen. Nie im Leben werde ich meine Toten verraten. Sie können in Frieden ruhen. Sie wissen, dass ich sie nicht vergesse, dass ich nie auf den Gedenktag verzichte.
»Tut mir leid, aber …« Ich wische mir den Schweiß von der Stirn und lasse den Satz unvollendet.
»Schreiben Sie doch auch ein Buch über uns«, sagt er, so beiläufig, als ginge es um eine Einladung zu einer Tasse Kaffee. »Sie müssen nicht gleich antworten«, fügt er hinzu, als er meine Verlegenheit bemerkt.
Auf dem kurzen Weg nach Hause bin ich voller Unruhe. Könnte das nicht der Beginn einer neuen Geschichte sein, oder besser noch, eine Fortsetzung? »Wir sind eine Geschichte für mindestens drei Bücher«, hatte Nadim gesagt, damals, als ich ihm mitteilte, dass ich unser Buch [›Who the Fuck Is Kafka‹] beendet hatte.
Zu Hause angekommen stelle ich den Hummus in den Kühlschrank und googele die Friedenskämpfer.
»Wir glauben, dass der Frieden nicht von selbst kommt. Er braucht Beharrlichkeit, Verbindlichkeit und stetige Arbeit. Je größer der Kreis der Menschen wird und je aktiver sie sind, umso größer wird der Einfluss unserer Bewegung auf die Realität … Unter den Aktivitäten der Bewegung kommt der palästinensisch-israelischen Zeremonie zum Tag des Gedenkens besondere Bedeutung zu. An diesem schweren Tag rufen die Friedenskämpfer beider Seiten auf, den Schmerz und die Hoffnung jener anzuerkennen, die auf der anderen Seite des Zauns leben, und zu versuchen, den nächsten Krieg zu verhindern …«
Noch während ich ins Lesen vertieft bin, zerschneidet der Ton der Sirene die Luft.
Ich mache den Computer aus, erschrocken wie jemand, der beim Betrachten eines Pornos erwischt wird.
Schweigend bleibe ich stehen, und wie jedes Jahr kommen sie zu mir zurück. Sehr lebendig kommen sie zurück und zerreißen mir das Herz.
Fast fünfundvierzig Jahre sind seit jenem schrecklichen Jom Kippur vergangen, und noch immer schaffe ich es nicht, sie während der Sirene sterben zu sehen. Da ist vor allem Rafael, mit geschlossenen Augen, er spielt den Säbeltanz von Chatschaturjan, bewegt den Körper im Takt, in vollkommener Harmonie mit dem Akkordeon, das wie ein Teil seines Körpers wirkt. Dann erscheinen Gadi, mit dem Pilotenabzeichen, und Micki mit dem verbrannten Gesicht. Und hinter ihnen Jehuda und Motti.
»Angenommen, dass …?«, fragte mich Rafael.
»Angenommen was?«
»Angenommen, wir wären Freunde.«
»Was dann?«
Er hielt den Brief in der Hand, der ihm bestätigte, dass er als Geiger des Armeeorchesters angenommen worden war.
»Und was würdest du zu mir sagen?«, fragte er.
»Ich denke, Panzerkorps.«
»Ich hab’s gewusst. Das habe ich auch gedacht. Panzerkorps wäre mir lieber.«
Frühjahr 1967
Wir wollen bauen, immer nur bauen, uns gehört das Land. Wir wollen bauen, immer nur bauen, das ist seit Generationen unser Wunsch und Begehr.
Ein Liederabend bei den Pfadfindern. Es war kalt, aber ich beschwerte mich nicht. Um mich herum sangen alle, und weil meine Kameraden sangen, sang ich auch.
Racheli, Rina, Rafael, Gadi, Micki und ich waren unzertrennlich. Wir waren im selben Jahr geboren, wir wohnten im selben Viertel, unsere Eltern stammten aus demselben »Dort«.
Das Lied unserer Einheit singen wir zum Gedenken, dunkel, dunkel ist das Wadi. Wache: Stillgestanden. In der Nacht geht die Gruppe, zum Kampf und zum Schutz,
Ich sang aus voller Kehle.
Gadi lachte. »Du singst falsch.«
Rafael, der neben mir saß, legte mir die Hand auf die Schulter und flüsterte mir liebevoll zu: »Es ist besser, wenn du nur die Lippen bewegst.«
Wir reiten auf silbernen Flügeln, Ritter des Windes in den Wolken.
Sie sangen weiter, ich bewegte nur noch die Lippen.
Niemand war überrascht, als Gadi nach dem Lied verkündete, er würde Pilot bei der Luftwaffe werden.
»Ich gehe zum Panzerkorps«, sagte Rafael. Er sagte, ein Panzer sei wie ein Haus, es sei die sicherste Waffenart.
Micki meinte, er müsse noch überlegen, wohin er sich melden würde, betonte aber, dass er auf jeden Fall zu einer Kampfeinheit gehen wolle. »Bei uns liegt es in der Familie«, sagte er und erinnerte uns an seinen Onkel Schulem, der Stolz der Familie, der in den Kämpfen um den Sinai gefallen war.
Wir versprachen unseren Freunden, ihren Eltern gegenüber kein Wort darüber zu verlieren. Sie würden sich Sorgen machen.
Wir waren vierzehn Jahre alt.
Das Bild in meinem Kopf wechselt, ich meine einen sommerlichen Windhauch zu spüren. Am Horizont segeln weiße Wolken. Vor mir taucht der Strand auf, Micki, der den Arm um Rina gelegt hat, Gadi seinen um Racheli, und ich sitze zwischen Rafael und Emil. Wieso fällt mir Emil auf einmal ein? Seit Jahren habe ich nicht mehr an ihn gedacht.
Sommer 1965
Jehuda, unser Gruppenleiter bei den Pfadfindern, stellte uns ein neues Mitglied vor, einen Einwanderer aus Polen. Neben ihm stand ein Junge, aufrecht und gut aussehend, mit schwarzen Haaren und dunklen Augen, fremdartig gekleidet in langen Hosen, einem geknöpften Hemd, hohen Schuhen und Wollkniestrümpfen.
Gadi brach in Lachen aus. Und wenn Gadi lachte, lachten alle.
Auch ich.
»Er heißt Emil«, sagte der Gruppenleiter.
Das Gelächter wurde lauter.
Er rief uns zur Ordnung und forderte uns auf, uns selbst vorzustellen.
»Alisa«, sagte ich.
»Elisabeth«, sagte Micki kichernd.
Wieder lachten alle.
»Emil und Elisabeth«, er konnte es nicht lassen.
Noch mehr Gelächter.
Ich wurde rot.
Auch Rafael.
Emil betrachtete uns gelassen. Auf seinem Gesicht erschien keine Spur von Lächeln, er musterte uns nur mit einem scharfen, durchdringenden Blick.
»Ein hübscher Kerl«, flüsterte Racheli Rina zu.
»Was heißt da hübsch, ein Polacke«, befand Rina.
Jehuda, unser Gruppenleiter, brachte uns zum Schweigen und befahl uns ungehalten, uns in Dreierreihen aufzustellen und Appell zu stehen.
Micki, Rafael und Gadi bildeten die erste Reihe.
Racheli, Rina und ich die zweite.
Danach folgten alle anderen in Dreierreihen.
Ich warf einen Blick zurück.
Emil ging allein als Letzter.
Zurück zum Strand.
Wir waren ein eingeschworener Haufen, hatten uns auf dem heißen Sand ausgestreckt, nur Emil saß in einem Liegestuhl, versunken in ein Astronomiebuch.
Ich betrachtete ihn heimlich.
Rina sprach als Erste, sagte, sie wolle zum Nachrichtendienst. Gadi nahm an, dass Rina Oberstleutnant werden würde, denn schöne Frauen dienten beim Nachrichtendienst, so wie die Besten zur Luftwaffe gingen, und Micki teilte uns endlich mit, er habe sich entschieden, freiwillig bei einer Elite-Patrouille zu dienen.
Gadi wandte sich an mich. »Und du?«, fragte er.
»Ich …«
Emil hob den Blick von seinem Buch und schaute mich interessiert an.
»Sie wird zum Nachal gehen«, antwortete Rafael für mich.
Während wir darüber sprachen, zu welchem Bataillon wir uns melden wollten und wer von uns im nächsten Krieg ein Held sein würde, konnte ich ihm nicht in die Augen sehen. Dennoch sah ich wieder und wieder zu Emil hinüber, ich wollte wissen, wozu er sich melden würde. Aber bevor ich es wagte, ihn zu fragen, behauptete Gadi, Emil, der Feigling, würde sich zum Dienst in der Kantine melden und uns allen Waffeln verkaufen.
Wir lachten.
»Ich hoffe, es wird Leute geben, denen ich Waffeln verkaufen kann«, sagte Emil, ohne den Kopf von seinem Buch zu heben.
Mai 2014
Gedenktag für die gefallenen israelischen Soldaten
Nach der zweiten Sirene fällt mein Blick wieder auf den Bildschirm. Die Fahne steht auf halbmast, Politiker, Rabbiner, Offiziere, Eltern, Brüder, Schwestern und Freunde, Sprecher, die das Kaddisch sagen, Gedichte des Gedenkens, Berichterstatter der Kriege, Geschichte der Gefallenen in den verschiedenen Kriegen, die Hymne.
Mai 1968
Gedenktag für die gefallenen israelischen Soldaten
Ich sah Blumensträuße vor mir.
Ein Blumenstrauß für Rafael.
Ein Blumenstrauß für Gadi.
Ein Strauß für Jehuda, unseren Gruppenleiter.
Ein Strauß für Motti, Rinas Bruder.
Und Micki, der schwere Verbrennungen erlitten hatte, nur ein Schatten des alten Micki, geht zwischen den Gräbern umher.
Ein schneller, abgehackter Clip flackert durch meinen Kopf.
Die Wache stand still.
Die verehrten Redner betraten die Bühne.
Ich betrachte die Grabsteine.
»Rafael Josef Levi.
Sohn von Sara und Mordechai.
Gefallen in den Kämpfen um die Golanhöhen.
Er wurde einundzwanzig Jahre alt.
Seine Seele möge am ewigen Leben teilhaben.«
Wieso ist nichts von dir geblieben?, fragte ich ihn dreißigtausend Fuß über dem Meeresspiegel.
Auch als man mir sagte, sein Panzer sei direkt getroffen worden, konnte ich mir nicht vorstellen, dass nichts von ihm übrig geblieben war, dass sie nur Reste von der Wand des verbrannten Tanks gekratzt hatten. Um standzuhalten, summte ich für mich den Säbeltanz, zu dem auch jetzt die Melodie seines Akkordeons erklang.
»Gadi Schiowitz.
Sohn von Mirjam und Jizchak.
Gefallen im Kampf um den Sinai.
Er war einundzwanzig Jahre alt.
Seine Seele möge am ewigen Leben teilhaben.«
Sein Flugzeug wurde direkt getroffen, er schaffte es nicht abzuspringen.
Man sagt, er habe nicht gelitten.
Nur Micki war am Leben geblieben.
Er wurde von feindlichem Feuer getroffen. Geriet in seinem gepanzerten Fahrzeug in Brand.
Racheli, Rina und ich besuchten ihn im Krankenhaus.
Als er zu Bewusstsein kam und wieder sprechen konnte, bat er uns, nicht mehr zu kommen.
Als wären nicht über vierzig Jahre vergangen. Dieser Krieg und ich, immer der gleiche Albtraum. Immer die selben Gesichter und Namen.
»Die Blume, die wir uns im Gedenken an die Gefallenen ans Revers stecken, ist eine Blume der Makkabäer. Der Überlieferung nach erblühte diese Blume da, wo das Blut von Helden der Makkabäer vergossen wurde.«
Die Lehrerin hielt in einer Hand die Abzeichen, und bevor sie sie uns ansteckte, erklärte sie ihre Bedeutung. Emil meldete sich und sagte, dass die Sitte, sich eine Blume ans Revers zu heften, aus England stamme, aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. In England waren es poppies – sie symbolisierten die Mohnblumen, die in Flandern wuchsen, das Heldentum der britischen Soldaten. »Das war nicht unsere Idee, und es hat nichts mit den Makkabäern zu tun«, fasste er zusammen.
Die Lehrerin schnitt Emil das Wort ab und sagte, die Sirene werde gleich ertönen und die Zeremonie müsse beginnen. Sie steckte ihren aufgeregten Schülern die Abzeichen mit der Blume der Makkabäer an. Bei mir hinterließ der Stich einen winzigen Blutstropfen auf meiner weißen Bluse.
Emil war der Erste, der den bedauernswerten Unfall bemerkte. Er musste lachen und flüsterte: »Im nächsten Jahr wird dir an dieser Stelle eine Blume der Makkabäer wachsen, nach zwei Jahren zwei, und wenn du alt bist, wirst du ein ganzes Blumenbeet haben.« Als die Lehrerin hörte, was er sagte, schloss sie ihn von der Zeremonie aus. Sie sagte, er lasse es am nötigen Respekt für die Gefallenen fehlen.
Die Zeremonie begann.
Gadi schlug die Trommel, Micki ließ die Nationalfahne auf halbmast herunter.
Die Sirene zerschnitt die Luft.
Die Nadel stach und ich stand stramm.
Als die Sirene verstummte, griff Rina, die Solistin des Chors, nach dem Mikrofon und sang Es brüllten die jungen Männer, der Krieg war vorbei.
Racheli las das Gedicht »Hier liegen unsere Körper«.
Dann betraten alle Klassenkameraden, die ein Familienmitglied verloren hatten, einer nach dem anderen die Bühne.
Sie lasen die Namen vor.
Micki war der Erste, wegen seines Onkels Schulem.
Ich wünschte, ich hätte einen Heldenonkel. Ich wünschte, ich hätte einen Bruder, der im Kampf gefallen war. Was für ein Gedanke.
Am Schluss des »Gedenke« durfte ich die Kerze des Gedenkens anzünden. Und danach spielte Rafael auf seinem Akkordeon Bab el-Wad, gedenket für immer unserer Namen …
Zur Beendigung der Zeremonie stellten wir uns alle vorn auf der Bühne auf und schworen, die Gefallenen nie zu vergessen.
»Ich schwöre«, rief ich mit allen.
Mai 2014
Am Ende des Gedenktages
Die Zeremonie des Zündens der Fackel auf dem Herzlberg. Und wieder sind Politiker, Rabbiner, verwaiste Eltern versammelt. Die Fahne wird gehisst, Feuerwerk, die Hymne.
Aber die Freude über den Unabhängigkeitstag will sich nicht einstellen. Die Bedrückung will nicht weichen.
Wieder Karaoke und Grillen, aber was wird danach kommen? Der nächste Krieg?
Trotz dieser Empfindungen und Gedanken raffe ich mich auf und gehe zu einer der Partys. Bevor ich das Haus verlasse, bekomme ich von Mohammed eine Freundschaftsanfrage auf Facebook.
Ich stimme zu.
»Hast du schon mit dem Schreiben begonnen?«, textet er und fügt ein Smiley hinzu.
Ich begreife, dass der Satz, den er mir zugeworfen hatte, während wir bei Salim auf den Hummus warteten, nicht nur so dahingesagt war.
Dieser Mann scheint entschlossen, er würde nicht einfach aufgeben.
»Hier ist die Handynummer von Suliman. Du solltest mit ihm anfangen. Ruf ihn an, gib ihm eine Chance. Ich schwöre dir, du wirst es nicht bedauern. Du bekommst von uns ein prima Buch.«
Beruhige dich, sage ich laut zu mir.
Später essen wir alle Kebab und singen unsere Lieder.
Weil das unser, unser Land ist … Ich bewege nur die Lippen.
Das ist schon Tradition.
30. Mai 2014
Soldaten vom Grenzschutz verhindern einen Selbstmordanschlag, als sie an der Straßensperre einen palästinensischen Terroristen mit einem Sprengstoffgürtel erwischten.
Es gibt nichts Neues unter unserer Sonne.
12. Juni 2014
Tel Aviv
Ich treffe ihn um die Mittagszeit im Restaurant gegenüber unserer Wohnung.
Als er mich kommen sieht, leuchten seine Augen.
»Ich freue mich, dass du so spontan gekommen bist, noch dazu so schnell«, sagt Mohammed. »Danke, wirklich danke.«
Ich bleibe vorsichtig, sage nicht, dass ich gleich gegenüber wohne.
»Entschuldige, dass es so kurzfristig ist, ich bin auf dem Weg zu einer Verabredung, und als ich tankte, kam mir die Idee.« Er trägt ein Jackett und sieht irgendwie feierlich aus.
»Ich freue mich wirklich, dass du gekommen bist«, sagt er noch einmal und schlägt vor, dass wir uns in eine ruhige Ecke des Lokals setzen. Er hebt die Hand, um den Kellner zu rufen. Als er kommt, spricht er arabisch mit ihm.
»Schawarma, ist dir das recht?«, fragt er mich.
»Ich bin Vegetarierin.«
»Wallah, wie konnte ich das vergessen, du bist schließlich aus Tel Aviv, was für ein Dummkopf bin ich doch. Obwohl ihr alles habt, esst ihr am Schluss Kopfsalat.« Er lacht und bestellt für die Dame Salat und fährt fort, mit dem Kellner arabisch zu sprechen, deutet auf mich und lächelt.
»Redest du über mich?«
»Was heißt da reden? Das ist Amer, ein Onkel von mir.«
»Ein Onkel? Wirklich?«
»Es ist schwer mit dir. Du beharrst hartnäckig darauf, mir nicht zu glauben, auch wenn ich die Wahrheit sage. In Deutschland glaubt man mir, auch wenn ich lüge.« Wieder lächelt er. »Aber darum geht es nicht. Außerdem muss ich bald los, konzentrieren wir uns deshalb auf das Wesentliche. Ich möchte dir etwas Außergewöhnliches vorschlagen.«
Wir ignorieren die verschiedenen Salate, den Hummus, die Fladen und das Schawarma, die auf dem Tisch stehen.
»Ich habe einen Freund, einen wahrhaft Intellektuellen, so einer, für den es kein Buch gibt, das er nicht gelesen hat. Er sagt immer, dass Literatur und Theater unsere Gesellschaft zwar nicht verändern, aber die Kraft besitzen, unsere Aufmerksamkeit auf komplizierte Themen zu richten. Er hat vorgeschlagen, wir sollten die Literatur für unsere Träume nutzen.«
Ein Freund, und sein Name ist Walter Benjamin.
»Normalerweise gehöre ich nicht zu denen, die sich an alle Details erinnern, aber heute, als ich tankte, sind mir plötzlich einige Dinge in den Kopf gekommen. Ich habe mich erinnert, in deinem Facebookaccount war zu lesen, dass du noch nicht weißt, wovon dein nächstes Buch handelt. Immer würde jemand dir irgendetwas über das Leben erzählen, über Menschen, über Erinnerungen, über Liebe oder über Qualen, und wenn dich die Geschichte fasziniere, würde ein neues Buch geboren. Deshalb habe ich einen Vorschlag: Wir werden dein neues Buch.«
»Wer ist das, wir?«, frage ich.
»Die Friedenskämpfer. Hast du schon etwas von ihnen gehört?«
Also keine Paranoia. Ich sitze neben einem Terroristen.
Ich bin eine Linke, aber soll ich neben einem Mörder vor einem Teller Hummus und Salat sitzen? Welchen Autobus hat er in die Luft gejagt? Wen hat er umgebracht? Auch Frauen und Kinder? Hat er geplant oder ausgeführt? Mit Fernbedienung, mit einem Gewehr, mit einem Messer? Hat er triumphiert, als sie starben?
Die Gedanken hämmern in meinem Kopf. Es ist wie in einem schlechten Film. Zweifellos bemerkt er, wie sich mein Gesicht verdüstert.
»Auf Facebook hast du geschrieben, dass jeder Schriftsteller eine Geschichte braucht. Ich liefere dir Supergeschichten.« Er versucht, mich zu gewinnen.
Fuck, ich sitze in einem Restaurant mit einem Terroristen.
Er will mich einwickeln, das spüre ich. »Der Hummus hier ist großartig«, sagt er, obwohl weder er noch ich die appetitlich angerichteten Teller auf dem Tisch angerührt haben.
Ich versuche, tief zu atmen. Die Friedenskämpfer haben sich für einen Dialog entschieden, sage ich mir. Ehemalige Terroristen von ihrer Seite, Kriegsdienstverweigerer in den besetzten Gebieten von unserer.
Sie haben eine gemeinsame Bewegung gegründet.
»Schau, ich habe meinen alten Werkzeugkasten weggepackt«, fährt er fort. »Jahrelang habe ich geglaubt, wir könnten nur durch euren Tod etwas gewinnen. Heute glaube ich, du und ich könnten ein Paradies haben.«
»Ein Paradies? Wo?«, frage ich.
»Zwischen dem Meer und dem Jordan«, sagt er und schaut mich mit einem tiefen Blick an.
»Zumindest solltest du es versuchen«, fährt er fort.
»Was versuchen?«
»Uns kennenzulernen.«
Ich schaue ihn verwirrt an.
Er greift sich mit beiden Händen an den Kopf. Mein Blick verrät meine Gedanken, das ist klar. Er ändert die Taktik. »Ich kenne einen Witz, der uns vielleicht weiterhilft. Eine linke Junggesellin sucht händeringend nach einem gleichgesinnten Liebhaber. Ihre Freude ist groß, als sie jemanden findet, der wie sie zu jeder Demonstration geht, der keine Produkte aus den besetzten Gebieten kauft, der die grüne Linie nicht überschreitet, der nur linke Parteien wählt. Sie verliebt sich auf der Stelle in ihn. Sie ziehen zusammen und sprechen sogar von Heirat. Dann sagt er eines Abends zu ihr, er wolle mit seinen Freunden ausgehen.
›Mit wem?‹, will sie wissen.
›Mit Achmed, Fadi und Nidal‹, antwortet er.
›Was, du hast arabische Freunde?‹, fragt sie verblüfft.
›Klar‹, antwortet er.
›Das war’s‹, sagt sie. ›Pack deine Sachen und hau ab.‹«
Er schaut mich an.
Das sollte ein Witz sein?
»Oh, ich bin spät dran, ich muss los«, sagt er mit einem Blick auf die Uhr.
Er hat es aufgegeben.
Er beeilt sich, die Rechnung zu verlangen und das Essen zu bezahlen, das wir nicht gegessen haben.
Auf der Rechnung, die auf dem Tisch liegen bleibt, notiert er eine Telefonnummer.
»Das ist die Handynummer von Suliman. »Ich bitte dich, ruf ihn an, glaub mir, du wirst es nicht bereuen, er wird dir ein Buch liefern«, sagt er und verschwindet.
»Wenigstens einen schwarzen Kaffee mit Zucker und Kardamom?«, schlägt der Kellner vor, der enttäuscht das Essen abräumt.
Aus Höflichkeit bleibe ich noch ein paar Minuten sitzen. Der Kaffee hilft mir, die Gedanken zu ordnen und meine trockene Kehle zu befeuchten.
»Übrigens, wie sind Sie miteinander verwandt?«, frage ich den freundlichen Kellner, bevor ich gehe.
»Ismael ist unser Vater, Mohammed unser Prophet, wie sollten wir nicht verwandt sein?«
Das ist seine Antwort.
12. Juni 2014
Drei junge Israelis werden in der West Bank gefangen genommen und getötet.
Mörder.
Raketen werden auf Siedlungen in der Nähe von Gaza abgeschossen.
Juli 2014
Operation »Fels in der Brandung«
Drei Wochen nach meinem Treffen mit Mohammed kehrt der Alltag in unser Paradies ein.
Erneut sind überall im Land Sirenen zu hören, am Himmel sind Raketen, auch über Tel Aviv.
Ein scharfes Pfeifen, Stürzen, ein Aufschlag. Angsteinflößend.
Wir füllen den Schutzraum unserer Wohnung wieder mit Wasserflaschen und Tüten voller Nahrungsmittel, und bei jedem Sirenengeheul renne ich samt Handy in den Schutzraum und kontrolliere, ob meine Familie und Freunde Schutz gefunden haben, ob niemand verletzt wurde.