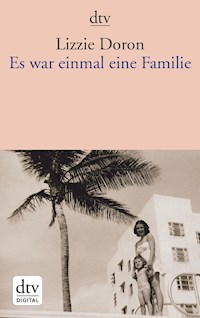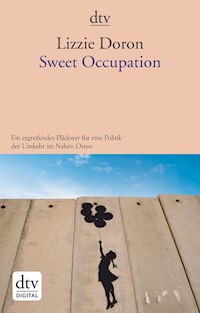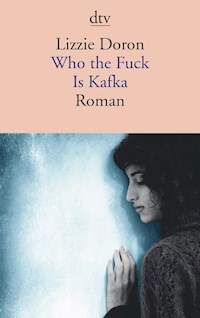8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die ganze Welt in einem Friseursalon Leale, mittlerweile um die sechzig, wurde von ihren Eltern einst einer polnischen Bäuerin anvertraut und überlebte Krieg und Verfolgung in einem Erdloch. Gerade volljährig heiratete sie in Israel den polnischen Schneider Sulik, denn sie sehnte sich nach einer Familie. Die beiden bekommen einen Sohn. Aber, sagt Sulik: »Man braucht auch einen Beruf, um zu überleben.« Und wirklich, nach Suliks Tod rettet die Arbeit in Sajtschiks Friseursalon ihr das Leben. Dreißig Jahre lang manikürt Leale den Frauen des Viertels die Nägel, hört ihre Geschichten und ist Sajtschiks Vertraute. In diesem Friseursalon verdichtet sich alles, Gegenwart, Vergangenheit, Erinnerungen, Sehnsucht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 221
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Lizzie Doron
Ruhige Zeiten
Roman
Aus dem Hebräischen von Mirjam Pressler
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Dieses Buch ist Menschen gewidmet, an die sich niemand erinnern wird.
1
Mein Srulik hatte es morgens eilig, zur Arbeit zu kommen. Er zog einen Schuh an, den zweiten hielt er in der Hand, und dann, auf einmal, hörte sein Herz auf zu schlagen. Er sank vom Bett auf den kalten Boden und starb, mit dem Schuh in der Hand. Einundvierzig Jahre war mein Srulik alt und ist, einfach so, eines schönen Tages gegangen.
Barfuß, in einem dünnen Nachthemd, stand ich mitten im Schlafzimmer und schrie: »Hilfe! Srulik ist gegangen! Hilfe! Srulik ist gegangen!«
Als ich keine Stimme mehr hatte, stand ich da und schaute abwechselnd auf unseren Sohn Etan, der damals kaum vier Jahre alt war, und auf den toten Srulik und fragte mich, woher Hilfe kommen würde.
Und ob ihr es glaubt oder nicht – sie kam.
Sajtschik, der Friseur, erschien. Er rannte ins Schlafzimmer, schüttelte zwei-, dreimal den toten Srulik, rief seinen Namen, dann reichte er mir ein Glas Wasser, umarmte meinen kleinen Etan und lief los, um Dr. Wollmann zu holen, der kurz darauf eintraf, meinen Srulik anschaute und sagte: »Leale, es tut mir sehr leid.«
Ich erinnere mich nicht mehr, was dann geschah.
Sieben Tage lang schluckte ich Medikamente. Rosa, die Nachbarin, war verantwortlich für die Bewirtung der Gäste und Sajtschik für deren Empfang. Er kümmerte sich um die Nachbarn, die kamen, um Trost zu spenden, spielte mit meinem Etan, erzählte ihm Geschichten und brachte ihn ins Bett.
Sieben Tage und sieben Nächte saß Herr Sajtschik, der Friseur, mit uns zusammen.
Am Ende der sieben Trauertage, als wir vom Friedhof zurückkamen, teilte er mir mit: »Ab morgen arbeitest du bei mir im Friseursalon.«
Bis mein Srulik starb, hatte ich Sajtschik nicht gekannt, den Menschen Sajtschik.
Sajtschik war für mich der Friseur mit Brillantine im Haar, in einem weißen Anzug, mit schwarzen Lackschuhen und mit grünen Augen. Sajtschik war Sruliks Freund gewesen, und mein Srulik, er ruhe in Frieden, war der beste Schneider im ganzen Viertel und auch der Einzige.
Tage- und nächtelang hatte mein Srulik für Sajtschik auf Bestellung weiße Anzüge genäht. Und ich liebte es, ihm zuzuschauen, wie er den weißen Stoff zuschnitt und, mit Stecknadeln zwischen den Lippen, die Nähte mit grauer Kreide markierte, sie mit einem Reihfaden zusammenheftete und den genauen Abstand zwischen den Knöpfen ausmaß.
Ein Künstler, wirklich ein Künstler, sagte ich mir. Stundenlang schaute ich ihm bei der Arbeit zu, und obwohl er fast achtzehn Jahre älter war als ich, hatte ich immer gespürt, dass ich ihn aus großer Liebe geheiratet hatte.
Als Srulik mich ins Viertel gebracht hatte, war ich vielleicht achtzehn gewesen. Zu meinem Glück war er in den Kibbuz gekommen, um Mordechai zu besuchen. Mordechai war derjenige, der mich in dem Waisenhaus in Polen gefunden hatte, und auch der Einzige aus dem Städtchen von Srulik, der noch vor dem Krieg ins Land gekommen war. Vom ganzen Städtchen sind nur Mordechai und Srulik geblieben.
Mordechais Frau war eine seltsame Frau, schön und schweigsam, den ganzen Tag über arbeitete sie im Magazin und im Sekretariat des Kibbuz, und am Abend machte sie Wachdienst. Ihre beiden Kinder waren sehr klein und wuchsen bei Kinderschwestern im Babyhaus auf. Ich war die ganzen Jahre im Haus der großen Kinder, und einmal am Tag kam Mordechai, um zu sehen, wie es mir ging.
Meinen Srulik traf ich bei Mordechai, schon in der ersten Woche, nachdem ich ins Land gekommen war. Ab da wollte er jedes Mal, wenn er Mordechai besuchte, auch mich sehen. Immer brachte er Süßigkeiten und Bücher mit, und manchmal nähte er mir auch einen Rock oder ein Kleid.
Mordechai erzählte mir, dass Sruliks verstorbene Frau ebenfalls Leale geheißen hatte.
Zwei Jahre später schlug mir Srulik vor, mit ihm zu leben, und ich zögerte keine Sekunde.
Ich habe doch so sehr gelitten im Kibbuz. Ich war dünn und schwach. Jedes Mal, wenn man mir Hacke und Spaten gab, hatte ich Angst, meine Arme würden mir von den Schultern fallen, und der Geruch von Erde lähmte mich und verursachte mir Sodbrennen. Für mich war es der Geruch des Krieges.
In den Feldern, den Orangenhainen und Obstgärten hatte ich das Gefühl zu ersticken, während der Blütezeit bekam ich Asthmaanfälle, im Stall wurde ich von den Kühen getreten, und im Herzen wusste ich, dass kein Kibbuznik mich je heiraten würde.
Ich fühlte, dass es das Schicksal war, das mir Srulik gebracht hatte, ich glaubte, wir seien füreinander bestimmt. Ich war inzwischen – so hatte man im Kibbuz entschieden – etwa achtzehn, und Srulik war ein erfahrener Mann, der schon zweimal achtzehn Jahre gelebt hatte.
Bereits an meinem ersten Tag im Viertel traf ich Sajtschik, den Friseur, vor seiner Ladentür.
Srulik umarmte mich fest und sagte mit zitternder Stimme zu Sajtschik: »Das ist Leale, noch einmal eine Leale für mich.«
Und bis heute höre ich, wie Srulik zu mir sagte: »Leale, das ist der schöne Sajtschik, wir sind Freunde von dort.«
Sajtschik lächelte und sagte: »Immer waren wir zusammen, Nachbarn, eine Pritsche über der anderen.«
»In der freien Zeit«, fuhr Srulik fort, »wenn wir die Latrine geputzt hatten, wenn wir unsere Suppe mit Dreck gegessen hatten, hat Sajtschik Frisuren entworfen.«
»Und dein Srulik«, sagte Sajtschik, »hat dort gestreifte Anzüge genäht.«
»Du siehst, majn kind«, sagte Sajtschik bei diesem Treffen zu mir, »man braucht einen Beruf, um zu leben.«
Und Srulik wiederholte: »Ja, Leale, man braucht einen Beruf, um zu leben.«
Auch nach unserer Hochzeit blieb Sajtschik, der Friseur, mit Srulik verbunden. Oft kam er nach einem Arbeitstag zu uns, um einen Anzug auszusuchen oder anzuprobieren. Ganze Nächte verbrachte er flüsternd mit Srulik in dessen Arbeitszimmer.
Einmal platzte ich in das kleine Arbeitszimmer und weinte und sagte zu Srulik, dass er viel eher Sajtschiks Mann sei als meiner.
Srulik wurde rot und Sajtschik blass.
»Wir haben einen Bund«, antwortete er mir nach einem langen Schweigen.
So lernte ich, dass man Sajtschik nicht wehtun durfte. Ich bat um Verzeihung und mischte mich nicht mehr ein, aber in meinem Herzen war ein bisschen Zorn auf Sajtschik, der abends zu Srulik kam und der, weil er keine Frau und keine Kinder hatte, bis mitten in der Nacht blieb, als hätte auch Srulik keine Familie.
Als die sieben Trauertage vorbei waren und ich den kleinen Etan in den Kindergarten gebracht hatte, ging ich nicht in die leere Wohnung zurück. Bis heute weiß ich nicht, was mich dazu trieb, Sajtschiks Vorschlag anzunehmen und bei ihm im Friseursalon zu arbeiten.
Ich glaube, ich hatte Angst, dass ich nicht genug Geld für meinen Etan haben würde, vielleicht hatte ich auch Angst, in der leeren Wohnung verrückt zu werden.
In Sajtschiks Friseursalon sah es aus wie immer, alles glänzte vor Sauberkeit, die Spiegel, die Geräte, das Waschbecken, die Handtücher, die Umhänge und der Fußboden, doch als ich kam, schlug Sajtschik vor, ich solle sauber machen.
»Aber es ist doch schon alles sauber«, sagte ich.
»Ich habe es gern, wenn der Salon vor Sauberkeit strahlt«, antwortete er.
Nachdem ich eine Woche lang den sauberen Friseursalon geputzt hatte, brach ich in Tränen aus. »Ich will kein Mitleid«, sagte ich mit erstickter Stimme und rannte aus dem Friseursalon.
Sajtschik rannte mir nach und packte mich an der Schulter.
»Ein Beruf«, sagte er ruhig zu mir, »man braucht einen Beruf, um zu leben.«
»Aber ich habe keinen Beruf«, erwiderte ich verzweifelt.
»Leale«, sagte er liebevoll, »irgendetwas kannst du bestimmt trotzdem.«
»Ich kann tief, tief in der Erde leben, ohne Essen, ohne Wasser, ohne Licht, das ist es, was ich am besten kann«, brach es aus mir heraus.
Sajtschik schwieg. Ich zitterte am ganzen Körper und lief bis abends mit bösen Gedanken herum.
Am nächsten Morgen ging ich wieder in den Friseursalon.
Sajtschik hatte mir in einer Ecke schon einen kleinen Tisch vorbereitet, mit Nagellackfläschchen, mit Aceton, Vaseline, Nagelfeile, Nagelschere und mit Watte in einem Glasbehälter. Und bevor die ersten Kundinnen kamen, brachte er mir alles bei, als wäre er ein großer Fachmann für Maniküre.
Von diesem Tag an arbeitete ich von neun Uhr morgens bis zu dem Zeitpunkt, wenn Etan nach Hause kam, im Friseursalon.
Über dreißig Jahre lang saß ich auf demselben Platz, auf einem Hocker vor einem niedrigen Tisch. Ich atmete den Geruch des Acetons ein, ich schüttelte alle möglichen Nagellackfläschchen und betrachtete die Finger und die Fingernägel aller Frauen des Viertels.
Und mit jedem Tag, der verging, liebte ich Sajtschik mehr.
Und dann, einfach so, nach einer schweren Krankheit, ist auch mein Sajtschik gegangen.
Wieder und wieder habe ich die Beerdigung in Kiriat Scha’ul vor Augen, ohne Familie, ohne Verwandte, ohne Kinder. Nur ein paar alte Leute aus dem Viertel und Mordechai vom Kibbuz folgten seinem Sarg, sehr langsam und still.
Niemand weinte. Wir hatten ja schon seit vielen Jahren keine Tränen mehr.
Vor uns schritten die Rabbiner, die gekommen waren, um von Gott Gnade und Vergebung zu erflehen. Ich konnte mich nicht beherrschen und sagte zu ihnen, um diesen Mann, der da gegangen war, müsse Gott weinen.
Dann verlor ich meine Stimme, und nur meine Lippen bewegten sich stumm, als ich sagte, dass Sajtschik a mentsch gewesen sei, ein wirklicher Mensch.
Dorka, Guta und Zila hatten Angst, ich würde zusammenbrechen, aber auch ihnen tat das Herz weh, und womit hätten sie schon helfen können.
»Wer wird sich an Sajtschik erinnern?«, fragte mich Dorka. »Und wer wird sich an uns erinnern?«, fragte Guta, die Frau des Rabbiners.
Und Zila flüsterte mir zu: »Unseren Sajtschik darf man nie vergessen.«
Ihre Worte schmerzten mir in den Ohren wie Stromschläge, ich wollte sie bitten zu schweigen, aber wieder versagte mir die Stimme, und nur meine Lippen bewegten sich lautlos.
Inzwischen hatte ein Mann von der Chevra Kaddischa, der Beerdigungsgemeinschaft, das Grab vorbereitet. Der Geruch der sandigen Erde ließ meine Gefühle und meine Muskeln erstarren. Wie versteinert stand ich dort neben dem Grab. Dr. Wollmann, der sich kaum auf den Beinen halten konnte, schaute mir die ganze Zeit in die Augen, um zu sehen, ob ich noch lebte, und Frau Poliwoda, die Frau des Metzgers, gab mir etwas Wasser, und mit den verbleibenden Tropfen befeuchtete sie mir das Gesicht.
Dann gab es eine kurze Zeremonie. Der Kantor betete das El male rachamim, »Gott voll Erbarmen«, und Ruben vom Gemüseladen, Poliwoda von der Metzgerei und Mordechai vom Kibbuz füllten das Grab meines Sajtschik mit Erde.
Und dann war es auch schon vorbei, die Beerdigung war zu Ende.
2
Als alle weggegangen waren, lief ich weiter auf dem Friedhof herum, nur ich, ganz allein. Ich traf dort viele nahe Menschen, ich sah die Gräber von Ida Zitrin, der Kosmetikerin, und von Tanja, die einen Hund namens Rexi gehabt hatte, sie mögen in Frieden ruhen, und auch das Grab von Esterke Pschigurski, die sich das Leben genommen hatte, kurz nachdem ich ins Viertel gekommen war. Dann traf ich Minka Marcus und ihren Mann, den Zahnarzt, beide lagen beieinander, neben dem Grab von Tova, der Frau von Dr. Wollmann, dem Arzt. Dann besuchte ich noch meinen Srulik, der dort im alten Friedhofsteil begraben lag, zusammen mit den Veteranen des Viertels.
Ich fing an, darüber nachzugrübeln, wie sich die Toten da im Dunkeln fühlen, ob es ihnen wehtut, wenn alles zerfällt. Ich wusste nicht, ob andere Leute nach Beerdigungen auch an solche Dinge denken.
Zu meinem Glück machte sich gerade in dem Moment, als mir diese Gedanken kamen, eine große Trauergesellschaft mit vielen Menschen auf den Weg. Um nicht allein zu sein, schloss ich mich ihnen an.
Es waren vielleicht tausend traurige Menschen, die weinten und schrien. Ich lief zwischen ihnen herum. Jeder von ihnen hatte den Verstorbenen gekannt. Der eine kannte ihn aus dem Kindergarten, der andere aus der Jugendbewegung, der Dritte war sein Onkel vom Land, wieder einer war mit ihm bei der Armee gewesen, und sein Sohn, der vielleicht dreißig war, hielt einen Nachruf, bei dem alle weinten, und ich stand unter ihnen und weinte auch. Ich schaute sie an und spürte Nadelstiche im Kopf und Neid im Herzen.
Als meine Beine müde und meine Augen und mein Mund trocken wurden, verließ ich den Friedhof, ich nahm mir ein Taxi und fuhr zurück in unser Viertel.
Ich setzte mich allein in den leeren Friseursalon.
Schmerzen tobten mir durch den Körper und das Herz. Alles brannte, als würde mein Körper in Flammen stehen.
Ich hatte Angst, in die leere Wohnung zurückzukehren, doch genau in diesem Moment sah ich im Spiegel Rosa Orenstein, meine beste Freundin. Sie kam auf den Friseursalon zu.
Rosa war nicht bei der Beerdigung gewesen. Rosa ist eine alte Frau, der das Gehen schwerfällt. Als ich sie näher kommen sah, war mir das unangenehm. Ich wusste, dass sie nur meinetwegen das Haus verlassen hatte.
Bis heute verstehe ich nicht, woher ich damals, gleich am ersten Tag nach meiner Ankunft im Viertel, den Mut genommen hatte, an Familie Orensteins Tür zu klopfen.
»Wer ist da?«, hörte ich die angenehme Stimme einer älteren Frau fragen.
»Ich, ich heiße Leale, ich bin die neue Frau von Srulik und bin heute hierhergezogen, in die Nachbarwohnung.«
Erst nachdem ich diesen ganzen langen Satz gesagt hatte, wurde mir die Tür von einer Frau geöffnet, die ein trauriges Lächeln hatte und dunkelblaue, junge Augen. Sie war ein bisschen dick, mit einem großen Busen, und ich weiß noch, dass sie ein geblümtes Kleid trug, und darüber eine Strickjacke, denn sie litt, wie sie mir sagte, immer sehr unter Kälte. »Herzlich willkommen«, begrüßte sie mich lächelnd und lud mich ein, zu ihr hereinzukommen.
Sie ging in die Küche, und ich schaute mich inzwischen in ihrer Wohnung um. Es gab zwei kleine Zimmer voller Bücher, auf den Tischen lagen Häkeldeckchen, an den Wänden hingen kleine gestickte Bilder, und im Wohnzimmer stand eine Kommode mit einem Glasaufsatz voller Porzellan- und Kristallgefäße. Auf den Tischen und Regalen standen Schwarz-Weiß-Fotos von verschiedenen Menschen, auch von Kindern. Und das Sofa und die Sessel waren mit Laken gegen Staub geschützt. In der ganzen Wohnung hing der Geruch von alten Sachen, aber das war mir angenehm. Ich setzte mich auf das Sofa im Wohnzimmer.
Sie servierte mir eine Tasse Kaffee und ein Stück warmen Hefekuchen. Auf einmal waren wir beide ein bisschen verlegen.
Rosa setzte sich mühsam in einen großen, braunen Samtsessel und breitete eine dünne, bunte Wolldecke über ihre Beine, die sie vermutlich aus Resten gestrickt hatte, und auf die Decke legte sie zwei oder drei dicke Bücher. Neben ihrem Sessel stand ein kleines Tabouret, eine Art Schemel, auf dem viele Bücher lagen, für ihre Kaffeetasse war kaum noch Platz darauf.
Rosa versank im Sessel. Trotz des Kleides und der Decke, die sie sich über die Knie gebreitet hatte, konnte ich sehen, dass sie geschwollene Beine mit Krampfadern hatte. Lange dachte ich, daran wären vielleicht die schweren Bücher schuld, die sie immer auf den Knien hatte.
»Woher kommst du?«, fragte sie mich und unterbrach damit meine Gedanken.
»Das weiß ich nicht«, antwortete ich.
Sie verstand sofort und fragte nicht weiter.
»Ich bin auch von dort«, sagte sie. »Ich bin etwas älter als du, deshalb weiß ich ein bisschen mehr.«
Dann fragte sie mich nach meinen Plänen.
»Familie«, sagte ich. »Ich möchte eine Familie.«
Danach schwiegen wir, wir tranken nur unseren Kaffee.
Rosa blätterte in einem der Bücher auf ihren Knien. Ich glaubte, sie wolle lesen, und hatte das Gefühl, es sei Zeit zu gehen. Aber vermutlich hatte mein Srulik mit ihr gesprochen, denn bevor ich ging, schlug sie mir vor, doch jeden Nachmittag zu kommen. Sie würde mir, versprach sie, ohne dass ich sie darum gebeten hatte, alles beibringen, was ich als gute Hausfrau wissen müsse.
Und ich, die noch nicht mal Rühreier machen konnte, lernte bei Rosa, wie man Hühnersuppe kocht, gefilte Fisch, Borschtsch und Kalbsfuß in Aspik, als wäre ich in einem normalen Zuhause aufgewachsen und meine Mutter hätte mir beigebracht, eine Ehefrau zu sein.
Jeden Tag ging ich zu ihr, zum Fünfuhrkaffee. So lernte ich auch Melech kennen, ihren Ehemann, der kein Wort Hebräisch konnte. Immer lächelte er mich an, ihm fehlten vorn zwei Zähne, und er sah aus wie »Gesegnet sei sein Angedenken«. Rosa erzählte, er würde in einer Wurstfabrik arbeiten und gut verdienen.
»Die Liebe ist süß, aber sie ist noch süßer mit Brot«, sagte sie.
Ich war damals so jung, und was verstand ich schon vom Leben.
Von Anfang an vertraute ich Rosa alles an.
Nur ihr erzählte ich, was ich im Kibbuz durchgemacht hatte, und ich sagte ihr auch, dass man mich dort Lea genannt hatte, wie die Lea aus der Bibel, die mit den matten Augen.
Nur ihr erzählte ich meine Gedanken über das Leben, und sie war die Erste, die wusste, dass ich schwanger war, sogar noch vor Srulik.
Ich erinnere mich, dass ich weinte, meine Tränen strömten wie die Donau im Winter, und sagte, dass ich nicht wisse, wie man ein Kind aufzieht.
Rosa gab mir den Mut, Mutter zu sein, sie versprach, es mir beizubringen.
Einmal, als mein Bauch schon riesig war, fragte ich sie, woher sie so viel über das Leben wisse.
Sie schwieg, aber ich hörte nicht auf zu fragen.
»Vom Leben«, antwortete sie schließlich. Aber ihre Antwort bedrückte mich noch mehr, ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich hatte das Gefühl, sie suche nach etwas, was unsere Stimmung verbessern könnte.
»Leale«, sagte sie, als habe sie eine Lösung gefunden, »über das Leben kann man sehr viel in den Büchern lernen.«
Das war die schönste Zeit in meinem Leben. Zusammen mit ihr ging ich in die Bücherei von Pschigurski, und zusammen lasen wir Märchen. Ich lernte sie richtig auswendig, die Geschichten von Schneewittchen, Aschenputtel, Dornröschen, Alice im Wunderland und dem Gänseblümchen mit Gold im Herzen.
Es gab auch Tage, an denen mir Rosa, um mich aufzuheitern, jiddische Lieder vorsang. Die Tränen fielen mir in den Kaffee und auf den Kuchen, und mein Herz zerfloss. Rosa sang leise, und ich summte die Melodie mit, bis ich die Worte aller Lieder kannte, aber ich ließ sie immer allein singen, als hätte ich eine Mutter und diese würde für mich singen. Ich glaube, auch für Rosa war das sehr aufwühlend.
Jeden Tag, wenn ich mit der Arbeit fertig war, wenn ich das Haus sauber gemacht, eingekauft und gekocht hatte, schaute ich auf die Uhr, weil ich immer schon auf mein Treffen mit Rosa wartete.
Manchmal besuchte ich sie auch an den Abenden, an denen Sajtschik zu Srulik kam, und manchmal mitten am Tag, wenn auch andere Gäste bei ihr waren.
Weil alle Rosa liebten, kamen viele, um sie zu besuchen.
Bei ihr traf ich zum ersten Mal Frau Poliwoda, die Frau des Metzgers, die Rosa jeden Tag Fleisch und Wurst brachte, zusammen mit ein paar Geschichten über die Nachbarn. Sie war eine schöne Frau, diese Frau Poliwoda, aber sie hatte nicht gerade einen klugen Ausdruck in den Augen, es sah aus, als wäre irgendetwas passiert und hätte ihren Blick einfach ausgelöscht.
Rosa erklärte mir, dass Frau Poliwoda versuche, mildtätig zu sein, deshalb bringe sie den Armen und Kranken fast jeden Tag Fleisch. Und obwohl es bei Rosa immer sehr viel Wurst gab, die Melech von seiner Arbeit in der Wurstfabrik mitbrachte, ließ es sich Frau Poliwoda nicht nehmen, sie täglich mit etwas aus der Metzgerei ihres Mannes zu versorgen.
Herr Mietek, der bei der Post angestellt war und viele Sorgen mit seiner Frau hatte, brachte Rosa die Briefe direkt in die Wohnung. Ich erinnere mich, dass sie einmal über ihn sagte, wenn er Kerzen verkaufen würde, würde die Sonne nie untergehen.
Guta, die Frau des Rabbiners, die einen kleinen Kopf mit einer aufgequollenen Perücke hatte, war oft bei Rosa, um sie dazu zu überreden, in die Synagoge zu kommen.
»Mich wirst du nicht in der Synagoge sehen, ich will nicht, dass Gott sich an mich erinnert«, beschied ihr Rosa immer wieder.
»Man muss Gott, gelobt sei er, vertrauen«, erklärte Guta bei jedem ihrer Besuche, und ich erinnere mich, dass Rosa sie immer bestärkte und ihr riet, Gott zu vertrauen, aber vorsichtshalber dennoch wachsam zu sein.
Wenn Guta bei Rosa war, spürte ich immer, dass eine gewisse Spannung in der Luft lag. Aber ich blieb da und hörte ihren Diskussionen zu.
Rosa sprach ein sehr schönes Hebräisch und kannte viele Wörter. Man sagte über sie, ohne den Krieg wäre sie sicher Professorin an der Universität oder eine berühmte Schriftstellerin geworden. Rosa hatte in Polen ein Gymnasium besucht und Latein, Englisch und Deutsch gelernt, sie besaß eine große Allgemeinbildung.
Ich glaube, dass ich jeden Tag zu ihr gegangen bin, mit Ausnahme von Tagen mit Krankheiten oder Festen.
Sie war für mich eine Schule. Nachdem wir aufgehört hatten, Märchen zu lesen, schritt ich fort und las mit ihr auch schwierigere Geschichten aus der griechischen Mythologie und Romane, die einen großen Einfluss auf meine Gefühle hatten, wie Vom Winde verweht und Doktor Schiwago.
Als mein Etan geboren wurde, kaufte Rosa ihm Kinderbücher. Bis heute weiß ich noch den Text von einem Zwergenbuch auswendig, außerdem Bialiks Gedichte für kleine Kinder. Abends, wenn Etan eingeschlafen war, saß ich neben ihm und las ihm leise, damit er nicht aufwachte, all die Märchen und Gedichte vor, und nachts, wenn niemand es hörte, sang ich für ihn die Wiegenlieder, die ich von Rosa gelernt hatte, und das gab mir die Sicherheit, eine gute Mutter zu sein.
Ein paar Monate nach der Geburt bekam ich Albträume, ich hatte schreckliche Angst, dass Rosa, weil sie alt war, bestimmt bald sterben würde. Dann stand ich mitten in der Nacht auf, und statt »Srulik« zu rufen, rief ich »Rosa«. Und ich zitterte am ganzen Körper und schämte mich vor Srulik.
Es ist gar nicht lange her, ein paar Tage, bevor Sajtschik starb, da kam Rosa extra seinetwegen in den Friseursalon und sagte, er solle sich zusammennehmen und zu Dr. Wollmann gehen, denn es sei besser, krank in einem warmen Haus zu sein als tot in einem kalten Grab.
Meinem Sajtschik half Gott nicht sehr viel, aber Rosa erwies er, gelobt sei er, seine Gnade, und sogar heute, da sie sehr alt ist und ihr Körper schon fast gestorben, arbeitet ihr Kopf noch wie der von Einstein. Das Einzige, um was sie mich bittet, wenn ich sie besuche, ist, dass ich Bücher zu Pschigurskis Bücherei zurückbringe und neue hole.
Ich regte mich schrecklich auf, als Rosa nun den Friseursalon betrat.
»Mejdele, komm nach Hause«, sagte sie zu mir, »die Toten kehren nicht zurück, auch wenn man auf sie wartet.«
Ich schaute sie an, war aber unfähig, den Friseursalon zu verlassen.
»Ich werde hierbleiben, bis auch ich tot bin«, sagte ich.
Sie antwortete nicht, vermutlich verstand sie meinen Zustand. Sie streichelte mir nur über den Kopf. »Ich werde auf dich warten, bis du nach Hause kommst«, sagte sie zu mir und verließ mit kleinen, langsamen Schritten den Friseursalon.
Ich schaute ihr nach. Sie war in sich zusammengefallen und krumm, sie hatte Wasser in den Beinen, und an ihren Armen hing die Haut wie Lappen herunter, ihre Haare waren weiß und ihre Schritte schwer, aber voller Kraft. Bei jedem ihrer Schritte stieß ihr Gehstock hart auf den Bürgersteig.
Auf einmal hatte ich das Gefühl, ihr Gehstock verwandle sich in einen großen, bunten Schirm und sie würde anfangen, himmelwärts zu fliegen, genau wie Mary Poppins.
»Rosa!«, schrie ich mit aller Kraft, aber sofort zwang ich mich zur Ruhe, mit ihren geschwollenen Beinen würde sie ja sowieso nicht weit fliegen können.
Rosa hörte meinen Aufschrei, sie drehte sich um. Ich machte ihr mit der Hand ein Zeichen, dass ich später zu ihr kommen würde, und sie bedeutete mir mit einer Handbewegung, dass sie verstanden hatte, und ging weiter.
Ich liebte sie.
Fast mein ganzes Leben und alle Vergnügungen waren mit Rosa verbunden. Mein Srulik war glücklich, dass er endlich ein Zuhause hatte, er ging nicht gerne aus. Nach Sruliks Tod konnte ich auch mit Sajtschik nichts unternehmen, denn es gehörte sich einfach nicht, dass ein Junggeselle und eine Witwe abends zusammen ausgingen. Und so kam es, dass von allen Leuten, die ich kannte, nur Rosa mit mir und Etan etwas unternahm.
Wir gingen in den Zirkus, ins Eisballett, in Sound of Music und in Mary Poppins, wir besuchten auch andere berühmte Musicals, wie My Fair Lady, Kazablan, König Salomon und Schalmai, der Schuster – das alles sah ich mit Etan und Rosa, wir drei zusammen, wie eine Familie.
Manchmal gingen Rosa und ich, nur wir beide, auch in Filme für Erwachsene, zum Beispiel Die zwei Kuni Lemel, Jenseits von Eden und Fieber im Blut. Rosa war die Einzige, die wusste, dass ich mich in James Dean verliebt hatte, aber auch er starb leider jung, wie alle, die ich liebte.
Das ist nun alles lange her, es war damals, als ich jung war und noch ein wenig Freude hatte.
Ich schaute ihr immer noch nach. Mit langsamen Schritten entfernte sie sich vom Friseursalon.
Sie ist meine beste Freundin, dachte ich, und trotzdem gab es Dinge, über die wir nie miteinander sprachen. »Jeder braucht etwas Privates in seinem Leben«, hatte sie einmal zu mir gesagt, damals, als ich noch jung war.
Und ich wusste, dass sie mir deshalb nie erzählt hatte, warum sie kinderlos war. Und ich hatte ihr nie erzählt, dass ich Sajtschik liebte.
3
Rosa entfernte sich immer weiter. Ich blieb im Friseursalon, ich saß wie festgeklebt auf dem Stuhl vor dem Spiegel und konnte mich nicht rühren. Ich erzählte Sajtschik, dass nur wenige Menschen zu seiner Beerdigung gekommen waren, etwa zwanzig, vielleicht auch weniger, aber jeder von ihnen war traurig gewesen.
»Weißt du«, wiederholte ich für ihn das, was Ida, die Kosmetikerin, einmal zu mir gesagt hatte, »der Krieg hat uns die Familie und die Verwandten genommen, und die Zeit, die vergeht, nimmt uns die Nachbarn und die Freunde.«
So sprach ich mit dem toten Sajtschik, laut und vor dem Spiegel, und mein Kopf war wirr von Gedanken und Sehnsüchten.
Ich schaute aus dem Fenster, um mich abzulenken, aber wenn das Herz wehtut, vergrößert alles, was man sieht, den Schmerz nur noch.
So fiel mir auf, dass das kleine Wiesenstück neben dem Friseursalon braun und leer war, nur da und dort war etwas Grün von Gräsern zu sehen. An jenem Tag sah ich auch, dass dort schon kein Klee und keine Chrysanthemen mehr wuchsen. Früher hatte Sajtschik hier die Blumen gegossen, sogar das Unkraut hatte er gegossen. Er wollte immer etwas Grünes vor Augen haben, wie dort, in seinem Rumänien.
Ich floh mit den Augen vom vertrockneten Wiesenstück zur Bushaltestelle, aber wenn das Herz wehtut, sieht man nur das, was nicht da ist.