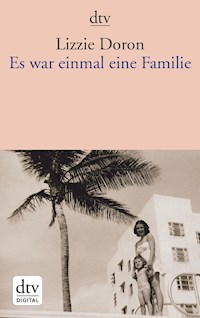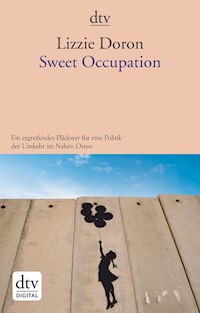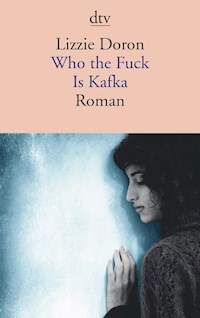
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Zuerst: Ein Hotel in Rom. Eine israelischpalästinensische Konferenz: Aber ist der Mann, der mit Lizzie auf dem Podium sitzt, nicht vielleicht doch ein arabischer Selbstmordattentäter mit Sprengstoffgürtel? Nein, Nadim pflegt nur seine Reiseunterlagen mit schwarzem Klebeband am Hosenbund zu befestigen, und dafür gibt es Gründe ... Dann: High Heels in Ost-Jerusalem? Ein Palästinenser im vornehmen Tel Aviver Apartmentgebäude? Von Anfang an ist es eine wechselvolle Freundschaft, die sich zwischen der israelischen Schriftstellerin Lizzie Doron und dem arabisch-palästinensischen Journalisten Nadim entwickelt, begleitet von Vorurteilen und Unverständnis. Es gibt Grenzen der Verständigung. Lizzie hat den Holocaust im Gepäck, Nadim die Nakba – die große Katastrophe –, wie die Palästinenser die Folgen des 48er-Krieges nennen. Sie begreifen, dass sie dieselbe Irrenanstalt bewohnen, nur in verschiedenen geschlossenen Abteilungen. Nadims Frau ist aus Gaza, hat aber keinen Ort, an dem sie bleiben kann ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 309
Ähnliche
Lizzie Doron
Who the Fuck Is Kafka
Roman
Aus dem Hebräischenvon Mirjam Pressler
Deutscher Taschenbuch Verlag
Dieses Buch ist Nadims Mutter gewidmet.
Und allen Müttern, die ihre Kinder dazu bewegen konnten, Frieden zu wählen und nicht Krieg.
Nadim ist ein fiktiver Held. Er steht für viele meiner palästinensischen Freunde, die ihre Geschichten mit mir teilen und mir auf diese Weise halfen, eine Figur wie ihn zu erschaffen, ein Buch wie dieses zu schreiben.
Lizzie Doron
Rabbi Chaim von Tzanz sagte:
In meiner Jugend brannte in mir die göttliche Flamme.
Ich glaubte, ich würde die ganze Welt verbessern.
Als ich älter wurde, erlosch die Flamme der Begeisterung, und ich sagte:
Die ganze Welt werde ich nicht mehr heilen, das liegt nicht in meiner Macht.
Ich werde versuchen, die Söhne meiner Stadt zu bessern.
Jahre vergingen, mir wurde klar, dass ich zu viel gewollt hatte.
Ich sagte: Es genügt mir, wenn ich die Menschen meines Hauses zum Guten führe.
Jetzt, am Abend meiner Tage, träume ich nicht mehr.
Ich habe nur noch einen Wunsch: Hoffentlich gelingt es mir wenigstens, mich selbst zu bessern.
Prolog
Tel Aviv, Juli 2014
Es ist ein gewöhnlicher Vormittag im Sommer. Die Sonne scheint, die große Stadt ist hell, und in Gaza tobt der Krieg.
Ich sitze an meinem Schreibtisch, mit Formulierungen und Interpunktion befasst, und dann heult die Sirene, zerbricht die Stille, mein Herz macht einen Satz, ich springe auf.
Aus dem Nebenzimmer kommt die trockene Stimme des Radiosprechers, der die Einwohner im Großraum Tel Aviv auffordert, sich in die Schutzräume zu begeben.
Meine Beine und Hände zittern, ich atme tief ein, schnappe mir aus der Küche noch eine Flasche Wasser und das Handy, das dort liegt, und renne zu unserem Schutzraum am Ende der Wohnung.
Ab dem ersten Ton der Sirene muss ich innerhalb von eineinhalb Minuten im Schutzraum sitzen.
Ich bin gehorsam, befolge genau die Anweisungen der Armee, also befinde ich mich wieder in dem Raum aus Stahlbeton, ohne Fenster, nur eine Stahltür. In diesem Raum gibt es Stühle für alle Familienmitglieder, eine Notbeleuchtung, einen Erste-Hilfe-Koffer, Gasmasken und eine Packung trockene, inzwischen abgelaufene Kekse vom letzten Krieg.
Der Raum ist klein, zwei Meter lang, zwei Meter breit, das ist der Schutzraum, der mein Leben retten soll.
An diesem Morgen bin ich allein zu Hause, ich sitze da und höre meinen Herzschlag und das Echo der Explosionen.
An diesem Morgen ist die Stimme des Krieges näher als je zuvor.
Ich schicke eilige SMS an meine Familie, um mich zu vergewissern, dass auch sie in einem Schutzraum sind, dann gibt es eine weitere Explosion und noch ein Sirenenheulen, und dann klingelt das Telefon.
Die Nummer ist unterdrückt.
Ich nehme das Gespräch an.
»Meine Liebe«, ich erkenne die Stimme sofort, »ich möchte, dass du weißt, du bist eingeladen, zu uns zu kommen. Ich nehme an, dass sie keine Raketen nach Jerusalem schicken werden, du sollst wissen, ab sofort ist mein Haus auch dein Haus, deines und das deiner ganzen Familie.«
»Wie geht es dir?«, frage ich. Meine Stimme zittert. Was für eine Geste, denke ich.
»So gut es eben geht«, antwortet er sachlich.
»Und, Nadim, kannst du mir vielleicht sagen, wie das alles weitergehen wird?« Schließlich ist er der Sachverständige für den Nahen Osten. Er, der mir über zwei Jahre lang nur über Telefon und Internet Lebenszeichen geschickt hatte.
An Feiertagen schickt er Textnachrichten oder er ruft an, auch an Geburtstagen und an unseren Gedenktagen.
Und immer verspricht er, dass wir uns wieder treffen, doch dann zieht er sich abermals zurück und verschwindet.
»Um auf deine Frage zu antworten«, sagt er, »ich glaube, dass alles immer noch schlimmer werden kann.«
Beide brechen wir in verzweifeltes Lachen aus.
»Wie dem auch sei, ich danke dir für dein Angebot«, sage ich. »Aber du weißt …«
Er unterbricht mich, er lässt meine Absage nicht gelten.
»Du sollst wissen, dass du in Ost-Jerusalem ein Zuhause hast.« Nadim will mir unbedingt klarmachen, dass er es ernst meint.
Am Ende des Gesprächs, wie hätte es anders sein können, versprechen wir uns gegenseitig, einander bald wiederzusehen.
Vier Tage später.
Es ist Abend, in Jerusalem heulen die Sirenen.
Ich rufe ihn an. »Und was jetzt?«
Nadim schweigt.
»Wo bist du?«, frage ich bedrückt. »Sag doch was.«
»Diesmal verspreche ich dir, dass wir uns wiedersehen, wenn wir das überleben«, sagt er.
»In Tel Aviv oder in Jerusalem?« Ich will konkret sein, ich will die Gelegenheit nutzen und dieses Treffen fest vereinbaren.
»In Rom«, sagt er. »Meine Liebe, treffen wir uns doch in Rom.«
Zwei Jahre zuvor,am Vorabend des Prozesses,17. Juni 2012
»Er hat also gesagt, dass er morgen kommt?«
»Er wird kommen!«
Dani grinst. »Das glaubst du wirklich?«
»Vielleicht wäre es sogar besser, wenn er nicht kommt«, sage ich. »Der Oberste Gerichtshof wird auch ohne ihn tagen.«
»Auch den Frieden werden wir ohne die Palästinenser machen müssen«, bemerkt Dani trocken.
Sechs Uhr abends, und ich denke schon seit ein paar Stunden an Laila. Immer wieder sehe ich die Frau mit der ruhigen Stimme und den toten Augen vor mir. Die Frau, die gelernt hat, Blicke über die Baumwipfel zu schicken und nichts zu hoffen. Sie ist schlank und hübsch.
Ich denke an Nadim, der sich in Zyklen bewegt wie die Jahreszeiten – er kommt und geht, er kommt und geht, Herbst, Winter, Frühling und Sommer. Manchmal stürmisch, manchmal ruhig, manchmal blühend, manchmal welk, manchmal warm, manchmal kalt und wie erstarrt.
In seinem Leben gebe es nur gute oder schlechte Tage, Honig oder Zwiebel, beschrieb er selbst einmal seine inneren Konflikte.
Seit sechs Monaten habe ich Nadim nicht mehr gesehen, er weicht mir aus, beantwortet nur selten meine SMS.
»Wie geht es dir?«, habe ich ihn vor kurzem gefragt.
»Im Krieg wie im Krieg«, hat er geantwortet und mir das Herz schwer gemacht.
Rom Cinecittà
Ich bin Nadim aus Jerusalem«, hörte ich einen Mann in fließendem Englisch und mit starkem arabischen Akzent sagen. Ich hatte den Vortragssaal zu spät betreten. Maria, die italienische Gastgeberin, eine etwa vierzigjährige Frau mit mediterranem Aussehen, brünettem Haar und der heiseren Stimme einer Raucherin, drängte mich, schnell meinen Platz auf dem Podium einzunehmen.
Ich gab mir Mühe, mich leise auf den freien Stuhl zu setzen, der mich erwartete, und betrachtete neugierig den Menschen, der jetzt sprach.
Die dämmrige Beleuchtung erschwerte mir die Sicht. Ich hörte Nadims warme, angenehme Stimme, und in meinem Kopf wurde eine andere Stimme laut.
»Operation gegossenes Blei« hatte der Nachrichtensprecher den Krieg genannt, der in dem Land herrschte, aus dem ich kam. Er berichtete, die Luftwaffe und Bodentruppen seien in Gaza eingedrungen und hätten das Feuer erwidert, als Reaktion auf Schüsse an der Grenze zum Gazastreifen. Er nannte die Terrororganisationen, die während der letzten Wochen über sechzig Raketen auf die grenznahen Siedlungen abgeschossen hatten.
Es war schon Krieg, als mich die Einladung zu einem Wochenende in Rom erreichte. Eine Vereinigung von Träumern, die die Realitäten im Nahen Osten verändern wollten, lud israelische und palästinensische Friedensaktivisten zu einem dreitägigen Kongress ein.
Ich hatte zugesagt, war nach Rom gereist und lauschte jetzt den Worten Nadim Abu Henis aus Ost-Jerusalem.
»Ich kam vier Stunden vor dem Abflug zum Flughafen«, sagte er, »und gab dem Sicherheitsmenschen mein Ticket. Ich wurde zum Security Check geführt und der Willkür des Metalldetektors überlassen, der mir zu Ehren begeistert zu pfeifen begann. Man brachte mich in einen Nebenraum, und dort ging es los mit den Fragen. Ein Sicherheitsbeauftragter wollte wissen, wohin ich fuhr und warum. Ich sagte, ich führe nach Rom, um Frieden zu bringen. Bei diesen Worten brachen die Umstehenden in lautes Gelächter aus.«
Bevor ich das Haus verlassen hatte, hatte Dani, mein Mann, beklagt, dass uns dieser Traum viel Geld koste, seit Jahren würden wir meine Reisen in Sachen Frieden finanzieren. Für ihn, als Finanzberater, lohnten sich solche Ausgaben nicht. »Du bist schon seit dreißig Jahren damit beschäftigt, ohne dass es etwas gebracht hätte. Wärst du meine Klientin, hätte ich dir schon längst geraten, den Laden dichtzumachen.«
Ich hatte geschwiegen. Ich wusste, dass er Recht hatte.
»Vor dreißig Jahren bist du allerdings nur zu Demonstrationen gegangen«, erklärte er, »und das hat nichts gekostet.«
Etwas in mir sagte mir, dass dies eine meiner letzten Friedenskonferenzen sein würde.
»Danach werden wir nur noch für Kriege Geld ausgeben«, versprach ich, um Dani aufzumuntern.
Ich brachte die Gedanken, die mir durch den Kopf schossen, zum Schweigen und konzentrierte mich auf Nadims Worte.
»›Ich verstehe‹, sagte der Securitymensch mit übertriebenem Ernst und bat mich zu warten. Erst, nachdem er in seinem Rechner Informationen eingeholt hatte, erklärte er, ich sei vermutlich in Ordnung und entschuldigte sich dafür, dass er die Gefahr, die von meiner Familiensituation ausgehe, kontrollieren müsse. Er stellte eine Reihe von Fragen zu meiner Frau und meinen Kindern und erkundigte sich, ob unter ihnen ein Terrorist sei. Was Laila, meine Frau, betraf, fiel meine Antwort eindeutig aus, doch in Bezug auf meine Kinder, sagte ich, falle es mir schwer zu antworten, denn mein ältester Sohn sei zehneinhalb und der jüngere neun. Dann kamen die anderen Verwandten an die Reihe. Ich erklärte, dass ich acht Geschwister hätte, oder besser gesagt Schwestern, leider sei ich der einzige Sohn meines Vaters.
›Gibt es Terroristen in Ihrer Familie?‹, wollte er wissen.
Falls es einen Terroristen gibt, dachte ich, kann nur ich es sein. Meine Schwestern sind längst verheiratet und haben sich in alle Winde verstreut, sie leben in Jordanien, in Gaza, in Dubai, in Ägypten.
›Sind Sie Mitglied einer terroristischen Vereinigung?‹
›Nein.‹
›Hat sich jemand aus ihrer Familie an Terroraktionen beteiligt? Dafür gespendet? Sich freiwillig gemeldet?‹
Acht Mal antwortete ich mit Nein.
Über zwei Stunden später gestatte er mir zwar auszureisen, ließ mich aber wissen, dass das Flugzeug, mit dem ich fliegen wollte, schon gestartet sei. Er versuchte mich mit der Mitteilung zu beruhigen, dass gleich, das hieß in fünfeinhalb Stunden, die nächste Maschine gehe, und mir war klar, dass ich auch diesmal die Zeit im Duty free shop vertrödeln würde.
Bestimmt verstand der Mann nicht, warum ich ihn anlächelte, er konnte ja nicht wissen, dass ich das Duty Free liebte, und das Duty Free liebte mich. Alle dort kannten mich – Nadim Abu Heni aus Ost-Jerusalem, er kauft Schuhe, Hemden, Trainingsanzüge, Unterhosen … er kauft alles, er hat immer Zeit.
Wie Sie gewiss verstanden haben, verpasste ich meinen geplanten Flug und kam verspätet in Rom an, dafür aber mit neuen Turnschuhen.« Er deutete auf seine Füße.
Im Publikum wurde wieder gelacht, und ich merkte, dass ich ebenfalls lachte.
»Ich bitte Sie, meine Verspätung zu entschuldigen«, schloss er.
Er weiß, wie man eine Geschichte erzählt, dachte ich bewundernd.
»Was tun Sie? Ich meine beruflich?«, erkundigte sich einer der Zuhörer.
»Für meinen Lebensunterhalt unterrichte ich Italienisch an der Universität, und in meiner Freizeit arbeite ich für Menschenrechtsorganisationen.«
»Was tun Sie da?«, fragte der Mann.
»Ich filme«, antwortete er kurz und schwieg.
»Sie filmen also das, was sie Ihnen antun?«, kam ein Ruf aus dem Publikum.
Nadim antwortete nicht, er hatte das Mikrofon schon an Maria weitergereicht.
Ich ahnte nicht, dass an diesem Tag etwas zwischen uns begann, und dass ich drei Jahre später an einem Juniabend in meiner Küche sitzen und mich fragen würde, ob wir uns am folgenden Morgen um elf Uhr dreißig bei Gericht treffen würden, wer hätte das gedacht?
Ich betrachtete ihn genauer, die schön geschwungenen Lippen, das runde Gesicht. Mein Blick blieb an den langen Wimpern hängen, die seine Augen verschatteten. Eine hochgeschobene Brille mit silbernem Gestell schmückte sein Haar wie eine Krone.
Araber tragen keine Brille, schoss es mir durch den Kopf, und sofort schob ich diesen rassistischen Gedanken beiseite.
Das Publikum dankte Nadim mit einem Applaus für seine Rede.
Maria wandte sich mit einer Frage an mich.
»Ich bin aus Israel, aus Tel Aviv«, antwortete ich.
»Und, sind Sie am Flughafen auch ausgezogen worden?«, rief jemand.
Ich wollte dem netten Mann antworten, dass wir keine Flugzeuge kidnappten und keine Wohnblocks sprengten oder Bomben in Straßen explodieren ließen, und dass wir im allgemeinen auch keine Sprengladungen in Schultertaschen spazierentrugen, aber ich entschied, den Zwischenruf zu ignorieren. Höflich entschuldigte ich mich für meine Verspätung.
»Der Abflug verzögerte sich, wie üblich, aus Sicherheitsgründen, und deshalb bin ich zu spät gekommen.«
Abermals traf mich ein Zwischenruf: »Warum habt ihr wieder einen Krieg angefangen?«
Gewiss würde ich die Raketen gegen israelische Ziele nicht gegen die Kampfflugzeuge aufrechnen, die Hintergründe der Kämpfe waren schwer zu erklären, und um die Wahrheit zu sagen, war ich auch über die Einzelheiten nicht informiert. Ich beschloss, mich nicht auf eine direkte Konfrontation einzulassen.
»Der Staat Israel hat alle Juden aus der Diaspora aufgenommen, die vertrieben wurden«, fing ich stattdessen an. »In unser Land kamen Überlebende des Holocaust. Es kamen auch diejenigen, die vor der stalinistischen Bedrohung und vor den Pogromen in den arabischen Ländern flohen. Der Staat Israel ist im Grunde eine psychiatrische Anstalt für posttraumatisierte Juden.« Ich überlegte, wie ich es erklären könnte. »Wir alle kamen nach Israel, um uns gegenseitig zu helfen, um Schutz vor einer existenziellen Bedrohung zu finden. Wir suchten Heilung für unsere Seele und unsere Körper, wir wollten unsere Traumata überwinden.«
Ich sagte, dass die Menschen in meinem Land hospitalisiert seien, dass sie sich nach einem normalen Leben sehnten, verzweifelt einen Arzt suchten, der ihnen Heilung und Ruhe bringe. »Die Menschen in diesem Land suchen nach einem Weg, um zu überleben. Doch bis heute, weder im Frieden noch im Krieg, haben sie die Ruhe und die Sicherheit gefunden, nach der sie sich sehnen.«
Ich sagte, unser Sanatorium treffe auf weitere Probleme, die Situation werde immer komplizierter, denn weder die Palästinenser noch unsere arabischen Nachbarn würden unsere Anwesenheit akzeptieren.
Ich suchte Nadims Augen, ich wollte sehen, ob meine Worte ihn berührten, aber ich konnte seinem Blick nichts entnehmen.
Ich war enttäuscht.
Ich trank einen Schluck Wasser, um Zeit zu gewinnen. Maria nutzte die Unterbrechung und griff nach dem Mikrofon.
»Eine psychiatrische Anstalt«, sagte sie, »damit haben Sie uns überrascht.« Das Publikum lachte.
Sie wollte wissen, ob es Fragen gebe.
Es gab keine.
»Dann ist es Zeit, zum Schluss zu kommen«, sagte Maria und dankte dem Publikum und allen Gästen auf dem Podium. Ich atmete erleichtert auf, ich hatte bereits Erfahrung mit derartigen Konferenzen und wusste, dass die harten Fragen noch kämen, aber vorläufig würde ich mich ein bisschen vom Flug erholen und für die anstehenden Kämpfe und Streitgespräche Kraft sammeln können.
Die Mitglieder der Delegation schüttelten einander die Hände. Ein palästinensischer Schriftsteller, ein israelischer Journalist, ein israelischer Professor für Gender-Studien, eine junge Frau aus Dschenin, deren Schwester an Terroraktionen teilgenommen hatte und bei den Vorbereitungen ums Leben gekommen war, eine Lehrerin aus Ramallah und Nadim, wir alle versuchten, freundlich zu sein, aber der Händedruck von Nadim und mir war etwas wärmer.
»Hören Sie, die Sache mit der Sicherheitskontrolle tut mir wirklich leid, aber Sie wissen, dass es keine andere Möglichkeit gibt«, sagte ich zu ihm. »Schließlich wollen wir doch alle leben.«
Er legte seine andere Hand auf meine. »Ich weiß, letzten Endes bin auch ich in euer Krankenhaus eingeliefert worden.« Er lächelte.
Er hatte also doch zugehört.
»Nur dass ich auf der Station für Sonderfälle bin«, fügte er hinzu, und ich musste lachen.
»Und auf welcher Station sind Sie?«, wollte er wissen.
Mir blieb keine Zeit für eine Antwort, Maria drängte zur Eile und wir gingen zum Speisesaal.
Auf dem kurzen Weg rief ich zu Hause an, um zu fragen ob alles in Ordnung sei. Ich erkundigte mich, welche Nachrichten es von der Front gab. »Wie üblich, in Gaza wird geschossen«, sagte Dani, und er beendete das Gespräch mit dem Satz: »Gut, dass du in Rom bist und ich in Tel Aviv.«
Im Speisesaal sah ich ihn. Er lächelte mir entgegen. Ich begriff, dass er mir einen Platz freigehalten hatte.
Als ich näher kam, stand er auf, um mir aus dem Mantel zu helfen. Nur aus Verlegenheit und Überraschung ließ ich es zu. Nadim hängte meinen Mantel schnell und geübt über die Stuhllehne. Ein palästinensischer Gentleman, dachte ich, eine Formulierung, die mir nie zuvor in den Sinn gekommen war.
»Ich habe mich Ihnen nicht vorgestellt«, sagte der Gentleman, »Nadim Abu Heni, aus Ost-Jerusalem.«
Bevor ich mich hinsetzte, betrachtete ich ihn. Man merkte ihm an, dass er Araber war, gestreiftes Hemd, gestreifte Socken und natürlich der Akzent. Wenn schon Araber, dann ist er hoffentlich Christ, schoss es mir durch den Kopf.
Hör auf mit diesen rassistischen Gedanken, wies ich mich zurecht.
Ich hatte mich kaum gesetzt, da betrat eine Gruppe Musiker den Saal und fing an, italienische Lieder zu spielen. Nadim sang mit, er kannte die Texte und Melodien. Ich zog die Augenbrauen hoch.
»Ich habe hier studiert. Ich war neunzehn, als ich kam, und fünfundzwanzig, als ich nach Hause zurückkehrte, nach Silwan.«
Meine Augenbrauen kehrten an ihren Platz zurück.
»Ist es schwer, in Silwan zu leben?« Ausgerechnet Silwan, dachte ich, der Stadtteil von Jerusalem, der so oft in unseren Nachrichten genannt wurde.
»In der letzten Zeit hat sich unsere Lage verbessert«, erwiderte er. Ich entdeckte ein kryptisches Lächeln auf seinem Gesicht. »In der letzten Zeit hat sich bei euch das Gerücht verbreitet, dass euer Messias aus Silwan kommen wird, deshalb wurde zu seinen Ehren eine Polizeieinheit aufgestellt, die dafür sorgt, dass niemand mit Raketen oder Schusswaffen herumläuft. Bevor ich mein Haus betrete, werde ich von Sicherheitsleuten durchsucht. Ihr habt vermutlich Angst, dass ich mich selbst in die Luft sprenge, oder, Gott behüte, euren Messias, der in Bälde erwartet wird.« Das Lächeln blieb auf seinem Gesicht.
Geschieht dir ganz recht, dachte ich. Du hast gefragt – und eine Antwort bekommen.
»Es tut mir leid, dass Sie die Ehre haben, die fünfzig verrücktesten Juden des Landes zu treffen«, sagte ich entschuldigend. »So ist es in Jerusalem nun mal, in dieser Stadt versammeln sich alle Irren.«
»Jetzt sind wir in Rom.« Nadim deutete auf die Speisekarte, um die Atmosphäre zu entspannen. »Darf ich etwas empfehlen?«
»Klar«, sagte ich, selbst erstaunt über meinen leichten Ton.
Er bestellte beim Kellner zweimal Tortellini und zum Nachtisch Crème brûlée. »Neben Ihnen sitzt ein Experte für italienisches Essen und für persische Teppiche, einer, der den Italienern während seines Studiums Wein und Teppiche verkauft hat.«
Ich war froh, dass er sprach. »Wenn dem so ist, sind Sie eingeladen, nach Tel Aviv zu kommen«, antwortete ich und erzählte ihm von der Ben-Jehuda-Straße. Dort breiteten die Händler Teppiche auf dem Gehweg aus, um den Passanten ihre Waren zu zeigen.
»Ich komme nicht nach Tel Aviv, für mich ist Jerusalem das Zentrum der Welt«, sagte er trocken. »Übrigens, sind Sie das erste Mal in Italien?« Er wechselte das Thema, fragte nach mir.
»Rom, Mailand, Florenz«, zählte ich die Orte auf, an denen sich unsere Familie schon vergnügt hatte, und fragte: »Und Sie? Fahren Sie auch mit Ihrer Familie nach Italien?«
»Wir fahren nicht ins Ausland«, sagte er kurz angebunden.
»Warum?«
»Wegen Laila, meiner Frau«, antwortete er nur.
»Ist sie krank?«
»Schlimmer, sie ist aus Gaza.« Wieder lächelte er, aber nur mit den Lippen, seine Augen blickten starr.
»Und das heißt?« Ich verstand seine Antwort nicht.
»Sie hat keinen israelischen Pass. Sie hat nur den Status eines geduldeten Bürgers. Sie kann das Land nicht verlassen.«
»Was soll das bedeuten?«
»Wenn sie das Land verlässt, darf sie nicht mehr zurückkommen.«
»Aber ihr seid doch aus Israel, aus Jerusalem, die Stadt ist doch vereint«, sagte ich erstaunt.
»Die Stadt ist vereint, aber ihre Bewohner sind es nicht. Was Laila betrifft, ist sie eine Palästinenserin aus Gaza, so wurde sie geboren, so wird sie sterben, auch wenn wir schon seit vierzehn Jahren verheiratet sind. Sie hat kein Recht auf einen israelischen Pass und wird nie einen bekommen.«
»Wirklich?« Ich war verwirrt.
»Wirklich.« Er warf mir einen Blick zu, offenbar abgestoßen von meiner Ignoranz. »Kurz gesagt, wenn sie das Land verlassen will, benötigt sie eine Sondererlaubnis, die wir nie im Leben bekommen würden.« Er sprach ruhig, aber ich bemerkte, dass sein Bein unter dem Tisch zuckte vor unterdrücktem Zorn.
»Unsere Geschichte ist kompliziert«, sagte ich, um ihn zu beruhigen. »Sie wissen es doch auch, wenn man jeder Palästinenserin, die einen arabischen Israeli heiratet, einen israelischen Pass gäbe, würde ganz Palästina nach Jerusalem ziehen.«
Nadim schwieg, er lehnte sich in seinem Stuhl zurück, als versuche er, die Distanz zwischen uns zu vergrößern.
Ein Spruch meiner verstorbenen Mutter fiel mir ein: Manchmal ist es besser, zu schauen und zu hören und zu schweigen. Etwas verspätet beschloss ich, ihrem Rat zu folgen und den Mund zu halten. Ich betrachtete die Gastgeber und die anderen Geladenen, die das Essen genossen.
Warum, zum Teufel, bin ich nur hergekommen?, flüsterte eine Stimme in meinem Inneren.
Wirklich, warum?, frage ich mich auch heute, an diesem Abend, drei Jahre nach dem Treffen in Rom. Ich habe doch schon damals gewusst, dass diese Friedenskonferenz so erfolgreich sein würde wie alle vorhergehenden auch. Wir würden ein gemeinsames Wochenende verbringen und dann mehr oder weniger zufrieden nach Hause zurückkehren, und die Kriege würden weitergehen und eine neue Hilfsorganisation würde sich bilden und zu einer weiteren Friedenskonferenz einladen, nach der wieder Qassam-Raketen fliegen und Flugzeuge wieder Bomben abwerfen würden, und man würde ihre und unsere Verluste zählen.
Vielleicht, dachte ich, fuhr ich ja, weil ich seit Schmuliks Tod im Jom-Kippur-Krieg vor fast vierzig Jahren immer wieder denselben Traum träumte.
Immer wieder laufe ich mit zwei Freundinnen am Strand zwischen Tel Aviv und Jaffo entlang. Die Nacht wird von schwachem Mondlicht erhellt. Plötzlich dringt ein Schrei an unsere Ohren.
Ich schaue mich um, und trotz der Dunkelheit sehe ich ein Fahrzeug ohne Räder, das im Sand steckt. Darin sitzt eine schwarz gekleidete Frau, die ein Bündel aus weißem Tuch an ihr Herz drückt – vielleicht ist es ein Gegenstand, vielleicht ein Baby.
»Es ist etwas Schreckliches passiert«, sage ich zu meinen Freundinnen.
»Du träumst«, erwidert die eine von ihnen. Sie hat weder ein Gesicht noch einen Namen.
»Hört ihr es denn nicht? Jemand ruft um Hilfe! Hilfe! Hilfe!« Ich schreie zusammen mit der Frau. »Dort in dem Wagen ist eine Frau mit einem Baby.« Ich deute auf das Fahrzeug.
»Das ist einfach ein verlassenes Auto«, sagt die andere Freundin, auch sie ist namenlos und ohne Gesicht. »Da ist niemand.«
»Hilfe! Hilfe!«, schreie ich, und meine Stimme bricht, schmerzt in meiner Kehle.
»Dort ist ein Baby, vielleicht erstickt es, vielleicht ist es verletzt …« Ich versuche, die Frauen zu schütteln.
»Alice im Wunderland«, sagen beide im Chor. »Sie übertreibt mal wieder.«
Ich will zu der Frau im Wagen hinüberlaufen.
»Und wenn du hingehst, was, glaubst du, kannst du tun?«, fragt eine meiner Begleiterinnen spöttisch.
»Hilfe! Hilfe!«, schreie ich und kann nicht aufhören damit.
»Was hast du? Du schreist wie eine Verrückte«, beschimpft mich die andere.
Am Morgen steht es in der Zeitung: Ein neugeborenes Baby ist am Strand gestorben, seine Mutter behauptet, um Hilfe gerufen zu haben, drei junge Frauen seien an ihr vorbeigegangen und keine habe reagiert.
Wir stehen vor Gericht.
Die erste Freundin behauptet, sie habe nichts gesehen und nichts gehört. Sie wird freigesprochen.
Die zweite Freundin behauptet, sie habe nicht helfen können. Sie wird freigesprochen.
Als ich an die Reihe komme, stehe ich mit wackligen Knien im Zeugenstand. Der Richter betrachtet mich mit glasigem Blick und sagt: »Wir werden Sie benachrichtigen.«
Nadim riss mich aus meinen Gedanken. »Cinecittà«, sagte er.
Cinecittà, der Klang gefiel mir.
»Ist das für Sie eine Art Abrakadabra?«, fragte ich.
»Ja«, sagte er.
»Cinecittà«, wiederholte er leise.
Der Kellner kam mit den Tortellini.
Ich machte mich vergnügt ans Essen.
»Das haben Sie gut gemacht«, sagte ich. Nadim blätterte in der Weinkarte und las die Namen laut vor.
»Marsala, Martini, Martini Prosecco, Chianti aus der Sangiovese Traube.«
»Ihr Italienisch ist großartig«, sagte ich bewundernd. Er akzeptierte das Lob mit einem freundlichen Lächeln.
»Was möchten Sie trinken?«, fragte er.
»Ich nehme den Chianti, und Sie?«
»Ich trinke keinen Wein«, antwortete er.
Also war er Moslem.
Ich gebe zu, dass es mich enttäuschte.
Was habe ich auf dieser Friedenskonferenz verloren, wenn mir solche Gedanken durch den Kopf gehen?, fragte ich mich.
Ich wandte mich wieder zu ihm. »Warum haben Sie sich ausgerechnet für Italien entschieden, um zu studieren?«
»Meine Urgroßmutter war Italienerin.«
»Wirklich?« Also war er kein hundertprozentiger Araber. Diese Antwort gefiel mir, ich wollte die ganze Geschichte hören und erkundigte mich nach Einzelheiten.
»Soweit ich weiß«, sagte Nadim bereitwillig, »reiste mein Urgroßvater Anfang des vergangenen Jahrhunderts aus geschäftlichen Gründen von Jerusalem nach Jaffo und von Jaffo nach Rom, und kehrte dann mit einem schönen Turiner Mädchen namens Cosima zurück.«
Der Name Cosima ließ mich lächeln, ich hoffte auf eine Fortsetzung der Geschichte, aber jetzt wollte Nadim Näheres über mich erfahren.
»Was arbeiten Sie eigentlich?«, fragte er.
»Ich bin Schriftstellerin«, antwortete ich.
»Tatsächlich? Wie kommt man dazu, Schriftsteller zu werden?«
»Bei mir ist es die Schoah. Meine Mutter war eine Überlebende des Holocaust. Eine, die nie etwas über ihr Leben erzählte. Sie hatte eine Art Schweige-Grundsatz, verstehen Sie«, sagte ich und ertappte mich sofort bei dem Gedanken: Wie kann er das verstehen?
Seine Augen verengten sich ein bisschen. Vielleicht bedauerte er, diese Frage gestellt zu haben.
»Meine Mutter gehörte zu denen, die schwiegen, wenn man sie fragte, was dort während des Krieges geschehen war. Viele Jahre nach ihrem Tod sollte meine Tochter die Geschichte unserer Familie in der Schule erzählen. So wurde ich gezwungen, über meine Mutter zu sprechen und mich zu erinnern. Aus meinen Erinnerungen wurde eine Geschichte, aus der Geschichte ein Buch.« Ich sprach schnell, für mein Gefühl klang das, was ich zu sagen hatte, banal und abgedroschen.
»Haben Sie Sehnsucht nach Ihrer Mutter?«
Seine Frage traf mich unvorbereitet. »Nicht wirklich«, sagte ich ehrlich.
Ich bemerkte das Erstaunen in seinen Augen. Er senkte den Blick und sagte mit matter Stimme, seine Mutter sei vor ein paar Jahren gestorben und er sehne sich nach ihr, sie sei das Licht seines Lebens gewesen. Ich sah ihn an und dachte, dass mein Blick nie so sehnsüchtig und verlangend gewesen war, weder bei dem Gedanken an meine lebende noch an meine tote Mutter. Diese Einsicht raubte mir den Atem.
»Menschen und ihre Mütter«, sagte ich und wurde rot.
Nadim holte Tabletten aus seiner Hosentasche, »Was fehlt Ihnen?«, fragte ich unverblümt.
»Eigentlich nichts Besonderes, irgendetwas tut mir immer weh. Jetzt zum Beispiel ist es mein Kopf.« Und mit einem halben Lächeln fragte er: »Wollen Sie auch eine?«
Er schien seinen Kopfschmerzen nicht erlauben zu wollen, unsere Unterhaltung zu stören. Er nahm eine Tablette aus der Packung und schluckte sie ohne Wasser.
Ich lächelte ihn an und sagte, dass ich ebenfalls mit einer Erste-Hilfe-Apotheke reiste und in Panik geriet, wenn mir einmal nichts weh tat.
»Nun, was möchte die Dame?« Höflich bot er mir eine Auswahl der Tabletten an, die er in seinem Repertoire hatte.
»Ich halte mir die Option offen«, versprach ich.
Nadim kehrte zum Thema zurück. »Also was schreiben Sie noch, außer der Geschichte Ihrer Mutter?«
Ich erzählte ihm, dass ich Geschichten über Menschen schriebe, die einen Krieg führten, über ihre Traumata. Über jene, die mit Alpträumen kämpften und dennoch zu einem neuen Leben aufstünden.
»Dann könnten Sie über mich schreiben«, sagte er und lachte. Mit einem Lächeln bedankte ich mich für das Angebot.
»Und was arbeiten Sie?«, fragte ich interessiert.
»Wie ich bereits auf dem Podium gesagt habe: Zum Broterwerb unterrichte ich Italienisch und in meiner Freizeit arbeite ich für Menschenrechtsorganisationen.«
»Und was genau tun Sie für diese Organisationen?«, beharrte ich.
»Ich fotografiere.«
»Sie sind Fotograf?«
Er seufzte. »Schön wär’s. Das ist ein Kindheitstraum. Sie werden es nicht glauben, aber ich fing im Oktober 1973 an zu fotografieren.« Ohne abzuwarten, ob ich etwas fragte, fuhr er fort zu sprechen. Er nutzte die Gelegenheit, mir die ganze Geschichte zu erzählen.
»Ich war acht, als draußen die Sirenen aufheulten und meine Eltern erschrocken Schutz im Keller suchten. Damals begriff ich noch nicht, wovor man sich fürchten sollte.« Wieder lachte er laut. »Heute weiß ich es sehr genau«, sagte er wie zu sich selbst, dann fuhr er fort: »Aber damals, als eure Flugzeuge über den Himmel donnerten, lief ich mit dem Fotoapparat meines Vaters in den Hof. Ich wollte die Flugzeuge fotografieren und die Aufnahmen ans Fernsehen schicken, aber als ich auf den Hof kam, waren die Flugzeuge schon wieder weg. Trotzdem gab ich nicht auf, mit der Kamera folgte ich den Kondensstreifen am Himmel. Ich erinnere mich an den Blick eines Nachbarn, der erschrak, als er mich auf dem Hof herumlaufen sah, während das Sirenengeheul noch immer auf- und abschwoll. Erst nach der Entwarnung ging ich zurück ins Haus. Mein Vater tobte, er bestrafte mich dafür, dass ich mich während des Alarms hinausgeschlichen hatte, und verkündete, dass ich seinen Fotoapparat nie mehr anrühren dürfe. Danach habe ich wirklich die Finger von seiner Kamera gelassen, aber ich habe nicht aufgehört zu träumen, dass ich eines Tages Fotograf sein würde. Davon träume ich übrigens heute noch. Leider bin ich im Träumen wirklich gut«, schloss er mit einem angedeuteten Lächeln und schwieg.
Das Schweigen breitete sich aus, und ich versank in meinen eigenen Erinnerungen an den Luftalarm, von dem er erzählt hatte. Sirenen heulten durch meinen Kopf. Ich dachte an den Schauer, der mir über den Rücken gelaufen war, als ich die Uniform anzog und zu der Einheit eilte, bei der ich damals diente.
Wie eine Welle schlugen das Klingeln der Telefone und die Schreie Rafis, unseres Kommandanten, der mich und Dafna anbrüllte, wieder über mir zusammen.
»Macht was! Schickt den Rettungsdienst! Krankenwagen!«
»Wie denn?«, rief Dafna. »Wen denn? Es ist doch keiner da!« Sie versuchte Rafi zu erklären, dass die Basis leer war, dass alle bereits mit Panzern zur Front gefahren waren. Aber Rafi wiederholte immer wieder, man müsse Hilfe schicken.
Dann stürzte Roni, der Bataillonskommandant, mit Dutzenden von Erkennungsmarken ins Zimmer, die von den ersten Opfern des Schlachtfelds eingesammelt worden waren, und legte sie auf den Tisch.
»Während des Jom-Kippur-Kriegs habe ich auch Flugzeuge gesehen«, sagte ich zu Nadim. Mein Herz klopfte wie wild, ich schaute ihm nicht in die Augen.
»Was heißt das?«, fragte er.
Ich sagte, ich sei damals Soldatin gewesen und sofort zu meiner Basis gefahren, als die Sirenen losgingen. Dort hatte ich nur eine Offizierin angetroffen, Dafna, nur sie und ich waren dort gewesen, und wir standen im Zimmer des Kommandanten, den Blick auf die Erkennungsmarken gerichtet, die sich auf dem Holztisch häuften, und Dafna hatte sofort angefangen, sie zu sortieren.
»Die sind alle gefallen?«, hatte ich sie gefragt.
Sie hatte nicht geantwortet.
Ein paar Stunden später hielt ich vier silbrige Erkennungsmarken in den Händen.
Jede hatte einem Freund aus der Kindheit gehört: Zwika Gold, Amir Tal, Jossi Sjubisch und Schmulik Levi.
Wieder meinte ich, die metallische Berührung der Erkennungsmarken zu spüren, eine Berührung, die meine Finger und mein Herz verbrannte.
Wieder erlebte ich die Minuten, als Roni, der Bataillonskommandant, mich bat, die Familien aufzusuchen, deren Söhne gefallen waren. »Ihr seid doch Nachbarn«, begründete er seine Bitte.
Am Abend jenes Tages verließ ich die Basis, setzte mich in den Militärjeep, der Richtung Tel Aviv fuhr, und schlich mich in unser Haus. Ich ging in mein Zimmer, schloss die Fenster, ließ die Rollläden runter, rollte mich, noch in Uniform, auf dem Bett zusammen und zwang mich, still zu liegen.
»Wer ist gefallen?«, fragte meine Mutter.
Sie nannte die Namen aller Freunde, die zusammen mit mir eingezogen worden waren. Sie sah meinem Gesicht an, wer lebte und wer tot war.
Schmuliks Mutter kam in mein Zimmer. »Vielleicht weißt du ja schon etwas?« Ihre Stimme klang flehend.
»Meine Tochter ist sehr krank«, sagte meine Mutter mit Nachdruck.
Über zehn Tage lang war ich sehr krank, bis endlich Vertreter des Militärs kamen, um den hinterbliebenen Familien die bittere Nachricht zu überbringen.
Jetzt sah ich wieder Dafnas grüne Augen, die sich auf mich und die Erkennungsmarken richteten.
»Gehören die alle dir?«, hörte ich sie fragen. Und ihre Stimme zitterte, als sie sagte: »Und das ist meine.« Sie hielt nur eine Erkennungsmarke in der Hand.
Ich las den eingravierten Namen. David Stein.
David. Dudi. Dudi war ihr Freund.
Ein Schauer überlief mich.
Dafna und Schmulik, die Erinnerung schnürte mir die Kehle zu.
Ich meinte wieder die Stimme des Nachrichtensprechers zu hören: »Beim Anschlag auf das Café ist heute Morgen auch Doktor Dafna Schiff aus Jerusalem umgekommen, siebenundvierzig Jahre alt und Mutter zweier Kinder, Leiterin der Station für Augenkrankheiten des Krankenhauses Hadassa. Die Familie wurde benachrichtigt.«
Das Atmen fiel mir schwer.
»Geht es Ihnen nicht gut?«, fragte Nadim, der bemerkte, wie bedrückt ich plötzlich war.
»Lassen Sie nur«, antwortete ich und versuchte sogar zu lächeln.
»Essen Sie noch etwas«, schlug er vor.
Schweigend aßen wir unsere Tortellini.
So ist es, wenn man mit Menschen aus dem Nahen Osten bei einem guten Essen sitzt, dachte ich. Es dauert keine fünf Minuten, da hörst du das Echo der Worte Schoah, Krieg, Besatzung, Intifada.
Schließlich brach Nadim das Schweigen, er wollte zu unserer Unterhaltung zurückkehren. »Cinecittà«, sagte er.
»Warum haben Sie ihr Zuhause verlassen und sind zum Studium nach Italien gegangen?«, fragte ich bereitwillig.
»Euretwegen«, sagte er mit einem Lächeln.
Ich wartete auf eine Erklärung, doch er stand auf, entschuldigte sich, ohne einen Grund zu nennen, versprach aber, gleich zurückzukommen und mir die ganze Geschichte zu erzählen.
Als er den Speisesaal verließ, gingen in meinem Kopf die Warnsignale an.
Er ist knapp über vierzig, dachte ich, zur Zeit der ersten Intifada war er ungefähr zwanzig, genau das richtige Alter für einen Terroristen. Ist er ein Terrorist, der sich unter einem Deckmantel in diese Konferenz geschlichen hat? Die Alpträume meines Lebens, sie kamen alle gleichzeitig.
Reiß dich zusammen, befahl ich mir, und eine beruhigende innere Stimme sagte: Dafür bist du schließlich hergekommen.
Nach einigen Minuten kam er zurück und sagte, er habe mit seiner Schwester sprechen müssen. Doch er hielt sich nicht mit weiteren Erklärungen auf, statt dessen begann er mit der versprochenen Geschichte. »Als ich neunzehn war, beharrte mein Vater darauf, dass ich das Hotelfach studieren solle. Er war überzeugt, dass dieser Beruf es mir ermöglichen würde, an jeden Ort der Welt zu fliehen. Damals begannen die Unruhen in der Westbank und die Armee ließ die Universität schließen. Mit der Unterstützung meines Vaters packte ich also meine Siebensachen und fuhr nach Italien. Nachdem ich mein Studium beendet hatte, wollte ich nach Hause zurückkehren, aber damals herrschte bei uns die erste Intifada und mein Vater schickte mich sofort wieder nach Rom. Zu meiner Freude bot mir der Professor für Politikwissenschaften eine Stelle als Assistent an. In den folgenden drei Jahren nutzte ich meine Kenntnisse und übersetzte Aufsätze und Dokumente über den Nahost-Konflikt aus dem Arabischen ins Italienische.«
»Da haben wir Ihnen also keinen schlechten Dienst erwiesen«, platzte ich heraus.
»Sicher«, antwortete er mit der Andeutung eines Lächelns, »ich bin wirklich sehr dankbar. Umso mehr, als das Hotelgewerbe bei uns nicht gerade blüht, wie Sie bestimmt wissen, schließlich kommen zu uns nur Touristen in Uniform.«
»Sie werden es vielleicht nicht glauben«, sagte ich, »aber auch meine Mutter hoffte, so wie Ihr Vater, ich würde einen Beruf wählen, der mich notfalls retten könne. Sie wollte, dass ich Ärztin werde. Immer wieder hat sie mir von meiner Tante erzählt, ihrer Schwester, die Zahnärztin war und deshalb überlebt hat. Sie hat auch erzählt, dass Doktor Mengele derjenige war, der sie aus der Reihe der zum Tod Bestimmten herauswinkte und sie zum Leben auswählte.«
Nadim nickte und sagte, sein Onkel sei ebenfalls Zahnarzt.
Er hat keine Ahnung, wer Mengele war, schoss es mir durch den Kopf. Und eine andere Stimme fragte: Was willst du von ihm?
Sein Handy summte.
Nadim setzte die Brille auf und schaute aufs Display. »Bei Bombardierungen in Gaza durch die Armee wurde ein Wohnviertel getroffen …« Er las mir den Text laut vor und sagte, eine seiner Schwestern lebe in Gaza. Er warf mir einen langen, kalten Blick zu, als wäre ich diejenige, die in diesem Moment Bomben auf sie warf.
Wir sind Feinde und werden immer Feinde bleiben, dachte ich. Und dann: Hör auf damit. Ich wollte mich erkundigen, wie es seiner Schwester ging, aber wir wurden dadurch unterbrochen, dass jemand mit einem Löffel unüberhörbar an ein Glas schlug.
Wir erschraken, wir reagierten beide empfindlich auf laute Geräusche.
Es war Maria, die um Ruhe bat, sie wollte Gästen und Gastgebern danken. Sie setzte zu einer Rede an und behauptete, sowohl die Palästinenser als auch die Israelis seien letztlich Menschen, die sich nach Frieden sehnten, doch ihre politischen Führer würden sie in den Kampf führen. Die unschuldigen Menschen, die zu dieser Konferenz gekommen seien, sagte sie, müssten den Frieden zu den Türen ihrer Regierungen befördern.
Und während der Kellner den Tisch abräumte, hörte ich zum wer weiß wievielten Mal, dass der Frieden kommen werde. Ich hörte, dass die hier Versammelten, hier und jetzt, in Rom, ihn vorantreiben würden. Maria behauptete auch, von unserer Zusammenkunft gehe eine Botschaft aus. Das Publikum klatschte.
Nadim erhielt eine weitere Nachricht. »In Gaza sind heute Dutzende von Zivilisten ums Leben gekommen …« Er steckte das Handy weg. »Genug davon.«
Mir war klar, dass es ihm ebenso schwer fiel wie mir, im Saal zu bleiben und all die Reden und Versprechungen über sich ergehen zu lassen.