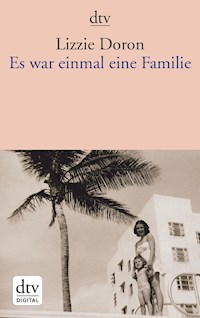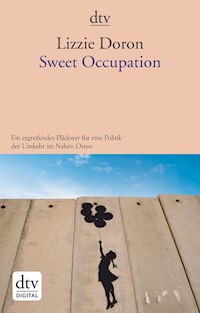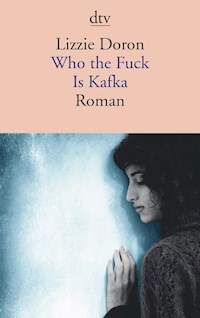8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Lizzie Dorons erstes, vielgerühmtes Buch. Ein liebender Blick auf eine schwierige Mutter über ein Leben im noch jungen Staat Israel Helena, die ihrer kleinen Tochter Elisabeth eine kurze Geschichte von einer Welt erzählt, die einmal war und nie wieder sein wird. Helena, die im Frühling 1960 zusammen mit Elisabeth einem Hinweis auf mögliche Verwandte nachgeht, vergeblich und zum allerletzten Mal. Helena, die auf Anraten der Lehrerin einen Hahn, eine Katze und einen Untermieter aufnimmt, damit das Mädchen nicht ohne die Wärme von Tieren und den Schutz eines Mannes heranwächst. Mit Witz und Trauer erinnert sich Lizzie Doron an ihre Mutter Helena, Shoah-Überlebende, eigensinnig, verwitwet, die mit widerständiger Energie, Einfallsreichtum und Überlebenswillen eine Existenz für sich und ihre Tochter in Israel aufbaut. Allein in dem jungen Staat, in dem die Vergangenheit lange Schatten wirft, die Gegenwart alle Kräfte fordert und die Zukunft am Anfang klein und ungreifbar erscheint. Lizzie Doron hat eine Liebeserklärung geschrieben, ein Manifest des »trotz alledem«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 140
Ähnliche
Lizzie Doron
Warum bist du nicht vor dem Krieg gekommen?
Aus dem Hebräischen von Mirjam Pressler
dtv
Es ist Freunden und Verwandten, meinen Kindern Dana und Ariel, meinem Mann Dani und meiner Mutter Helena zu danken, dass dieses Buch entstand.
Prolog
»Auf einem hohen Hügel, irgendwo dort in dem fernen Europa, stand eine Burg, in der ein königliches Geschlecht lebte, und von diesem Geschlecht weiß keiner etwas, ich bin die einzige Zeugin für seine Geschichte.« So erzählte Helena, mehr sagte sie nicht. Vielleicht fügte sie noch einige Sätze hinzu, abschließende oder einleitende, manchmal mehr, manchmal weniger, und alles »Mehr« galt der Gegenwart und alles »Weniger« der Vergangenheit, und eine Zukunft gab es nicht.
Und immer wieder dachte sie an diese Burg auf dem Hügel, denn dort war sie geboren worden und dort hatte sie andere Tage gesehen.
Und im Alltag, in der großen Stadt, in dem grauen Viertel, wo es keinen Hügel gab und keine Burg, an einer Stelle, wo sich die Straße des Sieges mit der Straße des Heldentums traf, in einem zweistöckigen Haus, im zweiten Stock, lebte Helena ein anderes Leben.
In dieser Wohnung mit zwei Schlafzimmern gab es zwei Eingangstüren, hintereinander, die innere war für die Besucher bestimmt, die man kannte, die äußere dafür, den Schall abzudämpfen, damit Helena nicht in Panik geriet, wenn ein Fremder an ihre Tür klopfte.
Neunzehn Stufen mit einem Geländer führten zum Eingang, es gab einen Hof ohne Zaun und ein Gartenstück mit einer Palme, Gestrüpp und wilden Blumen, hier logierten ein Straßenköter, ein Hahn, der als Wecker diente, eine Henne, die jeden Morgen ein Ei legte, Katzen, die in den Mülleimern wühlten, Zugvögel, die auf ihrem Flug eine Rast einlegten, und andere Tiere.
In dieser Wohnung, nicht in der Burg, lebten die Überreste des Geschlechts, Helena, die Mutter, und Elisabeth, ihre Tochter.
Einiges von dem, was sich zwischen 1960 und 1990 mit ihnen zugetragen hat, findet sich auf den folgenden Seiten. Es war einmal und ist nicht mehr, Geschichten über das, was war.
Kiriat Chajim
Mai 1960.
Eines Tages, als ich aus der Schule kam, erwartete mich Helena ungeduldig an der Tür.
»Komm, wir fahren nach Kiriat Chajim! Vielleicht haben wir dort Familie«, sagte sie aufgeregt.
»Da habe ich nur einmal, nur ein einziges Mal, nicht Radio gehört«, sagte sie zornig. »Zum Glück hat es wenigstens Soscha gehört und aufgeschrieben, hier sind der Name und die Adresse.« Ihre Hand umklammerte einen Zettel, eine Quittung des Lebensmittelhändlers, mit einer Adresse auf der Rückseite. »Lass uns fahren.«
In Windeseile hatte ich einen Rucksack mit einem belegten Brot und einem Stück Obst über der Schulter. Helena nahm eine Tasche mit Ausweisen und Geld, warf einen schnellen Blick in den Spiegel und fuhr sich mit den Fingern durch die Haare. Wir machten uns auf den Weg.
Vom Haus zur Bushaltestelle, vom Bus zum Bahnhof, vom Bahnhof zum Bus nach Haifa und von Haifa mit dem Bus nach Kiriat Chajim.
Auf dem ganzen Weg herrschte Schweigen.
»Kiriat Chajim West«, verkündete der Fahrer.
Helena nahm mich an die Hand. Sie ging zum Fahrer, zeigte ihm den Zettel mit dem Namen der Straße und der Hausnummer. Er deutete mit dem Finger hinaus und sagte: »Da ist es, das erste Haus an der Ecke.«
Helena brach ihr Schweigen. »Es ist, als wären wir in unserem eigenen Viertel«, sagte sie und sah überhaupt nicht beruhigt aus. »Ich brauche noch Einzelheiten, ich kann nicht einfach an die Tür klopfen. Ich muss wissen, wer mir aufmacht.« Es war nicht klar, ob sie zu sich selbst sprach oder wollte, dass ich es hörte. Dann bog sie in eine kleine Straße auf der anderen Seite ein, wo sie zu ihrer Freude einen großen Lebensmittelladen entdeckte.
Sie kaufte eine Tafel Schokolade »Rote Kuh« und fragte den Ladenbesitzer, der in ein dickes, mit geräucherter Makrele belegtes Schwarzbrot biss: »Entschuldigung, kennen Sie vielleicht meine Verwandten, die Familie Mitschmacher?«
Der Ladenbesitzer wischte sich mit der dunkelblauen Schürze, die seinen dicken Bauch bedeckte, als wäre er ein Tisch und die Schürze eine Decke voller Fettflecken, den Mund ab.
»Ja«, antwortete er und verschluckte den Rest seines Brotes. »Sie wohnen gegenüber.« Und einigermaßen freundlich fügte er hinzu: »Ein netter Mann, lässt anschreiben.«
»Und bezahlt?«, unterbrach ihn Helena ängstlich.
Er lachte. »Ja, er bezahlt. Aber es dauert …«
Helena wurde blass. »Gut, das tun alle«, sagte sie, vielleicht, um ihren neuen Verwandten zu verteidigen. »Tun Sie mir einen Gefallen, wie heißen seine Frau und seine Kinder? Ich habe sie schon seit Jahren nicht mehr gesehen.« Entschuldigend fügte sie hinzu: »Ich bin vergesslich, was Namen angeht.«
»Die Frau heißt Bella, und die Kinder …« Er hob die Augen zur Decke. Dann fiel es ihm wieder ein, er senkte den Blick. »Sie haben nur einen Jungen von sieben oder acht. Ich nenne ihn Schätzchen.«
»Gut, danke«, sagte Helena. »Die Schokolade ist für ihn.« Sie bezahlte und ging. An einer Hand hielt sie mich, in der zweiten die Schokolade für Schätzchen.
An der Tür des Ladens wandte sie sich, ohne zu zögern, an einen Passanten. »Wo ist hier die Schule?«
Und in der Schule fragte sie: »Wo ist die Sekretärin?«
Und zur Sekretärin sagte sie: »Guten Tag, entschuldigen Sie, ich bin Helena. Vielleicht wollen wir in diese Gegend ziehen. Und Elisabeth«, sie deutete auf mich, »wird hier in die Schule gehen, und sie kennt niemanden. Ich kenne nur die Familie Mitschmacher. Ihr Sohn ist doch bei Ihnen?« Und ohne die Antwort abzuwarten, fragte sie, ob sie sich einen Moment hinsetzen und ausruhen könne.
»Ja«, antwortete die Sekretärin.
»Entschuldigung«, fuhr Helena fort, »gibt er ein gutes Beispiel? Sie müssen verstehen, sie ist meine einzige Tochter.«
»O ja, natürlich«, sagte die Sekretärin. »Er ist ein wunderbarer Junge und sehr fleißig.«
»Vielen Dank«, sagte Helena erleichtert.
Und ging wieder.
Bevor sie an die Tür der Leute klopfte, von denen sie annahm, sie könnten Verwandte sein, stellte Helena noch eine letzte Untersuchung bei den Nachbarn im ersten Stock an. »Ich komme aus Tel Aviv, sie sind Verwandte«, sagte sie zu der Frau, die uns die Tür aufmachte. »Aber es ist niemand zu Hause. Können Sie mir vielleicht sagen, wo er arbeitet? Wir könnten dann zu ihm gehen.«
Die kleine, dünne Frau antwortete: »Bei der Stadtverwaltung.«
»Was, er ist Angestellter?«, fragte Helena erstaunt.
»Ich weiß nicht, als was er arbeitet«, sagte die Frau.
Als wir hinausgingen, sagte Helena enttäuscht: »Das ist kein gutes Zeichen, in unserer Familie gibt es keine Angestellten.« Ihre Hand, die meine hielt, zitterte.
Endlich gingen wir zu der bewussten Wohnung. An der Tür hing ein Holzschild: »Bella und Marek Mitschmacher«.
Sie klopfte nur einmal, dann wurde die Tür geöffnet. Eine Frau mit einem dicken Bauch – ob sie schwanger war oder nur zu viel aß, war schwer zu sagen – stand auf der Schwelle. Mit einem breiten, gutmütigen Lächeln forderte sie uns auf einzutreten. Nachdem sie verstanden hatte, um was es ging, bat sie eine Nachbarin, ihren Mann von der Arbeit zu holen.
»Vielleicht haben wir endlich auch Verwandte«, sagte sie. Als er ankam und uns in stockendem Hebräisch mit ungarischem Akzent begrüßte, war bald klar, dass er kein Verwandter war. Trotz ihrer Enttäuschung bewirteten sie uns mit Rührei, schwarzen Oliven, sauren Gurken und Brot. Außer Essen bekamen wir auch einen guten Rat: Es lohne sich, sagten sie, zu einem Moschaw in der Nähe von Haifa zu fahren. Dort gebe es einen Mann mit demselben Namen, und da wir nun schon mal in der Nähe seien, würde es sich lohnen, ihn aufzusuchen.
Helena schöpfte Hoffnung. Am frühen Abend verabschiedeten wir uns dankbar von unseren Gastgebern und fuhren zu dem genannten Moschaw, der eine halbe Stunde entfernt lag.
Bei den ersten Häusern fragte Helena nach Marek. Ein Mann in einem blauen Hemd, kurzen Hosen und hohen Stiefeln, der nach Kühen roch, sagte: »Das bin ich.«
Helena stellte sich vor.
»Ich erinnere mich an so etwas«, sagte er in flüssigem Hebräisch, die flatternden Lider halb über die Augen gesenkt. »Aber an was kann ich mich schon erinnern? Ich habe Polen verlassen, da war ich noch ein Kind, und meine Eltern haben den Kontakt zu mir abgebrochen.«
Wir setzten uns auf eine Bank, und er fragte: »Warum ist deine Tochter so blass und so dünn? Und was soll diese Diaspora-Kleidung? Und warum, sag mir, bist du nicht vor dem Krieg gekommen?«
Helena beantwortete diese Fragen nicht. Marek fuhr fort und erzählte mit Genugtuung, dass er schon immer Zionist gewesen sei, und bewunderte sich selbst dafür, dass er es schon in so jungem Alter gewagt hatte, sich gegen seine Eltern aufzulehnen, und damit sein Leben gerettet hatte. Helena nannte noch die Namen derer, die gegangen waren, und fragte voller Schmerz und den Tränen nahe: »Vielleicht hast du von ihnen gehört? Kennst du sie vielleicht?«
Er beharrte: »Ich war sehr jung, als ich wegging. Ich erinnere mich an niemanden und kenne niemanden.« Ihm war anzumerken, dass er dieses Gespräch beenden und seiner Wege gehen wollte. Als er sich bereits zum Gehen wandte, drehte er sich noch einmal um und sagte stolz, sein israelischer Name sei Meir Sabre, Marek sei nur noch eine Art Kosename.
»Endlich haben wir etwas gemeinsam«, sagte Helena. »Die Einwanderungsbehörde hat in meinen Pass als Vornamen ›Chaja‹ eingetragen.« Sie lächelte breit. »Jetzt verstehe ich, dass ich Helena als eine Art Kosenamen benutzen kann.«
Als wir uns verabschiedeten, nahm mich Helena fest an die Hand und sagte, vielleicht zu ihm, vielleicht zu mir, aber ganz bestimmt zu sich selbst: »Er ist so sehr ein Sabre, wie ich Chaja bin.«
Der Rückweg war lang und dunkel.
Am nächsten Tag fragte Soscha: »Nu, wie war’s?«
»Alle sind tot«, antwortete Helena.
Danach suchte sie nie mehr nach Verwandten.
Kikeriki
Die Krankenschwester der Schule ließ mich in der Pause kommen und überreichte mir einen verschlossenen Briefumschlag. »Gib ihn heute noch deiner Mutter«, sagte sie.
Helena öffnete den Brief und las ihn laut vor.
»Liebe Frau Helena, bitte kommen Sie morgen früh um neun Uhr zu einer Unterredung. Ich möchte Ihnen und Elisabeth helfen.«
»Sehr nett von ihr, dass sie uns helfen will«, sagte Helena, verzog das Gesicht und ging am nächsten Tag zu dieser Unterredung.
Schwester Carmela Gamso war eine besonders schöne Frau. Sie trug immer ein grünes Kleid und darüber einen weißen Kittel, wie alle Schwestern in den Schulen, aber bei Schwester Carmela war das Weiß weißer und das Grün grüner, und ihre Sachen waren besser gebügelt und gestärkt. Sie hatte ein langes, dunkles Gesicht, und aus ihrem Schwanenhals kam eine volle, warme Stimme. Sie sprach langsam und brachte Helena dazu, dauernd zu sagen: »Gut, ich habe verstanden, und weiter?«
Bei dieser Unterredung erzählte Schwester Carmela in ihrem Schildkrötentempo, sie habe kürzlich eine psychologische Weiterbildung gemacht. Helena müsse wissen, dass es heute sehr große Erkenntnisfortschritte hinsichtlich Themen wie Kinder, Eltern, Umgebung und deren Einfluss auf die Gesundheit der Seele gebe. Sie, Helena, und ihre Tochter Elisabeth seien ja allein in der Welt zurückgeblieben, deshalb müsse Helena, das habe sie bei der Weiterbildung gelernt, bedenken, dass Elisabeth eine Umgebung brauche, die ihr, solange sie noch klein sei, ein menschliches Modell biete, zur Nachahmung, zur Projektion und zur Identifikation. »Eine solche Umgebung ist zu einer gesunden seelischen Entwicklung unbedingt notwendig«, sagte sie.
Helena hörte sich diese professionellen Worte an und antwortete ungeduldig: »Ich habe verstanden, es wird in Ordnung sein.«
Innerhalb einer Woche kümmerte sich Helena um eine menschliche Umgebung. Dafür besorgte sie einen Hund, einen Hahn, eine Katze und Papageien und schuf das, was sie »Carmela Gamsos therapeutischen Zoo« nannte.
Zu den Nachbarn, die erstaunt schauten, sagte sie: »Das ist für Elisabeth, damit sie nicht allein ist«, und erklärte, das sei »eine medizinisch-pädagogische Empfehlung für Identifikation, Projektion und Nachahmung«, und lachend fügte sie hinzu: »Wundert euch nicht, wenn Elisabeth ab nächster Woche anfängt, zu bellen oder Kikeriki zu rufen.«
Carmela Gamso war nicht zufrieden. Wieder ließ sie mich in der Pause kommen und bat mich, Helena einen Brief im verschlossenen Umschlag zu bringen. Als Helena zu dem Treffen erschien, sagte Schwester Carmela behutsam, die Richtung sei richtig, und es sei schön, dass Elisabeth Tiere habe. »Aber das ist nicht alles, und das ist nicht genug. Elisabeth braucht eine Familie, Menschen, verstehen Sie?«, fragte sie mitleidig.
»Ja«, sagte Helena und versprach der Schwester und vor allem sich selbst, dass es keinen Grund für eine weitere Unterredung geben würde.
Zwei Wochen später rief mich Helena zu einem Gespräch.
»Hör zu«, sagte sie, »ab morgen wird ein fremder Mann aus Beer Sheva bei uns wohnen, der fünf Tage in der Woche in Tel Aviv arbeitet. Er mietet ein Zimmer bei uns. Das ist gut für deine Entwicklung – du wirst lernen, wie es ist, wenn man mit einem weiteren Menschen in einer Wohnung zusammenlebt. Und ich hoffe, dass mich Gamso dann nicht mehr einbestellt.« Ermutigend fuhr sie fort: »Es gibt noch ein paar Vorteile: Jeder, der zu uns kommt, wird sehen, dass es einen Mann im Haus gibt. Du kannst, wenn es nötig ist, sagen, er wäre dein Vater, und ich werde, wenn es nötig ist, sagen, er wäre mein Mann. Niemand wird mehr Fragen stellen. Und noch etwas Gutes hat es«, sagte sie erleichtert, »wir werden Geld bekommen. Laut Vertrag bezahlt er ein Jahr im Voraus. Das einzige Problem ist, dass wir ihm das Wohnzimmer abgeben müssen. Aber so schlimm ist das auch nicht, er geht früh aus dem Haus und kommt spät zurück, und am Wochenende ist er nicht da.«
Am nächsten Tag kam ein Mann mit einem großen Koffer. Er hatte ein nervöses Lächeln, einen Wust grauer Haare und eine ganze Reihe seltsamer Zuckungen im Gesicht. Seine Augen blinzelten die meiste Zeit, und er bewegte den Mund, aber nicht, weil er etwas sagen wollte. Eigentlich schwieg er fast immer.
Seit der Mann in unserem Wohnzimmer wohnte, waren Zeichen eines neuen Lebens zu bemerken: drei Zahnbürsten im Badezimmer, Männerkleidung an der Wäscheleine auf dem Balkon, große Männerschuhe im Flur.
Beim Aufstehen störte der fremde Untermieter. Früh am Morgen, noch bevor der Hahn krähte, rasierte sich der Mann aus Beer Sheva mit einem dieser makellosen elektrischen Rasierapparate, die ganz neu nach Israel gekommen waren. Das Geräusch dieses Apparats ließ einem Schauer über den Rücken laufen, es hörte sich an, als würde der Fingernagel des Lehrers über die Tafel kratzen. Helena wachte jeden Morgen auf, lief in der Wohnung herum und wünschte Schwester Carmela, sie solle nie mehr von einem Wecker geweckt werden, sondern vom Geräusch des Rasierapparats des Mannes aus Beer Sheva.
Aber die Anwesenheit des Mannes machte auch vieles leichter. Die Nachbarn fragten nicht mehr: »Helena, warum heiratest du nicht?« Und niemand schrie mir nach: »Dein Vater ist tot!« Schwester Gamso hörte auf, Helena zu einem Gespräch zu bitten, und unser Konto auf der Bank wuchs.
Der Mann ging jeden Morgen weg und kam jeden Abend wieder.
Eines Abends, als er auf dem Heimweg war, sagte ein Junge zu ihm: »Hallo Sie, Ihre Tochter ist zu Rina gegangen.«
»Sprichst du mit mir?«, fragte der Mann.
»Ja, klar, Sie sind doch der Vater von Elisabeth, nicht wahr? Sie ist bei Rina.«
Der Mann aus Beer Sheva sagte: »Ich bin der Vater von Michal.« Er betrat die Wohnung und schwieg, wie immer, doch diesmal waren die Zuckungen in seinem Gesicht besonders stark.
Ein, zwei Wochen später traf ihn Itta, die Nachbarin, als er von der Arbeit zurückkam. »Guten Abend«, sagte sie. »Vor einer Minute habe ich Ihre Frau im Lebensmittelladen getroffen. Sie hat viele gute Sachen fürs Abendessen gekauft. Guten Appetit und auf Wiedersehen!«
Er gab Itta keine Antwort. Er ging in sein Zimmer und sagte laut vor sich hin: »Sie haben mir hier eine Tochter angehängt, eine Frau, Tiere – ein Viertel mit lauter Verrückten.« Laut schreiend vertrieb er den Hahn, der einen Blick in sein Zimmer werfen wollte: »Weg mit dir! Verschwinde!« Dann ging der Mann in die Küche, zu Helena, die gerade vom Einkaufen zurückgekommen war, und fragte: »Warum habt ihr so viele Tiere?«
»Aus demselben Grund, aus dem Sie hier sind«, antwortete Helena. »Wegen Schwester Carmela.« Als sie seinen erstaunten Blick bemerkte, erschrak sie und sagte, dass sie Tiere eigentlich den Menschen vorziehe.
»Und warum die Hühner?«, fragte er.
»Wegen der Eier«, antwortete sie.
Von da an war er noch schweigsamer. Aus seinem Zimmer hörten wir nur das Geräusch des Rasierapparats. Der Mann hielt noch einige Wochen durch, eine Zeit, in der er gezwungen war, sich zu beherrschen und nichts zu antwor