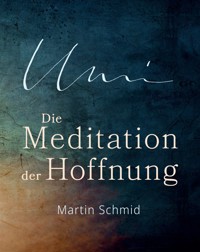Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Industriemanager Werner Wielandt erfährt in seiner Karriere nach einem anfänglichen Höhenflug einen Niedergang, der einerseits durch eigene Überheblichkeit, und andererseits durch Intrigen und Verrat von Menschen, denen er vertraut hat, ausgelöst wird und schließlich auch seinen privaten Bereich trifft. Als er fast wieder ganz unten angekommen ist, erfährt er ein Comeback, allerdings auf einem ganz anderen Sektor... Die Handlung spielt Anfang der 1980er Jahre als mit der Entwicklung des PC endgültig die Tür in das digitale Zeitalter aufgestoßen wurde...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 246
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Werner saß an seinem Schreibtisch und trommelte nervös mit den Fingerspitzen irgendeinen Rhythmus, während draußen ein ungemütlicher Wind den April-Regen jagte und er noch einmal das Computer-sheet, das er in Händen hielt, überflog. Er hatte dort die Zahlen des ersten Quartals 1984 aufgelistet.
Obwohl sich seit Jahren alle drei Monate das gleiche Ritual vollzog, kam er immer wieder ins Grübeln, wenn er auf die Zahlenkolonnen schaute, die nun, auf einem DINA4 Blatt zusammengefasst, die gesamte Leistung eines Vierteljahres der 1.384 Mitarbeiter seines Unternehmens widerspiegelte.
Der Vorgang erinnerte ihn immer wieder an das Ende seiner Schulzeit, als es darum ging, einen Studienplatz zu finden. In den Fächern, die mit einem numerus clausus belegt waren, ergab sich die Zulassungsberechtigung aus einer Durchschnittsnote, die aus allen Noten des Reifezeugnisses gebildet wurde. Dreizehn Jahre mehr oder weniger große Anstrengungen, Reifeprozesse, Höhen und Tiefen in der Motivation, gute und schlechte Erfahrungen mit Lehrern und Mitschülern, Ergebnisse großen Fleißes oder großer Begabungen, Ablenkungen, Selbstzweifeln, Hoffnungen und Enttäuschungen, alles wurde reduziert auf die Aussage „Eins Komma Acht“ oder „Drei Komma Null“ oder eine andere Zahl mit einer Stelle hinter dem Komma. Genau so erschien ihm jetzt der Ausdruck seines MIS, des Management-Informations-Systems.
Er stellte sich vor, was sich wohl jemand denken mochte, der in ferner Zukunft, wenn er und sein Unternehmen schon lange nicht mehr existierten, so ein Blatt Papier finden würde. Könnte er wohl noch verstehen, was da mit den abgekürzten Spaltenüberschriften Ist – Plan – Abw. - abs. - % - gemeint ist? Aber selbst wenn er die Semantik noch würde lesen können, die Bedeutung des Ganzen würde sich ihm sicherlich nicht so einfach erschließen. Denn es handelte sich ja im Wesentlichen um die Zusammenfassung all des Handelns und aller Entscheidungen, des Unternehmens und aller seiner Mitarbeiter im zurückliegenden Vierteljahr und damit auch implizit all dessen, was man nicht gewagt hatte zu entscheiden, obwohl vieles auf eine Entscheidung gedrängt hätte.
Natürlich kannte er die Schwachstellen einer solchen Darstellung, er wusste, wo er in seinen Erläuterungen die Dinge geschönt und was er nur kryptisch angedeutet hatte, um später sagen zu können:
„Ich habe in meinem Bericht vom soundsovielten schon darauf hingewiesen, dass...“
Die routinemäßigen Monats-Reports und der Forecast mussten positiv aussehen, dann ließen einen die Vorturner in der Konzernzentrale in Ruhe arbeiten. Im Quartalsbericht, den er in Händen hielt, gab es keine Widersprüche zu den Monatsberichten oder argumentative Stolperfallen, alles war geglättet so dass niemand unangenehme Fragen stellen konnte.
Ohne anzuklopfen kam seine Sekretärin, Maria Budweiser, herein. Sie hatte als einzige das Privileg, einfach sein Büro betreten zu dürfen. Von allen anderen verlangte er, sich im Vorzimmer anzumelden und, wenn dort niemand war, an seiner Tür anzuklopfen und auf sein „Herein!“ zu warten.
Als er drei Jahre zuvor seine jetzige Stellung antrat, hatte ihm sein Vorgänger keine Sekretärin hinterlassen, sie war gleichzeitig mit diesem ausgeschieden. Deshalb überließ man es Werner, sich eine neue Kraft für das Vorzimmer zu holen. Für die Übergangszeit sollte erst einmal Maria für ihn arbeiten, die das für sein Unternehmen zuständige Mitglied des Konzern-Vorstands aus den vorhandenen Bürokaufleuten ausgesucht hatte. Im Vorgespräch charakterisierte der sie als „ordentliche Schreibkraft“ und fügte hinzu „Leider haben wir zur Zeit kein besseres Material“. Werner ließ sich nichts anmerken, war aber doch sehr irritiert, dass der so unverblümt einen Menschen als Material bezeichnete.
Maria setzte sich auf den Besucherstuhl vor dem Schreibtisch und legte ihm eine Mappe mit der heutigen Korrespondenz vor. Die Frau war ein Arbeitstier und verfügte über ein hervorragendes Talent, die Büroarbeiten zu organisieren, obwohl sie das eigentlich nicht gelernt hatte. Eine ihrer ersten Taten bei Werner, von der man sich fragte, warum noch kein anderer auf die Idee gekommen war, bestand zum Beispiel in der Anschaffung von Unterschrifts- und Korrespondenzmappen in verschiedenen Farben, so dass Werner jederzeit in der Lage war, zu sehen, „was anlag“, wie er seine tägliche Agenda nannte. Auch an diesem Morgen sprachen sie den Tagesablauf durch, wobei Maria referierte: „Für 9:00 h hat sich der Konzern-Finanzvorstand zur Quartalsbesprechung angesagt. Der will gegen Mittag noch einen kleinen Imbiss einnehmen und dann wieder zurückfahren. Ab ca. 12:30 machen wir dann die Postbesprechung und um 14:00 wollen die Amis kommen.“ Das scheint ja ein ruhiger Tag zu werden, dachte Werner und machte sich an seinem neuen IBM-PC zu schaffen. Was die tägliche Korrespondenz anging, konnte er sich zu hundert Prozent auf seine Sekretärin verlassen. Bei den Routinesachen genügten oft nur ein paar Stichworte und Maria machte die Briefe fertig.
Inzwischen hatte sich der Himmel etwas aufgehellt, nachdem der heftige Aprilschauer niedergegangen war. Ein böiger Wind, der die dicke Wolke vor sich hergetrieben hatte und große kalte Regentropfen und kleine Hagelkörner aus ihr herausfallen und gegen sein großes Fenster klatschen ließ, hatte sich verzogen. Er hatte zusätzlich zu den Deckenleuchten seine Schreibtischlampe eingeschaltet, so dass jetzt zusammen mit dem Tageslicht eine eigenartige, fast romantische Stimmung aufkam. Sie stand im deutlichen Kontrast zu der geschäftlich sachlichen Atmosphäre, in der Maria ihm die Briefe vorlegte. Sie waren fehlerfrei im richtigen Layout geschrieben. Auf das Schriftbild legte er besonderen Wert Er hatte ihr am ersten Tag nur einmal gesagt, wie er es haben wollte und sie teilte seitdem die Briefe so auf.
Er wollte ihr die Mappe mit einem kurzen Kopfnicken zurückgeben, da fiel ihm jedoch ein, dass er ein paar lobende Worte sagen sollte. Man hatte ihm schon kurz nachdem er in diese Firma gekommen war, den Vorwurf gemacht, dass er die Mitarbeiter nie loben würde. Ihm war das bis dahin noch nie aufgefallen. Erst als Maria, ihm erzählte, dass sie das über den Flurfunk gehört habe, fing er an, ab und zu ein Lob auszusprechen, so sehr es auch mit seiner schwäbischen Mentalität kollidierte. Dort herrschte nämlich der Grundsatz: “Schon nix gschwätzt isch gnug globt.“
Als er Maria diese Erklärung für sein Verhalten gab, lachte sie herzlich und erzählte sie in den Büros weiter. Auch dort erzeugte sie große Heiterkeit und ein gewisses Verständnis für sein Verhalten. Maria aber ging es überhaupt vor allem darum, ihn aus allem herauszuhalten, was ein schlechtes Licht auf ihn hätte werfen können. Etwas holprig und wenig empathisch sagte er: “Danke, das haben Sie gut gemacht.“
Maria hatte ein besonderes Verhältnis zu ihm aufgebaut. Nachdem sie von ihren Kolleginnen als eher ungeeignet für diesen Job angesehen worden war. ,als er sie zu sich holte, wusste er inzwischen, dass es richtig war, sie in sein Vorzimmer zu setzen. Sie entsprach so gar nicht dem Stereotyp einer Sekretärin, die viel Zeit und Energie darauf verwendet, ihre Fingernägel zu pflegen und Modezeitschriften zu wälzen. In ihrem ganzen Wesen war sie recht natürlich geblieben, ihr Make-Up war dezent und passte sehr gut zu ihrem Typ. Ihr Parfum oder Eau de Toilette roch angenehm frisch und nicht süßlich und schwer. Ihre Figur war nicht die einer Hungerharke, sondern sehr fraulich mit einer für eine Frau Ende dreißig festen und wohlgeformten Brust. Dazu verfügte sie über ein fröhliches Temperament, das sich auch in ihrer Garderobe zeigte, die stets Farben enthielt, gut aufeinander abgestimmt und sich nicht „beißend“. Hätte allerdings so eine typische Macho-Figur eine Rangfolge eingeführt für die weiblichen Arbeitskräfte in der Chefetage, hätte sie sicherlich einen der hinteren Plätze belegt. Werner hatte sie ausgewählt, weil sie fachlich bestimmt nicht schlechter war, als die anderen, die zur Wahl standen, aber eher unfähig, sich nach vorne zu drängeln und sich wichtig zu machen. Wie sie ihm später einmal sagte, hätte sie nie damit gerechnet, dass er sich für sie entscheiden könnte. Werner wusste damals aber genau, was er tat, denn dadurch, dass er sie vom Nobody zur Chefsekretärin anhob, und ihr ein völlig neues Sozialprestige verschaffte, hatte er nicht nur eine gute Vorzimmerdame, sondern eine überaus loyale Mitarbeiterin gewonnen.
Dafür gab es allerdings auch noch einen anderen Grund, von dem er zuerst nichts wusste. Maria war geschieden. Sie hatte sich etwa zehn Jahre zuvor von ihrem Mann getrennt, das heißt sie war vor ihm geflohen. Sie war erst knapp über zwanzig, als sie ihn heiratete. Ihr Mann war gut aussehend und schien, obwohl noch relativ jung an Jahren, ein erfolgreicher Geschäftsmann zu sein. Er war zwar um einige Jahre älter als sie, aber noch keine dreißig, als sie ihn kennenlernte. Er erzählte stets vollmundig von seinen geschäftlichen Erfolgen, aber nur wenige, die das hörten, wurden misstrauisch, dass ein so junger Mann schon solche Erfolge erzielt haben wollte. Maria war unerfahren genug und außerdem über alles verliebt, so dass sie ihm und seinen Geschichten verfiel. Kaum zwei Jahre nach der Hochzeit flog er mit seinem Schwindel auf, den er einige Jahre lang wie ein Schneeball-System betrieben hatte. Es gab ein Gerichtsverfahren, dem er ohnmächtig gegenüberstand und sein Verhalten wurde zunehmend aggressiv.
Er begann zu trinken und sich selbst zu bedauern. Weil er aber sonst nur Misserfolge erlitt und niemand anderen hatte, dem er die Schuld dafür zuschieben konnte, ließ er seine Launen an Maria aus. Er quälte sie nicht nur seelisch, indem er sie permanent herabwürdigte, sondern fing auch an, sie zu schlagen. Als sie es nicht mehr aushielt und mit der Zeit auch Angst bekam, er könnte sie umbringen, floh sie in ein Frauenhaus. Zurück zu ihren Eltern wollte sie nicht, denn die hielten immer noch große Stücke auf ihren Schwiegersohn und bedeuteten ihr, dass sie wohl versagt hätte, weil sie nicht zu ihm gehalten habe.
Werner kannte die Geschichte zwar nicht, aber er fühlte doch, dass sie ständig bemüht war, trotz ihrer fröhlichen Ausstrahlung eine gewisse Distanz zu halten. Sie vermied jeden körperlichen Kontakt. Selbst als er nur einmal ihren Oberarm berührte, weil er einen Ordner aus dem Regal nehmen wollte, vor dem sie stand, zuckte sie wie elektrisiert zusammen.
Im Lauf der Zeit fasste sie aber zunehmend Vertrauen, als sie merkte, dass Werner zwar manchmal sehr zornig fluchen und schimpfen konnte, er damit aber meist die jeweilige Situation meinte und nicht jemand persönlich. Sie fand ihn als Mensch sympathisch und als Chef kompetent, der Loyalität nicht als Einbahnstraße sah. Wenn sie mal etwas verbockt hatte oder eine ihrer Kolleginnen ihr etwas anhängen wollte, hat er sich immer vor sie gestellt, ohne zu fragen oder feststellen zu wollen, wer da an was schuld sein soll. Sein Leitspruch war in diesen Fällen:
„Unsere Aufgabe ist es, Probleme zu lösen und nicht Schuldige zu suchen.“
Man konnte etwas altertümlich ausgedrückt auch sagen, Maria war ihm „treu ergeben“. Das hatte er einige Monate, nachdem er gekommen war, festgestellt. Damals hatte er mit ihr eine kleine Episode erlebt, in der sie das unter Beweis stellte, als es aufgrund einer Nachkalkulation erforderlich geworden war, einige Angebote noch einmal durchzurechnen, zu berichtigen und neu zu schreiben. Die Zeit drängte und so mussten sie bis in den Abend hinein arbeiten. Maria blieb einfach länger bis alles erledigt war, obwohl sie eine Verabredung absagen musste. Werner war froh, dass er die Unterlagen am nächsten Morgen abgeben und kein weiterer Druck mehr entstehen konnte. Spontan rief er damals zu Hause an, sagte, dass es später würde und lud Maria zum Essen ein.
Als sie ihn fragte, wo es denn hingehen solle, antwortete er vielsagend: „Wir brauchen kein Auto; und außerdem kennen Sie das Lokal.“ Sie dachte nach, aber außer einem leidlich guten Italiener und einem miserablen Chinesen fiel ihr nichts ein, was fußläufig zu erreichen gewesen wäre. Er dachte aber an das Gourmetlokal, in das er wichtige Kunden einzuladen pflegte. Es lag nur zwei Blöcke weiter und war in weniger als einer Viertelstunde zu erreichen.
Als sie davorstanden, sagte er lachend:
“Ich hatte doch recht, dass sie es kennen.“
Sie kannte es freilich nur von den Quittungen, die er ihr nach einer Kundenbewirtung auf den Schreibtisch legte und die sie dann in den vorschriftsmäßigen Beleg für die Buchhaltung übertragen musste.
Sie zögerte, als er ihr die Tür aufhielt:
“Mein Gott ich bin doch da gar nicht richtig angezogen.“
Er schaute sie an und lächelte:
„Da kann ich nur eine Freundin meiner Frau zitieren: 'Je toller der Schuppen, desto mehr kannst Du Dich daneben benehmen', aber glauben Sie mir, Sie sind immer richtig angezogen“.
Er öffnete die Tür, legte seinen Arm ganz leicht auf ihre Schulter und schob sie ein wenig nach vorne, ohne dass sie Berührung sie erschreckte. Der Kellner erkannte Werner sofort, und begrüßte die beiden mit einem freundlichen:
„Guten Abend, Herr Doktor“ ---
dann hielt er inne und wandte sich etwas ratlos Maria zu. Bevor er womöglich „guten Abend Frau Wielandt sagen konnte, stellte sie Werner als „Frau Budweiser, meine Assistentin“ vor.
Es war schon seit einigen Jahren im Rahmen der fortschreitenden Frauenemanzipation allgemein üblich geworden nicht mehr von „Sekretärin“ zu sprechen, sondern von der „Assistentin“.
Francesco war schon lange Kellner in dem Lokal. Er war zwar in Deutschland geboren, kurz nachdem seine Eltern als Gastarbeiter gekommen waren, wusste aber genau, wie seine Gäste – und vor allem die weiblichen – auf seinen auf italienisch getrimmten Charme reagierten. Er verneigte sich mit einem freundlichen Lächeln zu Maria und sagte, unterstützt von einer Handbewegung voller Grandezza “Dann seien Sie uns herzlich willkommen.“
Das Lokal war nur noch schwach besetzt, denn es war nun doch schon recht spät geworden. Werner fragte:
“Ist die Küche noch geöffnet“.
„Und wenn nicht, würden wir sie für einen Gast wie sie noch einmal öffnen, zumal wenn Sie in so reizender Begleitung kommen.“
Francesco legte die Speisekarten auf den Tisch und erwähnte wie beiläufig: “Wir haben heute Kalbsbries.“
„Wie kommt das?“
„Entweder als Milanese oder wenn - Sie wollen - auch auf schwäbische Art.“
„Dann wollen wir einmal sehen, was es sonst noch gibt.“
Er schob Maria eine Karte zu und öffnete auch die seine. Maria fragte ihn: „Worüber haben Sie gerade gesprochen?“
„Die haben heute Kalbsbries.“
„Was ist das?“
Werner freute sich über ihre Ehrlichkeit und dass sie nicht so tat, als wisse sie Bescheid, denn hier im Rheinland war Kalbsbries etwas ungewöhnlich. Er erklärte ihr, dass es sich um die Thymusdrüse des Kalbs handle, eine im Rohzustand recht labbrige Innerei, mit der nicht jeder Koch etwas anzufangen wisse. Aber in Italien, Frankreich und Deutsch Südwest würde man sie zu Delikatessen verarbeiten.
„Haben Sie dort auch schon gelebt?“ fragte sie erstaunt.
„Ich bin dort sogar geboren. Aber mit Deutsch Südwest bezeichnen wir spaßhaft Baden-Württemberg, den sogenannten Südwest-Staat“.
Er merkte, dass sie sich etwas naiv empfand, wollte sie aber nicht in Verlegenheit bringen und empfahl, sich dem Studium der Karte zuzuwenden.
Unterdessen hatte es draußen wieder begonnen zu regnen. Man sah durch die vorhanglosen Fenster sogar ein paar Blitze zucken. Werner murmelte hinter seiner Speisekarte hervor: “Jetzt müssen wir so lange essen bis sich das Wetter beruhigt hat, sonst werden wir auf dem Rückweg tropfnass“ und fuhr fort „ich glaube, ich nehme das Kalbsbries Milanese als Vorspeise und dann den sautierten Wolfsbarsch, Maria war ganz unsicher geworden angesichts der Speisen auf der Karte, denn das meiste von dem, was da stand, kannte sie nicht und sagte: „ Ach, ich nehme einfach das gleiche, wie Sie.“
Werner gab Francesco ein Zeichen, um ihn an den Tisch zu rufen und gab ihm die Bestellung auf. Obwohl Maria das, was sie gegessen hatte, nicht kannte schien es ihr geschmeckt zu haben. Vom Weißwein von der Loire tranken sie nur wenig, weil sie beide noch fahren mussten. Sie verzichteten auf das Dessert und Werner ließ sich die Rechnung bringen. Als er den Kreditkartenbeleg unter-schrieben hatte, nahm sie wie selbstverständlich die Durchschrift an sich, steckte sie in ihre Handtasche und lächelte ihm zu:
„Ich mach' das schon.“
Sie hatten tatsächlich so lange gegessen bis der Regen aufgehört hatte. Beschwingt liefen sie zurück zur Firma, um dort ihre Autos zu holen. Sie hakte sich vergnügt bei ihm unter und er wusste, dass er sie jetzt ganz auf seiner Seite hatte.
Werner fuhr mit einem zufriedenen Gefühl nach Hause, wo ihn seine Frau Brigitte erwartete. Als sie an ihren neuen Wohnsitz zogen, besichtigten sie vorher einige Häuser, denn eine Etagenwohnung kam für sie nicht in Frage. Sie wollten ein wenig „Ellbogenfreiheit“ haben und auch nicht in ein gewachsenes Gebiet ziehen, in dem sich alle Nachbarn schon kannten und sie noch lange Jahre als „die Neuen“ gelten würden. Deshalb suchten sie sich ein Haus in einem neu entstandenen Wohngebiet aus, das sie zunächst mieten konnten, um es später, wenn er sich in seiner neuen Firma etabliert haben würde, zu kaufen. Sie fanden das passende Objekt im „Wohnpark Ludwigsforst“, wie die Bauträgergesellschaft ihre kleine Siedlung, die etwa je zur Hälfte aus Reihenhäusern und freistehenden Gebäuden bestand, nannte. Die Bewohner waren fast alle auch Neubürger, so dass keine Unterscheidung in Neue und Alte erfolgen konnte. Das Haus war groß genug mit seinen beiden Geschossen und einem großen Hobbyraum unter dem Walmdach, das zwar ein wenig flach ausgefallen war, seinen drei Kindern aber ausreichend Platz bot, um sich dort außerhalb ihrer Zimmer zu entfalten. Die Kinderzimmer waren durch einen kleine Flur vom Elternschlafzimmer getrennt. Das Haus hatte einen Balkon zur Südwestseite hin, was dafür sorgte, dass sie von der aufgehenden Sonne nicht allzu früh geweckt wurden.
Auch Brigitte war eine „Nachteule“, wie er und war deshalb noch wach , als er eintraf. Sie hatte einen Underberg für ihn bereitgestellt, weil sie wusste, dass er bei Geschäftsessen manchmal „zu viel des Guten tat“, wie sie sagte. Sie lag mit einem Woll-Plaid bedeckt in ihrem bequemen Sessel und las in der Biographie über Marie Curie. Sie interessierte sich vor allem für diese Art der Literatur, nachdem sie sich in ihren früheren Jahren hauptsächlich mit kunsthistorischer Literatur und guter Belletristik ihre freie Zeit vertrieben hatte. Inzwischen meinte sie, das Leben sei zu kurz, als dass man es mit erfundenen Geschichten zubringen sollte. Deshalb hatte sie sich echten Lebensgeschichten zugewandt und bevorzugte dabei vor allem Lebenserinnerungen starker Frauen oder Schilderungen über sie. Werner setzte sich zu ihr und erzählte ihr, womit er den Tag verbracht und wie er geendet hatte.
Sie fragte ihn: “Muss ich jetzt eifersüchtig werden?“
Werner stand auf und beugte sich über sie, er schlug ihr Plaid etwas zurück und küsste sie zärtlich auf die Lippen.“Aber natürlich, wie immer“, sagte er leise. Sie verstand nach all den Jahren seinen Humor und antwortete: “Dann können wir ja getrost schlafen gehen.“ Während der nasskalte Wind geräuschvoll um das Haus wehte, schliefen sie einträchtig ein.
Seit damals, als er hier anfing, war es jetzt zum vierten Mal wieder April geworden. Und das Wetter war wieder von der gleichen Wechselhaftigkeit wie an jenem, wie es ihm schien, lange zurückliegenden Tag. „April, April, der macht halt, was er will“, dieser alte Kinderreim ging ihm durch den Kopf. Bis zum Eintreffen des Vorstands blieb noch Zeit für eine Tasse Kaffee, die ihm Maria so brachte, wie er ihn haben wollte: einfach schwarz ohne alles, aber in einem möglichst großen Becher. Maria war wieder hinaus gegangen und er ließ seine Gedanken abschweifen zu dem Tag an dem er vom Personalbüro ihren CV bekommen hatte.
Als er ihren Lebenslauf las und ihre bisherige berufliche Kariere betrachtete, musste er daran denken, wie wohl sein Lebenslauf aussehen würde, wenn er heute einen zu schreiben hätte. Obwohl eine gewisse Ehrlichkeit angezeigt wäre, würde er ganz bestimmt nicht alles offenbaren, was ihn zu dem Menschen gemacht hat, der er war.
Er hatte eine zehn Jahre ältere Schwester, der in einem Abstand von sieben Jahren eine weitere und noch einmal nach achtzehn Monaten eine dritte folgten. Die Familie wurde dann vervollständigt durch ihn. Er wurde im Abstand von nur fünfzehn Monaten nach seiner jüngsten Schwester geboren. Der Krieg hat, wie bei vielen anderen dafür gesorgt, dass die Kinder in einer Familie oft in sehr unterschiedlichen Zeitabständen auf die Welt kamen. Werner spürte schon in seiner frühen Kindheit, dass die Eltern ihre Zuneigung unterschiedlich zuteilten. Sein Vater, der sechs Jahre älter war als seine Mutter, war ganz und gar seinen Töchtern zugeneigt. Er schätzte ihre Intelligenz, ihre musischen Begabungen und sprach voll Stolz von ihnen und dem, was sie konnten. Werner war für die Familie halt „auch da.“ Das war nicht die Umgebung, in der er ein besonders ausgeprägtes Selbstbewusstsein entwickeln konnte.
Auch später während Schulzeit und Studium bekam er im Gegensatz zu seinen Schwestern keine Vorschusslorbeeren, sondern musste immer zuerst beweisen, dass er in der Lage war, den jeweiligen Abschnitt erfolgreich abschließen zu können. Seine Schwestern absolvierten nach dem Abitur die klassischen Studiengänge, für die man sich, nach damaliger landläufiger Meinung zu entscheiden hatte, wenn man vom humanistischen Gymnasium kam. Die Älteste wurde Apothekerin, die Mittlere war promovierte Medizinerin und landete in der Pharmaforschung, die Jüngste war Juristin mit der Befähigung zum Richteramt, das sie auch zügig anstrebte.
Werner hatte sich schon in der Untersekunda entschlossen, Wirtschaft zu studieren. Dabei war ihm damals noch nicht klar, dass es einen Unterschied macht, ob man sich für Volks- oder Betriebswirtschaftslehre entschied. Erst als er kurz vor dem Abitur stand befasste er sich mit den Feinheiten seines zu wählenden Studiums. Auf die Idee Wirtschaft zu studieren kam er aufgrund seiner intensiven Spiegel-Lektüre. Man musste dieses Magazin einfach gelesen haben, wenn man in den Schülerkreisen aus den oberen Klassen mitreden wollte.
Seine Mutter hatte allerdings ganz Anderes im Sinn, wenn sie auf seinen einmal zu ergreifenden Beruf zu sprechen kam. Sie riet ihm, beeinflusst durch die von ihr bevorzugte Trivialliteratur, er solle doch Bibliothekar oder Pfarrer werden.
Bei seiner Zeitungslektüre war er einmal auf einen Artikel mit dem Titel „It's a blessing, to have a man like Blessing“ gestoßen, der sich auf amerikanische Quellen bezog und ein einziges Loblied auf den Präsidenten der Bundesbank sang. Weil er nicht so richtig verstand, was da geschrieben wurde, er aber die dort geschilderten Zusammenhänge hinsichtlich Währungsstabilität und Wirtschaftskraft spannend fand, dachte Werner zum ersten Mal daran, sich berufsmäßig mit diesen Dingen zu beschäftigen. Ein anderer Impuls kam aus den Berichten über die Borgward-Pleite und die Rettung von BMW.
Nun wollte er mehr wissen über das, was man da macht, wenn man „Wirtschaft“ studiert. Er traf sich dazu mit einem Bekannten aus der Nachbarschaft, der zwei Jahre älter war als er, allerdings nicht zur Bundeswehr musste und deshalb schon im vierten Semester an der Uni war. Von ihm, Udo Hüttlein, hatte er gehört, er würde Wirtschaftspädagogik studieren und so nahm er an, dass er ihm seine Fragen beantworten könnte. Udo erklärte ihm zunächst die unterschiedlichen Studiengänge, um ihm dann von VWL abzuraten. „Die VWLer haben keinen guten Ruf. Es heißt nämlich: Wer nix wird, wird Wirt, wer gar nix wird, wird Volkswirt.“ Werner hatte genug gehört, sein Entschluss stand fest, er würde BWL studieren. Nach dem Abitur, das er wegen seines, wie es sein Chemie- und Biologie-Lehrer formulierte – „gebrochenen Verhältnisses zum schülerischen Fleiß“ - nicht mit den Ergebnissen bestand, die für ihn möglich gewesen wären, musste er jedoch zuerst zum Bund.
Er freute sich, im Gegensatz zu den meisten anderen, über seine heimatferne Verwendung mit einer Distanz von rund 800 km zu seinem Zuhause, viel weiter weg ging es schließlich nicht. Damit konnte er sein eigener Herr sein, ganz der Kontrolle durch die Familie entzogen. empfand er, so paradox es auch klingen mag, seine Situation trotz des militärischen Befehls- und-Gehorsams-Prinzips, als eine Art von Befreiung.
Nach der Grundausbildung wurde der Dienst arge Routine und, wie er fand, stinklangweilig. Als dann das Angebot an alle Wehrpflichtigen mit Abitur kam, es bei einer Verpflichtung auf zwei Jahre, bis zum Leutnant der Reserve bringen zu können, schlug er ein. Dabei hatte er noch in der Zeit, als er gemustert wurde, ernsthaft darüber nachgedacht, den Wehrdienst zu verweigern.
Ein richtig guter Soldat wurde er nie, verfügte aber, wie er später merkte, als er Ausbilder und Gruppenführer wurde, über eine bestimmte Art von natürlicher Autorität, die es ihm leicht machte, sich durchzusetzen. Überhaupt lernte er während des Wehrdienstes sehr viel über sich selbst, so zum Beispiel über sein Verhalten in Stress-Situationen und wie er seine cholerischen und manchmal jähzornigen Anfälle in den Griff bekommen konnte, was ihm freilich nicht immer gelang. Weil er aber merkte, dass man durch so ein Verhalten zwar Angst hervorrufen konnte, aber sich manchmal auch einfach nur lächerlich machte, versuchte er immer mehr dagegen anzukämpfen.
Es gab in der Kaserne weder offizielle Radios noch Fernsehapparate. Die mussten privat mitgebracht werden; und wenn dann einmal einer so ein tragbares Gerät mitbrachte, war das Bild meistens grieselich und vor allem so klein, dass höchstens zwei Mann gleichzeitig etwas sehen konnten. Die hauptsächliche Informationsquelle war somit das Radio und die BILD. Eine andere Zeitung war im Kantinenkiosk nicht zu bekommen. Wenigstens schickte ihm sein Vater regelmäßig den Spiegel und die Zeit. Er lies die beiden Publikationen im Aufenthaltsraum liegen, wenn er sie gelesen hatte, was von seinen Kameraden dankbar angenommen wurde.
In seine Bundeswehrzeit fielen die Studentenunruhen, die man später die 68er nannte. Sie werden meist als Zeiten des Um- und Aufbruchs geschildert, als Jahre der Befreiung von überalterten Konventionen, der durch die Verbreitung der Anti-Baby-Pille ausgelösten sexuellen Revolution, der Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit und anderer Segnungen, wobei die meisten aber verdrängt zu haben scheinen, dass es auch die Zeit des eskalierenden Vietnam-Kriegs und vor allem auch der Tschecheslowakei-Krise war. Von ihr war auch Werner betroffen, weil sein Standort nur einige Kilometer von der Zonengrenze entfernt lag und er dadurch manchmal, wenn er nachts Wachhabender war, von verunsicherten Rekruten angesprochen wurde, die sich Sorgen machten und von dem Fähnrich und angehenden Leutnant weise Antworten auf ihre Fragen erwarteten. Sie hatten so großen Respekt vor seinem Dienstgrad, dass sie ganz vergaßen, dass er, wenn überhaupt, nur rund ein Jahr älter war.
Später ödeten ihn die großmäuligen Reden der 68er-Revolutions-Veteranen fürchterlich an, wenn da irgendwelche Pseudointellektuelle in abgegriffenem Soziologensprech ihre heldenhaften Großtaten schilderten, und erzählten, sie hätten am Springer- Hochhaus beinahe eine Scheibe eingeworfen. Werner klinkte sich meist schnell aus einer solchen Runde aus, bevor er ausrastete und dem jeweiligen Sprecher vorhielt, dass er und seinesgleichen, ihm damals für seinen Unfug den Rücken frei gehalten hätten. Damit war er dann als „Rechter“ abgestempelt.
Mit „tempi passati“ pflegte er diese Gespräche zu beenden und auch seine eigenen Gedanken, wenn die Erinnerungen in ihm hochkamen. Als er schließlich ausweislich einer Abschiedsurkunde „in Ehren“ aus dem Dienst ausgeschieden war und er zu Hause ankam, nahm man dies in der Familie kaum zur Kenntnis. Vor wenigen Tagen hatte er in der Abschluss-Besichtigung noch eine Kompanie befehligt, wofür ihm seine Vorgesetzten allen Respekt für seine Leistung zollten und jetzt war er wieder nur „auch da“.
Am nächsten Morgen flüchtete er schon früh morgens unter dem Vorwand, er müsse rechtzeitig zur Uni, um sich einzuschreiben und mit der Suche nach einem Zimmer zu beginnen. Er hatte von seinem Wehrsold und dem Entlassungsgeld genügend in der Tasche, so dass er seine Eltern nicht um Geld bitten musste, weil er vorhatte ein paar Tage in der Universitätsstadt zu bleiben, um sich ein wenig umzuschauen. Dort angekommen wandte er sich zuerst einmal den „heiligen Hallen der alma mater“ zu.
Einer seiner Lateinlehrer hatte ihm für dort viel Glück gewünscht, wobei er bei „alma mater“ sein ironisches Grinsen nicht verbergen konnte. Der Spatz, der eigentlich Sperling hieß, war nämlich davon überzeugt, dass das humanistische Gymnasium eine Eliteschule sei, die ihre Schüler zum Wahren, Edlen, Schönen führe und es nicht verdient hätte, dass nun einer, der das ganze Curriculum - sogar nicht ohne Erfolg – durchlaufen hatte, sich einem Studium zuwandte, dessen einziger Sinn und Zweck es sei, sich zum Sklaven des Mammons zu machen. „Dafür haben wir Sie nicht gebildet, dafür hätten Sie nicht bei uns die Stühle wärmen müssen. Sie haben doch ganz andere Möglichkeiten, Sie haben das Zeug zum Forscher!“
Werner hörte sich das in Ruhe an, wobei er zum ersten Mal den Eindruck hatte, dass da wirklich jemand war, der ihm etwas zutraute und entgegnete dann:
„Gerade in den Wirtschafts-Wissenschaften gibt es noch viel zu erforschen … und - wenn Sie meinen - dann bin ich ja dort besonders gut aufgehoben.“
Der Sperling winkte verächtlich ab:
“Na ja, Wirtschafts-Wissenschaften?!“
und ging zu den Nächsten, um von ihnen auch zu erfahren, was sie studieren wollten. Die Antworten, die er dort hörte, wie zum Beispiel Pharmacie, Medizin, Jura, Musik und andere klassische Studiengänge, gefielen ihm schon besser. Als er sich verabschiedete sagte ihm Werner noch:
„Auch dieses Gymnasium wird neu nachdenken müssen, damit nicht nach jeder Unterrichts-Stunde die Fenster aufgerissen werden müssen, um den Mottenkugel-Gestank wieder los zu werden.“
Wegen solcher Bemerkungen blieb er den Lehrern als respektlos und mit einem losen Mundwerk ausgestattet in Erinnerung. Dabei war er eigentlich eher schüchtern und benutzte solche Sprüche als Schutzschild, weil sich dann keiner, mit ihm anlegen wollte. Meistens hatten seine Gegenüber Angst, von Werner verbal niedergemacht zu werden.
Mit einer ähnlichen Taktik verbarg er seine Schüchternheit vor den Mädchen. Er hatte stets ein paar flapsige Sprüche drauf, die keine romantische oder gar erotische Stimmung aufkommen ließen. Hinzu kam die geradezu panische Angst, abgewiesen zu werden und im Hintergrund stand auch immer die Sorge, sich mit zu forschem Vorgehen lächerlich zu machen.
Das änderte sich, nachdem er auf einer Party die ältere Schwester eines Klassenkameraden kennengelernt hatte. Er tanzte mit ihr das, was er und seine Altersgenossen „tanzen“ nannten: Auf Boogie-Woogie und Rock'n-Roll Rhythmen tanzte man offen den Hopser-Rock und auf langsame Musik den zwei-links-eins-rechts Schritt, den man bis zum Steh-Blues verlangsamen konnte. Es ging gegen Mitternacht als er mit dem Mädchen schon einige Zeit