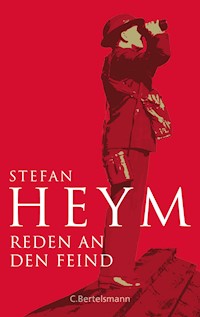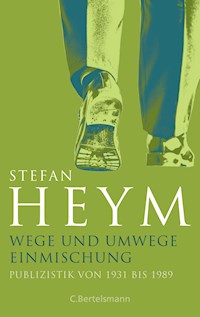
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Stefan-Heym-Werkausgabe, Autobiografisches, Gespräche, Reden, Essays, Publizistik
- Sprache: Deutsch
»Dieses Buch macht höchst nachdenklich.« Stuttgarter Zeitung
Der Doppelband »Wege und Umwege« und »Einmischung« enthält eine Auswahl aus dem umfangreichen publizistischen Werk Stefan Heyms: Essays und Porträts, Leitartikel und Berichte, Reportagen, Flugblätter, Aufrufe, Reden, Interviews und Autobiographisches aus sechs Jahrzehnten. Allesamt Äußerungen zu politischen Ereignissen und zur Geschichte ebenso wie zum Leben und Denken der Leute auf der Straße, die tagesbezogen entstanden, aber über den Tag hinaus ihre Frische bewahrt und sich dem Leser heute noch selbst erschließen.
Stefan Heyms scharfsichtige Publizistik, bei C. Bertelsmann als Doppelband erstmals 1998 erschienen, endlich wieder lieferbar als Teil der digitalen Werkausgabe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1168
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Zum Buch:
Dieser Doppelband »Wege und Umwege« und »Einmischung enthält eine Auswahl aus dem umfangreichen publizistischen Werk Stefan Heyms: Essays und Porträts, Leitartikel und Berichte, Reportagen, Flugblätter, Aufrufe, Reden, Interviews und Autobiographisches aus sechs Jahrzehnten. Allesamt Äußerungen zu politischen Ereignissen und zur Geschichte ebenso wie zum Leben und Denken der Leute auf der Straße, die tagesbezogen entstanden, aber über den Tag hinaus ihre Frische bewahrt und sich dem Leser heute noch selbst erschließen.
Stefan Heyms scharfsichtige Publizistik, bei C. Bertelsmann als Doppelband erstmals 1998 erschienen, endlich wieder lieferbar als Teil der digitalen Werkausgabe.
»Die Sammlung journalistischer Arbeiten zeigt Stefan Heym von seiner stärksten Seite, zeigt ihn als Publizisten, der den Kontakt zur Alltagswelt hat, recherchieren kann, der sich einmischt, ohne lang um den heißen Brei herumzureden.« Frankfurter Rundschau
Zum Autor:
Stefan Heym, geboren 1913 in Chemnitz, floh als kritischer jüdischer Intellektueller vor der Nazidiktatur nach Amerika. Während der McCarthy-Ära verließ er das Land und siedelte sich 1952 in der DDR an. Er war ein international hoch geschätzter Schriftsteller und streitbarer Publizist, der zu den bedeutendsten und erfolgreichsten Autoren der deutschen Nachkriegsliteratur zählt. Er starb 2001 auf einer Vortragsreise in Israel.
Besuchen Sie uns auf www.cbertesmann.de und Facebook.
Stefan Heym
Wege und Umwege
Einmischung
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 1980/1990 Inge Heym
Copyright © dieser Ausgabe 2021
C. Bertelsmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlagkonzeption und -gestaltung: Sabine Kwauka, München
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN978-3-641-27828-1V002
www.cbertelsmann.de
Vorwort
Als Stefan Heym vor kurzem gefragt wurde, ob er gedenke, seine Autobiographie zu schreiben, erklärte er, dazu verspüre er noch keine Lust. Im übrigen könne, wer wolle, markante Erlebnisse, Begegnungen, Erfahrungen seinem schriftstellerischen Werk entnehmen.
Ohne Zweifel, Biographie findet sich in seinen großen Romanen, auf dem weiten Feld, das von den Crusaders (Der bittere Lorbeer) bis zum Collin reicht. Ganz Eigenes ist verarbeitet, hinter ironischem Augenzwinkern verborgen, im König-David-Bericht, in der Schmähschrift. Aber Heymsche Biographie wird deutlicher noch in einem umfangreichen publizistischen Werk, in streitbaren Schriften, Reden, Gesprächen. Da haben wir, typisch für diesen Mann, eine Zurücksicht ohne Vorsicht, eine unfrisierte Art, Auskunft zu geben.
In diesem Buch also steckt Leben, Charakter, aus diesen Seiten tritt das Profil eines wachen Zeitgenossen hervor. Heym ist lebendige Kritik seiner Zeit. Sein Leben ist Polemik im aufklärerischen Sinn sozial-revolutionärer Vorfahren: Was als das Bessere erkannt wird, im kleinen wie im großen, soll als Besseres auch etabliert werden, lieber heute als morgen, wenn es geht, sofort.
Stefan Heym war von Beginn an Erzähler und Publizist. Ich habe mich in das Gewühl des täglichen Kampfes begeben; wenn mir dabei die Krawatte verrutscht ist – nun gut, ich bitte um Entschuldigung. Was er im Sommer 1954 im knappen Vorspruch für eine erste Sammlung seiner Artikel und Reportagen notierte, gilt für den Chemnitzer Oberprimaner, der wegen eines politischen Gedichts 1931 von der Schule flog, ebenso wie für den Redakteur des New Yorker Volksecho, der sich mit den Nazis herumschlug. Kein touristischer Trip, sondern täglicher Kampf war der Marsch mit der amerikanischen Armee quer durch Frankreich, über den Rhein, bis an die Elbe. Das Headquarter der 12. Armeegruppe zeichnet den Technical Sergeant Nr. 32 860259 mit der Bronze Star Medal aus für seine publizistische Arbeit unter direkter Feindbedrohung.
Ungeduld und ein Schuß Hoffnung zuviel auf rasche Entnazifizierung und Demokratisierung ließen ihn früh mit den Realitäten des beginnenden kalten Krieges kollidieren. KZ-Prozesse, über die er 1945 berichtet, finden noch heute statt … Seine Crusaders erzählen von einer Mission und markieren zugleich den Abschied von ihr.
Danach kommt der Abschied von McCarthys Amerika und wieder das Gewühl des täglichen Kampfes, als er 1952 in der DDR eintrifft. Hier fühlte er sich gebraucht, nützlich, als Geburtshelfer neuen Denkens und Handelns, da sah er sich anerkannt und weitgehend in Übereinstimmung mit den Zielen des Staates, dessen Bürger er wurde. Scharf beobachten, schreiben ohne Schnörkel, sich einen Kopf machen, das hatte er gelernt; eingreifen, sich einmischen, Veränderungen anregen, das war nach seinem Geschmack. Dieser Gesellschaft wollte er Sicherheit geben, Souveränität, mit ihr wollte er sich identifizieren können. Der wechselvolle Alltag diktierte ihm die Themen seiner Aufsätze, Anregungen, Polemiken in die Schreibmaschine, wenig Zeit blieb, die Krawatte geradezuziehen und sich feinzumachen für das offizielle Parkett. Er kümmerte sich ungeniert um die Besoldung von Krankenschwestern und die Mitbestimmung für kleine Angestellte. Im April 1957 schrieb er: Lieber hätte ich mich in den letzten Jahren ausschließlich jener Literatur gewidmet, die hier in Deutschland als »schöne« bezeichnet wird zum deutlichen Unterschied von der garstigen des garstigen Alltags. Dennoch hat die Alltagsliteratur ihre Vorzüge. Sie zwingt den Autor, sofort und direkt zu denken, um sofort und direkt Stellung zu nehmen; sie ermöglicht es dem Autor, sofort und direkt zu den Menschen zu sprechen, um sofort und direkt in das Geschehen einzugreifen.
Er schrieb voller Lust und Laune, wie immer eigentlich, wie heute noch, unerschrocken, forsch respektlos, auch Pathos nicht scheuend, kein Blatt vor dem Mund. Heinar Kipphardt sagte ihm zum 65. Geburtstag: Mich beeindruckte sein enormer Sinn für die Realität, sein Wunsch, eine Identität zwischen Leben und Arbeit zu finden. Die Literatur, verbunden mit einem stark reporterhaften Element, war für ihn ein Mittel zur direkten Einflußnahme auf die Wirklichkeit. Die stärkste Seite seiner Arbeit liegt für mich in der Tradition der amerikanischen Schule der Alltagsbeobachtung. Der Versuch eben, Literatur mit politischer Praxis zu verbinden. Es blieb für ihn immer wichtig, als Schriftsteller eine bestimmte Würde zu behalten. Nicht zu taktieren. Sich nicht anzupassen.
Am 12. Mai 1957 veröffentlichte Stefan Heym, angeregt durch einen Leserbrief, in seiner Kolumne OFFENGESAGT in der Berliner Zeitung den Wortlaut des Göttinger Appells. Achtzehn prominente Wissenschaftler rieten zu einem Verzicht der Bundesrepublik auf Atomwaffen und erklärten zugleich: »Wir bekennen uns zur Freiheit, wie sie heute die westliche Welt gegen den Kommunismus vertritt.« Diesen Passus hatte die DDR-Presse unterschlagen. Heym wetterte: »Seit wann scheuen ausgerechnet wir uns vor dem Abdruck langer Texte … Unsere redaktionellen Schönfärber, die uns die westdeutschen Atomwissenschaftler als eine Kollektion waschechter Antifaschisten vorsetzen möchten – sehen sie denn nicht, daß der Göttinger Appell seine riesige Schlagkraft erst dadurch gewinnt, daß sich der Satz von der westlichen Freiheit darin befindet!«
Die redaktionellen Schönfärber fühlten sich gekränkt und nahmen übel. Zwei Tage später erklärte das Redaktionskollegium der BZ am Abend unter der Überschrift Ganz offen gesagt, Heym habe die Journalisten der DDRfast in Bausch und Bogen beleidigt, Gebot für jeden Redakteur sei, das Wesentliche zu popularisieren, Heym aber betreibe unter dem Vorwand großer Offenheit … Popularitätshascherei, sein Artikel zeichne sich durch unmotivierte Überheblichkeit aus. Am 16. Mai stellte sich der Zentralvorstand des DDR-Presseverbandes hinter die RZA-Redakteure, nannte Heyms Formulierung einen ungerechtfertigten Angriff gegen die Vertrauenswürdigkeit unserer Presse und war zugleich der Meinung, daß es nicht zweckmäßig ist, die Polemik über das Für und Wider in den Spalten der Zeitungen fortzusetzen. Heyms Entgegnung blieb ungedruckt: Der wäre ein schlechter Sozialist, der einer Polemik zu entgehen sucht, indem er den Streitpunkt verschweigt und verdeckt. Polemiken, an denen wir nicht teilnehmen, finden ohne uns statt; und der Dreck wird nicht weniger dadurch, daß man ihn unter den Teppich schiebt.
Leser meldeten sich zu Wort. Heyms Kolumne OFFENGESAGT, entstanden unmittelbar nach dem 17. Juni 1953, war von Beginn an ein Dialog mit ihnen. Ich habe gelernt, wo sie der Schuh drückt, ein Schriftsteller muß so etwas wissen, schrieb Heym. – Bravo Heym, schrieb ein Berliner, möge ein gütiges Schicksal Dich noch lange der BZ erhalten. Heym wehrt sich und will sich nicht den Mund verbieten lassen. Im Juli zieht er noch einmal gegen Bürokraten und Schönfärber vom Leder: Auch wenn er nur ein kleiner Hahn auf einem kleinen Misthaufen ist, umgibt der Bürokrat sich mit Ja-Sagern, denn jeder Zweifel würde seine Autorität und seinen notdürftig zusammengezimmerten Glauben an sich selbst erschüttern. Instinktiv verbündet er sich mit seinesgleichen zum gegenseitigen Schutze, und wer einem aus dem Verein auf die Füße tritt, »liegt schief« oder »erschüttert das Vertrauen« und was dergleichen Redensarten mehr sind. Heym zeigte die Zähne, aber es war ein Abgesang. Die Partei wollte sich von ihm nichts mehr sagen lassen, offen schon gar nicht.
Zwei Jahre zuvor, 1956, hatte er sich noch ironisch mit der Westberliner B.Z. angelegt, die meldete Stefan Heym in Ungnade. Heym damals: So ist das Leben. Gestern ritt ich noch auf stolzen Rossen bei Ulbricht vor, und heute bin ich in Ungnade. Ich hatte gar nicht gewußt, daß es bei mir so auf und ab geht. Am 18. Mai 1958 schrieb er seinem Chefredakteur: Es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, daß ich OFFENGESAGT einstelle.
Die Ausflüge des Schriftstellers Stefan Heym in den Journalismus erscheinen wie Vorstöße. Eingreifen, mitreden, ja, aber er will auch das Feld vorbereiten für eine breite Wirkung seiner Romane. Hartnäckig verteidigt er einmal errungene Positionen. Alltagsliteratur ist unter den Gattungen der Literatur ungefähr das, was die Infanterie unter den Waffengattungen ist. Ohne Infanterie ist es aber unmöglich, einen Krieg zu gewinnen.
Die Themen seiner Bücher und die seiner publizistischen Arbeiten laufen vielfach parallel – Antifaschismus, Demokratie und Sozialismus, die Arbeiterbewegung und ihre Geschichte, die Situation eines Autors in dieser Welt. Publizistik, der rasche Gang in die Medien und anschaulich-ausholendes Erzählen durchdringen und beflügeln einander. Aber man wird dem Erzähler nicht gerecht, sieht man ihn, mit dem Blick auf sein journalistisches Werk, stärker als politische Figur denn als literarischen Kopf. Seine Bücher sind mehr als eine epische Umsetzung aktueller Themen, sind mehr als Verpackung und Vehikel für zeitkritische Befunde und polemisch gemeinte Diagnosen, mag auch der Journalist durchscheinen in der Prosa, der Dichter im Pressebericht.
Er hat sich gewandelt, und er ist zugleich sich und seiner Überzeugung treu geblieben. Aus dem rigorosen Antifaschismus der dreißiger Jahre wächst sein Engagement für eine Demokratie Rooseveltscher Prägung. Er versucht, demokratisches Bewußtsein mit sozialistischem Gedankengut zu verknüpfen, so, wie er später immer wieder Sozialismus mit Demokratie zu vereinen bemüht ist. Nach seinen Erfahrungen ist das eine nicht denkbar ohne das andere. Man könnte diesem Stefan Heym utopisches Denken vorwerfen, vielleicht auch Naivität hin und wieder, ihm ankreiden, daß er Illusionen nachhing, daß er die Macht des Wortes mit der dem Dichter gebührenden Eitelkeit überschätzte, daß er ein komischer Rufer in der Wüste war – er kontert: Manchmal ist es notwendig zu rufen, auch wenn es scheint, als ob nichts als Wüste um einen herum ist. So landet er häufig zwischen den Stühlen, aber dieser Schreiber aus Leidenschaft in Berlin-Grünau meint unverdrossen: In dieser Zeit ist das vielleicht eine ganz ehrenhafte Position.
Er war nicht frei von Irrtümern, hat lange geglaubt, daß vieles leichter gehen sollte, daß er diesem Nazi und jenem kalten Krieger und den vielen Bürokraten nur den Kopf zu waschen brauchte. Es führt eine direkte Linie von seinen Vorschlägen 1953, eine bessere Presse zu machen, von seiner permanenten Kritik an unbrauchbar gewordenen Kommandotönen und Papiermaßnahmen, seinem vehementen Einsatz für demokratischen Sozialismus und eine bürgernahe Rede- und Arbeitsweise hin zur mutigen Attacke gegen das SED-Politbüromitglied Konrad Naumann, dem er vor versammelten Schriftstellerkollegen im März 1977 sagte: Unterschiedliche Meinungen, die es geben muß, muß man auch ausdrücken können. Kritik muß man auch bei uns öffentlich äußern können.
Nur wenige Jahre konnte er in der DDR ausdrücken, was ihn bewegte, dann blieben ihm die Spalten der Zeitungen dort versperrt. Er hat rebelliert und hat andere Wege suchen müssen. Angepaßt hat er sich nicht. Am 23. Januar 1979 zieht er ein Fazit, das Selbstbewußtsein und Unantastbarkeit ausdrückt: Ich bin über 65 Jahre alt, und ich finde den ewigen Rundlauf um den heißen Brei schon ermüdend.
Heym ist derselbe geblieben, aber indem er der blieb, der er war, ging er in der DDR zu weit. Er begann links, er steht links, man hat vergeblich versucht, ihn links liegenzulassen. Er ist älter geworden und jung geblieben. Er hat sich oft die Finger verbrannt, zeitweise wurde es ruhig um ihn, aber ruhig geworden ist er nicht. Er hat eine Menge ertragen, aus dem Koffer des Emigranten gelebt und aus dem Kochgeschirr des Soldaten; er hat die Länder gewechselt, die Fronten nicht. Ob es unerträglich wird, ob es zum drittenmal einen Emigranten Stefan Heym geben wird, bleibt abzuwarten.
So oder so, dieses Buch gibt vorläufige Auskunft über ihn und seine Zeit. Es ist eine Bilanz ohne Schlußstrich. Der Mann macht weiter. Abschließendes kann noch nicht gesagt werden.
Januar 1980
Peter Mallwitz
Anmerkung
Dieses Buch ist eine Auswahl aus dem umfangreichen publizistischen Werk des Schriftstellers Stefan Heym.
Ausgewählt wurde, was für Weg und Zeit, für die Persönlichkeit dieses Mannes relevant erschien. Autobiographisches ist, die Chronologie der Texte durchbrechend, dort plaziert, wo sich die entscheidenden Abschnitte im Leben Heyms markieren lassen.
Vorgestellt werden Essays und Porträts, Leitartikel und Berichte, Reportagen, Flugblätter, Aufrufe, Reden und Interviews. Es sind subjektive Äußerungen zu politischen Ereignissen und zur Geschichte ebenso wie zum Leben und Denken der Leute auf der Straße, Sätze aus viereinhalb Jahrzehnten, die tagesbezogen entstanden, aber über den Tag hinaus ihre Frische bewahrten und die sich dem Leser heute noch selbst erschließen.
Anmerkung zu dieser Ausgabe
»Abschließendes kann noch nicht gesagt werden«, das gilt auch für die erweiterte Herausgabe der »Wege und Umwege« in dieser Edition. Neu hinzugekommen ist nicht nur, was 1981 bis 1985 entstand und die Kontinuität im Schreiben und Handeln Stefan Heyms markiert. Im immer noch ungeordneten Archiv des Autors fanden sich in einer schwarzen Klemm-Mappe die Aufsätze und Reportagen des jungen Berliner Studenten und des Emigranten in Prag und Chicago, bevor er nach New York gerufen wurde, um dort Chefredakteur des »Volksecho« zu werden. So konnte eine Lücke geschlossen werden. Aber auch die Meinungen und Gefühle des US-Offiziers in einer Psychological-Warfare-Abteilung sind nun deutlicher geworden durch Aufsätze wie »Begegnung mit den Deutschen« und »Hitler lebt weiter«.
Das umfangreiche Material der Funkmanuskripte, die Heym 1944 und 1945 für den von den Amerikanern betriebenen Sender Luxemburg schrieb, verdient eine eigene Publikation.
April 1985
P. M.
1931–1939
Biographisches
Es beginnt mit einem Skandal. Was die sozialdemokratische Chemnitzer »Volksstimme« am 7. September 1931 druckt, ist noch kein meisterliches Gedicht, aber es genügt, um die örtlichen Nazis in Erregung zu versetzen. Sie mobilisieren ihre Anhänger, »ein Schrei der Empörung« wird ausgestoßen, der Gymnasiast Helmut Flieg wird relegiert, muß nach Berlin übersiedeln und darf dort erst, im März 1932, sein Abitur machen. Er schreibt weiter für linke Blätter, auch für Ossietzkys »Weltbühne«. Genau ein Jahr später geht er, zu Fuß, übers Riesengebirge in die Emigration. Es gibt zwei Photos: 1945 steht er als Leutnant der U.S. Army in Chemnitz vor der zerstörten Fassade des Geburtshauses und auf dem anderen, breitbeinig, im Portal des Staatsgymnasiums – ein Sieger?
Leben vom Schreiben auch in Prag, bis ein Stipendium, gestiftet von einer jüdischen Studentenverbindung in Amerika, ihm die Fortsetzung seines Studiums an der Universität Chicago ermöglicht. Prager Redaktionen haben ihm die Überfahrt bezahlt, nun bedient er sie mit Nachrichten und Aufsätzen, mit kritischen Porträts von Zeitgenossen aus der ihm neuen, amerikanischen Welt. Stefan Heym schreibt und wirbt für die »Volksfront«, ein kleines Blatt in Chicago. Sein temperamentvolles Engagement müssen den in New York um den Wirtschaftswissenschaftler Alfons Goldschmidt und den ehemaligen preußischen Justizminister Kurt Rosenfeld versammelten Kreis so beeindruckt haben, daß der noch nicht Vierundzwanzigjährige von ihnen eingeladen wurde, nach New York zu kommen, um Chefredakteur einer neu zu gründenden deutschsprachigen Wochenzeitung zu werden.
Diese Zeitung, an keine Partei gebunden, sollte an alle appellieren, die gegen den Nationalsozialismus waren. Sie sollte für alle sprechen, die bereit waren, sich gegen die Umtriebe der Nazis unter den Deutschamerikanern zu wenden, und sie sollte aufklärend und mobilisierend wirken sowohl unter denen, die vor 1933 aus Deutschland nach Amerika eingewandert waren, als auch unter den Neuankömmlingen, die, deutsche Juden zumeist, vor Hitler flüchten mußten und in Amerika Asyl gefunden hatten.
Das Blatt, getauft auf den Namen Deutsches Volksecho, erschien zum erstenmal am 20. Februar 1937. Modern aufgemacht, mit Balkenüberschriften und vielen Fotos, hatte es sechzehn Seiten im Tabloid-Format – einem damals in den USA entwickelten, handlichen Zeitungsformat, das vor allem von den großen Massenblättern verwendet wurde. Die Startauflage war 8000; man hoffte, daß sie sich rasch steigern und jene magische Grenze erreichen würde, die man durchstoßen mußte, um die von den Zigaretten- und Schnapsfirmen routinemäßig vergebenen Großanzeigen zu erhalten; danach würde man soweit gesichert sein, daß man dem von Berlin aus finanzierten Weckruf und Beobachter, dem Blatt des mit seinen Schlägertrupps und Trainingslagern in den USA wirkenden Nazi-Bundes, Paroli bieten und eventuell sogar auf die Entwicklung in Deutschland Einfluß nehmen könnte.
Aber die Handicaps waren zu groß. Der Abonnentenstamm, übernommen von der inzwischen eingestellten kommunistischen Wochenzeitung Der Arbeiter, vergrößerte sich zwar, aber nicht in genügendem Maß; man war auf Sammlungen in linken Organisationen und auf Beiträge von Sympathisierenden angewiesen. Auf Unterstützung von seiten der deutschamerikanischen bürgerlichen Presse war nicht zu rechnen; ihre Redaktionen waren durchsetzt von Nazis, und Anzeigengelder flossen für sie aus Berlin; die sozialdemokratische Neue Volkszeitung weigerte sich zu kooperieren und erblickte im Volksecho nicht den Mitstreiter, sondern nur die Konkurrenz; dazu witterten die amerikanischen Behörden, vor allem J. Edgar Hoovers FBI, hinter jedem fortschrittlichen Wort die Initiative Moskaus – keine leichte Situation für einen jungen Schriftsteller, dessen engste Verwandte sich in den Ghetto-Wohnungen deutscher Städte befanden, der selber noch nicht Bürger der USA und daher von Ausweisung bedroht war und der dennoch es für notwendig hielt, in seinem Wochenblatt auch in die sozialen Auseinandersetzungen in seinem Asylland einzugreifen.
Aus alldem, und aus der ganzen Zeit, in der Hitler von Erfolg zu Erfolg schritt und das politische Gewölk immer dunkler wurde, erklärt sich die häufige Schärfe der Polemik, die uns heute übertrieben scheinen mag – doch ist es eher verwunderlich, daß diese Polemik nicht noch schriller war: Der Gegner, der hinter Weckruf und Beobachter stand, hieß schließlich Joseph Goebbels.
Es war ein einsamer Kampf, den Heym und seine wenigen Mitarbeiter zu führen hatten, und der Niedergang des Volksecho war nicht aufzuhalten. Es war vergeblich, daß der Chefredakteur sich an den Straßenecken von Yorkville, dem von vielen Deutschen bewohnten Teil von Manhattan, auf eine Holzkiste stellte und, bedroht von den Schlägertrupps der Nazis, für sein Blatt warb; vergeblich, daß die letzte Seite der Zeitung umgestellt wurde und nun in englischer Sprache erschien, um breitere Kreise zu interessieren und eventuell von der amerikanischen Presse nachgedruckt zu werden – Volksecho schrumpfte auf zwölf und dann auf acht Seiten zusammen und mußte schließlich ganz eingestellt werden. Die letzte Ausgabe erschien am 10. September 1939 – auf der Frontseite die Überschriften Göring-Rede bestätigt: Das deutsche Volk ist gegen den Nazi-Krieg und Heroischer Kampf des polnischen Volkes.
3. Juni 1966
Wenn mich einer fragte …
Wenn mich einer fragte: In welcher Zeit hättest du gerne gelebt? – würde ich ihm antworten: In unserer. Denn noch nie, glaube ich, gab es eine Zeit mit so raschen, so tief einschneidenden Veränderungen, mit so enormen Widersprüchen, so fürchterlichen Verstrickungen und Verteufelungen des Menschen; nie aber auch eine Zeit, in der der Mensch so sehr über sich hinauswächst und mit solcher Kühnheit eine neue, kaum erahnte Welt schafft: eine Zeit also, wie ein Schriftsteller für seine Zwecke sie sich nicht schöner wünschen könnte, selbst auf die Gefahr hin, daß er in ihre Strudel gerät.
In meinen Romanen und Erzählungen habe ich versucht, einige Aspekte dieser Zeit und ihrer Menschen zu erfassen. Selbst da, wo ich in die Geschichte griff, tat ich es, um dort die Wurzeln unserer Zeit und unserer Konflikte zu finden und vielleicht auch Antworten auf die Fragen von heute.
Durch die Darstellung von Gefühlen und Schicksalen habe ich mich bemüht, den Menschen etwas zu geben, ihnen vielleicht auch ein wenig vorwärtszuhelfen und so zur Veränderung unserer Welt beizutragen. Dabei war mir natürlich klar, daß der Einfluß des Wortes beschränkt ist, daß er sich oft auch nur indirekt auswirkt und daß der einzelne überhaupt nur wirken kann in Wechselbeziehung zur Gruppe, zum Kollektiv, zum Ganzen. Der Rufer in der Wüste wirkt immer leicht komisch; er muß sich schon dorthin bemühen, wo die anderen sind; aber manchmal ist es auch notwendig zu rufen, wenn es scheint, als ob nichts als Wüste um einen herum ist.
Wie weit es mir gelungen ist, mitzuwirken, mitzuhelfen an der Neugestaltung unserer Zeit, läßt sich schwer sagen. Man könnte da Ziffern anführen, in einzelnen Fällen sogar hohe – Titel, Auflagen, Anzahl von Übersetzungen. Aber das besagt noch nicht viel. Eher wäre hier zu erwähnen, daß es kaum ein Buch von mir gibt, das nicht vor oder nach seinem Erscheinen zu Kontroversen Anlaß gegeben hat. Wenn ich all die Epitheta aneinanderreihte, die mir dabei verliehen worden sind – die Skala reicht von Stalin-Agent bis Konterrevolutionär, von ein neuer Thomas Mann bis schwarz-rot-goldener Ganghofer –, so ergäbe sich ein ganz hübscher Waschzettel.
Habent sua fata libelli – die Schicksale meiner Bücher sind auch das meine, im Westen, im Osten, in unserer Zeit.
Für Redaktion Jungbuchhandel,
Düsseldorf
7. September 1931
Exportgeschäft
Wir exportieren!
Wir exportieren!
Wir machen Export in Offizieren!
Wir machen Export!
Wir machen Export!
Das Kriegsspiel ist ein gesunder Sport!
Die Herren exportieren deutsches Wesen
zu den Chinesen!
Zu den Chinesen!
Gasinstrukteure,
Flammengranaten,
auf arme, kleine gelbe Soldaten –
denn davon wird die Welt genesen.
Hoffentlich
lohnt es sich!
China, ein schöner Machtbereich.
Da können sie schnorren und schreien.
Ein neuer Krieg –
sie kommen sogleich,
mit Taktik und Reglement und Plänen,
Generale, Majore!
Als ob sie Hyänen der Leichenfelder seien.
Sie haben uns einen Krieg verloren.
Satt haben sie ihn noch nicht –
wie sie am Frieden der Völker bohren!
Aus Deutschland kommt das Licht!
Patrioten!
Zollfrei Fabrikanten von Toten!
Wir lehren Mord! Wir speien Mord!
Wir haben in Mördern großen Export!
Ja!
Es freut sich das Kind, es freut sich die Frau.
Von Gas werden die Gesichter blau.
Die Instruktionsoffiziere sind da.
Was tun wir denn Böses?
Wir vertreten doch nur die deutsche Kultur.
Berlin am Morgen, 24. Juli 1932
Berliner Hofmusik
Erlebnisse eines musizierenden Erwerbslosentrupps
Ich trieb die drei in der Untergrundbahn auf. Sie saßen da, müde, ihre Gesichter waren sehr grau, und in den Händen hielten sie ihre Instrumente. Arbeitslose sind sie, in den besten Jahren aus den Betrieben gerissen, verheiratet, sie haben einen ganzen Tag in den Hinterhöfen gespielt …
Dann verabredete ich mich mit ihnen, ich wollte sehen, wie sich in ihren Augen die Hinterhöfe spiegeln würden. Ich wollte an der untersten, ausgestoßensten Schicht des gesellschaftlichen Gebäudes prüfen, wie lange es wohl noch festbleiben würde.
Wir trafen uns früh. Der eine trug ein sonderbares Paket unter dem Arme, es war ganz unförmig. »Das ist meine Geige«, sagte er. »Ich muß sie so verpacken. Man hat mich schon zweimal beim Wohlfahrtsamt angezeigt, anonym natürlich. Hausbewohner waren das – wissen Sie, es ist nur so traurig, wenn man denkt, daß das auch Proleten sind. Finden Sie es nicht merkwürdig: Da faselt man in diesem Staat von privatem Unternehmungsgeist, Initiative … und tut einer mal wirklich was, um über die Stufe von 11 Mark wöchentlich emporzukommen – ach was, emporzukommen, um sich satt zu essen! – so verbietet es der Staat. Bei Strafe des Unterstützungsentzuges!«
»Wo fahren wir hin?« – »Wir wollen heute mal in der Gegend Frankfurter Allee spielen. Neulich waren wir in Friedenau. Da haben wir pro Mann für den ganzen Tag sage und schreibe 35 Pfennig verdient. Ich kann Ihnen versichern – der Arbeiter gibt noch den letzten Sechser, aber in den Herrschaftshäusern, da kriegt man nichts.«
Wir gehen in die Nebenstraßen der Frankfurter Allee, gleich ins erste Haus. Wir müssen anfangen, denn die Zeit schreitet rasch vorwärts, und es ist die sonderbare Erscheinung zu beobachten, daß bis zwölf Uhr mittags etwas reichlicher gegeben wird, von zwölf bis fünf Uhr ist dann wieder alles ruhig, gegen Abend belebt sich das Geschäft wieder etwas mehr. Was man so beleben nennt – statt fünf Pfennig bekommt man zehn – pro Hof natürlich, in dem man jedesmal ungefähr zehn Minuten spielt.
Wir wollen in den ersten Hof. Da steht schon einer, spielt Handharmonika und singt aus vollem Herzen und leerem Magen. Das ist dumm. Die Konkurrenz ist groß, und der Mann kann schon die ganze Straße abgeklappert haben, wir müssen warten, bis er fertig ist, und ihn fragen, woher er kommt. Also auch hier gibt es feste Regeln des Geschäftsverkehrs …
Plötzlich sehen wir im Hausflur ein Paket liegen – Stullen. Der älteste der Musiker, eigentlich ist er Mechaniker, 33 Jahre alt und hat Frau und zwei Kinder, schimpft. »Was für eine Gemeinheit! Ja, solche gibt es auch. Wir würden uns freuen, und die schmeißen die Brote weg. Wenn das jemand aus dem Hause sieht – wir haben dann darunter zu leiden.« Endlich kommt der Harmonikaspieler. »Guten Tag!« Jawohl, er gibt bereitwillig Auskunft. »Geht doch in die und die Straße – da war ich vor vierzehn Tagen – da habe ich sogar in einem Haus dreißig Pfennig bekommen!« Ausgewachsene Kapitalisten pflegen ihren Geschäftsfreunden ihre Bezugsquellen nicht zu verraten – der hier ist anscheinend keiner.
Wir spielen ein paar Höfe ab. Auf einem klopft ein Dienstmädchen beharrlich Teppiche. Und leider gegen den Takt. Auf bittende Blicke reagiert sie nicht. Manchmal gibt es Menschen, die ihre winzige Macht so ausnutzen – sie freuen sich, wenn sie jemanden gefunden haben, der noch schwächer ist als sie, auf den sie all das wieder ausbrechen können, was sie selbst an Erniedrigung geschluckt haben.
Das dankbarste Publikum sind ganz entschieden die Kinder. Sie ziehen von einem Hof zum andern mit, heben die spärlich fallenden Geldstücke auf. Neuerdings gibt man oft Vierpfennigstücke. Die fallen so schön laut wie die Groschen. Dann denkt die Nachbarin vielleicht: »O Gott, gibt die Minna Schulze viel! Ja, ein gutes Herz hat sie, das sagt der Emil auch …« Man muß eben auch in solchen Dingen auf Repräsentation halten.
Auf einem der Höfe spricht uns ein halbwüchsiger Junge an. »Geht doch mal nach Treptow – da ist es noch ganz gut.« – »Woher weißt du das? Spielst du etwa auch? Was denn?« – »Ich spiel’ Bandonium, mein kleiner Bruder singt. Ich kann bloß jetzt nicht, ich hab’ mir beim Baden die Haut verbrannt – mein Vater ist arbeitslos, die Mutter krank – wir müssen doch essen!«
»Es ist doch nicht nur das Essen«, sagt einer der drei. »Wir müssen auch Miete zahlen. Wir können uns nicht mal Kleider kaufen. Neulich habe ich wenigstens eine Hose von der Wohlfahrt bekommen. Drei Monate lief der Antrag. Dann kam der Prüfer – ich hatte nur noch Fetzen am Leibe. Und hier, dem Albert« – er zeigte auf den ältesten – »dem wollen sie jetzt auch die Möbel wegholen.«
»Jawohl«, bestätigt der, »das wollen sie. Aber das geht doch gar nicht! Wo ich vierhundert Mark abgezahlt habe! Die beste Zeit des Lebens habe ich im Schützengraben gelegen, in der Inflation haben sie einem die Ersparnisse weggeholt, da dachte ich, wenn du jetzt ein paar Pfennige hast, anlegen! Und jetzt sollen Geld und Möbel weg sein –«
Man sieht sehr vieles auf dem Weg durch die Hinterhöfe, sehr vieles, was sich sonst schamhaft verkriecht. Wir treten durch einen engen Gang in einen Hof – Teufel, wie stinkt es hier! Ein ganzer Abfallhaufen in der einen Ecke des Hofes: alte Matratzen, Blechtöpfe, Speisereste, zerbeulte Eimer, Staub; Insekten schnurren, schöne, dicke, blaue Riesenfliegen. Und daneben ein Säugling in einem wenig salonfähigen Kinderwagen, das Gesicht von Ausschlag bedeckt, – das Kleine hustet. Ein paar Mädchen, sehr blaß, dreizehn Jahre vielleicht, mit keimenden mageren Brüsten, fahren den Wagen zwei, drei Schritte vor und zurück – jetzt heben sie das Kind heraus, rachitische Beine hat es. Und in diese Trauerwelt hinein die melancholischen Töne der beiden Geigen und der Laute. Die verkitschten Lieder klingen falsch, und doch passen sie so zu dem Abfallhaufen, als fände sich aller menschliche Abfall hier zusammen.
Die drei Musikanten sind empört. »Da wundert man sich, wenn die Proletenkinder krank sind!« Sie denken an ihre eigenen.
Es wird langsam Mittag. Der Geruch des Essens dringt aus allen Küchen. Ich will nicht sagen, daß einen unbedingt Neidgefühle erfassen, wenn man unten steht und zum soundsovielten Male dasselbe spielt, und wenn der Dunst von Fleisch sich aufreizend in die Ecken des Hofes schlägt – den Leuten hier im Osten geht es auch nicht allzu üppig – aber man kommt sich doch sehr bemitleidenswert vor. Außerdem beginnt die schlechte Zeit. Es kommen Höfe, in denen man spielt, und wieder spielt, und verzweifelt nach oben sieht; doch aus keinem Fenster neigt sich ein Kopf, geschweige denn, daß eine Münze herabgeworfen würde. – Aus einem Parterrefenster schaut plötzlich eine dicke Köchin, winkt mich heran, gibt mir einen Groschen: »Sagen Sie Ihren Kollegen, sie brauchen nicht weiterzuspielen, in diesem Hause gibt doch keiner was.« Die Gegend ist feiner geworden.
Wir setzen uns auf eine Bank im Park, auf eine mit Rückenlehne. Denn wir können uns kaum auf den Beinen halten – stehen und spielen, gehen, wieder gehen und spielen – wir sind todmüde.
Und essen unser Brot. Irgendwo an einer Pumpe gibt es Wasser.
Die Einnahme betrug bisher 43 Pfennige für jeden. Außer dem Fahrgeld, das zu den Spesen gerechnet wird. Dieser Abschluß muß als günstig gewertet werden.
Und wieder an die Arbeit, noch einmal fünf Stunden dieselben drei Lieder spielen, in jedem Hofe – alle drei Erwerbslosen sind verheiratet, zwei haben Kinder, und auch der dritte wird bald eines bekommen. Man wartet zu Hause auf ihre Groschen.
Millionenschicksale. Die drei kämpfen ums nackte Leben. Sie werden auch für eine neue Welt kämpfen. Nur Geduld! Vorläufig geigt man harmlose Melodien, aber mitunter verbirgt sich hinter den harmlosen Klängen eine dumpfe Drohung.
1935
Ich aber ging über die Grenze …
Ich aber ging über die Grenze.
Über die Berge, da noch der Schnee lag,
auf den die Sonne brannte durch die dünne Luft.
Und der Schnee drang ein in meine Schuhe.
Nichts nahm ich mit mir als meinen Haß.
Den pflege ich nun.
Täglich begieße ich ihn
mit kleinen Zeitungsnotizen
von kleinen Morden,
nebensächlichen Mißhandlungen
und harmlosen Quälereien.
So bin ich nun einmal.
Und ich vergesse nicht.
Und ich komme wieder
über die Berge, ob Schnee liegt
oder das Grün des Frühlings die Höhen bedeckt,
oder das Gelb des Sommers, oder das dunkle Grau
des Herbstes, der den Winter erwartet.
Dann steh’ ich im Lande, das sich befreien will,
mit einer Stirn, die zu Eis geworden
in den Jahren, da ich wartete.
Dann sind meine Augen hart, meine Stirn zerfurcht,
aber mein Wort ist noch da, die Kraft meiner Sprache
und meine Hand, die des Revolvers
eiserne Mündung zu führen versteht.
Über die Straßen geh’ ich der Heimatstadt,
über die Felder, die mir verloren gingen,
auf und ab, auf und ab.
Aus »Verse der Emigration«
September 1933
Der Selbstmörderklub
Als wir siebzehn Jahre alt waren, litten wir weitgehend an Seelenschmerz. Wir fragten nach dem Sinn des Lebens, und als wir keine Antwort fanden – andere, Ältere, fanden sie ja auch nicht – begannen wir, sämtliche Stadien der Verzweiflung, anfangend mit dem Besuch dunkler Kneipen und endend mit rasenden Kopfschmerzen, durchzumachen.
Damals lernten wir den wasserklaren Wodka schätzen und unsere Lehrer, denen wir vormittags zuzuhören leider gezwungen waren, aus dem tiefsten Grund unseres Herzens zu verachten. Da saßen sie auf dem Podium, eingenommen von ihrer Weisheit und Würde, brabbelten Vokabeln in ihre vorhandenen oder nicht vorhandenen Bärte und ahnten nichts von der Tragik des Geschehens, von der gähnenden Leere des Weltalls und von der Lächerlichkeit aller strebenden Bemühungen. Wir hatten das dumpfe Gefühl, daß wir wahrscheinlich ebensolche Spießer werden würden wie sie, und wir ekelten uns auf Vorschuß.
Wir bemühten uns um die Kellnerin der »Blauen Blume«, die in verborgenen Fabriksgassen heimlich blühte. Das Mädchen besaß einen erheblichen Busen und auch sonst einige Reize, wir waren von idealer Liebe besessen und strengten uns an, ihr gelegentlich des herangetragenen Fusels beizubringen, daß sie ein Opfer der sozialen Verhältnisse und ein Mensch mit Menschenrechten und freier Seele sei – worauf sie uns mit ihren hellblauen Karpfenaugen anstarrte und uns (gegen die Interessen des Wirts nebenbei, man ermesse daraus den Altruismus dieser Person!) aufforderte, nach Hause zu gehen und unsere Rechenaufgaben zu machen.
Wir zogen daraus die Konsequenz, daß in dieser Zeit mit Weltverbesserung nicht viel zu machen sei. Wir dachten höchst ernsthaft daran, katholisch zu werden und in ein Kloster zu gehen, aber bei der Lektüre Boccaccios erschien uns auch diese letzte Insel der Seelenläuterung als ein Eiland voll verborgener Schlangen, und wir ergaben uns endgültig der Lebensverneinung.
Wir gründeten den Selbstmörderklub. In den Statuten wurde unter § 3 festgelegt, daß die Mitglieder nach einer bestimmten, möglichst toll verbrachten Zeit durch Selbstmord aus dem Leben zu scheiden hätten. Wir grübelten während der Lateinstunden über unserem Testament und traten dem Lehrerkollegium gegenüber in passive Resistenz. Wir versetzten unsere Schülermützen, bemalten die Ränder der Schulbücher mit lasziven Zeichnungen und kultivierten die Ringe unter unsern Augen. Einige von uns schrieben auch Gedichte, teils mit, teils ohne Reime.
Durch das Los wurde Paulchen Preyer bestimmt, der als erster zu sterben hatte. Die Todesart war ihm freigestellt. Es war ein regnerischer Nachmittag, die Welt triefte von Melancholie, wir schlichen umher, finster entschlossen und doch im Innersten bang. Die Stimmen, die uns leise zuflüsterten, daß das Leben doch ganz schön sei und mancherlei Amüsantes zu bieten habe, erstickten wir mit Gewalt.
Meine platonischen Neigungen gehörten damals einer Tänzerin der städtischen Oper, ich ging zu ihr, und wir tranken Tee. Diese Frau, die ein grundgütiger Kerl war und sehr schöne Hände hatte, war zuerst erstaunt und dann ängstlich über mein schweigendes Hin- und Hergehen. Schließlich nahm sie meine Hand und fragte mich geradeheraus, was eigentlich mit mir los wäre. Aber ich blieb stumm, denn das stand auch in den Statuten.
Um halb sechs sagte ich: »So, jetzt wird er wohl tot sein.« Und ich begann, schrecklich und lange und laut zu lachen. Die Tänzerin sah mich fragend an. »Wissen Sie«, bemerkte ich düster, »Sie könnten mir eigentlich mal erlauben, daß ich Sie küsse. Lange wird dazu nicht mehr Gelegenheit sein.«
»Sie sind verrückt«, erwiderte sie sehr richtig – denn es gibt Zeiten im Leben junger Menschen, in denen sie wirklich nicht weit von diesem Zustand entfernt sind. »Kommen Sie mal her, Kleiner«, sagte sie dann, und in ihrer Stimme war sehr viel Mütterliches, »was für eine Dummheit ist da wieder im Gang? Bilden Sie sich doch nicht ein, daß Sie nur hergekommen sind, um Tee zu trinken. Sie haben einfach jemanden gebraucht, dem Sie Ihr Herz ausschütten könnten.«
Ich starrte vor mich hin. Fast körperlich schmerzhaft bohrte sich das Muster der Tapete in mein Gehirn. Und dann sprach ich. Wirr und durcheinander, aber es kam alles heraus. Alle die Fragen, die ein junger Mensch an das Leben zu stellen hat, die ihm niemals beantwortet werden und die er nur überwindet, indem er sie vergißt. Und allein durch das Sprechen wurde mir leichter. »Ja«, sagte ich, »so standen wir da, in dieser dummen Ödnis unsrer Tage, und da war kein Mensch, der einem helfen konnte. Sehen Sie, wir möchten ja lieben, aber man hat die Ahnung, daß man noch nicht reif genug dazu ist. Man möchte große Dinge tun und weiß nicht, wie, man ist an allen Ecken und Enden gehemmt. Möglich, ja, wahrscheinlich, daß das viele gar nicht berührt, daß das die Krankheit junger Menschen einer bestimmten Klasse ist, die Zeit haben – viel Zeit und keine anderen Sorgen. Aber was soll ich machen? Ich stehe nun einmal vor meinen Problemen und komme nicht weiter damit. Also blieb die Flucht in den Selbstmord. Bitte, lachen Sie nicht. Es ist traurig genug.«
Aber sie lachte gar nicht.
Sie stand auf und streichelte mir übers Haar. Dann holte sie ihren Mantel, und wir gingen zu Paulchen Preyer. Wir fanden seine Mutter völlig aufgelöst in Tränen und Paulchen Preyer selig schlafend im Bett. Paulchen hatte auf dem Hausboden versucht, sich zu erhängen. Er hatte ein Seil genommen, es um einen Dachbalken geschlungen. Dann hatte er aus einer Ecke voller Spinnweben einen alten, dreibeinigen Stuhl herangeschleppt, war hinaufgestiegen – und gerade, als er seinen Kopf in die Schlinge stecken wollte, war der Stuhl unter ihm zusammengebrochen. Paulchen verknackste sich das Bein. Vor Wut über die Schande des verunglückten Selbstmordes und vor Schmerz hatte er sich in den Schlaf geheult.
Heute kann man lächeln. Aber mitunter hat man Minuten, wo man in derselben Stimmung ist wie damals. Aber ohne einen Klub und ohne Statuten macht es keinen Spaß, sich zu erhängen. Und dann – wir überschätzten damals wohl den Effekt des Selbstmordes. Was ist schon ein Mensch, der freiwillig abgeht von der Bühne, auf der wir unsere komischen Bewegungen machen? Wir sind ja alle Statisten und Hungerleider. Und für den Verschwundenen steht schon der Ersatz, in langen Reihen angestellt, vor den Arbeitsämtern dieser Welt …
20. September 1935
Huey Long
Ein junger Arzt aus New Orleans, ein schmächtiger Intellektueller mit gutem Gesicht, mit europäischer Bildung – er hatte in Wien studiert – hat den Diktator von Louisiana erschossen. Die Leibwächter Longs schlugen den Attentäter nieder, und als er ohnmächtig am Boden lag, jagten sie ihm aus ihren Maschinenpistolen einige sechzig Schuß in den Leib. Um das politische Erbe Longs streiten sich die Diadochen; wie das Reich Alexanders des Großen wird die allmächtige Parteimaschine Longs zerfallen, denn sie ruhte ganz und ausschließlich auf den Schultern des Diktators.
Als ich noch in Europa war, hatte ich schon verschiedene Artikel polemischer oder informativer Art über Long gelesen – sie alle berichteten nicht über das Wesentliche: über die politische Maschine. Man sagte, er sei ein Faschist. Gewiß, Long bediente sich bei der Propaganda durchaus faschistischer Methoden: Sein »Share-the-wealth«-Programm (Teile den Reichtum) hatte faschistische Züge, sein Terror-Regime in Louisiana konnte faschistisch genannt werden. Es ist auch wahrscheinlich, daß die Wallstreet-Kreise seine demagogischen Fähigkeiten benutzen wollten und benutzten, um die gärende Unzufriedenheit in Amerika zu neutralisieren. Möglich, daß Wallstreet den mopsgesichtigen Diktator als nächsten Präsidenten ausersehen hatte. Und trotzdem wäre der Longsche Faschismus ganz anders gewesen als der europäische und hätte keineswegs einen vollkommenen Umschwung von der jetzigen amerikanischen Regierungsform bedeutet. Die amerikanische Demokratie ist keineswegs eine »Herrschaft des Volkes«, sondern eine Herrschaft der politischen Maschine. Zwei politische Banden konkurrieren in den Wahlen, und die siegreiche besetzt vom Gouverneursposten abwärts alle politischen Futterkrippen. Im Falle Long war allerdings der prinzipielle Unterschied und das Neue, daß die Maschine, die Louisiana beherrschte, weder demokratisch noch republikanisch, sondern Longs eigene Schöpfung, Longs höchstpersönliche Maschine war: die Ein-Mann-Maschine. Auf der Konferenz der demokratischen Partei in Chicago, als man Roosevelt als demokratischen Präsidentschaftskandidaten aufstellte, wurde Huey Long über die Situation der demokratischen Partei in Louisiana befragt. Huey antwortete: »Die demokratische Partei in Louisiana? – Das bin ich.« Louisiana ist ein demokratischer Staat durch Tradition. So war auch Long auf der Liste der demokratischen Partei. Aber in Louisiana war es die Long-Partei, und nichts anderes.
Die Karriere des Mannes ist außerordentlich. 1924, gerade 30 Jahre alt – das gesetzliche Alter, um als Gouverneur kandidieren zu können – kandidierte er. Er hatte nie eine Hochschule zu Ende besucht. Den Doktortitel bekam er dann als Gouverneur »ehrenhalber« von den Universitäten Louisianas, die von seiner Gnade abhängig waren. Er hatte Backpulver verkauft. Er hatte auch alles mögliche andere versucht. Dann ließ er sich in Shreveport, Louisiana, als eine Art Winkeladvokat für arme Leute nieder. Das war kein schlechtes Geschäft. Er sprach die Sprache des einfachen Volkes, er war ein guter Schauspieler. So wurde er populär und ließ sich in eines der vielen kleinen Ämtchen hineinwählen, die es in der »Maschine« gibt. Er kam in die Public Service Commission, katzbalgte sich um Straßen und Abführkanäle und um das allgemeine Wohl.
Huey Long war im Grunde ein »kleiner Mann«. Sohn eines winzigen Farmers in Winnfield, Louisiana. Er hatte die Wunde des kleinen Mannes. Noch sehr jung, hatte er ein paar tausend Dollar in ein Unternehmen der Standard Oil investiert. Wie so viele andere Kleine hatte man ihn betrogen. Er verlor seine Ersparnisse. Das vergaß er nicht. Wenn er etwas haßte, dann war es die Standard Oil.
Die Standard Oil aber ist der wirkliche Diktator von Louisiana. Huey Long führte seine erste Kampagne für den Gouverneursposten gegen die Standard Oil, gegen die großen »Companies« überhaupt, er agitierte für den Bau von Zementstraßen – gute Straßen sind für den Farmer im Süden lebenswichtig – für freies Jagd- und Fischrecht, denn in Louisiana gibt es noch die Trapper, die auf Pelzjagd gehen, und im Mississippi gibt es Millionen Fische, für freie Volksschultextbücher, für Steuerermäßigung …
Die Standard Oil ließ ihn schimpfen und agitieren. Sie kannte die Gewohnheiten der Gouverneurskandidaten. Mit Speck fängt man Mäuse und Wähler. Auch sagte Huey nicht, wie er sein soziales Programm erfüllen wolle. Aber sein Programm gefiel den Hinterwäldlern Louisianas außerordentlich. Die sogenannte »Old Regular«-Maschine, die New Orleans beherrschte, lehnte Long ab. Auf New Orleans konnte er also nicht rechnen. Aber die Trapper und Fischer, die kleinen Farmer waren für Long, und sie waren in der Mehrheit. Alles hing vom Wetter ab. Wie bitte? – Ja, vom Wetter. Wenn es am Wahltag regnete, waren die Straßen überschwemmt und sumpfig, Longs Wähler konnten in ihren alten Fords nicht zur Wahlurne fahren. Die Nacht zum Wahltag war sternenklar. Aber am Morgen goß es in Strömen. Long fiel durch.
Er trug es leicht. »Es hat eben geregnet«, sagte er. Außerdem war er jung, dreißig Jahre alt. Er konnte vier Jahre warten. Er wartete. Er benutzte seine Stellung in der Public Service Commission, um sein Programm noch populärer zu machen. – Und vier Jahre später, 1928, regnete es nicht. Long war Gouverneur. – Er verließ sich übrigens nicht nur aufs Wetter. In manchen Gemeinden wurden mehr Stimmen für ihn abgegeben, als Wähler existierten. Das erinnert ungemein an Hitler. Er sicherte sich die Unterstützung des mächtigen Ku-Klux-Klan dadurch, daß er sich als Mitglied dieser Lynch-Organisation ausgab. Später stellte sich heraus, daß seine Mitgliedskarte gefälscht war. Aber da war er schon Gouverneur.
Doch er war Gouverneur ohne Maschine, er war Gouverneur der demokratischen Partei. Er ging daran, die alten demokratischen Politiker aus ihren Pöstchen herauszuschmeißen und seine Leute hineinzusetzen. Er vergab die Posten nur bedingt. Wer an die Futterkrippe heranwollte, mußte ihm vorher ein noch nicht datiertes Rücktrittsschreiben aushändigen. Damit hatte er seine Leute in der Hand. Und es kam mehr als einmal vor, daß ein in Ungnade Gefallener plötzlich früh in der Zeitung las, daß er zurückgetreten war.
Der Gouverneur mußte sein Programm erfüllen. Er war ja gar nicht so sehr gegen die großen Kompanien. Mit einer Ölkompanie in Texas hatte er sogar ganz beträchtliche Schiebungen gemacht, indem er Territorium, das dem Staate Louisiana gehörte, an diese Gesellschaft verschacherte. Das Anderthalb-Millionen-Objekt brachte ihm genau 214000 Dollar und eine Achtelbeteiligung am Profit. An die Missouri-Pacific-Eisenbahn gab er das Monopol für eine Brücke über den Mississippi, die er bauen würde. Und das sind nur die bekanntesten Schiebungen.
Natürlich dachte er nicht daran, die freien Schulbücher, die er versprochen hatte, etwa von den 214000 Dollar zu bezahlen. Er mußte eine neue Steuer haben. Aber er hatte doch Steuerermäßigung versprochen? So beschloß er, eine Steuer auf Ölbohrung zu schaffen, die natürlich nur die Standard Oil of Louisiana betreffen konnte. Das war seine Rache. Er sagte es ganz offen.
In den acht Monaten, die er jetzt schon Gouverneur war, hatte er seine persönliche Maschine gebaut. Er fühlte sich sicher. Natürlich schafft man so eine Maschine nicht aus dem Nichts heraus. Soundso viel Unkorrektheiten mußten begangen werden, damit seine Macht begründet wurde. – Die Standard Oil nahm den Kampf auf.
Plötzlich waren überall Widerstände. Die vielen Gegner Longs richteten sich auf. Das House of Representatives und der Senat von Louisiana begannen, ihrem Gouverneur auf die Finger zu sehen. Freunde fielen von ihm ab. Der Vize-Gouverneur, den Long »an seinen Rockschößen« ins Amt gebracht hatte, war gegen ihn. Das Unerhörte geschah: Eine Untersuchung der Amtshandlungen des Gouverneurs wurde im Parlament von Louisiana vorgenommen, mit dem Zweck, ihn anzuklagen und aus dem Amt zu jagen. Ein paar von den 19 Anklagen, die gegen ihn erhoben wurden, sollen hier angeführt werden. Sie mögen zur Charakterisierung des Mannes dienen, der bis zu seiner Ermordung der erklärte Liebling und Heros der amerikanischen Reaktionäre war.
1. Er habe seine Macht benutzt, um Gerichte zu beeinflussen.
2. Er sei schuldig des Mißbrauchs, unberechtigter Anlage und Aneignung von Staatsgeldern.
3. Er habe Abgeordnete bestochen und zu bestechen versucht.
5. Er habe unberechtigt Anleihen für den Staat aufgenommen.
6. Er habe Schulbeamte aus politischen Gründen entlassen.
7. Er habe ungesetzlich die Miliz benutzt, um Zivilbehörden zu unterwerfen.
10. Er sei schuldig, sich ungehörlich an öffentlichen Ereignissen auf geführt zu haben – »am 12. Februar 1929 nahm er in New Orleans an einer Unterhaltung teil, wo alkoholische Getränke serviert wurden (damals war noch Prohibition, d. A.) und bei welcher Gelegenheit besagter Huey Long sich in skandalöser und unanständiger Weise benahm«.
14. Er habe versucht, die Presse zu beeinflussen, indem er Herrn Manship, dem Herausgeber der Baton Rouge States-Times, drohte, bekanntzugeben, daß sein Bruder im Irrenhaus sei.
19. Daß er sich schuldig gemacht habe der Anstiftung zum Mord, indem er versucht habe, Battling Bozeman zur Ermordung von J. Y. Sanders jr. anzuheuern.
Ich habe die verschiedenen anderen Verstöße nicht erwähnt, da sie nur für den wichtig sind, der den Mechanismus der amerikanischen Verfassung kennt. Immerhin, für einen Gouverneur ein beträchtliches Sündenregister. Huey Long kämpfte verzweifelt und mit allen Mitteln – erst, als ihm die Sache wirklich an den Kragen ging, als ein Senatsausschuß bestimmt wurde, um ihn abzuurteilen, einigte er sich mit der Standard Oil.
Seit jener Zeit ist er, mit höherer Genehmigung, Diktator von Louisiana. Als seine vier Jahre als Gouverneur abliefen, ließ er einen seiner Anhänger zum Gouverneur von Louisiana wählen und nahm seinen Sitz im Senat von Washington ein, in den er sich inzwischen hatte hineinwählen lassen. Trotzdem blieb er der Herr von Louisiana. Sitzungen der gesetzgebenden Körperschaft von Louisiana verliefen ungefähr so, daß Long mit den Herren zusammenkam, sagte: »Ich habe hier 25 Gesetze, dies und dies Gesetz ist gut« – und dies Gesetz wurde dann angenommen.
Huey Long hatte seine kleinen Eigentümlichkeiten, die immer wieder dazu dienten, seinen Namen in die Presse zu bringen. Zum Beispiel empfing er den Kapitän des deutschen Kreuzers Emden, der in New Orleans dem Gouverneur einen Besuch abstatten wollte, in grünem Seidenpyjama. Man stelle sich die peinliche Überraschung des etwas formellen deutschen Offiziers vor. Huey Longs Parlamentsreden zeichneten sich durch eine ungeahnte Menge energischer und origineller Flüche aus, die, so schön sie auch sind, schwer zu übersetzen sind.
Sein »Share the wealth«-Programm war dumm und demagogisch. Jedermann, verkündete er, solle ein Einkommen von 5000 Dollar jährlich als Minimum bekommen. Keine Vermögen über eine Million Dollar sollten mehr existieren. Das ist schön und lieblich für die Ohren der Leute, die nicht zu fragen gewohnt sind: auf welche Weise? Long hatte ausgezeichnete Verbindungen zu Wallstreet, und was er predigte, trug den Stempel »Genehmigt«, ausgestellt in Wallstreet.
Aber hatten nicht Hitler und Mussolini mit ähnlichen Versprechungen ihren Weg gemacht? Es war nicht einzusehen, warum in Amerika nicht möglich und nützlich sein sollte, was in Europa so angenehm und profitabel funktionierte.
Da kam die Kugel des Dr. Weiß. Weiß war der Schwiegersohn eines Beamten, den Long um seine Stellung gebracht hatte. In der Presse gehen Gerüchte um, daß eine ganze Verschwörung einzelner politischer Gegner Longs bestanden habe; der unglückselige Dr. Weiß habe das Los gezogen und sich opfern müssen. Das klingt sehr wahrscheinlich. Die Zahl der Existenzen, die Long vernichtet hat, geht in die Tausende.
Und Louisiana ist einer der Staaten, wo die Tradition des Ku-Klux-Klan, der geheimen Sekten usw., sehr lebendig ist.
Im Augenblick raufen sich die Diadochen. Die ultra-nationalistischen Hearst-Blätter veröffentlichen ein Buch von Huey Long: »Ich, der Präsident« – eine Sammlung konzentrierten Unsinns. Wahrscheinlich ist das Buch eine geschickte journalistische Fälschung. Und ein Beweis dafür, daß, mag auch Long tot sein, der Geist fortlebt, aus dem sich solche Kreaturen entwickeln. Die Krise geht weiter, die Massen sind weiter unruhig, Streiks sind alltäglich. Demagogen und Führer werden gebraucht – und die Kugel des Dr. Weiß ist keine Lösung des Problems.
Februar 1936
Die deutsche Volksfront in Chicago
In Chicago leben 400 000 Deutsche. Sie sind meist Arbeiter, kleine Angestellte, leben sehr still und ruhig. Um Politik haben sie sich bisher verhältnismäßig wenig gekümmert. Während andere nationale Gruppen in Chicago – Tschechen, Iren – großen politischen Einfluß auf die Stadtverwaltung haben (der ermordete Bürgermeister von Chicago, Cermak, war ein Tscheche), sind die Deutschen trotz ihrer zahlenmäßigen Stärke ohne politischen Einfluß.
Die Machtergreifung Hitlers hat die Deutschen im Ausland, besonders die Deutschen in Amerika, gründlich politisiert. Mit viel Geld und mit Gangstermethoden haben die Nazis versucht, überall im Ausland ihre Organisationen aufzubauen; in Amerika heißt die deutsch-faschistische Organisation »Freunde des Neuen Deutschland«. Die Nazis arbeiten in Amerika Hand in Hand mit den amerikanischen faschistischen Gruppen, zum Beispiel mit den »Silvershirts«, den Silberhemden eines Herrn Pelley, der jetzt wegen Betrugs im Gefängnis sitzt.
Die antifaschistische Abwehr ließ nicht lange auf sich warten. Zögernd zunächst, und bedrückt von dem großen Schwung, mit dem die Nazis ihren Erfolg in Deutschland ausnutzten, begannen sich die Gegner des Faschismus zu sammeln. Zum Erfolg wurde die Abwehrbewegung aber erst, als die Einheitsfrontpolitik sich zu entwickeln begann. Die Deutschen in Amerika haben eigentlich nie verstanden, warum die Arbeiter nicht gemeinsam ihren Feind bekämpfen sollten. Sie haben ja nie das erniedrigende Erlebnis gehabt, daß Sozialisten im Staatsapparat auf sozialistische und kommunistische Arbeiter schießen ließen – in den USA haben Sozialdemokraten niemals in großem Maße Gelegenheit gehabt, irgendeine staatliche Machtposition zu erobern.
So ging es wie ein Aufatmen durch die amerikanische deutschsprechende Arbeiterschaft, als die ersten Aufrufe zur Einheitsfront kamen. Jetzt sind wir soweit, daß wir zum Gegenangriff Vorgehen. Die Reihen der »Freunde des Neuen Deutschland« sind gespalten. Die diversen »Führer« liegen sich gegenseitig in den Haaren. Ich will hier über die deutsche Einheitsfront in Chicago berichten, die unter den schwierigsten äußeren Umständen, ohne Geld, ohne große organisatorische Vorbereitung verwirklicht wurde.
Chicago ist eine Stadt mit revolutionärer Tradition. In Chicago war schon um 1880 die Haymarket-Revolte gewesen, wo die Polizei viele Arbeiter getötet und verwundet hatte. In Chicago ist die riesige Fleischindustrie, Eisenindustrie, im Süden der Stadt sind ungeheure Petroleumraffinerien. Chicago war ein Zentrum der »Wobblies«, der IWW-Leute (IWW – International Workers of the World, internationale Arbeiter der Welt, eine Art syndikalistischer Bewegung, aus deren Reihen die besten Kämpfer der kommunistischen Bewegung in Amerika hervorgingen).
Die deutschen Arbeiter waren aber meist nicht in den Massenindustrien beschäftigt, sie waren Spezialarbeiter, und ihre Organisationen sind die kleineren »Locals« der amerikanischen Gewerkschaft, der AFofL, der American Federation of Labor. Die deutschen Arbeiter hatten sich ganz nach deutschem Vorbild in ihren Gesangvereinen, ihren Turnvereinen, in den »Naturfreunden« organisiert. Die eigentliche Mitgliedschaft sowohl der sozialistischen wie der kommunistischen Parteien war nie besonders stark. Aus all diesen Organisationen wurde die Einheitsfront gebildet.
Die Nazis hatten es leicht. Sie wollten ja keine soziale Änderung, so durften sie sich ruhig unter dem Schutz der Polizei und unter der Protektion des deutschen Konsuls entfalten. Der letzte »Deutsche Tag« in Chicago fand unter dem Hakenkreuz statt, und die Kämpfer der Einheitsfront, die dort Flugblätter verteilten, wurden von der Polizei verhaftet.
Der Durchschnittsamerikaner denkt, daß jeder Deutsche ein Nazi ist. Zuerst mußte mit diesem Märchen aufgeräumt werden. Eine große Demonstration wurde veranstaltet, für Amerika typisch, in großen Autos, und unser Hauptschlagwort mußte sein: Nicht jeder Deutsche ist ein Nazi!
Das war am Anfang der Volksfront. Heute sind wir weiter. Die Nazis sind schwer beunruhigt durch unsere Aktivität. Wir haben eine eigene Zeitung, die monatlich erscheint, unsere »Volksfront«, und wir werden regelmäßig von dem nationalsozialistischen »Weckruf«, der sich mit Nazigeld zu einem verlustbringenden Wochenblatt entwickelt hat, beschimpft.
Wir haben sogar ein eigenes Theater, das erste deutsche Arbeitertheater in Amerika, die »Volksbühne«.
Vor kurzem trat die Volksbühne zum ersten Mal auf, mit der Uraufführung des antifaschistischen Stückes »Hinrichtung«.
»Hinrichtung« spielt in Deutschland. Es ist die Dramatisierung des Schicksals eines unserer edelsten Kämpfer, Fiete Schulze aus Hamburg. Das Stück zeigt seine Verhaftung, das Verhör in der Gestapo, zeigt ihn vor Gericht, wo er seine große, unvergeßliche Rede hielt: »Ich habe mich nicht vor diesem Gericht zu verantworten. Ich trage Verantwortung für das, was ich tat, vor meiner Partei, vor dem Proletariat, dem wirklichen Volk.«
Und als er wegen Hochverrats zum Tode verurteilt wird und seinen letzten Wunsch äußert, sagt er: »Ich wünsche, daß alle hier im Saal zu meiner Hinrichtung kommen, damit sie sehen, wie ein Kommunist zu sterben versteht.«
»Die haben tausend Dimitroffs«, muß der Kriminalkommissar Horst, eine der Nazifiguren des Stückes, nachdenklich zugestehen.
Die Schwierigkeiten, die zu überwinden waren, sind ungeheuer. Chicago ist mitten auf dem Kontinent Amerika, weit weg von New York, wo eine deutsche antifaschistische Kulturbewegung schon weiter entwickelt ist. Wir sind abgeschnitten von der deutschen Kultur. Trotzdem bestand die Aufgabe, gute deutsche antifaschistische Kunst zu schaffen, denn nur mit guter Kunst können wir werbend unter die Massen gehen. Wir hatten keine Bühne. Wir hatten keine Schauspieler. Aus Arbeitern, die nie auf der Bühne gestanden hatten, mußten in mühseliger Arbeit Schauspieler gemacht werden, die imstande waren, das verhältnismäßig schwierige Stück zu bewältigen. Aus ein paar Stühlen und Tischen, einer Hakenkreuzfahne und einem Gefängnisgitter mußte die Kulisse der deutschen Wirklichkeit aufgebaut werden.
Es ist uns gelungen. Trotz 32 Grad Kälte hatten wir ein vollgepacktes Haus – 500 Menschen im Zuschauerraum, die größte Zahl von Menschen, die je in Amerika zu einer deutschen Kulturveranstaltung kam. Der Kontakt zum Publikum war so vollkommen, daß die Zuschauer die Bühne plötzlich als Wirklichkeit sahen und die Nazis auf der Bühne, die Folterknechte und Ministerialräte, die im Stück vorkamen, niederzubrüllen begannen.
Man muß wissen, was die Aufführung eines Stückes, das die deutsche Wirklichkeit von heute zeigt, in Amerika bedeutet. Dadurch, daß es jedem bekannt ist, wie korrupt die amerikanische Presse ist, glauben die politisch nicht geschulten Leute in Amerika auch nicht die wahren Berichte, die diese Presse manchmal über Deutschland bringt. Dies dokumentarische Stück hat also in Amerika auch noch aufklärende Funktion – und es erfüllte diese Funktionen vollkommen. Eine Arbeiterfrau kam am nächsten Tag zu mir. »Wissen Sie«, sagte sie, »ich habe die ganze Nacht nicht schlafen können. Das ist unser Deutschland, unser Deutschland. …«
Die Volksfront in Chicago und ihre »Volksbühne« sind heute einer der wichtigsten Faktoren im deutsch-amerikanischen Leben der Stadt. Wir werden weiter arbeiten, aufklären und werben, und auf diese Weise unsern kleinen Teil zum großen antifaschistischen Befreiungswerk beitragen.
9. Mai 1936
Amerika sieht in die Zukunft
Man kann wohl ohne Übertreibung sagen, daß die Amerikaner die friedlichste Nation der Welt sind – wenigstens was den Mann auf der Straße betrifft. Sie sind durch je einen Ozean von den kriegerischen Gefahrenzentren dieser Erde getrennt, und der Grünkramhändler und Eiskremverkäufer hier sieht absolut keinen Grund, warum er sich an den Konflikten in dem winzigen Erdzipfel Europa oder in irgendwelchen uninteressanten und öden asiatischen Gegenden beteiligen soll.
Der amerikanische Durchschnittsbürger ärgert sich noch jetzt ein wenig über die Dummheit, daß man sich am Weltkrieg beteiligt hat. Da haben wir unsere »Boys« hinübergeschickt und unsere guten Dollars und unsere ausgezeichneten Cornedbeef-Konserven – und nun zahlen diese lumpigen Europäer nicht mal ihre Schulden. Unfair, nicht?
Immerhin, der Durchschnittsamerikaner hat ein gesundes Mißtrauen seiner Regierung und den Wallstreetfinanzgrößen gegenüber. Irgendwie, denkt er, werden sie uns schon in einen neuen Krieg hineinmanövrieren. Er ist im Grunde ein passives fatalistisches Wesen. Sein Lieblingswort ist: So what! – was ungefähr unserem achselzuckenden: Wichtigkeit! entspricht. Und da, wie sie denken, ein zukünftiger Weltkrieg mit Beteiligung Amerikas unvermeidlich ist und da sie sehen, wie ihre Regierung sich darauf vorbereitet (in diesen Tagen hat man das Flottenbudget um über 500 Millionen Dollar erweitert!), so haben sich ein paar findige amerikanische Studenten zusammengetan, um sich und die ganze amerikanische Jugend würdig auf die neue Schlächterei vorzubereiten.
Sie haben sich zusammengetan und eine große Organisation aufgezogen: die »Veterans of the Future War« – die Veteranen des zukünftigen Krieges. Die Jungens sagen sich mit Recht: Wir werden die Soldaten von morgen sein, wir werden die Dummheiten ausfressen müssen, die die diversen Regierungen machen, wir werden in den Schützengräben verfaulen und das Gas zu schlucken bekommen – so wollen wir wenigstens die angenehmen Seiten des Krieges, nämlich unsere Pension, schon jetzt genießen. Denn jeder Kriegsveteran bekommt in Amerika einen Bonus, eine gewisse Summe Geldes für seine geleisteten Dienste und als Dank des Vaterlandes sozusagen. Dieser Bonus war für die Weltkriegsveteranen ungefähr 1943 fällig – da die Veteranen aber großenteils schwer unter der Krise litten, so taten sie sich zusammen, machten den berühmten Bonusmarsch nach Washington und bekamen tatsächlich nach und nach ihren Bonus schon jetzt ausgezahlt.
Die »Veterans of the Future War« begannen in Yale, einer der ältesten und vornehmsten amerikanischen Universitäten. Zuerst hörte es sich fast wie ein unmöglicher Scherz an; aber dann wurde die unheimliche Logik der Sache klar: Man hatte mehr als nur einen Schimmer Recht, den Dank des Vaterlandes als Abschlagszahlung im voraus zu verlangen – warum sollte man denn das schöne Geld nicht genießen, solange man noch jung und gesund war und alle Glieder hatte? Was nützte einem der schönste Bonus, wenn man auf dem Felde der Ehre gefallen war …?
Und wie ein Sturmwind verbreitete sich die Bewegung von Yale aus zu allen größeren Universitäten und Colleges des Landes, überall taten sich Ortsgruppen der »Veteranen« auf, große Versammlungen wurden abgehalten, Resolutionen an den Kongreß geschickt, ein Abgeordneter aus Texas fand sich, der die Wünsche der zukünftigen Veteranen als Gesetzesvorlage in den Kongreß bringen wird – und aus dem Studentenscherz entwickelte sich eine Bewegung, die alle Aussicht hat, den sowieso recht ungeordneten Finanzen der Vereinigten Staaten gefährlich zu werden. Man stelle sich vor: Jeder Amerikaner unter 45 Jahren hat das Recht, einige tausend Dollar plötzlich von der Regierung zu verlangen – das ist eine Summe, die in die Milliarden geht!
Der Erfolg der Buben ließ die Mädchen natürlich nicht ruhen. Es gibt eine Organisation, die »Gold Star Mothers«, die Mütter des goldenen Sterns – das sind jene Mütter, deren Söhne im Weltkrieg gefallen sind und die nun, mit Regierungshilfe, in Abordnungen nach Frankreich fahren, um die Kriegsgräber ihrer Söhne zu besuchen. Also taten sich die Mädchen zusammen und gründeten den Verein der »Gold Star Mothers of the Future War«, und sie verlangen auch Geld von der Regierung, damit sie schon jetzt nach Frankreich fahren können und die noch ungegrabenen Gräber ihrer noch ungeborenen Söhne aufsuchen und sich nebenbei ein bißchen in Paris amüsieren können.
Nachdem sich so die zukünftigen Soldaten und die zukünftigen Heldenmütter organisiert hatten, begannen sich die zukünftigen Kriegsgewinnler zu organisieren. Der Verein »Profiteers of the Future War« kam zustande, und man verlangte schon jetzt die zukünftigen Regierungssubventionen, damit man mit diesen Subventionen die notleidende zukünftige Kriegsindustrie aufbauen könne.
Die ganze Idee ist nichts als der konsequent zu Ende gedachte und dadurch ad absurdum geführte Wahnsinn des Krieges selber. Eine Idee, die der selige Jaroslav Hašek gehabt haben könnte, schwejkisch und konsequent, und darum tödlich für die wirklichen Kriegstreiber. Diese Art Lächerlichkeit nimmt die Glorie von dem zukünftigen Krieg, Business is Business, wir sind loyale Staatsbürger, wir werden keineswegs Kriegsdienstverweigerer sein – aber bitte, gebt uns unser Geld. Die »Veteranen« haben sogar einen eigenen Gruß, ganz ähnlich dem Hitlergruß, nur ist die Handfläche nach oben gekehrt, so daß das Ganze die fordernde Gebärde: Geld her! bedeutet.
Selbstverständlich sahen die echten amerikanischen Patrioten, die Legionäre, die furchtbare Gefahr, die ihnen aus der Entglorifizierung des Krieges erwuchs. Ein wütender Legionär verübte ein Attentat auf den Gründer der »Veterans of the Future War«, Lewis Jefferson Gorin. Aber er traf den intelligenten, jungen Gorin nicht. Mr. Van Zandt, der Präsident der wirklichen »Veterans of the Foreign Wars« – Veteranen der ausländischen Kriege – hielt eine große Rede und schrie: »Diese jungen Burschen sind viel zu grün, um in den Krieg zu gehen – sie werden nie Veteranen in irgendeinem Krieg sein!« Immerhin, 1917 schickte die amerikanische Regierung dieselben grünen Burschen aus den Universitäten in die Schützengräben …
Mag sein, daß diese Bewegung, gerade weil sie auf halb humoristischer Basis aufgezogen ist, nicht lange dauern wird. Aber solange sie dauert, ist sie ein lebendiger Beweis für den Irrsinn, der nicht von den »grünen Jungen« verübt worden ist und wahrscheinlich verübt werden wird …
Und es ist immer nützlich und aufklärend, wenn ein Irrsinn in all seiner Größe recht deutlich demonstriert wird.