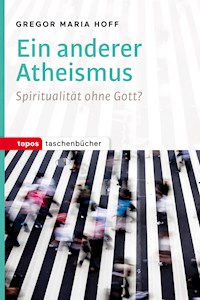Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Echter
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der alte Priester Jacob Beerwein lebt nach seiner Pensionierung wieder in seinem Heimatdorf am Niederrhein, in unmittelbarer Nachbarschaft zu seinem Freund Melchior. Ihr zurückgezogenes, ruhiges Leben gerät in Turbulenzen, als der ehemalige Schulkamerad Raven ermordet wird. Sein Tod wirft Fragen auf, die bis weit in ihre gemeinsame Schulzeit zurückführen. Und es bleibt nicht bei diesem einen Toten. Weitere Menschen aus Ravens Umfeld sterben. Gibt es eine Verbindung zwischen den Opfern? Mit der Aufklärung des Mordes geht nicht nur die gemeinsame Welt von Jacob und Melchior verloren, sondern auch Jacob selbst – und mit ihm sein Glaube an einen Gott, der so etwas wie Gerechtigkeit verbürgt. → Nachdenklicher Krimi über die Schuld eines Priesters
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 234
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
gregormariahoff
Welt verloren
gregormariahoff
Welt verloren
Roman
FürMarcus.Für wen sonst.
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel Nachsatz
1
Jacob lächelt. Noch immer fällt Schnee. Keine Flocke soll der anderen gleichen, hat er gelesen. In diesem Winter könnte man auf winzigen Sternen zum Himmel steigen. Man müsste nur leicht genug sein. Aber Schwerelosigkeit ist nichts für Jacob Beerwein. Dafür nimmt er sich Zeit. Beim Aufstehen, beim Beten, bei seinen Spaziergängen in die eisigen Ausläufer des Jahres. Der Rücken macht zu schaffen. Nicht nur der. Alles darf langsamer werden. Sein Kopf passt dazu. Auch deshalb lächelt Jacob. Wie dieser Winter. Er lässt sich bedenkenlos fallen.
Der Gott Jacobs hat nur einen Tag und eine Nacht benötigt, um die Welt neu zu schaffen. Er verfügt über kalte Vorstellungen. Atmet pulverfesten Schnee aus. In sanfteren Dosen erst, dann als eisige Sintflut. Der Niederrhein hat den Advent unter einer Decke aus Kristallen verschlafen. Ein Tief aus Skandinavien dehnte seinen Gefrierpunkt in alle Himmelsrichtungen aus. Am Nikolausabend sanken die Temperaturen in Düsseldorf und Köln auf minus fünfzehn Grad, dann hielt sie nichts mehr auf. Der Rhein fror endgültig zu und mit ihm die Bahnhöfe, die Flughäfen, die Städte. Der Gott dieses Winters kennt keine Ausnahmen. Die Welt hält an und Jacob Beerwein mit ihr. Die Räumkommandos stoßen nicht mehr bis nach Dornbusch vor. In manchen Landesteilen ist zwischenzeitlich der Strom ausgefallen. Man fürchtet Versorgungsengpässe. An Heiligabend hat die Landesregierung den Notstand ausgerufen. Das macht heute keinen Unterschied mehr. Am Rande seiner eigenen Welt versinkt Jacob Beerwein mit seinen Gedanken in einem mythischen Einerlei aus weißem Nichts.
Er schüttelt es aus dem Haar, als er das Pastorat verlässt. Immerhin, er besitzt noch Haare. Müde wendet er sich zur Seite. Gegenüber bildet das alte Schulhaus eine finstere Formation aus Backsteinen. Kein Licht von drinnen. Dieser Teil des Planeten schläft. Die Träume, die Melchior träumen muss, scheinen Jacob zum Greifen nah. Deshalb lässt er in jedem Zimmer eine Lampe brennen, selbst wenn er das Haus verlässt. Nachts sowieso. Er bevorzugt gedämpftes Licht. Es wirft warme Schatten.
Jacob schnürt Schal und Mütze fest zu und zieht in den Kampf. Er trägt eine Skimaske und Thermowäsche. Trotzdem friert er, wenn das ein passendes Wort wäre. „Wir friertesten“, hatte der Vater immer gesagt. Aber etwas Anderes gemeint. Es ist sechs Uhr wie an jedem Morgen. Die Kirchturmuhr müsste doch die Zeit schlagen. Das gab es zuletzt, als der Krieg dem Ende zuging. Oder ist es umgekehrt richtig? Jacob hört die Stimme seines Vaters: Er erzählt von einem russischen Winter. Er verwendet sparsame Sätze.
Auch dieser Winter schluckt alles. Heute nutzt er nur einen Lungenflügel, den linken. Er pumpt von der Dorfseite her. Dornbusch klingt nach Sommer, nach Wüste, findet Jacob. Aber die Pole sind verrutscht. Das ewige Eis wächst nun hier. Ein herrischer Wind aus dem Norden streift über Land, er hat sich am Wochenende erholt. Großzügig weist er seinen Besitz aus, weit ausgreifende Gesten verteilen den nächsten Schnee. Er lässt nicht nach. Buchstabiert eisige Namen in die Luft, die keiner liest. Kaum erreichen sie den Boden, fallen sie lautlos in sich zusammen. Aus den Abständen zwischen den Flocken ließe sich etwas machen, denkt Jacob. Aber er bekommt sie nicht zu fassen. Direkt vor ihm probiert eine Krähe den Schnee. Sie bohrt sich in grundlosen Boden. Hier gibt es nichts für sie zu holen. Nach einigen Flügelschlägen sieht sie es ein. Ihre Handschrift zittert noch einen Augenblick in ungelenken Linien durch die Luft. Bis die nächste Böe kommt. Sie packt den einsamen Spaziergänger am Genick und schiebt ihn zwei, drei Schritte vor sich her. Kein Mantel hilft gegen den eisstarren Blick, der ihn von hinten trifft.
Aber das ist Jacob egal. Er liebt den Winter. Der macht alle einsam. Weihnachten hat er die Welt verweht. In die Christmette wagten sich nur die unentwegten Bäuerinnen von den umliegenden Höfen. Und der letzte Sturm des Jahres kommt erst noch. Solange bleibt alles, wie es ist. Einmal hält die Welt der Zeit stand. Jetzt, wo er alt ist, weiß Jacob das zu schätzen. Er braucht keine anderen Farben, keine Geräusche. Einmal, denkt Jacob, darf alles anhalten. Das Ende kommt früh genug. Im Schnee, den er wie einen Urlaub nimmt, geht nichts verloren. Alles wartet nur. Das gefällt Jacob, dem Unruhigen. Er holt tief Luft. Seine Bronchien reagieren. Lass sie nur, denkt Jacob, der Geduldige. Er spuckt aus, was ihn gereizt hat. Seine Atemwege stellt er sich als die Straße vor, der er folgt. An den Seiten sind Wegmarker wie Bajonette aufgepflanzt. Irgendwo hinter Broiers Bruch rücken die Bagger heran. Sie führen ihren eigenen Krieg. Graben Unterwelt. Schaufeln Tod. Das hat er allen Ernstes gepredigt, am ersten Advent. Er lächelt, zufrieden mit dem Schnee.
Er hat sich vorgenommen, es bis zum Lühpfuhl zu schaffen. Früher gab es hier Reiher und in den ersten Sommern des Vaters sogar Störche. Aber sie gingen verloren. Siedelten um. Man fand sie nie wieder. Sie hatten ihre Gründe. Am Weiher nimmt Jacob sich Zeit für einen Gedanken an sie, als ließen sie sich mit einer geliehenen Erinnerung anlocken. Aber als Jacob nach einer halben Stunde ankommt, rührt sich hier nichts. Kein Tier wagt sich heraus. Das Eis drückt schwer auf das Wasser. Jacob stapft heran, riskiert einige Schritte auf den gefrorenen Belag und wartet. Er kann sein Gewicht spüren, genauer als auf jeder Waage. Wenn er jetzt einbräche, denkt er, bliebe er unter einer transzendenten Platte begraben. Das gefällt Jacob. Den Ausdruck will er sich merken. Hier hat er schwimmen gelernt. Zuerst das Tauchen im brackigen Wasser, bis auf den schlammigen Boden. Der Vater musste ihn retten. Damals hatte er zum ersten Mal die ganze Stille dieser Welt gespürt. Sie kroch in seine Ohren, sank in seine Nase, füllte seinen Mund. Aus diesem Traum hatte er nicht aufwachen wollen. Aber der Vater hatte etwas Anderes mit ihm vorgehabt.
Jacob erinnert sich daran jedes Mal, wenn er seine Runde bis hierhin verlängert. Er schickt, wie gewohnt, ein schnelles Gebet um die Ecke, wo das Kreuz steht. Die Jahreszahlen stecken im Holz fest. 1789, im Jahr der großen Revolution, hat hier ein Blitz den neunzig Jahre alten Pastor Wirsch erschlagen. Ausgerechnet. Was er hier wohl getrieben hat, zur Mitsommerwende? Und was den Eintrag auf dem Kreuz veranlasst haben mag: Leid ons niet in bekoring. Jacob denkt an Versuchungen und den unglaublichen Einschlag, der die Welt mit tausend Volt verwandelt. Wenn Hitze und Kälte keinen Unterschied mehr machen, weil alles zu schnell passiert. Danach kommt nichts als Schweigen. Kam nichts mehr, mehr als zweihundert Jahre das Schweigen Gottes, der seitdem nichts mehr unternahm. Jetzt zieht er im Eis auf. Holt sich, was er vergessen hat, denkt Jacob.
„Ich werde verrückt“, murmelt er und bläht die Backen. Saukalt ist es. Er bricht auf. Er hatte noch etwas denken wollen, da fehlt etwas. Er hat es vergessen, nichts Wichtiges, aber es fühlt sich an, als müsse er etwas in Ordnung bringen. Als Kind meinte er manchmal, einen Schritt nach links statt nach rechts gemacht zu haben, und alles war wie verhakt, der Tag, die ganze Welt. Das musste er korrigieren. Nur wie? Jacob drehte sich in sich selbst ein, um das Schnittmuster der falschen Bewegung zurückzunehmen. Er lenkte dann mit dem Kopf zur Seite, als steuere er den massigen Schlitten seines Kinderkörpers eine Bobbahn herunter. Dabei wusste er, dass das alles Unsinn war, doch er vermochte nichts gegen die Notwendigkeit, eine entgleisende Welt noch eben rechtzeitig anzuhalten. Wenn der Vater ihn erwischte, konnte es passieren, dass er den Kopf schüttelte.
„Was machst Du, Junge?“
Aber es hätte nichts geholfen, das zu erklären. Wer sollte verstehen, dass mit einem unvorsichtigen Schritt alles aus dem Lot geraten war. Wie ein Seil, das für immer die Zeit verdreht.
„Nichts, Papa.“
Hat er das gerade gesagt? Jacob schaut nach, aber er findet nichts. Das nimmt zu, dass er nach den Wörtern schaut, die er gebraucht hat. Und dass er mit den Toten redet. Von denen gibt es immer mehr, denkt Jacob Beerwein.
Blaue Lichter flammen auf. Sonst kann man sie hören. Auf der Landstraße schießt ein Rettungswagen wie ein Spielzeugauto in eine Richtung, die Jacob nur zu gut kennt. Irgendwo hinter der nächsten Kurve ringt ein Mensch um sein Leben. Jacob folgt den aufzuckenden Signalen, bis sie abbrechen. Wie kann etwas schön sein, das den Tod bringt, fragt er sich noch.
2
Etwas stimmt nicht, denkt Jacob als Nächstes, aber er kann es nicht fassen. Angestrengt hört er in den Schnee, der einen transparenten Schutzmantel bildet. Jacob kneift die Augen zu. Kein Wunder, dass er nichts sieht. Nichts. Selbst der Limbus friert zu, denkt Jacob. So kalt ist ihm.
Zu Hause ist der Kamin schon angeheizt. Daran hat er gedacht, bevor er losging. Das Holz reicht noch einen Monat, vorsichtig geschätzt. Melchior hat zur Not den ganzen Stall voll. Der Freund hat noch ganz andere Vorräte gehamstert. Es hat seine Vorteile, wenn man das Haus nie verlässt und sich von Konserven ernährt. Nur Kaffee besitzt er nicht. Melchior hasst Kaffee. Jacob wird, sobald er wieder im Pastorat ist, die erste Tasse des Tages trinken, einen tiefschwarzen Mokka, und dann in Ruhe frühstücken, wenn auch ohne Zeitung. Die liefert derzeit keiner. Jacob mag es nicht, wenn man in seinen Lebensrhythmus eingreift, wenn die Welt gegen seine Rituale verstößt. Aber der Schnee wiegt alles auf, das Kindergefühl von Schneeballschlachten und Schlittenfahrten und wirklichen Abenteuern. Außerdem hat Jacob für Ausgleich gesorgt: Schönberg in einer Einspielung von Inés van Breijden, die sie ihm zu Weihnachten geschenkt hat, in einem Paket mit Spritzgebäck und einer Widmung: Verklärte Nacht. Das Päckchen hatte er am Heiligabend vor seiner Tür gefunden. Nach der Christmette. Inés hatte gefehlt. Den Gedanken, der ihn seitdem beunruhigt, behält er für sich.
Der Rettungswagen kehrt nicht zurück. Hände, die nur Jacob spürt, haben sich auf seine Schultern gelegt. Ob man erfrieren kann, indem man einfach aufhört? Ohne jeden Anlass aufhört, mit allem? Diese Vorstellung fasziniert Jacob schon seit Langem. Sie treibt ihm mit den Schneeflocken entgegen. Es kostet Jacob Beerwein einige Anstrengung, sich von ihr zu lösen. Er kneift sich in die Nase, wischt über die Augen, streckt seine Zunge möglichst gerade heraus.
„Brrr.“
Das Geräusch macht er bewusst. Mit einem energischen Schütteln reibt er die Kristallhaut ab, die sich auf ihn gelegt hat. Aber die kalte Hand, die nach ihm greift, lässt ihn nicht so leicht los. Also entscheidet sich Jacob für das Naheliegende. Setzt einen Fuß vor den anderen und schaut nicht zurück. Zählt Schritte, um nicht vom Weg abzukommen. Kämpft sich dem Kaffee entgegen. Zu Hause wird er sich vor den Kamin setzen, in seinen Lesesessel, und die verschlissene Steppdecke um die Beine schlagen, die der Vater bei Frost auf die Orgelbühne mitnahm, für alle Fälle. Bei seinem Pott Kaffee, schwarz, ohne Zucker, will er durch die ZEIT stöbern, die übers Jahr liegen geblieben ist. Jacob hat sie sich aufgespart. Er holt in diesem Winter die Nachrichten aus dem Sommer nach. Eine Stunde gönnt er sich, jeden Morgen. Manchmal döst er ein. Aber heute nicht. Jacob ist entschlossen. Er wird sich an seinen Schreibtisch setzen, den er an die Fensterseite seiner Bibliothek gestellt hat. Gegenüber wohnt M. Fünftausend Bände verteilen sich in den deckenhohen Regalen, manche doppelt besetzt. Es stellte eine Herausforderung dar, sie im Pastorat aufzubauen. Manchmal fragt er sich, wer seine Bücher einmal übernehmen soll. Melchior interessiert sich einen Dreck für Theologie. Obwohl er viel vom Tod hält. Aber der Gedanke führt Jacob nicht weiter. Er verzettelt sich. Er kennt das. So verläuft sein Leben, denkt er, und stemmt sich einer Schneeböe entgegen, die ihn von vorne trifft. Dabei hat er sich mit dem Eintritt in den Ruhestand entschlossen, die Biografie noch einmal aufzunehmen. Jacob Beerwein überschlägt die Zeit, die bleibt. Vielleicht zwei gute Jahre, schätzt er, beim nächsten Schritt vorwärts. Wenn er sich nicht verrechnet. Im Rechnen war er nie gut. Ob zwei Jahre reichen, um das erstaunliche Leben des Kasper Bareisl in eine Form zu bringen? Es zu schreiben, sein Buch zu schreiben? Es ist Jacob nicht gleichgültig, aber es gibt nicht den Ausschlag, dass es kaum jemand lesen wird. Er ist es sich schuldig. Und Kasper Bareisl. Ihm bestimmt. Jacob hat eine Schwäche für vergessene Menschen.
Hinter ihm bellt etwas. Das kann nur Tons Hund sein. Jacob wendet sich um, aber er sieht nichts. Stattdessen schaut er auf seine Uhr. Fast eine Stunde vorbei.
„Bin ich eingeschlafen?“
Wieder murmelt er. Das muss aufhören. Außerdem sollte er längst weiter vorangekommen sein. Er wendet sich zur Seite. Rechts. Falsch. Für einen Moment hat er die Orientierung verloren. Die dichter fallenden Flocken nebeln ihn ein.
„Ich habe die Zeit weggelassen“, raunt er und beschließt, diese Formulierung zu behalten, um sie an Melchior weiterzugeben. Der braucht solche Sätze. M nimmt sie und baut sie um. Der Freund hat eine Kartei für gute Sätze angelegt. Jacob blättert sie manchmal durch und entdeckt eigene Gedanken, mit denen Melchior Grabsteine bestückt.
Sonderbares Geschäft, denkt er, was wir da von unseren beiden Straßenseiten her betreiben. Melchior kann nichts daran finden. Aber der glaubt auch nicht an Gott. Jacob schmunzelt vor sich hin und wartet darauf, dass es noch einmal bellt. Nichts. Eine Einbildung.
„Passt ja“, grummelt er und geht weiter. „Warum bin ich heute nur so langsam? Und so müde?“
Den gestrigen Abend haben die Freunde gründlich betrieben. Melchior verträgt mehr als Jacob, das war schon immer so. Nach drei Flaschen Bier reicht es für ihn. In der Regel. Aber Melchior hatte einen Whiskey ausgepackt.
„Zur Feier des Abends.“
Jacob hatte ihn überrascht angesehen.
„Du hast was zu feiern?“
Melchior hatte nicht geantwortet, stattdessen zwei Fingerbreit eingeschüttet und ihm zugeprostet.
„Probier einfach.“
Der Whiskey hatte nach der Beschreibung geschmeckt, die Melchior vorlas. Jacob kennt sich mit Whiskeys nicht aus, doch mit dem ersten vorsichtigen Schluck war ihm klar, dass Melchior wirklich etwas zu feiern haben musste. Der hatte sich ausgeschwiegen und auf das Spiel konzentriert, das sie im Fernsehen verfolgten. Wenigstens spielten die Engländer zu dieser Zeit noch. Trotz Schnee. Es war ein Pokalspiel, das sich eine Verlängerung bis zum Elfmeterschießen nahm. Danach war Jacob schwer ins Bett gekommen.
Die Nacht verlief unruhig. Erst musste er auf die Toilette, dann riskierte er einen Schritt in die Kälte des Treppenhauses, um in die beunruhigenden Bewegungen des alten Pastorats zu lauschen. Manchmal knarrten die Dielen ohne Grund. Geheime Bewohner unterhielten sich im Holz. Seine Ängste würde Jacob nie loswerden. Bis heute versicherte er sich manchmal, dass sich niemand im Haus und lächerlicherweise unter seinem Bett versteckt hielt. Dann schwemmte der Whiskey Bilder hoch, die Jacob lange nicht mehr belästigt hatten. Als Jacob um fünf Uhr von seinem unnachgiebigen Wecker aufgeschreckt wurde, erinnerte er sich halb verschämt, halb belustigt an die Erektion, die ihn durch die Nacht getrieben hatte. Da lebte etwas auf eigene Rechnung in ihm.
„Immerhin“, hatte er sich gesagt. „Ist doch mal was, oder?“ Aber das blieb ein vorgelagerter Aspekt seines Morgengebets.
Jetzt streift Jacobs Blick über Dorf und Land. Er strengt die gereizten Augen an. Sie jucken dornrot. Manchmal kann Jacob Farben spüren. Im Frühling riechen, im Sommer schmecken. Noch so etwas, denkt er.
Der Kirchturm ragt aus der Senke hervor, in die man Dornbusch gebaut hat. Er wirkt so vertraut, der eigentliche Anhaltspunkt seines Lebens. Mehr als ein halbes Jahrhundert hat sein Vater hier Küsterdienste versehen und die Orgel gespielt. Die Posten sind längst vakant. Niemand wird sie nachbesetzen. Der Gedanke macht Jacob manchmal traurig, aber nicht heute. Jacob Beerwein ist woanders. Er genießt die wilde Verrücktheit eines Himmels, der auf den Feldern festfriert. Er knirscht unter seinen massiven Schuhen.
Jacob hat sie eigens angeschafft, als er vor einem Jahr hierhin gezogen ist. Seitdem dreht er seine Runden. Morgens, abends. Nach den Laudes. Nach der Vesper. Eine Stunde braucht er für die Schleifen, die er wie langgezogene Gedanken hinter sich im Schnee verfolgen kann. Unsichere Linien, zaghafte Kurven, wo er den Straßenverlauf vermutet hat, Schritte wie plötzliche Einfälle. Er betrachtet sein Werk. Setzt seinen Weg fort. Hört Schnee flüstern. Wenn er lange genug in die Wirbel schaut, verliert sich die Schwerkraft, und er meint, es zöge ihn etwas nach oben. Aber das ist Unsinn. Trotzdem: Jeder weitere Schritt, mit dem er sich auf St. Thomas zubewegt, macht alles leiser.
3
Sie sind nicht verabredet. Aber Ton van Breijden kommt. Elegant. Allein. Schon auf den ersten Blick vermisst Jacob die zierliche Gestalt von Inés. Schade, denkt er, und findet das sofort unverhältnismäßig. Sie treffen sich meist auf der Höhe von Coenen. Zweimal in der Woche hat die Gaststätte noch geöffnet. Sonntags nach der Messe, die seine schrumpfende Gemeinde aus sentimentaler Gewohnheit besucht, wie Jacob argwöhnt, gibt es den Frühschoppen. Und am Freitagabend setzt die alte Mutter Coenen ihre Reibekuchen vor, manchmal auch Panhas, saisonbedingt. Jacob lässt sich beides ungern entgehen. Er mag diese Kneipe. Er freut sich auf das erste Altbier am Abend, den malzigen Nachgeschmack auf der Zunge. Jacob betrinkt sich nicht, aber er sitzt gerne an der Theke.
Ton van Breijden ist dafür zu reserviert. Er bewohnt den ausgebauten Vierkanthof am Übergang zum Willebrand. Wenn er nicht auf Konzertreise unterwegs ist, schließt er sich in seinem Studio ein. Aber Inés taucht manchmal auf, und Jacob genießt es, wenn sie sich zu ihm an die Theke setzt, zu seinem Platz an der äußersten Ecke, den man respektvoll für ihn freihält. Früher hat sein Vater hier immer gesessen, und Jacob war stolz, wenn er als junger Kerl mitdurfte. Es hatte auch Vorteile, wenn man ohne Mutter aufwuchs, zu zweit, unter Männern. So kam Jacob früher ans Altbier. Der Vater liebte den dunklen Ernst des Getränks, wie er sich ausdrückte. Seinen kunstvollen Bariton stellte er dann betont andächtig ein. Aber das Bier machte ihn auch traurig, noch trauriger als ohnehin.
Inés trinkt keinen Alkohol, und sie isst auch selten etwas, vermutet Jacob, aber sie mag die Atmosphäre in diesem urtümlichen Lokal, das sich in den letzten hundert Jahren nicht verändert zu haben scheint. Deshalb kommt sie, und wegen Jacob. Will er glauben. Selten spricht sie von sich selbst.
„Ein bisschen ätherisch, was?“, hat Melchior einmal gemeint.
Aber der kann viel meinen, denkt Jacob nicht nur jetzt. Inés ist einfach zurückhaltend, vielleicht auch vorsichtig. Ihr Mann heißt eben van Breijden. Während sie auch nach beinahe zwanzig Jahren die zweite Frau bleibt, die Katalanin.
Zu Jacob hat sie Vertrauen gefasst, und wenn sie an seinen Wangen vorbei ihren Begrüßungskuss haucht, kommt sie ihm näher, als sie es wohl ahnt. Meist schaut sie Jacob einfach an und wartet, bis er zu erzählen beginnt. Von früher. Das gefällt ihr. Die Fotografien an den Wänden führen durch die Zeit, an ihnen haftet die Geschichte des Dorfes mit den erstaunlichsten Begebenheiten. Wenn Mutter Coenen einmal nicht mehr kann, soll ihre Tochter die Familientradition fortsetzen. Aber vorher werden die Bagger kommen. Und Jacob wird nicht mehr erzählen.
Bei Coenen brennen Lichter im Obergeschoss. Jacob ist heute wirklich spät, und Inés fehlt. Gewöhnlich begleitet sie ihren Mann und Shep, den riesigen Hirtenhund, auf ihren Runden durch das Tal, das die Höhen einschließen. Einige grimmige Eichen starren herüber. Jacob weiß vom Vater, dass einige seit dem Dreißigjährigen Krieg dem Wald vorstehen. Sie verfügen über eigene Erinnerungen.
Hier treffen sie sich, der Dirigent und der Priester, an der Kreuzung, an der es für Jacob die letzten fünfhundert Meter bis zur Kirche geht. Shep ist streng abgerichtet, aber auch zutraulich. Er mag Jacob. Umkreist ihn. Brummt etwas Freundliches. Also bleibt Ton van Breijden kurz stehen. Er zieht den Hut, eine Anrede spart er sich. Er redet auch sonst wenig.
Ein sonderbares Leben, denkt Jacob. Dann kommt Melchiors Einwand. Der Freund hat es mit allem, was Jacob Beerwein merkwürdig findet.
„Bist halt ein Spießer.“
Manchmal erwidert Jacob etwas, stimmungsabhängig. Er wüsste schon gerne, was einen Spießer auszeichnet, wenn er anders sein soll als M. Aber das denkt er sich nur. Es gibt bessere Anlässe, mit Melchior zu streiten. Und auf innere Stimmen sollte auch ein Priester wohl nur im Ausnahmefall reagieren.
Jacob mustert den Dirigenten. Der hat die Augen geschlossen. Ob er auch eine Stimme hört? Ton van Breijden ist sonderbar. Jacob bleibt bei seinem Urteil. Die feenhafte Inés denkt er sich gerne weg von dem Dirigenten. In ein Leben, das besser zu ihr passt. Aber was weiß Jacob schon. Von Feen und überhaupt. Einzelne Falten in ihrem Gesicht erzählen von dem, was sie auch Jacob verschweigt. Vermutet er. Wenn sie sich begegnen, lächelt Inés ihm entgegen, schon aus der Entfernung, ohne jede Anstrengung, sie, die so selten lächelt. Jacob hat sich wie jeden Morgen darauf gefreut, ihre schmale, dunkle Gestalt zu sehen. Er kann es nicht beschreiben, ihre Gegenwart macht ihn einfach fröhlich. Vielleicht hätte er sich früher in sie verliebt, denkt er manchmal. Aber sich zu verlieben, war nie sein Temperament.
Jacob schlägt die Handschuhe gegeneinander, aus verschiedenen Gründen. Ton van Breijden scheint auf etwas zu warten. Nicht auf seinen Hund. Ein Hase beansprucht Sheps Aufmerksamkeit. Unversehens springt er hoch. Dann zerrt er sein Herrchen auf das Schneefeld, und zu Jacobs Überraschung gibt van Breijden nach. Er lässt das Tier von der Leine, und Shep stürmt bedenkenlos auf den Hasen zu. Eine rasante Jagd entwickelt sich, die van Breijden aus der Hocke verfolgt. Er stützt sich auf das rechte Knie und scheint nur schwer hochzukommen.
„Geht es Ihnen gut?“
„Danke der Nachfrage.“
Ein kantiger Satz. Es braucht nicht mehr. Also verbietet sich Jacob auch einen Gruß an die Gattin. Er fürchtet Schwierigkeiten, obwohl Eifersucht keinen Sinn macht. Nicht wenn es um Jacob geht. Van Breijden steht wieder aufrecht. Gebeugter als sonst. Er blickt in die Richtung seines Hundes, doch sein Kopf folgt nicht den Haken, die der Hase schlägt. Der Schnee dämpft seinen Blick. Nimmt ihn gefangen. Inés hat von solchen Momenten berichtet, wenn ihr Mann wegkippt, im Gefälle eines musikalischen Gedankens oder vielleicht auf der Suche nach der Frau, die er verloren hat.
Sara van Breijden ist vor vielen Jahren bei einem Unfall ums Leben gekommen. Auf dem eigenen Hof. Beim Fensterputzen gestürzt. Das Gleichgewicht verloren. Das Unglück löste allgemeines Entsetzen aus, auch weil Meier, der Rettungsmeier, der den Feuerwehreinsatz leitete, sich später betrunken verredete. Eine Flasche Korn hatte er gesoffen, bei Mutter Coenen, und nachher ausgekotzt. Nicht nur sie. Meier hatte Sara van Breijdens Leiche vom Eisenzaun lösen müssen.
Jacob hatte sich zu Besuch beim Vater aufgehalten, noch zu Studienzeiten. Er kannte Sara, sie waren zusammen in die Grundschule gegangen. Ein anderer Typ als Inés: blond, üppiger. Jacob fällt kein besseres Wort ein. Klug war sie, das weiß er sicher. Und dass sie van Breijden geheiratet hatte, als sie kaum zwanzig Jahre alt war. Der besaß Geschmack. Und er bekam, was er wollte, ohne sich anstrengen zu müssen. Ihm flog die Welt zu, denkt Jacob, und dann weicht der Gedanke vom Weg ab, findet dieses andere Bild, das sich mit Schnee vermischt …
Jacob sucht van Brejidens Blick. Aber der schaut in den Himmel, mit dem er seinen eigenen Vertrag hat. Vermutet Jacob. So klingt auch die Musik, die er dirigiert: bestimmt. Damals war van Breijden schon eine bekannte Figur. Person des öffentlichen Lebens. Beinahe berühmt. Etwas in der Art. „Ein Sohn Dornbuschs“, hatte jedenfalls der alte Pastor Loosen ehrfürchtig geraunt, wenn van Breijden ihn gelegentlich besuchte. Ob er bei ihm beichtete?
Jacobs Vater hatte den Mann nie gemocht. Ohne etwas zu sagen. Brauchte er nicht. Beim Requiem hatte Jacob ministriert. Er konnte dem zehn Jahre älteren Witwer damals ins Gesicht schauen: ein Block, der sich ihm jetzt zuwendet.
Van Breijden scheint etwas sagen zu wollen, überlegt es sich aber anders und wendet sich ab. Seinen Hut zieht er kein weiteres Mal.
4
Gott macht eine Pause. Der Schneefall lässt allmählich nach und hört mit einem Mal ganz auf. Jacob blickt nach oben. Kein weiteres Kommando erfolgt. Still und bewegungslos wird die Welt, wie der Kirchturm, der einfach standhält. Vor der Haustür schüttelt sich Jacob den Schnee gründlich vom Mantel und zieht die Schuhe aus. Auf Strümpfen betritt er das Pastorat. Zwei Paar hat er übereinander gezogen. Geholfen hat es nichts. Er spürt seine geschwollenen Füße kaum. Rücksichtsvoll jongliert er seine vereisten Sachen durch den Flur. Jeden Morgen um acht Uhr kommt Frau Haverkamp, die ihn versorgt und für ihn putzt. Wäsche macht. Sogar Socken stopft. Bei den Gottesdiensten hilft sie als Küsterin aus. Oft sitzen sie werktags zu zweit in der Kirche. Gott ist einsam geworden in Dornbusch. Das bedrückt Jacob mehr, als er eingesteht. Manchmal gesellt er sich zu seinem Gott. Nimmt in einer Kirchenbank Platz und wartet auf etwas, was er selbst nicht zu sagen weiß. Er glaubt an einen unaufdringlichen Gott.
Jacob schaut auf die Schlieren, die den Flur bedecken. Frau Haverkamp wird einiges zu tun haben, denkt er und rekonstruiert die Spuren, die er hinterlassen hat. Ein dünner, wässriger Arm greift unter die eisenbeschlagene Holztür, die ein anderes Jahrhundert zu verschließen scheint, aber nur das Pfarrbüro abtrennt. Seit St. Thomas keine eigenständige Pfarrei mehr ist, hat man sogar die wöchentliche Sprechstunde in die Stadt verlegt. Ein leerer Raum mehr. Der Rendant von St. Judas kommt einmal im Jahr, der buckelschiefe Gebert, den Jacob noch nie zu einer Tasse Kaffee eingeladen hat. Man muss nicht alles tun, denkt er, mit dem Anflug eines schlechten Gewissens, als er die hintere Tür aufschließt, die zur Treppe führt. Jacob wohnt im ersten und zweiten Stockwerk. Unter dem Dach befinden sich das Bad, sein Schlaf- und ein Gästezimmer. Jacob hat es so belassen, wie es war. Auch wenn er nie Besuch empfängt. Zumindest keinen, der übernachten würde. Er ist froh für die Ruhe, die er sich nicht mehr nehmen lassen will. Wen sollte er auch einladen? Die Jahre in den anderen Gemeinden hat er hinter sich gelassen.
Er geht in die Küche, stellt die Thermoskanne mit dem Kaffee, den er vorsorglich aufgebrüht hat, auf das Tablett mit dem Schwarzbrot von Frau Haverkamp. Aus dem Kühlschrank nimmt er die Platte, die sie ihm abends bereitstellt: Aufschnitt, Käse, Rübenflitsche. Selbst gemacht. Nur das Frühstücksei muss Jacobs selbst kochen, bevor er morgens losmarschiert. Sieben Minuten hart, hat er es in eine der winzig grauen Zipfelmützen gepackt, die noch von seiner Mutter stammen. Manchmal streicht Jacob über das, was sich nie auswaschen lässt. Aber heute überwiegt der Appetit. Er packt das labile Ensemble mit der linken Hand und steigt gelenksteif die Treppe hoch, noch ein Abenteuer. Mit der Kanne als Richtwert muss er sein eigenes Gewicht balancieren. Jeden Tag eine Erstbesteigung, denkt Jacob, und bleibt schließlich auf dem Treppenabsatz stehen. Luft holen, das muss er inzwischen eigens denken. Er braucht das Wort, als setze es erst in Gang, was sich da in seinem immer enger werdenden Gehirn abspielt. So stellt er es sich vor: enger wird es …
Unter der Türritze des Wohnzimmers, das Jacob in seine Bibliothek verwandelt hat, spürt Jacob einen Zug kaminwarmer Luft. Sie kitzelt an den Zehen. Jacob tut die letzten erforderlichen Schritte und kommt an. Alte Freunde erwarten ihn. Früher hat Jacob seine Bücher auf Karteikarten geführt, aber die letzte Inventur ist Jahre her. Es macht keinen Sinn. Manchmal verstecken sich die Bände, die er sucht. Ein fremder Geist spielt hier auf Jacobs Rechnung. Denkt er manchmal. Nach dem letzten Umzug hat er jedenfalls die Ordnung nie mehr herstellen können. Er versteht das eigentlich nicht. Aber so ist es.
Das Licht in der Bibliothek ist warm wie erzählt, und der Kamin tut, was er tun muss. Jacob hat als Kind Stunden vor dem Feuerofen verbracht, den der Vater unterhielt. Von hierher stammt seine Lust an Geschichten und Geschichte. Das lässt nicht nach.