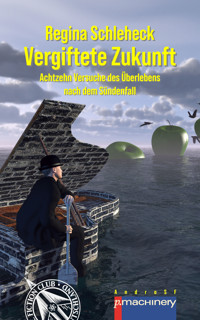2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: p.machinery
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Drachen, die menscheln, Menschen, die Drachen sind, intelligente Insekten, furiose Finken und unglückliche Undinen sind die Protagonisten der oft schrägen Schleheckschen Märchengeschichten. Die Autorin »weiß, was sie mit Worten erreichen kann, und setzt ihre Ideen routiniert um« (scifinet.org-Rezension). Motive aus einer ganzen Palette klassischer und weniger bekannter Märchen werden in »Wenn Drachen Sachen machen« von Regina Schleheck angespielt. Der Band versammelt aber auch vollkommen originäre Erzählungen, die oft bittere Realität auf berührende Weise märchenhaft verpacken, etwa die eines »Sternenkinds« im Dritten Reich, einer minderjährigen Zwangsprostituierten oder den Nöten alleinerziehender Väter. Wirklich glücklich können solche Geschichten nicht ausgehen, aber die Autorin findet immer wieder überraschende Twists, die haarscharf an der Katastrophe vorbeischrammen und zu einem (schwarz)humorigen oder mindestens tröstlichen Ende führen. Die Texte stammen aus den letzten anderthalb Jahrzehnten, nicht wenige wurden ausgezeichnet, so das Märchen vom unglücklich verliebten Mond, in einem Band zum Grimm-Jahr erschienen, der den Deutschen Phantastik Preis errang.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 253
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Regina Schleheck
Wenn Drachen Sachen machen
und andere Märchengeschichten
Außer der Reihe 68
Regina Schleheck
WENN DRACHEN SACHEN MACHEN
und andere Märchengeschichten
Außer der Reihe 68
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© dieser Ausgabe: Juli 2022
p.machinery Michael Haitel
Titelbild: Jörg Neidhardt
Layout & Umschlaggestaltung: global:epropaganda
Lektorat & Korrektorat: Michael Haitel
Herstellung: global:epropaganda
Verlag: p.machinery Michael Haitel
Norderweg 31, 25887 Winnert
www.pmachinery.de
ISBN der Printausgabe: 978 3 95765 291 1
ISBN dieses E-Books: 978 3 95765 812 8
»Wohl wahr«, seufzte der Prinz, »dass Drachen blaublütige Jungfrauen grünem Salat vorziehen, ist ein ziemliches Problem. Farblich-geschmacklich aber untadelig.«
Mariechen saß weinend im Zimmer
Als ich klein war, las meine Mutter mir jeden Abend aus dem dicken Märchenbuch vor. Immer, wenn ich mit frisch geputzten Zähnen erwartungsvoll in meinem Bett lag, kam sie, gab mir das Buch, und ich blätterte so lange darin herum, bis ich eine Illustration fand, die mein Interesse weckte. Einmal stieß ich auf das Bild einer dicken rosigen Frau, die in einem Fenster ein Federbett ausschlug, das offensichtlich kaputt war, denn die Daunen wirbelten nur so daraus hervor. Das Bild hatte überhaupt nichts Märchenhaftes an sich. Es erinnerte mich eher an unsere Nachbarin, die immer am Fenster hing. Egal ob ich morgens zu Schule ging oder mittags nach Hause kam, immer saß sie dort, eine dicke Frau auf einem dicken Kissen, und beobachtete alles, was draußen vor sich ging. Der Gedanke amüsierte mich, dass diese Nachbarin ihr Kissen ausschüttelte, das dabei alle Federn verlor.
»Lies das«, sagte ich, und meine Mutter las mir die Geschichte von dem braven und von dem faulen Mädchen vor, die in den Brunnen gefallen waren. Ich weiß heute die Details nicht mehr von dieser Geschichte. Dass sie mir dennoch so lebhaft im Gedächtnis blieb, lag daran, dass meine Mutter am Ende auf einmal anfing zu weinen.
»Das Pech aber blieb fest an ihr hängen und wollte, solange sie lebte, nicht abgehen«, las meine Mutter und ich guckte überrascht an ihr hoch, weil ihre Stimme auf einmal so merkwürdig zitterte. Da sah ich, dass ihr Gesicht tränenüberströmt war. Sie klappte das Buch zu, stand auf, ohne mir einen Gutenachtkuss zu geben, und verließ das Zimmer. Die halbe Nacht lag ich wach und sah die Szene immer wieder vor mir, hörte die Worte meiner Mutter, die von dem Pech erzählte, das nie mehr von dem Mädchen abging, und sah ihre Tränen und ihr hastiges Hinausgehen vor mir, ohne den Zusammenhang zu begreifen. War dem Mädchen denn nicht ganz recht geschehen? Es hatte doch nicht gemacht, was es sollte. Ich kriegte doch auch immer Ärger, wenn meine Mutter mich erwischte, wie ich, statt mir die Zähne zu putzen, einfach mit dem Finger ein bisschen Zahnpasta auf den Zähnen zerdrückte, damit es wenigstens so roch, als wären sie frisch geputzt.
Mein Vater war zu der Zeit wochenlang weg, beruflich, hieß es. Aber dann war er eines Abends da und erzählte mir, dass er jetzt eine eigene Wohnung habe und dass ich ihn am Wochenende besuchen kommen sollte. Meine Mutter fuhr mit mir dort hin, es war ein großes Haus mit einem Messingschild, auf dem viele Namen standen, auch der meines Vaters. Mutter drückte auf den Klingelknopf, es summte, und sie ging mit mir in den Hausflur, wo es einen Fahrstuhl gab. Sie schob mich in die geöffnete Aufzugtür, drückte auf den Knopf mit der Drei, hauchte mir einen flüchtigen Kuss auf den schwarzen Scheitel und sagte: »Bis nachher.« Ehe ich recht begriffen hatte, dass sie nicht mitkam, schlossen sich die Metalltüren und der Aufzug setzte sich in Bewegung.
Auf der dritten Etage empfing mich mein Vater. Er legte den Arm um meine Schulter und führte mich zu einer offenen Wohnungstür. »Das ist Marie«, sagte er zu einer platinblonden Frau, die im Flur stand, bestrahlt von der nackten Glühbirne, die direkt über ihr von der Decke baumelte. Ich kann nicht sagen, was mir in dem Moment genau durch den Kopf ging, aber irgendetwas machte Pling und ich wusste plötzlich, warum meine Mutter die Tage geweint hatte. Die Frau war über und über mit Gold behängt. Sie trug große goldene Kreolen, eine Goldkette mit einem rubinroten Anhänger, an beiden Handgelenken hatte sie eine Fülle von Goldreifen und an mehreren Fingern goldene Ringe. Im Licht der Glühbirne gleißte alles an ihr. Ich fürchtete auf einmal, wenn sie mich anlächelte, wären alle Zähne golden, und ich bekam Angst vor diesen Zähnen, Angst vor dieser Frau. Schlagartig wusste ich, dass das Märchen gelogen hatte, dass es gar nicht darum ging, ob jemand seine Zähne geputzt oder sein Zimmer aufgeräumt hatte. Das Leben machte zur Goldmarie, wer ihm gerade in den Sinn kam. Ich fing an zu weinen und hörte nicht auf, bis meine Mutter mich am Abend wieder in die Arme nahm.
Nie wieder wollte ich aus dem Märchenbuch vorgelesen bekommen.
Laura Schlüsselkind
König Magnus machte seinem Namen keine Ehre. Er war der kleinste König, den man sich denken kann.
Als seine Frau, die Königin Margot, noch bei ihm lebte, hatte sie sich immer darüber geärgert, weil sie neben ihm nie ihre hochhackigen Schuhe anziehen konnte, in denen sie so verführerisch aussah. Sie fand, das machte einen blöden Eindruck, wenn die Königin den König um Haupteslänge überragte. Daher trug sie immer flache Schuhe und machte sich klein. Auf die Dauer kriegte sie darüber Minderwertigkeitskomplexe und Rückenschmerzen, und so musste sie irgendwann in Kur, und da lernte sie einen anderen König kennen, der groß war und mit dem sie weglief.
König Magnus vermisste sie nicht sonderlich.
Allerdings ließ die Königin im Schloss noch jemanden zurück, und das war die kleine Prinzessin Laura. Die vermisste ihre Mutter. Zwar hatte sie sie nicht häufig zu Gesicht bekommen, weil die Königin die meiste Zeit ihren offiziellen Dienstverpflichtungen nachkommen musste, aber eine Mutter ist eine Mutter. Laura kam in die Königliche Krabbelstube, dann in den Königlichen Kindergarten und schließlich in die Königliche Grundschule mit integrierter Königlicher Mittagsbetreuung, sodass die kleine Prinzessin immer versorgt war. Aber man kennt das ja, wenn Vater und Mutter sich nicht sonderlich um die Kinder kümmern, zumal wenn die Mutter ganz weg ist und der Vater nach der Arbeit immer erst noch seinen Aktenkram erledigen muss, ehe er in Ruhe die Königlichen Nachrichten lesen will, – die Prinzessin war sich meistens selbst überlassen. Solche Kinder sind immer ein bisschen traurig. Aber das lernen sie mit der Zeit zu verstecken und dann kriegen sie es faustdick hinter den Ohren.
Bei Laura war das so: Hinter dem rechten Ohr saß Luzi, der kleine Teufel, der ihr Blödsinn eintrichterte, und links hockte Lelia, der kleine Engel. Laura stellte ihr linkes Ohr meist auf Durchzug, weil ihr Lelia ziemlich auf den Zwirn ging. Luzis Anstacheleien hingegen fand sie ziemlich cool.
Und so wunderte sich der König über seine Manschettenknöpfe in der Kaffeetasse, über die mit Schnurrbärten und komischen Brillen verzierten Fotos seiner Minister in den Königlichen Nachrichten und über den versalzenen Sonntagsnachmittagstee, obwohl er doch hätte schwören können, dass er einen Löffel Zucker aus der Zuckerdose hineingerührt hatte.
Da König Magnus Wichtigeres zu tun hatte, schenkte er solchen Vorfällen wenig Beachtung. Aber eines Tages platzte ihm der Kragen. Es ging darum, wer den Königlichen Müll in den Keller des Schlosses bringen sollte.
»Laura«, sagte König Magnus würdevoll, »die letzten beiden Male war ich dran. Geh du jetzt!«
»Der spinnt doch wohl!«, rief Luzi Laura ins Ohr. »Wie redet der denn mit dir!«
»Er hat recht«, wisperte Lelia. »Er ist sogar schon dreimal dran gewesen. Mach ihm die Freude!«
»Du hast ja wohl einen Vogel«, sagte Laura. »Ich geh doch nicht in den Keller!«
Des Königs Miene verfinsterte sich.
»Mein liebes Kind«, sagte er. »So sprichst du nicht mit deinem Vater!«
Lelia hatte es für einen Moment die Sprache verschlagen.
»Sag ihm, du hättest Angst allein im Keller!«, raunte Luzi auf der anderen Seite.
»Ich trau mich nicht«, jammerte Laura. »Da ist es dunkel!«
»Dafür gibt es Lichtschalter«, entgegnete der König.
»Schwarzer Mann!«, gab Luzi Stichwort.
»Aber da ist ein schwarzer Mann versteckt!«, klagte Laura.
Der König seufzte.
»Komm. Wir gucken jetzt gemeinsam, ob wir einen schwarzen Mann finden. Wenn nicht, gehst du beim nächsten Mal allein, klar?«
Was blieb Laura anderes übrig? Sie holte den Kellerschlüssel vom Schlüsselbrett, ging mit dem Vater in den Keller, schloss ihm die Tür auf, weil er ja die Hände voller Müllbeutel hatte, und blieb mit dem Rücken an die Tür gelehnt stehen, während der König die Tüten in die Tonnen warf.
»Los, die Tür!«, rief Luzi.
Noch ehe die nichts ahnende Lelia reagieren konnte, hatte Laura die Tür zugeschlagen, den Schlüssel zweimal im Schloss herumgedreht und war die Treppe hinaufgelaufen auf die Straße. Sie hüpfte fröhlich die Bordsteinkante entlang.
Das linke Ohr hielt sie sich zu, während sie in der rechten Hand den Schlüssel schwenkte.
»Gulli!«, schrie Luzi.
Da ließ Laura den Schlüssel in den Gulli an der Straßenkreuzung fallen.
Durch die Eisenstangen des Gullis konnte man ihn unten liegen sehen.
»Wie willst du den wieder rausfischen?«, jammerte Lelia.
Aber Laura war jetzt am Schlosspark angekommen, wo der Königliche Bauspielplatz war. Keiner war in der Nähe. Laura kletterte die Leiter zu einem der Baumhäuser hoch. Das Haus war um den Baumstamm herum gebaut und zu der einen Seite mit einem richtigen Dach versehen. In dem Baumhaus war eine Zigarrenkiste, in der Schätze versteckt waren. Laura öffnete sie vorsichtig. Da waren Kerzenstummel, Streichhölzer, ein Stück Wäscheleine, Malsteine, ein rostiges Küchenmesser und sogar ein kleiner Taschenspiegel. Eben hatten Lauras Finger den Spiegel ertastet, als sie ein Räuspern hinter sich vernahm. Sie fuhr herum.
In der dämmrigen Ecke des Baumhauses hatte ein Bündel gehockt. Es war eine kleine zerlumpte Frau mit einem karierten Kopftuch.
»Wow, eine Hexe!«, schrie Luzi begeistert.
Aber Lelia jammerte: »Laura, pass auf!«
Die Frau hatte sich aus ihrer Kauerstellung erhoben und sah Laura verärgert an.
»Was hast du da?«, fragte sie heiser.
Laura folgte ihrem Blick und merkte jetzt erst, dass sie in der Hand den kleinen Spiegel hielt.
In der Kehle hatte sie einen Knoten, und so hielt sie ihn der Alten nur stumm hin.
»Ah«, krächzte die alte Hexe, »ein Spiegel für das Prinzesschen!«
Sie streckte ihre runzlige Hand aus: »Gib her!«
Die Hexe hielt sich den Spiegel vor das Gesicht. Sie spuckte auf die Hand und strich sich mit der feuchten Handinnenfläche eine verrutschte Haarsträhne unter das Kopftuch. Dann hielt sie Laura den Spiegel vor und lachte. »Guck rein, mein Vögelchen, guck! Was siehst du?«
Laura sah in den Spiegel und erschrak. Sie sah einen kleinen Spatzen, der sie aufmerksam musterte, sonst nichts.
»Einen Vogel«, stammelte sie.
Die Alte kicherte. »Ist das nicht lustig? Ein Vögelchen! – Was meinst du, warum du einen Vogel siehst?«
Lelia wisperte: »Oh je, das kommt davon!«
Laura war es innerlich ganz heiß geworden.
»Ich hab mich mit meinem Vater gezankt«, sagte sie leise. »Ich hab ihm gesagt, er hätte einen Vogel.«
Wieder kicherte die Hexe. »Wie recht du hattest, Prinzesschen! Er hat ja nur dich! Sein Vögelchen!« Sie gackerte beinahe.
»Oh je«, jammerte Lelia.
»Cool«, juchzte Luzi, »du kannst jetzt fliegen!«
»Und?«, fragte die Alte weiter, »hat dein Vater dir den Hintern versohlt?«
Die Vorstellung schien sie besonders spaßig zu finden.
»Nein … äh …« Laura zögerte.
»Na, was ist passiert?«, krächzte die Alte, und Laura spürte, dass sie es genau wusste.
»Die will dich nur ärgern, die alte Schachtel«, ereiferte sich Luzi.
»Wie willst du das nur wieder in Ordnung bringen?«, klagte Lelia.
»Na?« Die Hexe hielt den Spiegel drohend an Lauras Gesicht. Laura wich zurück und flatterte. Sie merkte zu ihrem Erstaunen, dass sie tatsächlich fliegen konnte.
Die Hexe lachte gellend, und Laura flog verschreckt aus dem Baumhaus. Das Lachen verfolgte sie bis zur Straße.
Nachdem sie mit ein paar flatternden Flügelschlägen ihren Schwindel überwunden hatte, ließ sie sich mit größeren Bewegungen durch die Luft gleiten. Sie flog bis an die Straßenecke und setzte sich auf den Bordstein. Der Gulli lag vor ihr. Wenn sie das Köpfchen schief legte, konnte sie den Schlüssel unten blinken sehen.
»Los, flieg!«, juchzte Luzi. »Du kannst jetzt überall hin!«
»Halt’s Maul!«, sagte Laura böse.
Laura zwängte sich durch die Gullistäbe. Sie hatte Mühe, den Schlüssel mit ihrem kleinen Schnabel zu packen zu kriegen. Ein paar Mal rutschte er ihr weg, als sie gerade hoch flattern wollte, doch dann schaffte sie es endlich, ihn durch die Stäbe zu schubsen und sich selbst hinterher zu zwängen.
Atemlos hockte sie sich auf die Bordsteinkante und begann sich das zerzauste Gefieder zu putzen. Ihr Blick fiel auf eine kleine Pfütze, die sich vor dem Gulli angesammelt hatte. Zu ihrem Erstaunen sah sie in dem Spiegelbild sich selbst, Prinzessin Laura, die sich ihren Mund am Ärmel abzuwischen schien. Laura erstarrte. Sie tastete mit den Händen ihren Körper ab.
»Du bist wieder ein Mensch!«, jubelte Lelia.
Luzi sagte nichts. Aber Laura spürte, wie er ihr verärgert ins Ohr kniff. Laura schnappte sich den Schlüssel und lief zum Königlichen Schloss. Im Keller steckte sie ihn ins Schloss und drehte ihn herum.
Der kleine König Magnus lehnte mit verschränkten Armen nachdenklich an der Wand. Er blickte überrascht auf.
»Papa, entschuldige bitte!«, rief Laura und fiel ihm um den Hals. »Es tut mir leid, dass ich so gemein war!«
Der König fasste sie an den Schultern und hielt sie so vor sich, dass er ihr in die Augen schauen konnte.
»Laura, mein Prinzesschen«, sagte er rau, »ich glaube, ich bin auch nicht immer ganz nett zu dir. Vielleicht brauchen Menschen in deinem Alter doch ein bisschen mehr Papa.«
Lelia und Luzi hatte es ausnahmsweise mal gleichzeitig die Sprache verschlagen. Laura schmiegte sich an ihren Vater. Er war so groß, dass sie ihr Gesicht unter seiner Achsel verstecken konnte.
Der König schnupperte.
»Sag mal, du riechst ja, als hätten sie dich aus dem Gulli gezogen!«, sagte er. »Höchste Zeit, dass ich dir mal wieder den Kopf wasche!«
Und das war ja wohl auch höchste Zeit.
Die Raubritter
Etwa alle Vierteljahr mussten wir uns ihnen unterwerfen, den roten Rittern.
Unsere Hofmarschallin fuhr jede Woche mit der Kutsche vor und zahlte einen hohen Tribut, damit wir weiterhin Wegerecht erhielten. Es nützte nichts.
Die roten Ritter blickten stets grimmig und suchten uns mit beißendem Gestank zu benebeln. Sie richteten ihre Lanzen drohend gegen die Kutsche und prüften sie mit ihren Turbosensoren. Wenn sie fertig waren, musste die Hofmarschallin zu dem Hauptmann und den ständig steigenden Tribut bezahlen. Wenn er gnädig winkte, wussten wir, dass wir passieren konnten.
Aber das war ihnen nicht genug.
Sie mussten uns ihre Macht spüren lassen. Und sie waren sehr mächtig. Weil sie über magische Kräfte verfügten. Deshalb konnten sie alles mit uns machen. Es machte ihnen Freude, uns zu quälen.
Der Schlossherr überließ diese unangenehmen Dinge immer der Hofmarschallin. Viermal im Jahr schickte er sie zu dem Unterwerfungsritual. Weil wir wussten, dass sie panische Angst davor hatte, begleiteten wir sie.
Wieder musste sie mit dem Hauptmann verhandeln. Anders als bei ihren wöchentlichen Tributzahlungen suchte sie ihn gleich vorab mit Silber und Gold zu beschwichtigen. Aber er kannte kein Erbarmen, niemals.
Kaum hatte er das Geld eingestrichen, hob er das Laserschwert, woraufhin die Hofmarschallin sich zitternd in der Kutsche verkroch. Das machte ihn erst recht wütend. Er richtete einen heißen Dampfstrahl gegen die Karosse. Von allen Seiten attackierte er sie, bis uns Hören und Sehen verging.
Dann spürten wir, wie wir mitsamt der Kutsche weggeschoben wurden. Ein Schneegestöber hob an, bis wir in völliger Finsternis versanken.
Sie ließen alle Elemente gegen uns toben: Hagelschauer prasselten auf unser Verdeck. Ungeheuer tauchten rechts und links des Weges auf. Sie bedrängten uns von allen Seiten, unten und oben und suchten uns zu verschlingen, spritzten Gift und leckten mit gierigen Zungen an unserer Kalesche. Wir hatten Fenster und Türen fest verschlossen und klammerten uns aneinander, während die Hofmarschallin magische Gebete sprach. Da wichen die Ungeheuer.
Noch wollten die roten Ritter uns jedoch nicht ziehen lassen. Sie hatten einen Baumstamm quer über unseren Weg gelegt.
Wenn wir dann mit dem Mut der Verzweiflung flehten und baten, dass sie uns durchlassen sollten, dann hob sich schließlich der Schlagbaum wie von Zauberhand, und wir konnten darunter hergleiten.
Ein letztes Mal ließen sie schwarze Netze vom Himmel fallen, um uns zu schrecken. Aber wir ballten die Fäuste in den Taschen und riefen: »Lasst uns ziehen! Lasst uns ziehen!«
Auf einmal spürten wir einen Sonnenstrahl, und noch einen und immer mehr.
Und schließlich waren wir ihnen entkommen.
Jubelnd fielen wir uns in die Arme und umarmten die Hofmarschallin, die immer noch am ganzen Leibe zitterte und die Pferde mit der Peitsche antrieb, dass wir schnell nach Hause kamen.
Bis zum nächsten Mal. Bis der Schlossherr wieder meinte, der Wagen habe es nötig. Bis die Hofmarschallin uns wieder zusammentrommelte und wir wieder in die Schlacht zogen. Obwohl von vornherein feststand, dass wir keine Chance hatten gegen die Barone von Tank und Wasch.
Oder gerade deswegen.
Das Christkind auf dem Bayer-Kreuz
Die Geschichte, die ich euch erzählen will, hat sich vor gar nicht allzu langer Zeit zugetragen. Vielleicht erst gestern. Oder vielleicht wird sie erst stattfinden. Wer weiß das schon so genau. Die Welt ist voll von Geschichten, die irgendwann einmal passiert sind oder passieren könnten, ob in der Wirklichkeit oder in unseren Köpfen.
Meine Geschichte spielt in Leverkusen. Das ist ein kleines Städtchen in Deutschland, in dem Oma Lisabeth lebt. Nicolas wohnt seit einem halben Jahr auch da. Vorher hat er in Bayern gelebt. Immer, wenn er Oma besucht hat, ist Mama an der Autobahn genau da rausgefahren, wo das große Wegkreuz steht. Mama sagte, das hätten sie extra für Besucher aus Bayern aufgestellt, dass sie wissen, wo es lang geht. »Bayer« steht kreuz und quer darauf. Das konnte Nicolas schon lesen, bevor er in die Schule kam.
Es war kurz vor Weihnachten, für Kinder die spannendste Zeit im Jahr. Außer Ostern vielleicht oder Karneval. Oder Ferien. Oder Kommunion. Jedenfalls ziemlich aufregend, weil es mächtig viele Prospekte gibt, in denen unglaublich viele Sachen angeboten werden, und man nie so genau weiß, ob man die angekreuzten Artikel auch in der richtigen Ausführung bekommen wird oder ob Oma Lisabeth nicht statt des gewünschten Computerspiels ein Buch besorgen wird. Nicolas war etwas in Sorge, als er Oma Lisabeth den Prospekt mit seinem Geschenkvorschlag präsentierte. Sie schien nur mit halbem Ohr hinzuhören.
»Ich guck mir das Kreuzchen nachher in Ruhe an«, sagte sie. »Wenn ich mir die Brille aufgesetzt hab. Dann bespreche ich mal mit dem Christkind, ob es dieses Jahr auch zu dir kommt.« Damit faltete sie den Prospekt zusammen und schob ihn in die Schürzentasche. »Erzähl mir lieber, wie es in der Schule läuft.«
»Eigentlich fast super«, antwortete Nicolas. »Die Lehrerin meint, wenn ich mal was zur Sache sagen würde, dann wär alles super.«
»Wie, zur Sache?« Oma war ein bisschen begriffsstutzig.
»Na ja, halt, was so dran ist.«
»Na und was für eine Sache ist so dran?«
»Na, Sachen halt. Sie nennt es Sachunterricht.«
Oma Lisabeth war nicht nur begriffsstutzig, sondern darin auch noch äußerst beharrlich. Sie sah Nicolas über ihrer Lesebrille erwartungsvoll an, und Nicolas wühlte verzweifelt in seinem Gedächtnis.
»Leverkusen und so«, fiel ihm schließlich nach einigem Nachdenken ein.
»Heimatkunde«, meinte Oma erfreut. »Da kann ich dir auch einiges zu erzählen.«
Das war nun nicht gerade das, was Nicolas wollte. Aber Oma Lisabeth.
»Weißt du eigentlich, wie Leverkusen überhaupt entstanden ist?«, wollte sie wissen.
Das hatte Nicolas zum Glück behalten. »Herr Leverkusen hat es gegründet. Er hat eine große Fabrik gebaut und Wohnungen für die Leute.«
»So, so«, meinte Oma Lisabeth über ihre Lesebrille hinweg. »Woher kamen denn die Leute?«
»Von irgendwo«, vermutete Nicolas. »Es gab eine Völkerwanderung. Oder die wohnten halt hier.«
»Was meinst du denn, was die gemacht haben, bevor der Herr Leverkusen, wie du ihn nennst, gekommen ist?«
»Keine Ahnung.«
»Was lernt ihr denn bloß in der Schule«, sagte Oma Lisabeth böse. »Die lebten von der Fischerei. Leverkusen war früher ein Fischerdorf, vielmehr mehrere. Heute ist das alles eine Stadt mit mehreren Stadtteilen. Aber früher waren das einfach kleine Fischerdörfer.«
»Fischerdörfer?«, fragte Nicolas ungläubig, »Hier ist doch kein Meer!«
»Komm mit, ich zeig dir, wo die Fische herkamen«, sagte Oma.
An dem Tag hängte Oma Lisabeth ihre Schürze an den Haken, holte ihren karierten Wollmantel hervor und marschierte mit ihrem Enkel zum Rhein. Es war eine ganz schöne Strecke, weil man erst an der großen Fabrik vorbeimusste. Aber irgendwann kamen sie an. Sie gingen bis zum Wasser, und da gab es Kiesel und sogar Muscheln, Wellen, Treibholz und einen linken Schuh. Nicolas sammelte auf, was ihm gefiel, schmiss Steine ins Wasser, lief vor den Wellen weg, die die großen Frachtkähne machten, und kriegte trotzdem nasse Füße. Zum Glück merkte Oma es nicht, weil sie ihre Brille zu Hause gelassen hatte.
Sie wanderten ein Stückchen am Rhein entlang, bis sie zu der Autobahnbrücke kamen. Da kletterte Oma Lisabeth mit ihrem Enkel hoch. Nicolas lief vor bis zur Mitte der Brücke und spuckte von oben auf die Lastkähne.
»Siehst du jetzt, dass Leverkusen am Wasser liegt?«, fragte Oma Lisabeth, die ein wenig keuchte, als sie endlich nachkam.
»Nein«, sagte Nicolas. »Wo ist denn Leverkusen?«
Von der Stadt war tatsächlich nichts zu sehen, nur die unendlich große Fabrik, die ans Rheinufer grenzte. Sie war so groß, dass man dahinter keine Häuser erkennen konnte.
»Dafür haben sie die Landesgartenschau gemacht«, sagte Oma nachdenklich, »damit die Leverkusener endlich wieder an den Rhein gehen können.«
»Landesgartenschau?«, fragte Nicolas.
»Das Gelände hinter der Fabrik, oberhalb von da, wo wir gerade am Rhein entlanggelaufen sind.«, meinte Oma. »Das war früher eine Müllkippe. Bis sie gemerkt haben, dass das nicht gut für die Umwelt war. Da haben sie die Deponie abgerissen und einen Park daraus gemacht.«
Aber Nicolas hatte etwas anderes entdeckt. »Ich seh’ das Kreuz!«, rief er.
Oma seufzte. »Das hätten sie fast auch abgerissen.«
Nicolas erschrak. »Dann hätte Mama nicht mehr gewusst, wo sie abfahren muss.«
»Eben. Da sind die Leute auf die Barrikaden gegangen, und jetzt bleibt es hoffentlich. Das wäre jedenfalls mein größter Wunsch.«
»Was sind Barrikaden?«, wollte Nicolas wissen.
Eine Barrikade ist eine Art Schutzwall«, sagte Oma.
»Ein Geländer?«, fragte Nicolas und guckte zwischen den Stäben nach unten.
Oma Lisabeth lachte. »So ungefähr.«
»Bist du auch auf die Barrikaden gegangen?«
»Natürlich.« Oma gab ihm einen Nasenstüber. »Das Bayer-Kreuz steht schließlich für meine Heimat. Deine doch jetzt auch.«
In der Nacht übernachtete Nicolas bei seiner Oma. Er schreckte mehrmals aus Albträumen hoch, in denen Oma auf das Brückengeländer geklettert war und herunterstürzte. Als er das zweite Mal in diesen Traum geriet, konnte er sie gerade noch an ihrem karierten Wollmantel erwischen, aber sie riss ihn mit sich, sodass sie beide auf einen großen Frachtkahn zu stürzen drohten, der gerade vorbeizog. Zum Glück wachte er auf, ehe sie aufschlugen.
Als er zum dritten Mal lange wach gelegen hatte, stand er schließlich auf, zog seine warme Winterjacke und die gefütterten Stiefel an und marschierte los in Richtung Bayer-Kreuz. Er wollte das Christkind sprechen. Das Kreuz schien ihm der ideale Treffpunkt, weil es erstens schön weit in den Himmel ragte, zweitens so hell beleuchtet war, dass das Christkind es auch nicht übersehen konnte, und drittens, weil das Christkind ja zum Kreuz gehörte, das hatte er schließlich im Religionsunterricht gelernt. Wenn das Kreuz den Bayern den Weg weisen konnte, dann musste das Christkind es doch erst recht finden. Lesen konnte es vermutlich nicht. Schließlich war es in einem Stall aufgewachsen. Aber das war auch ganz gut so, denn sonst konnte es am Ende meinen, es sei gar nicht gemeint.
Oma Lisabeth hatte Nicolas früher Geschichten vorgelesen von Kindern, die das Christkind auch mal sehen wollten. Die hatten ihm Geschenke hingestellt, und da war es auch gekommen. Ein Geschenk konnte Nicolas in der Nacht nicht so leicht auftreiben. Außerdem musste er die Hände frei haben, damit er klettern konnte. Er grübelte ein bisschen, weil es ja auch was Besonderes sein sollte, etwas, was das Christkind sonst nicht kriegte, damit es auch einen Anreiz hatte, gerade zu ihm nach Leverkusen vom Himmel runterzukommen. Und da fiel ihm schließlich etwas ein. Etwas typisch Leverkusenerisches.
Es war leichter, als er geglaubt hatte, auf das Kreuz zu klettern. Nicolas hatte schon lange gewusst, dass das möglich war, weil irgendjemand ja jeden Abend die ganzen Glühbirnen anmachen musste, aus denen es bestand. Ihm war aufgefallen, dass derjenige wohl gelegentlich eine Birne vergessen hatte einzuschalten. Da war dann ein kleines Loch in der Lichterschnur gewesen. Als er schließlich rittlings oben saß und nach unten guckte, war es zum Glück so düster, dass ihm gar nicht schwindelig wurde so hoch oben am Himmel. Die Sterne waren aber noch sehr weit entfernt. Nicolas überlegte eben, ob er das Christkind wohl rufen sollte, als er ganz hoch oben auf einmal eine Sternschnuppe sah. Er zerrte schnell ein kleines Päckchen aus der Jackentasche, schwenkte es hoch über den Kopf und schrie aus Leibeskräften: »Christkind, komm und guck, was ich dir mitgebracht habe!«
Der kleine Leuchtpunkt irrlichterte ein bisschen hin und her, dann kam er näher und näher, in rasender Geschwindigkeit, ein gleißend heller Lichtschein flammte vor ihm auf, und es gab einen kleinen Rumms.
Nicolas hatte die Augen zusammengekniffen, weil das Licht so blendete, aber riss sie sofort wieder auf. Er sah tatsächlich das Christkind vor sich auf dem Bayer-Kreuz sitzen, blond gelockt, mit roten Pausbäckchen und einem weißen langen Hemd bekleidet.
»Na, dann zeig mal her«, sagte das Christkind und lachte.
Nicolas hielt ihm das kleine Päckchen entgegen. »Eine Leverkusener Spezialität«, sagte er stolz.
»Bonbons!«, rief das Christkind entzückt. »Das ist aber lieb!«
Es drückte gleich mehrere der kleinen Pastillen aus der Verpackung und warf sie mit einer flinken Handbewegung in den Mund, lutschte erst ein bisschen, kaute dann vorsichtig und sah etwas irritiert aus. Als es Nicolas’ enttäuschten Gesichtsausdruck sah, setzte es sofort wieder sein strahlendstes Lächeln auf. »Schmeckt interessant«, sagte es.
»Ich hab es selbst noch nie gegessen«, meinte Nicolas. »Aber Oma Lisabeth sagt, es wirkt Wunder.«
Das Christkind lachte ein glockenhelles Lachen. »Ein Wunder könntest du gebrauchen?«, fragte es.
»Na ja, es wäre nicht für mich«, sagte Nicolas zögerlich.
Das Christkind zog die linke Augenbraue hoch. »Du wolltest dieses Computerspiel mit jemandem teilen?«, fragte es ungläubig.
Nicolas spürte, wie er rot wurde. »Nein, das mein ich ja gar nicht«, sagte er hastig. »Ich mein, ich will, dass das Kreuz nicht abgerissen wird. Es ist Omas größter Wunsch.«
»Und wie kann ich euch dabei helfen?«, fragte das Christkind neugierig und hielt sich eine Hand auf den Bauch.
»Du sorgst dafür«, sagte Nicolas.
Das Christkind schaute ihn geistesabwesend an.
»Na ja, zumindest könntest du es versuchen«, besserte Nicolas nach.
Das Christkind gab einen kleinen Rülpser von sich, zuckte von dem eigenen Geräusch zusammen und guckte Nicolas verlegen an. »Entschuldige«, sagte es. »Das war nicht sehr christkindlich, aber es ist mir so rausgerutscht. – Was hast du gerade gesagt?«
»Ich meine, du könntest es vielleicht einfach mal im Auge behalten«, sagte Nicolas, dem die Sache immer peinlicher wurde.
»Im Auge?«, fragte das Christkind verständnislos und fasste sich erst ans linke, dann ans rechte Auge. Doch dann griff es wieder nach seinem Bauch. Dort blubberte etwas.
»Tut mir leid«, kicherte es, »mir ist irgendwie komisch. Es sprudelt so.«
Als es Nicolas’ enttäuschten Blick sah, sagte es schnell: »Ich will sehen, was sich machen lässt. Aber ich glaub, ich muss jetzt wieder los.«
Damit richtete es sich auf. Es stand neben ihm ganz oben auf dem Bayer-Kreuz und schwankte ein bisschen.
»Danke, Christkind«, sagte Nicolas. »Das ist wirklich total nett von dir.«
Das Christkind antwortete nicht, sondern schwankte etwas stärker. Es kicherte wieder, fasste mit beiden Händen nach seinem Bauch, verlor das Gleichgewicht und schien auf einmal kopfüber von dem Bayer-Kreuz zu stürzen.
»Nicht!«, schrie Nicolas erschrocken. »Halt!« Er beugte sich vor, um das Christkind an seinem weißen Hemdchen zu erwischen. Das gelang ihm auch, aber er verlor selbst den Halt dabei, und so fiel er am Rockzipfel des Christkindchens in die unergründliche Schwärze unter dem hell erleuchteten Bayer-Kreuz.
Als Nicolas zu sich kam, lag er in seinem Bett. Er hatte wieder seinen Schlafanzug an, und es dauerte eine ganze Weile, ehe ihm klar wurde, dass er wohl geträumt haben musste. In der Küche hörte er Oma Lisabeth kramen, und alles war wie immer. Nur dass heute Heiligabend war und er das Christkind wohl doch nicht gesehen hatte. Er richtete sich auf, schlüpfte in seine Pantoffeln und schlich zu Oma Lisabeth in die Küche. Die Oma öffnete und schloss gerade alle Küchenschranktüren und drehte sich nicht nach ihm um.
»Guten Morgen, Oma«, sagte Nicolas. »Stell dir vor, ich hab heute Nacht von dem Christkind geträumt.«
»Das ist schön, mein lieber Junge«, sagte die Oma zerstreut. »Aber sag mir doch bitte mal: Wo ist das Schächtelchen mit meinen Aspirin bloß geblieben?«
Guckkastenbiest
Weil Roman Knöfel und ich an dem Morgen zu spät kamen, mussten wir zusammen einen Guckkasten bauen. Es war der totale Flop. Das Märchen fand er blöd, malen konnte er auch nicht. Der Prinz, den er ausschnitt, ähnelte einem Gorilla. Ich hatte »Dornröschen« vorgeschlagen, aber dann schwenkte ich um auf »Die Schöne und das Biest«. Er kannte die Geschichte nicht und hörte auch nur mit halbem Ohr zu.
Als wir unser Guckkastenkino vorführten, lag die ganze Klasse am Boden. Reden konnte Roman nämlich! Allerdings klang es eher nach einer Fußballreportage: »Aber jetzt! Wer bricht da aus der Deckung hervor? Ein Löwe! Er nähert sich unaufhaltsam dem armen Kaufmann –«, und so weiter.