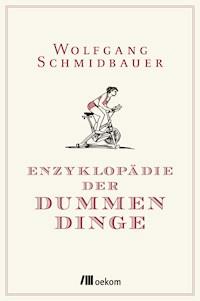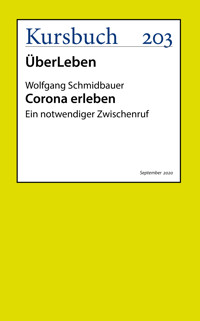9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Liebe, Mißbrauch und Narzißmus – darum geht es in diesem Buch des Psychoanalytikers Wolfgang Schmidbauer. Mit seinem 1977 erschienenen Standardwerk «Die hilflosen Helfer» hat er den Begriff «Helfer-Syndrom» eingeführt. In dem vorliegenden Text über Helfer-Fehler ist die Tendenz spürbar, Abstand zu gewinnen und den in der «Psycho-Szene» verbreiteten Neigungen zu Fanatismus und Humorlosigkeit zu begegnen. «Viele Leser haben mich ausschließlich für einen Kritiker der Helfer gehalten. Sie werden sich wundern, wenn ich diesmal vor einer Dämonisierung der Helfer warne. Näher betrachtet, ist freilich der Zusammenhang zwischen der Kritik des Helfer-Syndroms und der Kritik an einer völligen Entwertung fehlerhafter Helfer nur logisch.»
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 385
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Wolfgang Schmidbauer
Wenn Helfer Fehler machen
Liebe, Mißbrauch und Narzißmus
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Liebe, Mißbrauch und Narzißmus – darum geht es in diesem Buch des Psychoanalytikers Wolfgang Schmidbauer. Mit seinem 1977 erschienenen Standardwerk «Die hilflosen Helfer» hat er den Begriff «Helfer-Syndrom» eingeführt. In dem vorliegenden Text über Helfer-Fehler ist die Tendenz spürbar, Abstand zu gewinnen und den in der «Psycho-Szene» verbreiteten Neigungen zu Fanatismus und Humorlosigkeit zu begegnen.
«Viele Leser haben mich ausschließlich für einen Kritiker der Helfer gehalten. Sie werden sich wundern, wenn ich diesmal vor einer Dämonisierung der Helfer warne. Näher betrachtet, ist freilich der Zusammenhang zwischen der Kritik des Helfer-Syndroms und der Kritik an einer völligen Entwertung fehlerhafter Helfer nur logisch.»
Über Wolfgang Schmidbauer
Wolfgang Schmidbauer, geboren 1941 in München, studierte Psychologie und promovierte 1968 über «Mythos und Psychologie». Tätigkeit als freier Schriftsteller in Deutschland und Italien. Ausbildung zum Psychoanalytiker. Gründung des Instituts für analytische Gruppendynamik. Psychotherapeut und Lehranalytiker in München.
Inhaltsübersicht
Vorwort
Und dann ging der Kaiser in der Prozession unter dem herrlichen Thronhimmel, und alle Leute auf der Straße und in den Fenstern riefen: «Herrgott, wie unvergleichlich sind doch die neuen Kleider des Kaisers! Was für eine reizende Schleppe hat er am Rock, und wie sitzt sie großartig!» Keiner wollte sichs anmerken lassen, daß er nichts sah; denn dann hätte er ja für sein Amt nicht getaugt oder wäre sehr dumm gewesen! Keins von den Kleidern des Kaisers hatte je einen solchen Erfolg gehabt.
«Aber er hat ja nichts an!» sagte ein kleines Kind.[*]
Seit ich vor über zwanzig Jahren beschloß, doch noch etwas mit dem Psychologiestudium anzufangen, das ich neben meiner Redaktionsarbeit absolviert hatte, fühlte ich mich in der Welt der Helfer immer ein wenig wie ein Ethnograph. Das mag daran liegen, daß meine frühen Interessen in diese Richtung gingen; ich hatte über Mythen promoviert und eine Weile meinen eigenen ethnologischen Dilettantismus gegen den der Human-Ethologen der Lorenz-Schule gesetzt.[*] So erschien mir die Welt der Psychotherapeuten, in die ich mit der Absicht geriet, mein doch sehr theoretisches Wissen durch praktische Kenntnisse in Psychoanalyse und Gruppentherapie aufzubessern, wie ein Dschungel abseits der großen Strömungen der Naturwissenschaft, von einem bunten Gemisch der unterschiedlichsten Stammeskulturen besiedelt. Es erinnerte an das, was ich über Neuguinea gelesen hatte: Bereits nach einer Tagesreise verstehen die Angehörigen des einen Volkes die Sprache des nächsten nicht mehr. Jede Sprachgruppe ist der festen Überzeugung, daß jenseits der Berge mit der eigenen jede Zivilisation endet und ein Reich der Dämonen beginnt.
Diesem naiven Blick und der Leidenschaft für eine genaue Beschreibung verdanke ich das Thema der «hilflosen Helfer», das mein Leben so beeinflußt hat, wie es eben ein Bestseller mit seinem Autor zu tun pflegt. Nachdem ich bereits längere Zeit rein theoretisch Mythologie und Dogmatik der einzelnen psychotherapeutischen Glaubensrichtungen studiert hatte, kam ich nun mit dem konkreten Verhalten der Helfer in Berührung. Ich war Reporter genug geblieben, um zu erkennen, daß die offenkundigen Widersprüche zwischen dem Glaubensbekenntnis und der Lebenspraxis ein interessantes Thema boten. Es wiederholte sich, was mich bereits als Kind, sobald ich anfing, die frommen Katholiken meiner Passauer Heimat genauer zu beobachten, ebenso gefesselt wie dem katholischen Glauben entfremdet hatte: Verhalten und Verhaltensbegründungen paßten nicht zusammen.
Da hatte ich den psychosozialen Helfern, die doch wissenschaftlich fundiert und weltlich arbeiteten, etwas anderes zugetraut. Ich dachte, daß Ärzte besonders gesund leben müßten, daß Pädagogen sich gerne anderen Erziehern aussetzen und Therapeuten, die doch die Wohltat des offenen Ausdrucks preisen, bereitwillig über ihre Gefühle sprechen. Jetzt war es aber wieder ähnlich, ja noch krasser, denn die Religion hatte viele Bilder für die menschliche Schwäche angesichts des Erhabenen, die Helfer aber verstummten, wenn es um die Anwendung ihrer eigenen Aussagen auf sie selbst ging.
So wurde es zu meiner Arbeitshypothese, daß Menschen manchmal deshalb Helfer werden, weil es ihnen so schwer fällt, sich helfen zu lassen. Aus diesem Grund delegieren sie die Abhängigkeit nach außen, an ihre Schützlinge.
Vielleicht paßte das Buch in den Zeitgeist. Es erschien 1977, der Reformoptimismus der 68er verebbte. Die Bewegung hatte sich zersplittert, auf dem langen Marsch durch die Institutionen aufgezehrt. Ich war bis 1970 die meiste Zeit in Italien, in einer ländlichen Idylle gewesen und hatte mich nur theoretisch mit der Studentenbewegung (die ein Jahr nach meinem Examen einsetzte) beschäftigt. Seit 1971 arbeitete ich selbst mit Gruppen und suchte Kontakt zu anderen Therapeuten, deren Gemeinsamkeit vor allem ihre Distanz zu den etablierten Therapieausbildungen war, die wir als zwanghaft, verschult, kurzum als reaktionär ablehnten. Damals lernte ich neben anderen auch Günter Ammon und Siegfried Gröninger kennen, schillernde Charaktere mit beträchtlichen Organisationstalenten.[*]
Es war eine bewegte und bewegende Zeit, in der ich Illusionen über die Möglichkeiten, durch Gruppenanalyse «befreite Gebiete» in einer repressiven Gesellschaft zu schaffen, aufbaute und wieder revidierte. Vom Nutzen der Gruppenarbeit in Therapie und Erwachsenenbildung wurde ich bleibend überzeugt. Der Widerspruch zwischen der nach außen deklarierten, strahlenden Helfer-Fassade und dem Elend, das sich dahinter so oft abspielt, hat mich vielleicht auch gerade wegen dieser Begegnungen mit verschiedenen Helfer-Szenen bewegt und interessiert. Ich sah, wie die Kritiker des Establishments zwar die Scheinheiligkeiten anderer aufdeckten, aber in dieser vermeintlichen Entlarvung an eigenen Fassaden bastelten, hinter die sie nicht blicken lassen wollten. Und ich habe miterlebt, wie schnell in sozialen Bewegungen, kaum geben sie sich eine Satzung und organisieren sich als Verein, eben die Ausgrenzungsmechanismen und Richtungskämpfe einsetzen, die man bislang den Rivalen angekreidet hatte. Solche Beobachtungen sollten uns wachsam erhalten. Wenn ihre Beschreibung gelegentlich zynisch klingt, erinnere ich mich lieber an den Ursprung dieses Wortes, als doch wenigstens ein Stück von des Kaisers neuen Kleidern zu preisen. Kyon, der Hund, ist auch ein Wächter, der selbst denen dient, die ihn verachten.
Fehler zu erkennen, aus Fehlern zu lernen, das heißt in der Therapie auch: eine liebevolle Beziehung zu Fehlern entwickeln. Möglicherweise ist auch dies eine zynische Bestrebung. Kein geringerer als Diogenes hat die Flöhe gepriesen, die ihn plagten, da ihn ihre juckenden Stiche wachsam erhielten. Eine liebevolle Beziehung zu Fehlern schien mir immer der beste Weg, sie zu erkennen und zu vermeiden, und in dieser Haltung erkannte ich einen wesentlichen Vorzug meiner «neuen», therapeutischen Umgangsformen gegenüber den «alten», normativen, die ich während meiner Schulzeit erlebt hatte. Das hing damit zusammen, daß ich, je älter und wachsamer ich wurde, um so weniger humorlose Menschen um mich haben mochte – Humor ist schließlich eben jene Qualität, die Diogenes vor anderen Philosophen auszeichnete.
Wer sich für Humor interessiert, muß sich auch mit dessen Grenzen beschäftigen, also mit jenem Bereich, an dem eigentlich Schilder stehen müßten wie: Jetzt wird’s ernst! Von hier ab kein Pardon! Beim Geld (beim Sex, bei der Macht) hört der Spaß auf. Die meisten Menschen halten sich für humorvoll, bis sie an eine solche Grenze gebracht werden; wer sie bei ihnen überschreitet, gerät aus der Idylle in ein Minenfeld. In der Therapie der gegenwärtig überwiegenden Form von psychischen Problemen – jener vom narzißtischen Typus – ist nach meiner Überzeugung ein ganz wesentlicher Schritt getan, wenn es gelingt, ein gemeinsames Interesse daran zu entwickeln, wann und unter welchen Umständen Klient (und Therapeut) ihren Humor zu verlieren drohen. Dieser Grenzpunkt hängt eng mit Empfindungen zusammen, festgehalten zu werden und sich unterwerfen zu müssen. Wer den Humor verliert, kann nicht mehr gleichberechtigter Partner einer Interaktion sein. In der Therapie ist dann der Helfer nicht ein Mensch wie er, der an seiner Seite versucht, dem Leben etwas abzugewinnen, und sei es auch nur dessen tragikomische Seite. Er ist ein Verfolger, ein Gott, jemand, der unbetroffen ist vom Elend des Kranken und unerreichbar über menschlichem Leid schwebt.
In dem vorliegenden Text über Helfer-Fehler ist vermutlich die Tendenz des Autors spürbar, Abstand zu gewinnen und den Neigungen zu Fanatismus und Humorlosigkeit zu begegnen, die sich hier ankündigen. Viele Leser haben mich ausschließlich für einen Kritiker der Helfer gehalten. Sie werden sich wundern, wenn ich diesmal vor einer Dämonisierung der Helfer warne. Näher betrachtet, ist freilich der Zusammenhang zwischen der Kritik des Helfer-Syndroms und der Kritik an einer völligen Entwertung fehlerhafter Helfer logisch. Wie ich zeigen werde, stützt die Dämonisierung des «bösen» Helfers das Bedürfnis, um jeden Preis der «gute» zu sein. Sie gleicht der Entwertung von Eltern – vor allem von Müttern –, die eine üble Tradition in den Szenarien von Psychotherapeuten hat. In der traditionellen Gesellschaft mußten Eltern durchgefüttert werden[*], wenn sie schwach wurden; waren sie tot, durfte nur Gutes von ihnen gesagt werden. Heute hat man oft den Eindruck, daß die Beliebtheit der Vampir-Filme die Leidenschaft der Kinder ausdrückt, ihre lebenslangen Bedürfnisse nach perfekten Eltern in das Bild der Blutsauger zu projizieren, die untot in ihren Gräbern liegen. Wenn Pädagogen und Therapeuten ausziehen, um Eltern schlecht zu machen, sagt das häufig wenig über die seelische Entwicklung der betroffenen Kinder aus. Es signalisiert die narzißtischen Bedürfnisse von Helfern, die mit den Regressionswünschen ihrer Schützlinge einen ungesunden Pakt schließen, in dem zwar das Unerfüllbare nicht möglich gemacht, aber Sündenböcke für dieses Scheitern gefunden werden.
Helfer zu sein kann ein Beruf werden. Professionell zu helfen heißt aber, nicht immer und jederzeit als hilfreich bestätigt zu werden, sondern Grenzen zu definieren und damit auch zu akzeptieren, daß ein naives Bedürfnis, als guter (gar vollkommener) Mensch dazustehen, nicht erfüllbar ist. In dieser Situation entwickeln sich aus jenen Helfern, die nicht einfach in diesem Beruf arbeiten, sondern in ihm auch dauernd geliebt und bestätigt werden wollen, jene Über-Helfer, die ihre eigene Geltung unter anderem auch dadurch steigern, daß sie andere Helfer als egoistisch, inkompetent oder bösartig entlarven.
Sexueller Mißbrauch in der Therapie, dieser heute publizistisch am meisten ausgeschlachtete Helfer-Fehler, ist zugleich für die Untersuchung der Probleme von «neuen Helfern» von besonderem Interesse. In den soziologisch orientierten Reflexionen über den Gegensatz von «alten», normativen und «neuen», beziehungsorientierten Helfern habe ich unter anderem die Wechselwirkung von Beruf und Privatleben untersucht, die doch dort eine spezielle Rolle spielen muß, wo es zur zentralen Aufgabe des Helfers gehört, eine emotionale Beziehung herzustellen und aufrechtzuerhalten.
Ich beschrieb vier Typen[*]: das Opfer des Berufs, in dem der intimitätsnahe Beruf das Privatleben ersetzt; den Perfektionisten, der unter ungeheueren Druck gerät, weil er privates Scheitern und völliges menschliches Versagen nicht unterscheiden kann, da er sich z.B. als Ehetherapeut durch eine Scheidung entwertet fühlt; den Spalter, der seinen Beruf benützt, um sich aus privater Emotionalität herauszuhalten («Bitte fang damit nicht an, ich muß mir den ganzen Tag die Klagen deprimierter Frauen anhören!»). Der letzte Typus war der Pirat, von dem ich sagte, daß er den intimitätsnahen Beruf verwendet, um sein Privatleben auszufüllen; ich erwähnte auch sogleich die sexuelle Beziehung als häufigstes und auffälligstes Beispiel der Piraterie, konzentrierte mich dann aber auf zwei andere Gesichtspunkte: 1. die allgemeine Regressionsförderung und Verwöhnung durch den Beruf des Therapeuten, der so viele Möglichkeiten hat, Beziehungen zu kontrollieren, und z. die narzißtische Piraterie.[*]
Es ist ein gar zu einfaches Modell und ein Rückfall in vorpsychoanalytische Zeiten, in der Rede vom «sexuellen Mißbrauch» vorzugeben, es gebe einen Verhaltenskodex, der mißbrauchende von unschuldigen Therapeuten so unterscheidet, wie es der sizilianische Bräutigam zwischen Jungfrau und Hure tut. Der therapeutische Ge-Brauch einer engen, emotionalen Beziehung ist grundsätzlich in Gefahr, zu einem Miß-Brauch zu werden; die Konzentration auf den Sexualakt vereinfacht diese Situation in einer ebenso humorlosen wie wissenschaftlich unfruchtbaren Weise. Nur die Polemik und die Schlagzeilen gedeihen, wenn «Forscher» wieder einmal auf hohe Dunkelziffern und tiefgehende Schäden hinweisen. Eine merkwürdige Projektion steckt in dem Gedanken, daß heute ein Moralist des Mißbrauchs der Mutige in einer Welt von Verschweigern und Vertuschern ist. Auseinandersetzungen zwischen Helfern werden fast immer indirekt, im Namen der Schützlinge geführt. Sonst aggressionsgehemmte Helfer können beträchtliche Angriffslust entwickeln, sobald sie im Namen und vermeintlichen Auftrag eines Schwachen, eines Opfers reden. Auf diese Weise ist es oft sehr schwer, die Interessen zu erkennen, welche hinter den Argumenten stehen.
Immer ist Vorsicht angebracht, wenn jemand für einen anderen spricht – für «seine» Patienten, für «die» Opfer. Politiker, die für ihre Wähler, Produzenten, die für ihre Kunden sprechen, werden durch Abstimmungen oder Kaufentscheidungen mit der Realität konfrontiert. Helfer, die für Unmündige, Entmündigte oder mundtot gemachte Opfer sprechen, benötigen sehr viel mehr Selbstdisziplin, um der Verführung zu entgehen, eigenen Projektionen zu folgen.
Wer Sachlichkeit mit einer Parteinahme für die Täter verwechselt, schadet den Opfern, denen mit Versprechungen nicht gedient ist. Im Zweifel für den Angeklagten heißt nicht: im Zweifel gegen das Opfer.[*] Wer so argumentiert, verläßt die Gewaltenteilung im Rechtsstaat. Der Richter entscheidet gegen eine Strafe, wenn die Beweise nicht ausreichen, um die Übel, welche durch die Tat ohnehin entstanden sind, nicht noch durch die Strafe für einen möglicherweise Schuldlosen zu vermehren. Wenn er einen Verdächtigen freispricht, heißt das keineswegs, daß er ein Opfer für schuldig erklärt. Im Gegenteil: Er schützt auch das Opfer vor dessen möglicherweise vorhandenen Wünschen nach blinder Rache. In solchen Kurzschlüssen der Argumentation spiegelt sich eine Größenphantasie engagierter Helfer, die von Standards der Gewaltenteilung nichts wissen wollen und einem gutgemeinten Modell der Lynchjustiz verfallen. Diese kann nur in einer filmisch geschönten Fassung[*] über ihre primitiven, im Faschismus neu belebten Qualitäten hinwegtäuschen.
Bei meiner Suche nach Gründen für die Irritation durch solche doch letztlich harmlosen Äußerungen bin ich in den Erinnerungen an meine Begegnungen mit therapeutischen Sekten fündig geworden. Was die Sektierer, von denen ich auf meiner Expedition in die Psycho-Szene einige aus der Distanz, zwei aber aus großer Nähe kennenlernte, zu einer traumatischen Erfahrung werden läßt, ist gerade ihre Stilisierung zum Über-Helfer, der unbedingt Bösewichte braucht, um endzulagern, was ihm mißlingt.
Während er selbst mit einer Ex-Patientin zusammenlebte, wurde einer dieser Gründer einer «neuen» Psychotherapieschule nicht müde, die sexuellen Abstinenzverfehlungen seiner Schüler zu kritisieren oder mißliebigen Kollegen solche zu unterstellen. In Gruppen und Einzeltherapien seiner «Schule» war es üblich, die Eltern und manchmal auch die Ehepartner der Patienten massiv anzugreifen, sie zu entwerten und für alle Mängel der Anpassung an die hehre Gründergestalt und ihre Ziele verantwortlich zu machen. Das ist der Stil der Sekte: Ihrer Wurzeln beraubt, binden sich die Neulinge intensiver an die totalitäre Gruppe. Was verkündet wird, sind die neuen Kleider des Kaisers.
So habe ich gelernt, zwischen dem Schutz für Opfer und der Selbst-Stilisierung als Retter und ideale Elterngestalt zu unterscheiden, in der die Opfer nicht mehr als Subjekte ernst genommen, sondern ein zweites Mal funktionalisiert werden. Ein Helfer, der scheitert, kann eine Person voller Entwicklungsmöglichkeiten sein. Ein Helfer, der nicht scheitern darf, ist gefährlich. Er droht, zum Superhelfer zu werden. Wodurch könnte er sich besser beweisen als durch den Entwurf von Dämonen, die vor oder neben ihm als Eltern, Partner, Helfer-Rivalen eine böse Wirkung hatten? So macht er seine Schützlinge nicht frei von seiner Hilfe, sondern vertieft ihre Abhängigkeit. Er appelliert an ihre regressiven Bedürfnisse und Opferphantasien. Er muß sie enttäuschen, aber er kann die Wut geschickt ablenken auf andere und so eine Idealisierung genießen, die ihm ebenso schadet wie seinen Klienten, obwohl sie beiden unentbehrlich werden kann.
Ich danke den Kolleginnen und Kollegen in der Münchner Arbeitsgemeinschaft für Psychoanalyse und in der Gesellschaft für analytische Gruppendynamik für zahlreiche Anregungen. Den größten Teil seines Wissens verdankt jeder Analytiker den Menschen, deren Namen er nie nennen darf: seinen Analysandinnen und Analysanden. Unersetzlich ist schließlich, wie immer in den letzten achtzehn Jahren, der Beitrag von Gudrun Brockhaus gewesen.
Einleitung
Er darf nicht die Szene des Hundewettrennens mit ihr aufführen, bei dem ein Kranz von Würsten als Preis ausgesetzt ist, und das ein Spaßvogel verdirbt, indem er eine einzelne Wurst in die Rennbahn wirft. Über die fallen die Hunde her und vergessen ans Wettrennen und an den in der Ferne winkenden Kranz für den Sieger.[*]
Sigmund Freud verdeutlicht mit diesem Gleichnis in seinem klassischen Text zur Übertragungsliebe die Situation der erotischen Abstinenzverletzung. Er versucht sozusagen, mit poetischen Mitteln eine Position zu gewinnen, in der er nicht nur das Preisgericht, einer der Wettkämpfer oder ein Zuschauer ist, sondern in dem es auch den Joker, den Spaßvogel gibt, der alles durcheinanderbringt. Die einzelne Wurst ist die kleine, unerlaubte, verwirrende sexuelle Befriedigung durch den Therapeuten.[*] Der Wurstkranz ist die legal erworbene, große Befriedigung durch das Leben nach der erfolgreichen Therapie (dem Wettrennen). Die Stimmung der Metapher ist ironisch. Nehmt bitte nicht allzu ernst, was ich sage, drückt sie aus. Tut nicht so, als ob der Siegespreis und das Mittel der Verwirrung wesensverschieden wären. Unterstellt keine Tragik, sondern nur ein komisches Versagen in einer Veranstaltung, die bei allem leidenschaftlichen Interesse auch ein Spiel ist.
Mein gegenwärtiges Interesse an dem Thema der Abstinenz-Verletzungen hängt mit der Erforschung der Konsumgesellschaft zusammen. Sexuelles Agieren von Therapeuten ist die typische Auswirkung des «jetzt haben – später zahlen»-Prinzips im Bereich der helfenden Berufe. Was ihr Verhalten ihre Klientinnen und sie kostet, ist den Beteiligten im Augenblick des Agierens gleichgültig. Darüber, so scheinen sie sich zu sagen, können wir uns immer noch Gedanken machen, später; jetzt wollen wir unsere Grenzüberschreitung erst einmal genießen.
Diese Verblendung verbindet den Professionellen, der seine Aufgabe der kurzfristigen Befriedigung opfert, mit dem Schützling, der einen mühevollen Weg abkürzen will, ihn aber in Wahrheit verlängert. Sie weckt heute offensichtlich weit heftigere Aggressionen als früher, setzt Bemühungen der Berufsverbände und selbst des Gesetzgebers in Gang. In Freuds ironischer und entspannter Debatte der Übertragungsliebe ist die Gefahr einer Enttäuschungswut nur angedeutet. Und während sie sich heute darauf bezieht, daß der übergriffige Therapeut fürchten muß, für seinen Mißbrauch einer Abhängigen bestraft zu werden, werden in Freuds Untersuchung der Enttäuschungs- und Racheaspekte eher die unliebsamen Folgen der professionellen Abstinenz als die einer Abstinenzverletzung betont.
Der heute als Mißbraucher von Kollegen und Opfern angegriffene Therapeut mußte damals weniger die Wut der Enttäuschten fürchten als die Selbstkritik, seine Aufgabe verraten zu haben. Und der Analytiker, der die Rache einer Verschmähten auf sich zog, erhielt eine Quittung für seine Unnachgiebigkeit.
Wie läßt sich dieser Paradigmenwandel erklären? Das gesellschaftliche Klima des Umgangs mit Helfer-Fehlern hat sich verändert. Das betrifft nicht nur die Mißbrauchs-Diskussion in der Psychotherapie, obwohl diese besondere Perspektiven eröffnet. Es entspricht einem Trend, der beispielsweise die Arbeitsweise in zentralen Bereichen der modernen Medizin erheblich beeinflußt. In dem Bestreben, sich abzusichern («defensive Medizin»), behandeln Ärzte nicht mehr nach dem Prinzip des größten Nutzens für den Patienten, sondern nach dem Prinzip des größten eigenen Schutzes vor Regreß-Ansprüchen. Nur ein naiver Betrachter wird behaupten, daß der Arzt, der sich maximal absichert, auch der ist, der am besten behandelt. Die Folgen sind z.B. in den USA bereits statistisch faßbar: Wo Anwälte besonders aktiv sind, unzufriedene Patienten für Schadensersatzprozesse zu gewinnen, sind nicht nur die Versicherungsprämien in schwindelnde Höhen gestiegen, sondern auch die Zahl der Entbindungen durch Kaiserschnitt hat sich dramatisch erhöht.
Die Fehler von Beziehungshelfern müssen deshalb besonders beachtet und gründlich erforscht werden, weil sie nicht in ähnlicher Weise objektiviert werden können wie die Fehler eines Chirurgen oder Geburtshelfers. Arbeit in emotionalen Beziehungen sollte immer kreativ, neuartig, nicht technisch vorgefertigt sein. Zur Professionalität des Therapeuten gehört es, daß er nicht in technischer Routine, sondern persönlich mit seinen Klienten umgeht. Das bedeutet aber auch, daß er weniger Schutz vor Verstrickungen gewinnen kann, als das in anderen Berufen möglich ist.
Die moralische Entrüstung über Mißbrauch in der Therapie, die Dämonisierung des Täters drücken dringende Anliegen aus, ein komplexes Problem zu vereinfachen und einen unlösbaren Konflikt erst gar nicht aufkommen zu lassen. Sie sind ein Rückschritt gegenüber dem Stand der Diskussion, der in den «Bemerkungen über die Übertragungsliebe» bereits erreicht war, wo Freud bei aller Unnachgiebigkeit in der Sache doch immer wieder versucht, das Verständnis für diese widersprüchliche Situation voranzutreiben. Ein wesentliches Signal des Rückschritts ist die sprachliche Fassung: an die Stelle der Rede über eine agierte (Übertragungs-)Liebe, die ein weites Feld erschließt und nahelegt, daß hier so genau untersucht und mit so vielfältigen Verläufen gerechnet werden muß wie in den Liebesbeziehungen des Alltags auch, tritt als zentrales Modell der sexuelle Mißbrauch. Dieser Ausdruck stiftet eine Analogie zum Gebrauch und damit zum Hantieren mit Dingen. Damit wird unterstellt, daß die therapeutische Beziehung auf der Objektivierung des Patienten durch den Therapeuten besteht. Der Therapeut soll sozusagen eine (zugegeben komplizierte) Maschine nach Vorgabe korrekter professioneller Technik «behandeln» und reparieren.[*]
Ich glaube, daß auch sexueller Mißbrauch durch Helfer besser verstanden werden kann, wenn der Aspekt der Liebe nicht negiert wird. In den meisten Fällen, die ich genauer untersuchen konnte, hat zumindest eine, haben sehr häufig auch beide Seiten zunächst an eine Liebesbeziehung geglaubt. Gerade diese Qualität ist verführerisch, und nur wer sie untersucht, kann vielleicht einen Beitrag dazu leisten, den Schritt von der Liebesbeziehung zum Mißbrauch zu verhindern.
Mir scheint die Intoleranz mancher Wortführer unter den Psychotherapeuten, die so sehr gegen Freuds sanfte Ironie absticht, mit einem professionellen Ideal zusammenzuhängen, das in Abwehr der realen Probleme übersteigert wird. Wer noch lautstärker und heftiger verurteilt, wer noch radikaleres Einschreiten, noch härtere Strafen fordert, lenkt von einer Auseinandersetzung mit seiner eigenen Verführbarkeit ab und versucht, das Bild des gegen alle Versuchungen gefeiten Helfers hochzuhalten. So scheint das Getöse um die Täter die Opfer nicht zu schützen, im Gegenteil: es führt dazu, daß sich in diesem Schwarzweißbild alle auf die weiße Seite retten, denen nicht nachgewiesen werden kann, daß sie etwas Schwärzliches an sich haben.
In der Psychoanalyse ist nicht nur die Regression systematisch beschrieben und erforscht worden; sie bietet auch selbst gute Beispiele dafür, daß ein bereits erreichtes Niveau der Differenzierung immer durch Regressionen gefährdet bleibt. Während Technik und Naturwissenschaften ihren Differenzierungsgrad durch das feste Gerüst ihrer mathematischen Strukturprinzipien aufrechterhalten können, stehen Sozialwissenschaftler immer wieder vor der Tatsache, daß sie etwas für einen theoretischen Fortschritt gehalten haben, was in Wahrheit ein Rückschritt war.
Am deutlichsten ist dieser Prozeß in der Theologie, die an vielen Fronten mit fundamentalistischen Strömungen ringt; aber ähnliche Prozesse lassen sich in vielen anderen Bereichen nachweisen. Wo der Mensch im Mittelpunkt steht, ist die Gefahr der Regression allgegenwärtig. Das wollen oft jene Forscher nicht wahrhaben, die sich in einer Rivalität mit den Naturwissenschaften erleben.
Auch die Geschichte der Psychotherapie ist reich an Neuerungen, die darauf beruhen, primitivere Modelle an die Stelle von ausgearbeiteten zu setzen und dieses Vorgehen als Weiterentwicklung auszugeben. Ein solches primitives Modell dominiert gegenwärtig unsere Ausbildungsinstitute. Es ist die Vorstellung, daß Beziehungshelfer nach ihrem Pflichtprogramm an Selbsterfahrung, Technikseminaren und Supervision «fertig» sind und künftig alle beruflichen Probleme bewältigen werden.
Das naiv-pädagogische Modell von der gültigen Lösung des Widerspruchs zwischen Lust- und Realitätsprinzip tritt an die Stelle des analytischen Modells einer Unlösbarkeit und lebenslangen Auseinandersetzung. Freuds Gedanke, die Eigenanalyse der Therapeuten alle fünf Jahre erneut aufzunehmen und zu vertiefen, hat sich zu dem Fünfjahreschritt mutiert, nach dessen Überstehen der examinierte Analytiker Lehranalytiker werden kann. Zum pädagogischen Vorbild erstarrt, hat er es immer schwerer, sich selbst in Frage zu stellen und damit etwas zu tun, dessen Nutzen für andere zu beteuern er nicht müde werden darf.
Dieser Text über die Fehler von Helfern ist neben der Analyse der Ambivalenzen unserer Abstinenz-Vorstellungen auch ein Plädoyer für eine kollegiale Supervision, welche die gesamte Dauer unserer Berufsarbeit begleiten sollte und Raum für die Untersuchung persönlicher Verstrickungen gewährt, welche die Arbeit erschweren.
1 Die großen Folgen kleiner Störungen
Sie hat von ihm die Überwindung des Lustprinzips zu lernen, den Verzicht auf eine naheliegende, aber sozial nicht eingeordnete Befriedigung zugunsten einer entfernteren, vielleicht überhaupt unsicheren, aber psychologisch wie sozial untadeligen.[*]
Unsere begrenzte Aufmerksamkeit und die Tatsache, daß Menschen psychisch sehr verletzlich sind und leicht in Panik geraten, führen im Störungsfall dazu, daß häufig das Wissen darum verlorengeht, wie umfangreich die Störung wirklich ist. Dann bestimmt sie das ganze Erleben. Vereinfacht gesagt: wer Zahnweh hat, dem wird in der Regel nicht mehr bewußt sein, daß er nur einen kranken, aber viele gesunde Zähne hat. Selbst wenn er daran denkt, muß er mit der bedrückenden Phantasie kämpfen, daß nach dem einen jetzt auch noch alle anderen Zähne anfangen werden, ihm Beschwerden zu machen.
Je stärker der ungestörte Verlauf idealisiert wird, desto schwieriger wird es, die Störung nicht nach dem Alles-oder-nichts-Prinzip zu erleben. Wem die leidenschaftliche Verliebtheit nicht erfüllt wird, der fühlt sich völlig beziehungsunfähig; der Marathonläufer hält sich schon bei einer Knieverletzung für einen Krüppel, die dem Durchschnittsmenschen noch harmlos erscheint. Idealisierte Ämter übertragen solche Phänomene, in denen der kleinste Defekt die Untauglichkeit des Ganzen bewirkt, in die Öffentlichkeit. Ein hochrangiger Politiker soll angesichts einer harmlosen Lüge oder eines Irrtums über die Qualifikation eines Mitarbeiters zurücktreten.
Solche Vergehen würden jedem, der nicht so viele positive wie negative Idealisierungen auf sich zieht, mit Leichtigkeit verziehen. Den Betrachter muten solche Ereignisse oft sehr irrational an. Wie kommt es, daß sozusagen ein winziger Bruchteil an Kompetenzmängeln die große Menge ungestörter Kompetenzen im Bewußtsein der Öffentlichkeit auszulöschen scheint? Darüber hinaus wirken die Opfer, die über eine solche Kleinigkeit gestolpert sind, in ihrer Betrachtung der Situation ebenfalls sehr unsicher. Sie scheinen selbst an sich zu zweifeln, obwohl doch deutlich ist, daß sie neben dem kleinen Fehlverhalten eine quantitativ unendlich größere Menge richtiger Entscheidungen getroffen haben.
Die öffentliche Meinung arbeitet hier mit einem höchst naiven Modell von Glaubwürdigkeit und Funktionstüchtigkeit, das sie, aller psychologischen Einsicht trotzend, durchsetzen kann. Dieses naive Modell betrifft das Zustandekommen von Leistungen wie moralische Integrität und Zuverlässigkeit. Sie werden im Sinn von einfachen Charaktereigenschaften verstanden, die entweder «da sind» oder «fehlen»; wer sie hat, ist gut und glaubwürdig; wem sie mangeln, ist unwürdig.
In sozialen Zusammenhängen, die von Rivalität bestimmt sind, ist diese naive Psychologie deshalb besonders beliebt, weil sie es erlaubt, den Gegner im Wettkampf um die Idealisierung zu schlagen. Für diese narzißtische Perspektive gibt es keine Kleinigkeiten; außerdem wird in ihr nicht unterschieden, ob der unterstellte Mangel nun wirklich vorhanden ist oder nur im Gerücht. Die Marketingabteilung eines Automobilkonzerns wird Verleumdungen, daß ein bestimmtes Modell schlecht verarbeitet ist, fast mit derselben Sorgfalt behandeln wie tatsächliche Mängel, denn beide beeinflussen die Kaufentscheidungen.
Da wir in der Konsumgesellschaft fast jeden Tag ohne genaue Kenntnis zwischen verschiedenen Waren, Dienstleistungsanbietern, Politikern entscheiden müssen, ist diese Orientierung an einem irgendwo aufgeschnappten, eigentlich belanglosen Merkmal von großer Bedeutung für unser Handeln. Irgend jemand, der irgendwen kennt, der den Politiker A. kannte, hat gesagt: ein guter Mann. Und weil wir sonst nichts haben, an das wir uns halten können, halten wir uns daran. Ein Patient von Doktor X. soll an einem Behandlungsfehler gestorben sein. Also gehen wir zu Dr. Y.
Wer nun, wie Dr. X., von einem solchen Gerücht erfährt, ist in einer unangenehmen Lage. Er leidet erheblich unter diesem Rufmord, fühlt sich vielleicht in seiner wirtschaftlichen Existenz gefährdet, zergrübelt sich in schlaflosen Nächten den Kopf, welchen Fall denn die Gerüchtebildner gemeint haben könnten, ob er juristische Schritte unternehmen kann, wer dahintersteckt.
2 Die Gefahren der Idealisierung
Nein, im ärztlichen Handeln wird neben der medicina immer ein Raum bleiben für das ferrum und für das ignis, und so wird auch die kunstgerechte, unabgeschwächte Psychoanalyse nicht zu entbehren sein, die sich nicht scheut, die gefährlichsten seelischen Regungen zu handhaben und zum Wohle des Kranken zu meistern.[*]
In den helfenden Berufen scheinen Gerüchte und mit ihnen verknüpfte Entwertungen besonders verbreitet. Vorurteile bilden sich blitzschnell und scheinen unvermeidlich, weil es sich um ein komplexes, unübersichtliches Feld handelt, in dem nicht immer abgewartet werden und gründliche Information gewonnen werden kann, ehe Entscheidungen erfolgen. Diese Dynamik hängt wahrscheinlich damit zusammen, daß in vielen Bereichen der helfenden Berufe Idealisierungen eine große Rolle spielen und es gar nicht leicht ist, sie einzugrenzen und zu versachlichen. Ein Maschinenbauingenieur oder ein Dachdecker können ihre Qualitäten wie ihre Grenzen objektivieren; es ist genau erkennbar, welche Teile ihrer Maschine funktionieren, wo ihr Dach dicht ist und wo es noch Regenwasser eindringen läßt. Wenn eine Stelle undicht ist, entwertet das nicht den Rest, sondern fordert eine gezielte Reparatur.
Ein Gymnasiallehrer mag ein halbes Jahr lang einen Schüler angemessen gefördert haben; weil er dann aber einen harschen Tadel ausgesprochen oder ihm den Eindruck ungerechter Behandlung gemacht hat, ist diese ganze Leistung wie weggeblasen. Er bleibt dem Schüler in unerfreulicher Erinnerung.
Noch ausgeprägter ist diese Situation bei Psychotherapeuten. Hier gehört es geradezu in die Arbeit, die Idealisierung auf sich zu ziehen, sie aufzubauen, sie zu verwenden (in den suggestiven Methoden) oder aber durch Einsicht in ihre Gesetze auch wieder abzubauen (in den psychoanalytischen Verfahren).
Die Idealisierungsbedürfnisse der Menschen sind mit der oben angesprochenen Anfälligkeit für Panik, Orientierungslosigkeit und Verzweiflung verknüpft. Sie stammen aus dem kindlichen Bedürfnis nach einem Erwachsenen, der nährt, schützt, dessen Stärke im Bewältigen der Realität Vorbild und eigene Orientierung sein kann. In der normalen Entwicklung werden diese Bedürfnisse schrittweise und milde so enttäuscht, daß ein wohlwollendes Elternbild erhalten bleiben kann und die selbständige Bewältigung der Realität zu einer relativ stabilen psychischen Kompetenz wird.
Erfolgt die Enttäuschung abrupt, etwa in einer Mischung aus Verwöhnung und Rücksichtslosigkeit, kommt eine angemessene Idealisierung gar nicht zustande (wie bei manchen Kindern in Säuglingsheimen), oder endet sie traumatisch durch den Tod des idealisierten Elternteils, bleiben starke, unabgesättigte, sozusagen gierige Idealisierungsbedürfnisse bestehen. Sie knüpfen sich in vielen Fällen an die sexuellen Wünsche und führen dazu, daß die Abhängigkeit vom Gegenstand erotischer Wünsche einen Speicher kindlicher Idealisierungssehnsucht und Enttäuschungswut anzapft.
Solche Entwicklungen und die aus ihnen folgenden seelischen Konflikte sind allen Psychotherapeuten wohl vertraut. Ihre Klienten sind sehr häufig in ihren Fähigkeiten beeinträchtigt, selbständig die Anforderungen der Realität zu bewältigen, zu ihren Wünschen zu stehen, Liebe und Haß zu lenken und angemessen auszudrücken. Sie suchen im Therapeuten ein steuerndes Objekt, das sie idealisieren können, das ihnen erlaubt, zu ihren eigenen Wünschen zu stehen und diese nicht als so zerstörerisch und gefährlich zu erleben wie bisher. Der Therapeut sollte das wissen und die Zusammenarbeit so gestalten, daß die Idealisierung im konstruktiven Bereich bleibt. Das ist jedoch leichter gesagt als getan.
Die psychoanalytische Regel dazu lautet etwa so: Die positive Übertragung wird zugelassen, gefördert und erst dann bearbeitet, wenn sie so übermächtig geworden ist, daß sie den therapeutischen Prozeß beeinträchtigt. Die negative Übertragung wird sogleich aufgegriffen. Da mit «Übertragung» die Wiederholung einer kindlichen Beziehung gemeint ist, hat sie immer auch Züge der positiven oder negativen Idealisierung, der Überschätzung im Guten wie im Bösen.
Da in der Idealisierung große Macht zugeschrieben wird, übt dieser Prozeß auch Macht aus. Es ist faszinierend, idealisiert zu werden, weil dadurch eigene Ängste und Unsicherheiten fast ebenso verringert werden, wie es geschieht, wenn ein idealisiertes Objekt gefunden wurde. Bekannt ist, daß sich Demagogen oder Schauspieler, die längere Zeit nicht mehr von einem Publikum gefeiert wurden, niedergedrückt und nutzlos fühlen. Sie brauchen das «Bad in der Menge», wie es Dagobert Duck braucht, in seinen Dukaten zu baden: beide verschmelzen mit einer idealisierten und idealisierenden Umgebung. Sie fühlen sich dadurch sicherer.
3 Übertragungsliebe, Übertragungshaß
Anderseits ist es eine peinliche Rolle für den Mann, den Abweisenden und Versagenden zu spielen, wenn das Weib um Liebe wirbt, und von einer edlen Frau, die sich zu ihrer Leidenschaft bekennt, geht trotz Neurose und Widerstand ein unvergleichlicher Zauber aus.[*]
Aus den genannten Gründen wird deutlich, daß die Idealisierung des Helfers ebenso mächtig wie gefährlich sein kann. Im guten Fall gibt sie Kraft, Depressionen zu überwinden und Entscheidungen zu treffen, sich dem bisher Gemiedenen auszusetzen und es mit inzwischen gewonnenen Kräften zu bewältigen. Aber dieser Prozeß ist sensibel, die Gefahr, daß er scheitert, ist stets präsent.
Unter den Gefahren ist zunächst das Umschlagen der Idealisierung von Verehrung in Haß zu nennen. Es tritt ein, wenn eine positive Idealisierung nicht aufrechterhalten werden kann, sei es, daß der Klient selbst sich überfordert hat und nun im Zusammenbruch der Erwartungen an die eigene Person auch den idealisierten Therapeuten vernichtet sieht, sei es, daß er ihn haßt, weil er ihn nicht immer und überall begleitet und schützt, sondern bequem in seinem Behandlungszimmer bleibt, während sich der Klient doch den Unannehmlichkeiten der Welt stellen muß.
Die Übertragungsliebe ist in jedem Fall eine Begleiterscheinung der Idealisierung; sie ist ihr stärkster Ausdruck und zugleich ihr größtes Risiko, weil sie an mächtige irrationale Wünsche appelliert, die auch der Therapeut niemals ganz verarbeitet und bewältigt hat. Unsere Sexualität gleicht immer einem Palimpsest: die Schrift der kindlichen Wünsche bleibt unter der Schrift einer erwachsenen Leidenschaft erhalten. Wenn beispielsweise der Gegenstand unserer Liebe anwesend ist, fühlen wir uns ihm auf einer erwachsen-erotischen Ebene verbunden; ist er aber nicht zugegen, überfallen uns kindliche Verlustängste und Haßtiraden.
Wenn es gelingt, solche Zusammenbrüche der Idealisierung zu bearbeiten, weil sich Reste einer mild positiven Übertragung erhalten und pflegen lassen («Arbeitsbündnis» ist ein zweckrationales Wort für diese Situation), dann haben Analytiker und Analysand gewonnen. Wenn nicht, wird die Zusammenarbeit unerträglich. Der Analysand bricht ab, der Analytiker erscheint ihm ebenso unfähig wie diesem der Analysand unanalysierbar, psychotisch, frühgestört und so weiter.
Eine zweite Gefahr ist die psychotische Übersteigerung der Idealisierung, eine dritte der Mißbrauch einer Idealisierung. Wenn die Idealisierung wahnhafte Züge annimmt, ist ein therapeutischer Prozeß sehr erschwert, weil sich die Basis drastisch verschmälert, auf der die Realität geprüft und eine Entwicklung vollzogen werden kann.
Die Übertragungsidealisierung wird zum Wahn, wenn in der Klientin jede Distanz zu ihrem Erleben verschwindet. Sie entdeckt den Analytiker überall, er sendet ihr Botschaften durch die Television und drückt seine Liebe durch Manipulationen des Inhalts der Tageszeitung aus. Die Sitzungen selbst werden immer schwieriger, weil die Klientin durch ein komplexes System den Analytiker in ihren Wahn einbaut und zugleich ausschließt. Sie kann den Wahn nicht besprechen, aber außer ihm fällt ihr nichts ein. So schweigt sie oder ergeht sich in Andeutungen. Sie hofft, daß demnächst der Analytiker, der doch unsterblich in sie verliebt ist, sich zu diesen Gefühlen offen bekennen wird, ist aber überzeugt, daß er jetzt noch, aus Rücksicht auf seine berufliche Rolle, auf seine oder ihre Ehe, schweigen muß.
Wenn eine Idealisierung derart übersteigert wird, gerät der Analytiker in eine schwierige Situation. Wenn er sich entzieht, wird dieses Verhalten ebenso wahnhaft gedeutet, wie wenn er verfügbar bleibt. Selbst wenn es ihm gelingt, aus der gewährenden, den Ausdruck von Gefühlen fördernden Haltung, die ihm üblicherweise zur beruflichen Einstellung geworden ist, in eine konfrontierende, strenge und eng an der Realität orientierte Haltung überzuwechseln, kann die Klientin diesen Wechsel als Prüfung ihrer Liebe idealisieren und gerade dann an ihrem Wahn festhalten, wenn sie energisch auf ihn hingewiesen wird.
Der Analytiker soll nach seinem professionellen Credo die Idealisierung weder stützen noch aktiv zerstören, weder ausbeuten noch moralisierend bekämpfen. Er soll sie schrittweise und rücksichtsvoll auflösen. Aber dieser Gestus führt in dem beschriebenen Szenario dazu, daß der Analytiker denkt, wenn er sich nach dieser professionellen Regel der Analyse verhält, seiner wahnkranken Patientin zu schaden, und wenn er sich dieses Verhalten verbietet, ihr ebenfalls zu schaden.
Die Überweisung zu einer Kollegin ist dann das kleinste Übel. Doch ist leider damit zu rechnen, daß die Kranke den Wahn anziehender findet als seine Auflösung und der Therapeut in ein seelisches Geschehen verstrickt wird, das er nicht überblicken, geschweige denn beherrschen kann und für das ihn die Umgebung der Kranken zum Sündenbock macht.[*]
Solche Ereignisse sind glücklicherweise sehr selten. Aber es scheint mir eine Illusion, daß es gelingen kann, sie immer zu vermeiden. Die psychotische Entwicklung ist ein existenzielles Risiko, gegen das es keine Versicherung gibt; die analytische Theorie, welche uns belehrt, wie gefährdet und komplex die Durchsetzung des Realitätsprinzips immer bleiben muß, mag es erleichtern, solche Risiken zu akzeptieren, hilft uns aber nicht, sie technisch zu bewältigen.
Nachdem ich selbst als Anfänger mit einer wahnhaften Übertragung konfrontiert war und nach diesem Ereignis zwanzig Jahre ungestört davon blieb, schmeichelte ich mir, ich sei doch durch meine gewachsene Erfahrung in der Lage, solchen Prozessen auszuweichen. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Ich mußte erkennen, daß die größere Erfahrung keinen Schutz vor dem Auftreten einer solchen Störung bietet, sondern allenfalls den Umgang mit ihr ökonomisieren hilft. Das heißt konkret: ich brach den Versuch, einen Wahn analytisch zu bearbeiten, diesmal weit schneller ab, ohne jedoch meinen Zweifel zum Schweigen zu bringen, ich hätte dies aus Bequemlichkeit getan und meine analysetechnischen Argumente seien Rationalisationen.
4 Die Verletzung der Abstinenz
Die Kur muß in der Abstinenz durchgeführt werden; ich meine dabei nicht allein die körperliche Abstinenz, auch nicht die Entbehrung von allem, was man begehrt, denn dies würde vielleicht kein Kranker vertragen. Sondern ich will den Grundsatz aufstellen, daß man Bedürfnis und Sehnsucht als zur Veränderung treibende Kräfte bei der Kranken bestehen lassen und sich hüten muß, dieselben durch Surrogate zu beschwichtigen. Anderes als Surrogate könnte man ja nicht bieten, da die Kranke infolge ihres Zustandes, solange ihre Verdrängungen nicht behoben sind, einer wirklichen Befriedigung nicht fähig ist.[*]
Durch die Idealisierung gewinnt der Therapeut Macht. Wer Macht erhält, gerät immer in Versuchung, sie zu mißbrauchen. In der Therapie bedeutet das, Macht zu anderen Zwecken einzusetzen als zum Wohl des Klienten. Die Grenzen, innerhalb derer sich der Helfer bewegen soll, werden durch seine Ausbildung vorgeformt und während seiner Arbeit durch seine berufliche und persönliche Entwicklung verändert. Es werden sogar Reglements diskutiert, in denen ein Analytiker bereits als wenig abstinent gilt, wenn er Analysen in seiner Privatwohnung durchführt oder das Behandlungszimmer mit den Bildern schmückt, die ihm gefallen.
In der Geschichte der Psychoanalyse wurde die Abstinenz vor allem im Zusammenhang mit der «aktiven Analyse» diskutiert, die Sándor Ferenczi vorschlug und von der Freud urteilte, sie lasse die analytische Therapie zur Petting Party entgleisen. Ferenczi berichtete von Experimenten, mit Analysandinnen Zärtlichkeiten auszutauschen, mit ihnen in Urlaub zu fahren, ihnen gegenüber eigene Gefühle bloßzulegen («wechselseitige Analyse»).[*]
Es ist zu erwarten, daß Patientinnen, die an der Möglichkeit zweifeln, daß eine idealisierte männliche Gestalt ihnen wirklich positiv zugewandt ist, immer deutlichere Liebesbeweise fordern und schließlich die Therapie völlig entwerten, wenn ihnen nicht Zärtlichkeit oder erotische Erfüllung gewährt wird. In dieser Situation ist es für den Analytiker niemals einfach, unbeeinträchtigt zu seiner Arbeit zurückzufinden. Die Theorie sagt, daß erotische Erfüllung den therapeutischen Prozeß lähmt. In der Praxis meint der Analytiker nur die Wahl zu haben, entweder ganz aufzugeben oder sich auf ein Experiment einzulassen, das ihm über den Kopf wächst.
Eine sexuelle Beziehung ist in der Gesellschaft kein neutraler Akt, sondern intensiv geregelt und zwischen Personen, die in einem beruflichen Abhängigkeitsverhältnis stehen, durch professionelle Normen und in manchen Fällen auch gesetzlich verboten. Der Analytiker, welcher in dieser Weise seine Abstinenz verletzt, beraubt sich selbst seiner beruflichen Integrität. Er hat auf die Idealisierung, die ihm entgegengebracht wird, mit einer Idealisierung der Patientin geantwortet, die ihn blind macht für die Ambivalenz solcher Verhältnisse. Er rechnet dann nicht mehr damit, daß diese sich, wenn sich ihre Idealisierung trübt, im Stich gelassen fühlt. Sie tut das, weil sie bitter enttäuscht ist. Sie wünschte sexuelle Befriedigung als Krönung ihrer verliebten Idealisierung, erkennt nun aber, daß sie den bewunderten Analytiker verloren und ihn gegen nicht mehr als eines der problematischen Verhältnisse getauscht hat, die ihr Leben bisher geprägt haben.
Diese Szene bezieht sich auf eine Interaktion der Idealisierungen in der Therapie. Es kann aber auch sein, daß der Analytiker seinerseits sich verliebt und aktiv eine Patientin verführt, weil sie ihm gefällt und er die Grenzen seiner professionellen Ethik nicht wahrnimmt. Extremfälle moralischen Versagens sehen so aus, daß ein Therapeut die Schäferstunden mit einer Patientin in seinen Abrechnungsbogen einträgt und sich von ihrer Krankenkasse dafür bezahlen läßt.
Während kein Zweifel daran herrscht, daß dieses Verhalten illegal ist und den Tatbestand des Betrugs erfüllt, scheint es sehr schwierig, Kriterien zu finden, die ein erotisches Verhältnis nach dem Ende einer Therapie betreffen. Ein rigoroser Standpunkt besagt, daß die Idealisierung niemals völlig verschwindet und daher nie ein Kontakt möglich sein wird, in dem Ex-Patientin und Ex-Analytiker wirklich partnerschaftlich miteinander umgehen. Ein anderes Modell geht davon aus, daß erwachsene Menschen über ihre Sexualität nach der Beendigung professioneller Abhängigkeitsverhältnisse frei entscheiden können und daher moralisch nichts einzuwenden ist, wenn ein Analytiker seine Behandlung beendet und – sich selbst als Privatperson definierend – der Privatperson seiner einstigen Analysandin entgegentritt.
Da es sich um ein Problem handelt, das im Rahmen von Psychotherapien entsteht, könnten wir versuchen, spezifisch psychotherapeutische Umgangsformen damit zu entdecken. Aus therapeutischer Sicht scheinen weder die rigorose noch die laxe Regelung angemessen. Beide versuchen, was unmöglich ist: ein Urteil zu fällen, ohne die Dynamik der jeweils ausgeformten Beziehungen zu kennen. Von unserem analytischen Wissen her ist jedenfalls soviel deutlich, daß wir weder davon ausgehen können, daß sechs Monate nach Ende einer Therapie alle Übertragung dahingeschmolzen ist, noch mit Sicherheit wissen, ob unzuträgliche Idealisierungen verhindern, daß die Liebesbeziehung zwischen einem Analytiker und seiner von ihm abgenabelten Analysandin gelingen kann.
Wer aber soll diese Dynamik erkennen, wenn es die Beteiligten selbst nicht vermögen, weil sich der bisherige Analytiker seines Amtes entkleidet hat, ohne daß er als gleichberechtigter Partner bereits wirklich glaubwürdig geworden ist? Eine Lösung wäre eine gemeinsame Beratung bei einem vertrauenswürdigen Kollegen; eine andere der gemeinsame Entschluß, sich das Ende der Abstinenz nicht leicht zu machen, sondern Zeit zu gewinnen, eine Art Trauerjahr zu halten und dann zu sehen, wie die wechselseitigen Gefühle sich entwickelt haben. Wir müssen in jedem Fall davon ausgehen, daß der Abbau einer Idealisierung und der Gewinn von Gleichberechtigung zwischen Therapeut und Patient weder immer unmöglich noch in allen Fällen erreichbar sind. In psychotherapeutischen Gesellschaften wird gegenwärtig eine «um – zu» Regel diskutiert. Sexuelle Beziehungen auch nach dem Abschluß einer Therapie sind als Mißbrauch zu bewerten, wenn die Therapie abgeschlossen wurde, um die intime Beziehung zu beginnen.
Der außenstehende Supervisor könnte erkennen, ob die Idealisierung des Therapeuten und die Abhängigkeit der Patientin bereits reflektiert und in ihrem Gefahrenpotential für eine erotische Alltagsbeziehung erkannt wurden oder ob diese Risiken in wechselseitiger Schwärmerei verleugnet werden.
Ich muß gestehen, daß ich eine solche Beratung bisher noch nicht durchgeführt habe, aber ich halte es doch für eine sinnvolle Einrichtung, sie anzubieten und an diese Möglichkeit zu denken.
5 Die Ambivalenz der Abstinenz
Unzweifelhaft ist die geschlechtliche Liebe einer der Hauptinhalte des Lebens und die Vereinigung seelischer und körperlicher Befriedigung im Liebesgenusse geradezu einer der Höhepunkte desselben. Alle Menschen bis auf wenige verschrobene Fanatiker wissen das und richten ihr Leben danach ein; nur in der Wissenschaft ziert man sich, es zuzugestehen.[*]
Der Begriff der Abstinenz stammt aus dem Latein. Abstinentia bedeutet Enthaltung. Freud meinte mit seinem Satz «Die Kur findet in der Abstinenz statt» vor allem die Abstinenz des Patienten von Ersatzbefriedigungen. Nur wer ihn mißverstehen wollte, faßte das so auf, als gelte während der Analyse ein Sexualverbot. Wesentliche und während der Analyse zu meidende Ersatzbefriedigungen sind betäubende Drogen und Alkohol, aber auch Nebenanalysen (der Patient bespricht seine Träume und Einfälle mit einem Dritten, zum Beispiel dem Ehepartner) und symptomatische Befriedigungen. Hier fällt das Abstinenzgebot mit dem Gebot zusammen, phobische Vermeidungen möglichst einzuschränken. Der Angstkranke soll zum Beispiel ohne Begleitperson in die Analyse kommen, auch wenn ihm das schwerfällt; der Prüfungsneurotiker soll sich der Prüfung stellen, auch wenn er fürchtet, ohnmächtig zu werden, und so weiter.
Die Abstinenz des Analytikers richtet sich ebenfalls dagegen, daß er dem Analysanden Ersatzbefriedigungen gewährt. Er soll ihm die Befriedigung anderer Bedürfnisse als jene verweigern, die unmittelbar oder mittelbar der Einsicht in die eigene Psyche dienen. Ein eigenes Sexualtabu auszusprechen, hat Freud zunächst für unnötig gehalten. Er beläßt es bei dem bereits zitierten Vergleich der Befriedigung sexueller Wünsche während einer Analyse mit dem Verhalten eines Spaßvogels, der bei einem Hunderennen einen Kranz Würste auf die Bahn wirft.
Freud spricht so, als sei die Sexualität zwischen Analytiker und Analysandin eine lästige Störung auf dem Weg zum Ziel, ein technisches Versagen. Heute finden sich Aussagen, dasselbe Ereignis, das Freud mit einem hinderlichen Zwischenfall oder der Niederlage in einem Ringen gegen die Neurose verglich, sei schlimmer als Inzest. Die klassische Auffassung der Analyse, wonach die Wiederholung einer kindlichen Erfahrung durch den Erwachsenen Korrekturmöglichkeiten erschließt, wird sozusagen umgekehrt. Theoretisch ist das schwer zu begründen. Dieser Versuch wird allerdings in den moralischen Exzessen auch gar nicht unternommen. Zu fragen wäre immerhin, mit welcher Begründung der erwachsenen Analysandin unterstellt wird, sie sei durch den sexuellen Übergriff der imaginierten Eltern-Instanz stärker verletzbar als ein Kind durch den Übergriff der realen.
Wenn gegenwärtig nicht mehr von einer Verletzung der Abstinenz durch sexuelle Befriedigung, sondern von sexuellem Mißbrauch gesprochen wird, dann scheint mir das mit einer wiedergewonnenen Dominanz der therapeutischen Pädagogik gegenüber der therapeutischen Analyse zusammenzuhängen. Ich meine damit, daß in der Pädagogik auf Werte hingearbeitet werden soll, während es in der Analyse um Erkenntnis der Ambivalenz geht.
In einem Mißbrauchskonzept wird eine pädagogisch-juristische Unterscheidung von Täter und Opfer zugrunde gelegt, während es in einem analytischen Konzept eher um die wechselseitige Befriedigung oder Schädigung geht. Vorformulierte Urteile sind in Pädagogik und Jurisprudenz nicht nur zulässig, sondern auch notwendig. In der Analyse sind sie nicht notwendig, mögen aber manchmal zulässig sein, wenn es darum geht, Schaden zu verhindern. Freuds Befriedigungskritik geht mit der modernen Mißbrauchskritik insofern konform, als sie die sexuelle Aktion während der Analyse ablehnt. Aber sie enthält den Ansatz für ein Verständnis der Interaktion, das über eine Täter-Opfer-Schematisierung hinausgeht.
In das begriffliche Umfeld der Abstinenz gehören noch einige Ausdrücke, die hier kurz erläutert werden sollen:
1. Neutralität des Analytikers, der sich üblicher Werturteile enthalten soll und in der Art eines Unparteiischen dem Spiel (und Kampf) zwischen den Trieben und der Zensur einen «wohlgeschliffenen Spiegel» (Freud) entgegenhält.
2. Indifferenz des Analytikers im Sinne der «gleichschwebenden Aufmerksamkeit», die nicht gezielt nach bestimmten Inhalten (auch nicht nach denen, welche die Theorie erwarten läßt) Ausschau hält, sondern ohne Unterschied (sine differentia) alle Einfälle gleich aufmerksam betrachtet.
3. Präsenz des Analytikers im Sinne eines wachen, möglichst intensiven und auch dem Analysanden vermittelten Interesse für dessen seelische Inhalte, für seine Phantasien, seine Gegenwart, seine Zukunft, auch sein Wohlergehen.
Zur Verdeutlichung dieser Begriffe beschreibe ich auch ihre Gegensätze. Der Gegensatz zur Abstinenz ist die Befriedigungeigener Wünsche des Analytikers auf Kosten der Arbeit mit dem Analysanden. Die Idealisierung kann dann mißbraucht[*] werden, um dem Patienten einzureden, es sei etwas gut für ihn, was ihm schadet. Der Gegensatz der Neutralität ist die Parteilichkeit