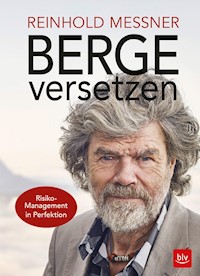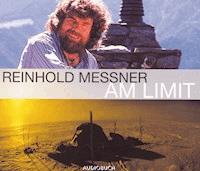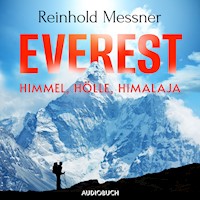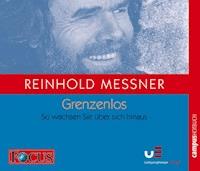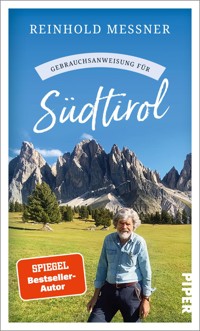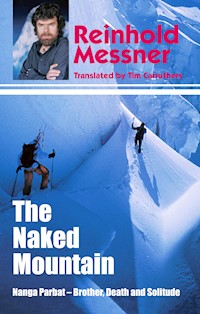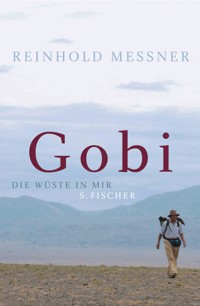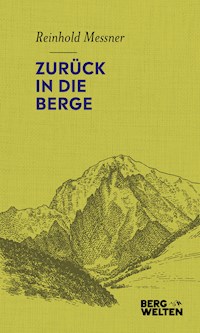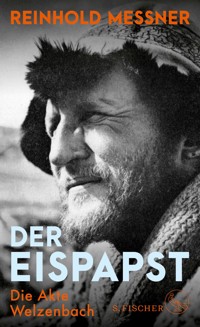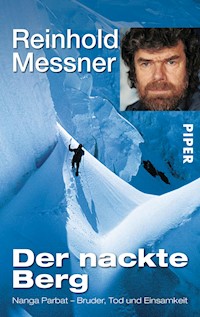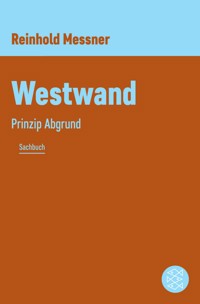
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Reinhold Messner erzählt anhand des Versuchs, im Sommer 2004 die Westwand des Ortlers auf der Route der Erstbesteiger zu bezwingen, von einer unfreiwilligen Erstbegehung, die fast zur Katastrophe geführt hätte. Messner und seine beiden Kameraden versteigen sich und stecken plötzlich in einer tausend Meter hohen vertikalen Felswand, über ihnen ein riesiger Eisüberhang. Ein Zurück gibt es nicht mehr. Es bleibt nur die Flucht nach oben. Was die drei Kletterer in dem unberechenbaren senkrechten Labyrinth rettet, sind letztlich jene untrüglichen Instinkte, die Messner zeitlebens auszeichneten. Reinhold Messner, für den in den Jahren seiner Extremkletterei die Gesetze der Schwerkraft aufgehoben schienen, zieht in diesem Buch die Summe aus seinen Erfahrungen als Grenzgänger in der Vertikalen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 239
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Reinhold Messner
Westwand
Prinzip Abgrund
Über dieses Buch
Reinhold Messner erzählt anhand des Versuchs, im Sommer 2004 die Westwand des Ortlers auf der Route der Erstbesteiger zu bezwingen, von einer unfreiwilligen Erstbegehung, die fast zur Katastrophe geführt hätte. Messner und seine beiden Kameraden versteigen sich und stecken plötzlich in einer tausend Meter hohen vertikalen Felswand, über ihnen ein riesiger Eisüberhang. Ein Zurück gibt es nicht mehr. Es bleibt nur die Flucht nach oben. Was die drei Kletterer in dem unberechenbaren senkrechten Labyrinth rettet, sind letztlich jene untrüglichen Instinkte, die Messner zeitlebens auszeichneten. Reinhold Messner, für den in den Jahren seiner Extremkletterei die Gesetze der Schwerkraft aufgehoben schienen, zieht in diesem Buch die Summe aus seinen Erfahrungen als Grenzgänger in der Vertikalen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2009 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Nicole Lange, Darmstadt
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490779-6
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
Motto
[Kapitel]
Ortler, im Sommer
König-Nordwand
Ortler-Erstbegehung
Villnösser-Odla-Nordpfeiler
Ortler
Gran-Vernel-Südwand
Kein Ausweg, Ortler
Alleingang »Schubert«, Ciavazes
Das Mögliche im Unmöglichen
Ortler
Langkofel-Nordwand
Orientierungslos am Ortler
Furchetta-Westwand
Gletscherschwund als Ausweg, Ortler
Heini Holzers Tod
K2-Südwand
Unter Séracs
Valle Blanche
Am Ende nur Abgrund
Marmolada
Flucht nach oben
Die Similauner am Ortler
Ortler, in der Querung
Wir haben uns verstiegen
Niedergang und Zukunft des Bergsteigens
Kein Gipfel
Ein Jahr danach
Santnerspitze
Peitlerkofel-Nordwand
Untergang ist überall
Berg der Brüder
Drama am König der Berge
Wadi Rum
Tafelteil
Für Renato Reali, Heinz Holzer, Friedl Muschlechner, Reinhard Karl, Wolfgang Güllich, Mugs Stump, Roger Baxter-Jones, Wanda Rutkewics, Slavko Sveticic, Pierre Béghin, Bruno Cormier, Renato Casarotto, Gian-Carlo Grassi, Benoit Chamoux, Alison Hargreaves, Trevor Peterson, Scott Fisher, Eric Escoffier, Alex Lowe, Seth Shaw …
»Es fällt schwer, an ein Ideal zu glauben, wenn so viele dafür gestorben sind.«
Mark Twith
»Am besten scheinen sich die Menschen zu konzentrieren, wenn sie ein bisschen stärker als gewöhnlich gefordert werden und wenn sie mehr als gewöhnlich geben können. Werden sie zu wenig gefordert, langweilen sie sich, sind sie den Anforderungen nicht gewachsen, werden sie ängstlich. Das Fließen ereignet sich in dem heiklen Bereich zwischen Langeweile und Angst.«
Mihaly Csikszentmihalyi, Psychologe an der Universität Chicago
Inhalt
I
Ortler, im Sommer 2004
9
II
König-Nordwand, 1964
19
III
Ortler-Erstbegehung, 2004
27
IV
Villnösser-Odla-Nordpfeiler, 1965
32
V
Ortler, 2004
41
VI
Gran-Vernel-Südwand, 1967
54
VII
Kein Ausweg, Ortler, 2004
64
VIII
Alleingang »Schubert«, Ciavazes, 1968
69
IX
Das Mögliche im Unmöglichen, 1968
78
X
Ortler, 2004
85
XI
Langkofel-Nordwand, 1969
88
XII
Orientierungslos am Ortler, 2004
95
XIII
Furchetta-Westwand, 1973
98
XIV
Gletscherschwund als Ausweg, Ortler, 2004
102
XV
Heini Holzers Tod 1977
105
XVI
K2-Südwand, 1979
110
XVII
Unter Séracs, 2004
116
XVIII
Valle Blanche, 1989
124
AM ENDE NUR ABGRUND
128
XIX
Marmolada, 1992
161
XX
Flucht nach oben, 2004
163
XXI
Die Similauner am Ortler, 1994
167
XXII
Ortler, in der Querung, 2004
170
XXIII
Wir haben uns verstiegen, 1997
173
XXIV
Niedergang und Zukunft des Bergsteigens, 1998
185
XXV
Kein Gipfel, 2004
194
XXVI
Ein Jahr danach, 2005
199
XXVII
Santnerspitze, 2007
207
XXVIII
Peitlerkofel-Nordwand, 2007
217
XXIX
Untergang ist überall, 2007
223
XXX
Berg der Brüder, 2008
232
XXXI
Drama am König der Berge, 2008
236
XXXII
Wadi Rum, 2009
247
Ortler, im Sommer
Gletscher sterben nicht, sie schwinden, ehe sie verschwinden, denke ich, während wir über glucksende Rinnsale steigen. Immer weiter bergan. Es ist wärmer, als es sein sollte, obwohl der Morgen klar ist. Früher, in meiner Jugend, erinnere ich mich, war es in den Eisregionen während der Nachtstunden so kalt, dass Schnee und Wasser gefroren. Auch in den Sommermonaten. Nur tief unter den Gletscherzungen blieb ein fernes Rauschen hörbar, nachsickerndes Schmelzwasser vom Vortag.
Ich habe zwar ein ungutes Gefühl – warme Morgen sind im Hochgebirge Schlechtwetterboten –, aber Angst kommt vorerst keine auf. Wenigstens noch nicht. Auch keine Wut wegen des Gletscherschwunds etwa als einer Folge der zunehmenden Erderwärmung. In letzter Zeit werde ich nicht mehr so schnell wütend wie früher. Dabei ist der Niedergang der Gebirge überall sichtbar. Am Gletscher auch hörbar, sogar riechen kann man ihn. Wo der Permafrost auftaut, rutscht, schwitzt, stinkt die Erde. Es riecht überall nach Fäulnis.
Ich bleibe stehen und weise mit der Hand auf die grauschwarze Felswand links von uns. Sie liegt im Schatten. Trotzdem tropft Wasser aus jeder Ritze. »Dort irgendwo«, sage ich, »haben wir eine Erstbegehung gemacht. Vor bald 30 Jahren.« »Schwierig?«, fragt Wolfgang, der Bergführer ist und die 1000 Meter hohe Flanke mit den Augen absucht. Ich sehe, wie sein Blick die Felsen prüft, sich emportastet. Wie erfahrene Bergsteiger es immer tun, wenn sie aus einer gewissen Distanz in Gedanken eine kletterbare Route durch eine Felswand legen. Diese Art zu suchen – nach einem brauchbaren Weg, einer neuen Route – gehört zum Ritual einer jeden Erstbegehung. Wir allerdings wollen heute keine neue Route, sondern nur den ältesten Ortleraufstieg finden, um ihm bis zum Gipfel folgen zu können. Also stehen wir unter den fast senkrechten Dolomitwänden im Westen des Ortlers, des höchsten Berges von Südtirol, und sehen uns den Fels an. Trotzdem: Wir wissen nicht recht, ob wir einsteigen sollen. Es ist zu warm, und bald wird Steinschlag einsetzen. Es ist jetzt aber müßig, über den Verfall der Berge zu lamentieren, zumal man als Zeitgenosse selbst mit dazu beiträgt, dass das Eis schmilzt. Schließlich habe ich mich schon früher für die Erhaltung der Berge starkgemacht, bin aber trotzdem Auto gefahren.
Unweit von uns schlagen jetzt die ersten Steine auf dem Toteis ein. »Weg von der Wand«, schreit Hubert, mein neun Jahre jüngerer Bruder, der noch die Instinkte des Bergneulings hat. Früher wollten wir die Berge für die Nachwelt so erhalten wissen, wie wir sie vorgefunden haben: erhaben, gewaltig, gefährlich, herausfordernd. »Alles für die Nachwelt«, grinst Wolfgang und springt ein paar Schritte zur Seite, als hoch oben in der Wand wieder ein Surren zu hören ist. Der Schutt auf dem tauenden Eis, auf dem wir stehen, ist ins Rutschen gekommen, und Wolfgang hat Mühe, das Gleichgewicht zu halten. »Das hier ist unsere Nachwelt«, meint Hubert darauf und möchte wissen, was zu tun ist. Sollten wir weitersteigen auf der Suche nach dem ältesten Weg zum Ortlergipfel, den ein Outlaw und Gämsjäger namens Josef Pichler, genannt Pseirer Joséle, vor genau 200 Jahren gefunden hat, oder zurückgehen nach Drei Brunnen hinter Trafoi, wo unsere Autos stehen? Von dort sind wir am Vortag bis zur Bergl-Hütte aufgestiegen.
Wieder einer dieser Konflikte, die mich mein Leben lang begleitet haben. Weiter oder zurück? Es gibt Momente, in denen ich guten Grund hätte, aufzugeben, mich in die Sonne zu legen und auf alle Risiken zu pfeifen. Aber was bringt einem das? Kommen wir auf diese Weise weiter? Ausruhen, das ist das eine, doch jetzt abbrechen wäre wie Alles-Aufgeben. Es hätte etwas Endgültiges. Wenigstens versuchen sollten wir es. Natürlich muss auch ich mich überwinden. Es ist schließlich der größere Kraftakt, nicht aufzugeben, als nach Hause zu gehen. Denn in die Wand einsteigen heißt Mühen ertragen, ein Risiko eingehen. Vielleicht gelingt es ja doch, den richtigen Einstieg zu finden, und vielleicht hilft dann das Klettern, jenes flaue Gefühl der Leere loszuwerden, das mich in diesem Moment des Zweifels beschleicht.
Was ich noch vermisse, ist das Instinktive, das ich sonst beim Unterwegssein verspüre. Einmal unterwegs, bin ich mir meist selbst genug. Als sei ich ein Wesen, das eins ist mit allem. Auch mit den Kletterpartnern.
Später, als ich wieder in Juval bin, wo ich mit meiner Familie die Sommermonate verbringe, holt mich dieses Gefühl der Leere noch einmal ein. Es hat nichts mit Sabine oder den Kindern zu tun; sie freuen sich, wenn ich da bin. Es ist etwas anderes. Am Berg sind wir mit all unseren Entscheidungen letztlich allein. Und jede Tour kann tödlich enden. Es hilft uns niemand über unsere Zweifel hinweg: eine spezifische innere Einsamkeit, die ohne Rat ist, bleibt ein ständiger Begleiter. Anders als in der Zivilisation, wo alle gewünschten Sicherheiten suggeriert werden. Auch anders als jene universelle Erfahrung, die Religionen geboren hat.
Über Geröll gehen wir weiter, immer parallel zur Wand. Ein leichter Fallwind bläst uns jetzt ins Gesicht. Steine sind im Eis eingeschmolzen, der Schnee überfroren, aber nicht hart. Bei jedem Schritt breche ich in den Firn ein. Hoch über uns eine Eisbruchbarriere. Sie scheint an die 60 Meter hoch zu sein, auch wenn sie teilweise eingestürzt ist. Die Flanke in Falllinie darunter müssen wir meiden, denke ich. Schutt, Lawinenkegel und Krater am Sockel der Wand verraten, dass mit Lawinen Tonnen von Eis und Geröll heruntergekommen sind. Dort also dürfen wir keinesfalls hochklettern. Diese Angst kommt wie eine Ahnung, wohl von Erfahrungen aus der Vergangenheit gespeist.
Den ganzen Morgen schon habe ich dieses ungute Gefühl. Es ist keine wirkliche Angst, aber doch eine mahnende Stimme in meinem Unterbewusstsein. Es gilt, auf der Hut zu sein. Meine Sorge ist nicht, dem Aufstieg nicht gewachsen zu sein, doch die Befürchtung nimmt zu, herabfallendes Eis könnte uns erschlagen. Düstere Bilder entstehen in meiner Phantasie, während wir auf eine finstere Schlucht zusteigen. Auf der ersten gefrorenen Eisplatte rutsche ich aus. Nur der Eispickel, reflexartig eingesetzt, bremst mein Stolpern. Ich zwinge mich, ohne innezuhalten weiterzumachen. Der Sprung vom unbewussten zum bewussten Gehen bewirkt, dass meine Muskeln sich verkrampfen. Und jedes Mal, wenn Huberts Eispickel an Steinen abprallt, muss ich an die beiden Brüder denken, die ich beim Bergsteigen verloren habe. Nicht auszudenken, wenn ein weiterer umkäme.
Aus der Froschperspektive erscheinen sogar Steilwände harmlos. Als ob sie zu überschauen wären. Auch die Wand über uns senkt sich jetzt in den höheren Partien scheinbar ab. Als ob es dort flacher würde. Und das Gelände hat Risse, Bänder, eine Aufstiegslinie. »Es geht«, sage ich. Die Felsstruktur erscheint dem erfahrenen Auge jetzt aufgeschlüsselt. Also versuchen wir es! Unser erster Beschluss an diesem Tag: Einstieg direkt unter dem Finish, 700 Meter höher oben an einer Eiskante. Darüber jetzt das Leuchten des Morgenhimmels.
Mit den ersten Klettergriffen werden wir zu Vierbeinern. Ich könnte nicht sagen, dass ich dabei einer speziellen Technik folgte, ich steige einfach nur, Arme und Beine tun wie selbstverständlich, was sie tun müssen. Der Abgrund unter uns wächst zwar, aber ich merke es nicht. Ich sehe und spüre nur noch das Tasten und Greifen der Hände, das Setzen der Füße. Leichte, kurze Berührungen.
Klettern ist eine Sache der Konzentration. Wir Kletterer leben dabei in einer Art Eigenwelt. Alles andere wird ausgeschaltet, die Erinnerung schwindet. Die Außenwelt ist wie ausgesperrt, weit weg. Als gäbe es nichts mehr auf der Welt als unser kleines Team. Wir sind nur noch für uns selbst da. Wir steigen in einen Zustand unseres Daseins hinein, den es im Flachland, unten in den Städten nicht gibt. Dabei ist alles so wirklich, weil alle unsere Sinne, Instinkte und Kräfte jetzt mehr als sonst gefordert sind. Wir funktionieren nun automatisch. Die Bewegungen folgen dem Sehen, Tasten und Hoffen. Eine ergibt die andere, und alle ergänzen einander: Hand, Fuß, Arm, Bein und der Herzschlag, alles wird eins. Wie bei einem artistischen Tanz. Das Steigen geht bald in eine fließende Bewegung über. Wir sind ganz da, ganz gespannte Aufmerksamkeit und doch selbstvergessen.
In diesem Schwebezustand dürften wir dem Dasein der Tiere näher sein als dem des Menschen. Deshalb habe ich als Kletterer auch nie Probleme damit gehabt, mit einem Eichhörnchen oder Affen verglichen zu werden. Was sie mit uns Kletterern verbindet, ist das vollkommene Selbstverständnis der Bewegung bei gleichzeitiger Relativierung von Höhe und Tiefe und Reduktion der Landschaft ringsum zur bloßen Kulisse. Das Klettern geschieht jetzt um seiner selbst willen. Und doch: Diese Art Sein ist absolutes Risiko. Allein schon wegen des Abgrunds. Es ist uns auch stets bewusst dabei, dass wir gefährlich leben, und je höher wir steigen, je tiefer wir in den Gefahrenraum hineinklettern, umso weiter weg sind wir von allen Hilfen und Sicherheiten: auf uns selbst und an den Rand unserer Existenz gestellt. Als ob zwischen dieser Art Selbstverschwendung und dem jederzeit möglichen Absturz ein instinktives, weil lebensbejahendes Handeln keinen Fehler zuließe. Handeln und Sinn und Sein sind jetzt eins. So wie das Steigen zum Klettern wird, weil wir auch die Hände dabei brauchen, um unser Gleichgewicht zu halten, wird unbewusst ein Fließen daraus.
Während der Tour stellen sich solche Gedanken nicht ein. Immer erst im Nachhinein, wenn ich wieder zu Hause bin und realisiere, dass alles gutgegangen ist, kommt zum Übermut jenes Gefühl, wiedergeboren zu sein, hinzu. Aber es bleiben auch die Momente des Schreckens in meinen Erinnerungen lebendig, wenn ein Steigeisen rutscht oder ein Griff bricht. Heute noch, sechzig Jahre später, kann ich die Empfindungen abrufen, die mich als Fünfjährigen erfassten, als ich erstmals vom Gipfel des Saß Rigais nach Norden blickte. Unter mir 600 Meter Abgrund! Warum nur, frage ich mich, hinterließ dieser Blick in die Tiefe derart bleibende Spuren in den Nervenzellen meines Gehirns? Wie kann der Schauer beim Anblick einer nie zuvor gesehenen Tiefe so klar und dauerhaft in das molekulare Gefüge meiner Gedächtniszellen festgeschrieben bleiben, dass ich dieses emotionale Erlebnis ein Menschenleben später noch mit einzelnen Bildern wieder in mir wachrufen kann. Meine erste Bergbesteigung war wohl deshalb ein Wendepunkt in meinem Leben, weil ich spürte, wie instinktiv, gleichsam aus dem Bauch heraus, das Lernen vonstattenging. Ich lernte auch, dass Sicherheit relativ war, abhängig von meinem eigenen Tun und den Anforderungen, die ich an mich stellte.
Bei unserem Versuch am Ortler wird uns rasch bewusst, dass es das einzig Vernünftige wäre, umzukehren. Sicherheit wäre nur um den Preis zu erreichen gewesen, dass wir nicht eingestiegen wären. Nun aber, da uns Neugier oder Ahnungslosigkeit bis zum Wandfuß geführt haben, wollen wir es wenigstens versuchen. Erwartungsvoll denken wir jedoch nur daran, die Tour so schnell wie möglich hinter uns zu bringen.
Die ersten Seillängen über den Wandsockel klettern wir simultan. Jeder im Alleingang. Es geht auf diese Weise schneller als mit Seilsicherung, und die Verhältnisse hier sind vorerst perfekt: Drei Wochen warmes Wetter, gefolgt von einer Woche mit Neuschnee und Frost, haben die Schneerinnen am Anfang der Wand gut kletterbar gemacht. Solche idealen Verhältnisse kommen vielleicht nie wieder, sagen wir uns. Trotzdem, die angepeilte Route bliebe extrem gefährlich, wenn das Wetter umschlüge, vor allem, wenn es noch wärmer würde.
Die globale Erwärmung ist eine unumstößliche Tatsache, und sie macht das große Bergsteigen immer gefährlicher. Trotzdem bin ich im steilen Eis unterwegs. Immer noch. Ich erwähne das auch deshalb, weil ich selbst nicht ganz begreifen kann, warum ich in diese Westwand will.
Welche Szenarien habe ich nicht zu eisfreien Bergen entwickelt, zum Schwinden des Permafrosts, zu beschleunigter Verwitterung. Sogar das Ende des Eiskletterns in den Alpen gehörte dazu. Klingt gar nicht so unvernünftig, und doch bin ausgerechnet ich es, der immer wieder gefährliches Terrain aufsucht: eine fragile Welt über dem Abgrund. Wie ich mich nur in all diese Widersprüche verstricken konnte? Es wird ja auch mir nicht gelingen, die globale Erwärmung aufzuhalten. Ich habe immer wieder über ihre Ursachen und vor allem über die Konsequenzen gesprochen, natürlich ohne irgendetwas auszurichten.
Warum ich immer noch klettere? Aus Trotz vielleicht oder weil beim Klettern gerade jener Teil des Verstandes benutzt wird, der nicht hauptsächlich von Vernunft gesteuert ist. Umgekehrt aber sind Dummheiten oft das Tor zu neuen Erkenntnissen. Unser Gehirn will Fehler aufspüren, um daraus zu lernen. Eine faszinierende Fähigkeit! Intuition, jenes unbewusste Wissen, das erfahrene Bergsteiger einsetzen, ist die Summe einer lebenslangen Wahrnehmung. Einer Natur, die immer neu, im Wandel und unvorhersehbar ist. Die Widersprüche zwischen unserer Erwartung und dem tatsächlichen Geschehen sind es, über die wir stolpern, ohne dabei nachzudenken. Wir alle lernen schließlich nur durch Versuch und Irrtum. Nicht die Intuition hat unsere Vernunft blockiert, höchstens die leichtfertige Hoffnung, dass die Routenskizze, der wir folgen, stimmt.
Über eine Stunde lang schon halten wir uns inzwischen unterhalb von Séracs auf, einer Eisbarriere, die jederzeit kalben und die Wand darunter mit Eisbrocken verschiedenster Größe überspülen könnte. Eis ist zähfließend, es reißt und stürzt zuletzt dem Abgrund zu. Dem Eisschlag ist vor allem im unteren Wandteil nirgends auszuweichen. Und mehr als neun Stunden werden es schätzungsweise bis zum Ausstieg sein.
König-Nordwand
Seit fünfzig Jahren setze ich Ideen in die Tat um, mehr oder weniger erfolgreich. Völlig erfolglos war ich dabei nie, aber mein Bemühen brachte wenigstens Erfahrungen ein. Nur was den Umweltschutz angeht, scheint jeder Einsatz, von wem und welcher Organisation auch immer, vergeblich. Das Artensterben, die globale Erwärmung, das Waldsterben, die Lärmbelastung – alles nimmt zu, wird schlimmer, obwohl wir zu Tausenden dagegen anschreiben, anreden, Protest bekunden. Mit unseren hilflosen Gebärden geht eine Menge Energie verloren, das Übel aber wird nicht geringer. Es nützt also nichts, wenn wir alle für »die gute Sache« nur eintreten. Es gilt wohl, wie beim Bergsteigen, für eine winzige Sache Verantwortung zu übernehmen.
Wenn ich mir die großen Alpenwände heute ansehe, muss ich mir eingestehen, dass es viel schlimmer geworden ist, als ich es mir vor zwanzig Jahren vorgestellt habe. Die Matterhorn-Nordwand: Das Einstiegseisfeld ist weg, verschwunden. Der Eiger: Überall brechen Trümmer ab, Stücke, so groß wie Hochhäuser. Die Königsspitze-Nordwand: Die untere Hälfte ist eisfrei. Es ist zum Verzweifeln! Und dabei geht es am allerwenigsten um die Möglichkeiten des Kletterns. Das Klettern ist ja ohnehin unnütz.
Trotzdem habe ich nicht aufgehört, auf Berge zu steigen. Die Energie dazu beziehe ich aus der Spannung zwischen Idee und Wirklichkeit. Denn beim Klettern geht es um die Menschennatur: Wenn das anscheinend Unmögliche Realität wird, findet ein aufregender Bewusstseinsprozess statt. Und ihren intensivsten Ausdruck findet diese Spannung im extremen Klettern. Beim Höhersteigen ist diese Selbsterfahrung von höchster Intensität. Alles ist Fließen. Nicht der Gipfel, nicht der Weg, das Überleben wird dabei zum Sinn. Unser in Frage gestelltes Leben, angestachelt nur von einer Idee, ist plötzlich zweifellos das richtige Leben, in jedem Fall ein schöpferisches Leben.
Ich weiß, auch das Trockenbiotop aus heimischen Pflanzen vor der eigenen Haustür ist sinnvoll, auch Umweltschützer fühlen sich gut dabei, wenn sie in der Natur sein dürfen; vielleicht sind sie sogar weniger selbstgerecht als wir Kletterer. Soweit sie sich bemühen, wenigstens einen kleinen Winkel des Ökosystems zu retten, tun sie wirklich etwas Gutes. Uns allen. Auch wenn niemand sonst es bemerkt. Aber hilft diese Mühe der Erde? Die Königsspitze-Nordwand jedenfalls wird nicht so schnell wieder zu einer Eiswand.
1964, als ich diese Steilwand zum ersten Mal durchsteigen wollte, waren mein Villnösser Kletterpartner Heindl und ich nicht allein auf der Hintergrat-Hütte. Mehrere Seilschaften aus Meran und Innsbruck brachen am anderen Morgen vor uns auf, und wir mussten im ersten Wanddrittel mehrmals längere Zeit warten. Es lag Schnee auf einer dünnen Eisglasur an der Schlüsselstelle, und die Kletterei war heikel. Vor allem, nachdem die Morgensonne in die Wand gezogen war und den Schnee zum Tauen gebracht hatte. Heindl, vier Jahre älter als ich und als Jungbauer immer in ausgezeichneter Form, blieb ganz ruhig. Wir führten abwechselnd. Es war dann an mir, die Querung aus dem kombinierten Gelände in die keilförmige Eiswand, die sich bis in den Himmel über uns erhob, vorauszusteigen. Als ich die Frontzacken meiner Steigeisen, die wir an die Schuhe geschnallt hatten, vorsichtig in das dünne Eis drückte und belastete, lösten sich tellergroße Platten. Öfters schabten dabei meine Steigeisen über darunterliegenden Fels. Unwillkürlich verlagerte ich mein Gewicht jetzt auch auf die Hände und kletterte wie im Fels. Eisgeräte, die als Anker dienen, wie wir sie heute benützen, gab es damals noch nicht. Weit spreizend stieg ich hin und her, über einzelne Stufen, die nicht mit Eis bedeckt waren. Bis ich ins Gipfeleisfeld kam. So habe ich gelernt, auch beim Klettern im Eis die Struktur der Wand zu nutzen, so dass ich ohne Tricks, auch ohne Angst zu stürzen, vorankam. Mein Stil ist es immer schon gewesen, nicht allzu sehr auf die Technik zu vertrauen. Ich setze viel mehr auf den Instinkt. Alles andere versagt in kritischen Momenten schnell.
Das Eis war dünn, und es war schwierig, Standplätze zu schaffen. Wenn ich mit der Haue des Pickels dabei auf Fels schlug, regnete es Funken, und von oben hagelte es Eissplitter, wenn die ersten Seilschaften Stufen über mir ins Eis schlugen. Aus Angst, getroffen zu werden und infolgedessen den Halt zu verlieren, drehte ich mich beim Warten so zur Wand, dass ich die anderen wie in der Schwebe über mir sah. Mir war klar, fiele weiter oben einer rückwärts aus der Wand, er überschlüge sich und käme kopfüber direkt auf mich zugerast. In meiner Sorge, dabei mitgerissen zu werden und im Seilknäuel mit anderen abzustürzen, kamen mir Bilder vor Augen, wie Schädel platzen, Steigeisen sich in fallende Körper bohren und unser kostbares Leben sich im Abgrund verlor. Nicht der drohende Sturz beim Klettern, die Aussicht mitgerissen zu werden, war es, die diese Art Ängste in mir auslöste. Trotzdem, es war leichter, diese Ängste zu ertragen, wenn ich die Gefahr im Blick hatte. Mit dem Weitersteigen verflüchtigten sich diese Sorgen. Denn in keiner anderen Situation sind wir so lebenshungrig wie beim Klettern. Unsere Hirne sind währenddessen nicht vernebelt, sondern in einem erhöhten Wachzustand. Auch empfinden wir dabei sehr intensiv. Wir verteidigen unser Leben Schritt für Schritt und so hartnäckig gegen die Gefahr zu fallen, dass Zweifel am Überleben erst gar nicht aufkommen können. Ein Risiko besteht zwar immer, doch glauben wir das Leben zu hundert Prozent im Griff zu haben. Einen Widerspruch darin sehen vielleicht die Leser, nicht die Kletterer. Haben wir uns mental doch wochen-, oft monatelang mit unserem Weg in Fels und Eis auseinandergesetzt, sind im Vorausvollzug jede einzelne Passage geklettert.
Nur Dritte, die anderen Kletterer also, ließen sich nicht kontrollieren. Heindl und ich mussten also schnell sein, wenn wir an der Reihe waren zu klettern, keine Sekunde zögern und an den Standplätzen die Selbstsicherung an wenigstens zwei Eisschrauben fixieren. Der Übergang vom Fels ins Eis war 50 Meter lang gewesen, und auch Heindl bemühte sich dabei, besonders sauber zu klettern. Die kleinste Unsicherheit – und schon bist du verloren. Rutscht ein Fuß, fehlt der Gegendruck, und du stößt dich selbst von der Wand ab. Als wir ins massive Eis kamen, wusste ich, dass die Tour klappen würde.
Damals hatten wir noch nicht diese leichten Materialien, wie der Markt sie heute sogar für Wanderer bereithält. Wenigstens hatte das Hanfseil, das ich bei vielen meiner frühen Dolomitentouren eingesetzt hatte, ausgedient. Aber auch die modernen Nylonseile banden wir uns noch um den Bauch. Wir sicherten uns gegenseitig mittels der Dülfer’schen Schultersicherung, einer Bremsmethode, bei der das Seil über Schulter und Rücken zum Partner geführt wird. So ausgerüstet, kamen wir beim Klettern in großen Wänden allerdings rasch an unser Limit. Vor allem, weil wir keinesfalls stürzen durften. Heute wird die Grenze des Kletterbaren auch deshalb immer weiter hinausgeschoben, weil ein Sturz nicht mehr den Tod bedeuten muss. Glücklicherweise, sage ich, will aber auch jene nicht kritisieren, die auf jede Form der Absicherung verzichten.
Auch unsere sportlichen Fähigkeiten waren damals begrenzt. Ich lief zum Training ab und zu steil bergauf. Auf Zehenspitzen. Professionelles Training war jedoch für die allermeisten von uns ein Fremdwort. Mit zwanzig machte ich dann schon einige Anstrengungen, meine Fitness zu verbessern. Hauptsächlich aber ging ich zur Schule. Von Muskelaufbau, Ausdauertraining und ausgewogener Ernährung hatten wir damals wenig Ahnung. Auch Hallentraining gab es nicht. Das alles soll keine Entschuldigung für unser niedriges Niveau beim Klettern sein, es ist lediglich eine Feststellung. Trotzdem, die Abenteuer, die wir am Berg erlebten, waren lebensbestimmend für mich. Für viele von uns wurde Bergsteigen zu einer besonderen Lebensform. Einige von uns haben für dieses Ideal sogar alles andere aufgegeben. Sie folgten der Vision von Abenteurern oder Eremiten. Manche wollten Berufssportler werden. Wenn sie erst einmal auf diesem oder jenem Berg säßen und einen Namen hätten, dachten sie, hätten sie es geschafft. Von der bürgerlichen Welt waren wir alle eine horizontale Ewigkeit und oft 1000 vertikale Meter entfernt. Ich führte immer auch ein normales Leben, für andere war es damit zu Ende. Sie hatten später keine eigene Familie, keine Kinder, nicht Haus oder Hof, viele nicht einmal eine Wohnung. Einige waren ohne Glück und sind aus den Bergen nicht zurückgekommen. Wieder andere haben, von heute auf morgen und für die Szene unerwartet, irgendwas anderes angefangen: sie sind ausgewandert, haben ein Boot gebaut und sind auf den Ozean hinausgefahren. Als hätten sie ein für alle Mal auf die Option eines normalen Lebens verzichtet – also auch keine Freundin mehr, kein Auto, kein Kino, keinen Rotwein. Ebenso gut hätten sie im Gefängnis leben können. Heindl und ich sind in Südtirol geblieben. Er führt mit seinen 70 Jahren noch immer den »Pfaltener-Hof« und ich inzwischen ein recht bürgerliches Leben. Unter der Königspitze-Nordwand weiden im Sommer heute meine Yaks, tibetische Hochlandrinder.
Die König-Nordwand galt 1964 noch etwas, und wir extremen Bergsteiger waren ein kleines geschlossenes Grüppchen. Tagelang aßen wir nur Sardinen und Brot, tranken Schneewasser oder lutschten Eis. Wenn wir schließlich den Gipfel erreichten, schmerzten Finger und Zehen oft, als würden sie gleich abfallen. Unsere verschwitzten Kleider stanken, die Haut brannte, die Fingerkuppen fühlten sich an wie Leder. Am Berg aber waren wir unter uns und unseresgleichen. Irgendwann aber begannen einige von uns auszuscheren. Sie schlugen ganz normale Karrieren ein. Einige meiner Freunde wurden Ärzte, andere Handwerker, einer wurde Wissenschaftler. Ich habe den Absprung nicht rechtzeitig gefunden und bin Abenteurer geblieben. Wieder andere gingen nicht auf die Uni, sind später nie in die Welt hinausgekommen und haben heute keine Rente. Während ich mich in meiner Burg vor dem brennenden Kamin mit jungen Grenzgängern oder alten Freunden unterhalte, lauschen sie dem Trommeln des Regens auf ihrem Zeltdach. Sie hassen mich dafür, dass ich weder Eremit noch Fundamentalist, schon gar nicht Karrierist oder Pensionist geworden bin. Mich treibt immer noch die Neugier an, inzwischen vor allem die Frage, wie wir Menschen ticken.
Die König-Nordwand habe ich später öfters noch durchstiegen. Mit immer besserer Ausrüstung und unter von Mal zu Mal schlechteren Umweltbedingungen. Das Eis schmolz weg, die Felsen darunter verwitterten und wurden zu Geröll, sie zerbröseln heute unter den Schuhsohlen. Der Gletscherschwund in den Alpen, von den Fundamentalisten als Rache der Natur für das Fehlverhalten der Menschheit angeprangert, schritt Jahr für Jahr fort. Ist es wirklich eine Katastrophe, was da passiert? Ja, es ist eine Katastrophe, dennoch ist dieser Gletscherschwund nichts anderes als eine Tatsache. Das Lamento der Ankläger heute nutzt so wenig dagegen wie meine Jung-Siegfried-Gedichte gegen die Umweltzerstörung damals. Eine heile Welt hat es nie gegeben und wird es nie geben.
Ortler-Erstbegehung
Wir stehen zu dritt auf einem Schneefeld und blicken einander an. Haben wir uns verstiegen? Wir stecken mitten im Nebel, hoch oben in der kirchturmsteilen Westwand des Ortlers, und fragen uns, wie es nun weitergehen soll. Oder gibt es kein Weiter mehr? Die Orientierung jedenfalls ist so schwierig geworden, dass wir mehr raten, wo wir gehen, als einem klar vorgezeichneten Weg zu folgen. Wie konnten wir auch so leichtfertig sein, ohne eine von unten ausgekundschaftete Routenlinie einzusteigen?
In einer solchen Wand gilt es doch, immer einem imaginierten Weg zu folgen. Noch aber ist das Gelände nicht allzu steil und wir alle drei sind in der Lage, ohne Seilsicherung auszukommen. Also steigt jeder für sich allein weiter. Bald würde hoffentlich der Nebel aufreißen und uns so die Orientierung erleichtert. Trotzdem kommt Besorgnis auf, auch Angst. Was, wenn ein Gewitter aufzieht oder die Nebel sich verdichten? Weil aber Hubert und Wolfi das Gelände, in dem wir klettern, souverän meistern, will ich nicht warnen.