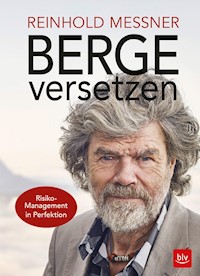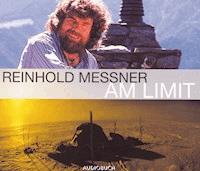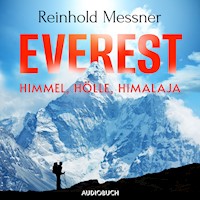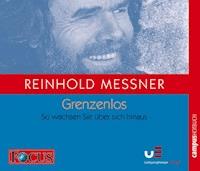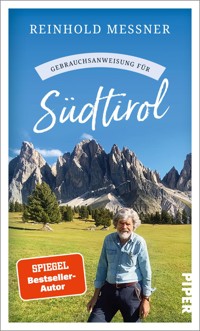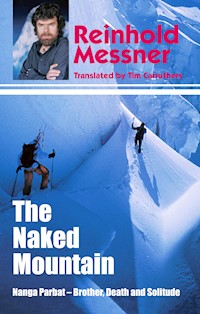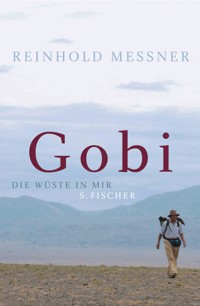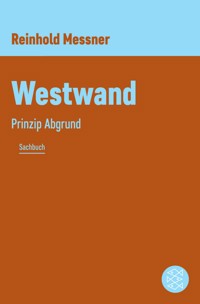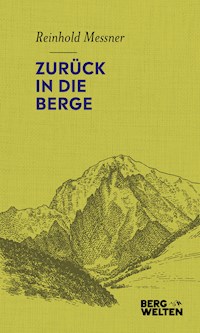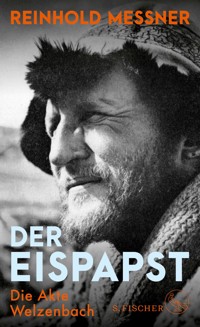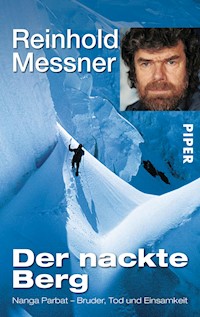12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Reinhold Messner sichtete ein erstes Exemplar des Yeti – in unseren westlichen Kulturen als der Schneemensch bekannt – auf einer Himalaja-Expedition im Jahr 1986. Seitdem hat er verschiedene Forschungsreisen unternommen, immer auf der Suche nach einer Antwort auf das Rätsel Yeti. In diesem Buch begleiten wir Messner zu den Hütten abgeschiedener Bergstämme, bei denen der Yeti als Vorbote des Unglücks gefürchtet ist, folgen Messner auf den verbotenen Pfaden im östlichen Himalaja, wo er ständig auf der Flucht vor den chinesischen Behörden ist, die Fremden den Zutritt zu den »wilden« Regionen Tibets untersagt haben. Doch genau dorthin haben sich die letzten Yeti-Exemplare zurückgezogen. Es ist eine einzigartige Spurensuche, und Messners Ergebnis ist eindeutig: Der Schneemensch lebt – in der Vorstellung der Himalaja-Bewohner und als bedrohte Tiergattung im Osten von Tibet. Die Summe dessen ist der Yeti.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 286
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Reinhold Messner
Yeti
Legende und Wirklichkeit
Über dieses Buch
Reinhold Messner sichtete ein erstes Exemplar des Yeti – in unseren westlichen Kulturen als der Schneemensch bekannt – auf einer Himalaja-Expedition im Jahr 1986. Seitdem hat er verschiedene Forschungsreisen unternommen, immer auf der Suche nach einer Antwort auf das Rätsel Yeti. In diesem Buch begleiten wir Messner zu den Hütten abgeschiedener Bergstämme, bei denen der Yeti als Vorbote des Unglücks gefürchtet ist, folgen Messner auf den verbotenen Pfaden im östlichen Himalaja, wo er ständig auf der Flucht vor den chinesischen Behörden ist, die Fremden den Zutritt zu den »wilden« Regionen Tibets untersagt haben. Doch genau dorthin haben sich die letzten Yeti-Exemplare zurückgezogen. Es ist eine einzigartige Spurensuche, und Messners Ergebnis ist eindeutig: Der Schneemensch lebt – in der Vorstellung der Himalaja-Bewohner und als bedrohte Tiergattung im Osten von Tibet. Die Summe dessen ist der Yeti.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 1998 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Buchholz/Hinsch/Hensinger
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490833-5
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
Irgendwo in Tibet
Wiedersehen in Lhasa
Verwirrspiel in Kathmandu
Schnee-Bär und Bär-Mensch
Götter und Dämonen
Wie ich zum Yeti kam
Der Yeti und seine Verwandten
Bei den Yak-Nomaden
Zwischen Neugier und Gespött
›Welteislehre‹ und ›Ahnenerbe‹
Spuren im Schnee
Weisskopf und schwarzer Riese
Das Puzzle stimmt
Das Eigenleben der Legende
Reisen zur Yeti-Recherche
»Was als Ungeheuer erscheint,
was als Ungeheuer benannt,
was als Ungeheuer erkannt wird,
entsteht aus dem Menschen selbst
und verschwindet mit ihm.«
Milarepa
Irgendwo in Tibet
An einem Hochsommernachmittag 1986, als mich das steigende Schmelzwasser des Mekong immer tiefer in eines seiner zahllosen Nebentäler trieb, gab es nur noch eines für mich: Ich mußte durch dieses tosende Wasser hindurch. Doch war ich wirklich auf dem richtigen Weg? Wo weiter? Und wie? Die Schlucht, in der ich mich befand, war so tief in den Fels eingeschnitten, daß ich die Übersicht verloren hatte und ziemlich ratlos war.
Die Gewalt der Strömung drohte mir bei jedem Schritt die Beine wegzureißen. Das eine mußte erst Halt finden, alle Kräfte spüren, bevor ich das zweite entlasten konnte. So stand ich, gestützt auf einen mannslangen Ast, schräg gegen die Strömung gestemmt, mitten im Wildbach und machte mir selbst Mut. Nein, zurück ging es nicht.
Das Ufer vor mir, einen Steinwurf weit entfernt, lag als dunkler Streifen zwischen Nadelbäumen und naßschwarzem Gestein. Die Flut war grau wie Nebel, kalt und so schnell, daß ich nicht hineinsehen durfte, um nicht schwindlig zu werden. Die Wasserspritzer schmeckten nach Fels und faulem Schnee. Zum Glück hatte ich die Schuhe anbehalten, als ich ins Wasser gestiegen war. So hatte ich wenigstens einen etwas festeren Stand zwischen den Steinen, doch jeder Schritt war gefährlich. Seit mir nach der Nanga-Parbat-Expedition 1970 sieben Zehen amputiert worden waren, hatte ich beim Durchqueren von Bergbächen Schwierigkeiten. Zudem war ich erschöpft und ganz auf mich allein gestellt.
Vorsichtig setzte ich den nächsten Schritt. Mit den Augen einen Stein am Ufer fixierend, schob ich den rechten Fuß in eine Mulde zwischen einigen Steinen unter dem brodelnden Wasser. Wenn der Schuh flach stand, galt es auszubalancieren und dem Untergrund zu vertrauen. Das rechte Bein belastend, den linken Fuß nachziehend und wieder zwischen Felsen schiebend, die ich vor mir unter dem Schmelzwasser ertastete, kam ich zentimeterweise voran, diagonal zur Strömung und flußaufwärts.
Von den Knien abwärts waren meine Beine gefühllos vor Kälte, im Gesicht stand mir der Schweiß. Meine Arme waren erschöpft vom Klammern und Stützen und dem Rudern in der Luft. Als ich mich endlich dem dunklen Ufer näherte, glühte ich vor Aufregung.
Wo genau ich war, wußte ich nicht. Ich kam von Qamdo und wollte weiter nach Nachu. Ich hatte die Täler einiger der größten Ströme Asiens gequert: Yangtse, Mekong, Salwen. Die Bergketten zwischen den von Norden nach Süden verlaufenden Flußtälern waren so zerklüftet und steil, daß Menschen nur an wenigen Stellen siedeln konnten. Von Dorf zu Dorf hatte ich mich durchgefragt und war oft zwei Tage lang marschiert, ohne einer einzigen Menschenseele zu begegnen.
Abseits der Straßen sind die Berge im Osten von Tibet schier unüberwindlich. Mit einer Yak-Karawane kam einer weiter oder mit den zähen tibetischen Ponys; allein und zu Fuß jedoch nur derjenige, der auf jeden Komfort verzichten konnte. Einen Schlafsack hatte ich im Rucksack, eine Stablampe, Speck und hartes Brot, ein Taschenmesser und einen Regenumhang. Aber keine Zahnbürste und kein Zelt. Wenn ich nicht rechtzeitig vor Einbruch der Dunkelheit in einen Weiler kam, schlief ich im Freien, in einer Höhle oder unter einem Baum.
Ich setzte mich auf einen trockenen Stein wenig oberhalb des Ufers und zog mir die Schuhe aus. Während ich die Strümpfe auswrang, wurde mir allmählich etwas wärmer. Wie beruhigend das Rauschen des Wassers jetzt klang! Vor mir lag ein unvorstellbar dichter Hochwald unter einer schrägstehenden Sonne. Dieser Wald war zu schaffen, wenn ich ihn vor dem Dunkelwerden durchsteigen konnte. Ich zog die nassen Strümpfe und die Schuhe wieder an, stand auf und nahm den Rucksack, der nach der Rast viel schwerer auf meinen Schultern lag als beim Überqueren des anschwellenden Gletscherwassers. Ich hatte unterschätzt, wie mühsam es war, eine Route durch das düstere Schattenreich zu finden, zwischen Unterholz, Felsen und Baumstämmen einen Weg zu bahnen und voranzukommen.
Diesmal war ich nicht nach Tibet gereist, um einen Berg zu besteigen oder eine Wüste zu durchqueren, ich wollte jenen Weg verfolgen, den das Volk der Sherpa bei seiner Flucht aus dem Gebiet von Dege über Qamdo, Alando, Lharigo, Lhasa, Tingri bis ins Khumbu-Gebiet genommen hatte: eine Völkerwanderung, die in vielen Überlieferungen der Sherpa immer noch nachklang. Diese Geschichte lag inzwischen ein paar Jahrhunderte zurück, doch ich wollte herausfinden, wie weit die Bilder aus der Überlieferung mit der Wirklichkeit übereinstimmten.
Zwischen Rhododendronbüschen und Berberitzen gab es kaum ein Vorwärtskommen. Das Dickicht war undurchdringlich wie ein tropischer Urwald. Ich versuchte mich zu erinnern, was mir die Einheimischen in den letzten Hütten auf meine Fragen nach dem Weiterweg geantwortet hatten.
Es war jetzt ganz still. Einzelne weiße Wolkenknäuel standen hoch oben über den schrägen Wipfeln der Koniferen. Im Himmel, der greifbar nahe schien, schwebten wie verloren ein paar Vögel über der Schlucht. Kaum ein Windhauch regte sich. Hatte nicht einer der Einheimischen, ein Yak-Hirte, angedeutet, das falsche Bachbett führe hinauf ins Nirgendwo? Zu Steinschlag und Lawinengefahr? In den Schluchten unterhalb der vergletscherten Bergkämme sollten sogar Ungeheuer leben, seltene Tiere, die zwischen dem Steppenland weiter im Norden und dieser zerklüfteten Gebirgslandschaft hin- und herwechselten!
Noch war Tag und gutes Wetter! Also stieg ich weiter, als ob ich auf der einzig richtigen Route wäre. Zwischen Felsen und den Stämmen jahrhundertealter Himalaja-Zedern kam ich jetzt besser voran als in Flußnähe, wo Hydrangien, Gänsekräuter, Dentzien, Clematis zwischen Rhododendrondickicht und Ahorn jede Spur überwucherten. Obwohl mich normalerweise tagsüber auch an den entlegensten Orten der Welt keine Ängstlichkeit befällt, suchte ich an diesem Tag immer öfter nach einem Wegzeichen, irgendwelchen Anhaltspunkten, nach einer Art Vergewisserung. Warum war ich so unruhig? Wann immer eine Steilstufe zu überwinden war, blieb ich stehen. Oft sank ich dabei in meiner Erschöpfung vornüber: die eine Hand aufs Knie gestützt, rastete ich unter der Last des Rucksacks und zählte meinen Puls. Aber der Blick auf die Schlucht brachte mir zu Bewußtsein, daß ich mich am Rand der Welt befand. Es war der 19. Juli, und ich war unterwegs nach Tschagu. Falls ich auf der richtigen Route war!
In all den Wochen, die ich schon zu Fuß unterwegs war, hatte ich Pfaden oder Steigspuren folgen können, mehrere Male hatte ich mich Yak-Karawanen angeschlossen, und immer hatte mir jemand den Weiterweg beschrieben, bevor ich allein zum nächsten Dorf aufgebrochen war. In Alando jedoch, wo ich eine Siedlung erwartet hatte, war kein Mensch gewesen, den ich hätte fragen können. Alando war nur ein Ort, kein Dorf. Kein einziges Haus war zu finden gewesen. Nicht einmal Steinmauern hatte ich gesehen und keine einzige Feuerstelle.
Auf einem moosbewachsenen Felsbrocken sitzend, holte ich eine Landkarte aus der Deckeltasche meines Rucksacks und schaute auf ein Gewirr von blauen und roten Linien auf braunem Grund; dazwischen Zahlen und Ortsnamen. Es war jedoch vollkommen aussichtslos, meinen Platz einem Punkt auf dem Papier zuordnen zu wollen. Wer hier verlorenging, den fand keiner mehr. Unschlüssig hockte ich da und starrte in die Hochgebirgswelt, aus der ich kam – Erinnerungen an anstrengende Tage drängten herauf. An manchen von ihnen war ich sechzehn Stunden auf den Beinen gewesen und hatte nicht einmal genug zu essen gehabt.
Zwischen die hohen Bäume fiel jetzt kein Sonnenstrahl mehr. Es war so kalt geworden, daß sich meine Haut unter dem schweißnassen Hemd zusammenzog. Gleichmäßig rollte irgendwo im Schluchtgrund das Schmelzwasser, das bald seinen Höchststand erreichen würde. Bevor es dunkel wurde, mußte ich irgendwo ankommen. Also weiter, ins nächste Dorf oder bis zu einer Alm über der Waldgrenze.
Als ich aufstand und mich bergwärts wandte, glänzten die vergletscherten Bergspitzen im Osten im schrägen Licht der Abendsonne, am Waldboden aber lag schon die Dämmerung. Im Augenblick, als ich mich in Bewegung setzte, sah ich keine zehn Schritte höher oben einen Steig. Hinter Bäumen und Unterholz war eine seichte Geländestufe zu erkennen. Ich stieg schneller. Fast mechanisch setzte ich meine Schritte und trat aus dem wuchernden Gestrüpp auf eine Waldlichtung: Da war deutlich ein Pfad, und mein Weg hatte wieder eine klare Richtung.
Endlich waren da Menschenspuren und der Weg, nach dem ich lange gesucht hatte. Ohne zu zögern, folgte ich ihm. Vorangetrieben von dieser Entschlossenheit, stieg ich, jetzt auf festem Grund, Tschagu entgegen, dem imaginären nächsten Dorf. Jetzt war das Steigen eine Lust, die mit jedem Atemzug noch wuchs und beim Ausatmen manchmal als tiefer Brustton aus mir herausbrach. Und dann, lautlos wie ein Gespenst, trat etwas Großes, Dunkles in eine Nische zwischen das Rhododendrongestrüpp, hinter dem sich der Steig dreißig Schritte weiter vorne verlor. Ein Yak, dachte ich und freute mich schon auf die Begegnung mit Tibetern, eine warme Mahlzeit am Abend sowie eine Behausung für die Nacht. Aber es blieb ganz still, kein Grunzen war zu hören und kein Pfeifen der Treiber. Lautlos und weich glitten behaarte Füße über den Waldboden, verschwanden, tauchten wieder auf, wurden schneller. Keine Äste und keine Gräben behinderten dieses Dahingleiten! Ein Yak konnte das nicht sein!
Ich war stehengeblieben. Mit angehaltenem Atem verfolgte ich die huschende dunkle Masse hinter einem Vorhang aus Laub und Astwerk. Was hatte diese Unruhe zwischen Ästen und Unterholz zu bedeuten? Wer oder was trabte da durch den Wald, allein und geschützt in der Dämmerung? Oder narrte mich dieser Fetzen Bewegung, der auftauchte, verschwand, wieder da war, um gleich wieder in die Schwärze hinter einem Baumstamm einzutauchen?
Als es wiederkehrte und kurz auf die Lichtung trat, war es eine Figur, riesengroß, auf zwei Beinen. Als ob mein eigener Schatten auf das Dickicht zehn Meter weiter projiziert worden wäre. Einen Herzschlag lang hielt mein Gegenüber in dieser Erstarrung inne, dann wandte es sich ab und verschwand in der Dämmerung. Ich hoffte noch, wenigstens ein Schnaufen, einige Atemzüge zu hören. Aber nichts, es blieb still, kein Kollern von Steinen, keine knackenden Äste. Im Grau des Waldhintergrunds glaubte ich noch ein paar Laufschritte zu vernehmen, leicht und weich, dann nichts mehr.
Ich starrte auf den nun leeren Ort der Erscheinung, zuerst erstaunt, dann ratlos. Was war das da oben gewesen? Warum hatte ich nicht fotografiert? Ich wagte es nicht einmal, meinen Standort zu verlassen. Wie angewurzelt dastehend, schaute, witterte, lauschte ich in die Stille vor mir. Hatte ich Angst nachzusehen? Vielleicht, vor allem aber war ich wach wie ein Tier. In diesem Zustand erhöhter Aufmerksamkeit auf alles, was sich rührte, was anders als der Waldboden roch, was im leisesten Windhauch an Geräuschen aufkam, schlich ich die zwanzig Schritte bis zu dem Gestrüpp, wo das seltsame Wesen aufgetaucht und gleich darauf wieder verschwunden war. Vor einer feuchten Mulde blieb ich stehen. Da war eine Delle auf dem schwarzen Lehm mitten auf dem Steig. Ein Fußabdruck! Im Grau der Dämmerung starrte ich auf eine riesige menschliche Fußspur! Gut zu erkennen! Auch Zehen waren auszumachen! Als müßte ich mich selbst davon überzeugen, daß die Spur frisch war und die Erscheinung also kein Trugbild gewesen sein konnte, griff ich in den Morast neben der Spur. Schwarzer Lehm! Dann fotografierte ich die große Delle und prüfte die Tragfähigkeit des Bodens daneben mit meinen eigenen Schritten. Da meine Schuhe weniger tief einsanken als die nackten Fußsohlen des gesichteten Wesens, mußte es viel schwerer sein als ich.
Ich war so sicher gewesen, mit dem Auftauchen von Tieren Menschen zu treffen und Auskunft zu erhalten, daß ich mir jetzt verloren und wie ausgesetzt vorkam. Noch immer hatte ich ja keine Antwort auf die Frage, wo ich mich befand. Während ich noch lange unverwandt auf diese Spur starrte, erinnerte sie mich plötzlich an jenen berühmten Fußabdruck, den Eric Shipton 1951 am Melung-Gletscher zwischen Tibet und Nepal fotografiert hatte und der nach wie vor als der beste Beweis für die Existenz des Yeti galt. Ein Yeti also?
Sicher, die Legende vom Yeti kannte ich, sie wurde überall im Sherpa-Land erzählt, aber ein lebendiges Wesen hatte ich mir nie dazu vorstellen können. Warum auch? Ich kannte große Teile Tibets und den Himalaja recht gut. Dort, wo wir Bergsteiger mit unserer modernen Ausrüstung nur unter großen Mühen und höchstens für einige Monate überleben konnten, hatte ich nie einen Yeti gesehen, und tiefer unten in den Tälern, wo die Einheimischen ihre Sommerweiden hatten, wären sie bis in ihre Höhlen zu verfolgen gewesen.
Die Legende vom Yeti war für mich nichts als ein Märchen aus längst vergangener Zeit, eine Geschichte, mehr nicht. Sie gehörte zu den Bildern aus dem Himalaja wie die vergletscherten Bergspitzen, die Schneestürme und die eisigen Winternächte. Wie oft hatten mir die Sherpas im Küchenzelt des Basislagers vom Yeti erzählt. Von Mädchen, die er entführt, von Yaks, die er mit einem Prankenschlag getötet, von riesigen Fußspuren, die er im Schnee hinterlassen hatte. Zwischen Ausrüstungsgegenständen und Kisten mit Proviant hokkend, hatte ich meist nur halb hingehört, während sie mit Worten und Gesten das Bild eines gefährlichen Riesen im raucherfüllten Halbdunkel des Zelts beschworen. Ganz selten nur, wenn einer seine Geschichte mit genauen Ortsangaben versehen und denjenigen mit Namen genannt hatte, der ihm begegnet oder nachgestiegen sein sollte, war ich hellhörig geworden. Auf mein Nachfragen aber waren meist aus Vätern Großväter, aus einem Ort eine Gegend, aus einem Sicher ein Vielleicht geworden, bis das Gerede über den Yeti so dürftig und vage geklungen hatte, daß ich es vergessen wollte.
Die Legende vom Yeti hatte sich über den Himalaja und Tibet ausgebreitet wie die Wasser, die von den Bergen kommen, wie die Rinnsale nach der Schneeschmelze hatte sie überall im Himalaja bis ins letzte Dorf, zu jedem Haus gefunden. Hatten vielleicht die Sherpa sie bei ihrer Wanderung nach Nepal gebracht, nach Sikkim und Solo Khumbu vor allem? Mit den ersten Forschungsreisenden, die den Himalaja aufsuchten und vom Yeti hörten, war sie dann in Zeitungsartikeln und Büchern nachzulesen gewesen und damit scheinbar realer geworden. Nach den Bergsteigern waren die Trekker und Touristen gekommen, und es waren immer mehr geworden. Innerhalb nur eines Jahrhunderts war das Geheimnis vom Yeti über die ganze Welt verbreitet worden. Niemand wußte eine Antwort auf das Rätsel, aber alle gaben eine. Mehr als eine Milliarde Menschen in den Industrieländern dürften heute eine Vorstellung vom Yeti haben, jeder seine eigene. Bei vielen von ihnen steht gewiß nur die Sehnsucht dahinter, einen Blick zurück in unser Dasein vor der Menschenzeit werfen zu können, und einige möchten wohl einen Schauer empfinden beim Blick in den Spiegel der Vorzeit.
Während sich der Yeti bei uns als auflagensteigernder Gegenstand von Zeitungsmeldungen bewährte und damit rasch zum belächelten Gerücht verkam, übernahmen die Sherpa in Nepal und andere Touristen-Animateure in Bhutan, Indien sowie Tibet für ihre Kolportage vom Yeti allmählich jene plumpe Figur aus dem Westen, die eher unserem King Kong aus der Traumfabrik Hollywood glich als dem Bild, das sich die Himalaja-Bewohner einst vom Yeti gemacht hatten. Das Gespenst aus unserer Welt allerdings konnte nur so weit auf das Dach der Welt zurückgespielt werden, wie es Straßen, Fernsehantennen und Videorecorder dort gab.
Während ich wieder bergwärts ging, den Steig vor mir weiter nach den geheimnisvollen Spuren absuchend, wurde mir bewußt, daß ich nirgendwo auf dieser Reise vom Yeti hatte erzählen hören. Seit ich zu Fuß unterwegs war, hatte mich auch niemand vor einem geheimnisvollen Wesen gewarnt. Hatte es in Kham eine Yeti-Legende nie gegeben, oder war sie in diesen entlegenen Gebirgstälern versiegt, bevor die ersten Touristen kamen? Oder war umgekehrt die Yeti-Welle aus Europa, Amerika, Japan dort zum Stillstand gekommen, wo man Worte wie Neandertaler, King Kong und Yeti nie gehört hatte?
Viermal noch an diesem Abend sah ich übergroße Fußabdrücke auf dem Steig, dem ich folgte. Das Tier war also bergauf gelaufen und stieg jetzt wohl irgendwo weiter vorne durch den Wald. War es wirklich ein Tier? Von einem Bären hätte ich irgendwo auch den Abdruck einer Vordertatze finden müssen, und die Spuren von Schneeleoparden sahen ganz anders aus und waren kleiner.
Die Vogelstimmen hoch oben in den Bäumen wurden mit dem eisigen Fallwind immer seltener und leiser. Oder hörte ich beim schnellen Steigen jetzt nichts mehr als mein Atmen und den Widerhall meiner Schritte?
Der Weg hinauf bis zur Baumgrenze war mühsam und voller Ungewißheiten: Verlief meine Route nicht doch weiter oben am Hang? Und das Rauschen über mir – kam es aus der Schlucht, in der das Wasser toste, oder aus den Baumkronen, die in den Nachtwind ragten? Überall herrschte jetzt die gleiche finstere Nacht. Obwohl ich tagsüber wiederholt daran gedacht hatte, zu gehen, bis es dunkel wurde, und dann zu biwakieren, war ich jetzt nicht bereit, zwischen dem Wurzelwerk einer großen Zeder auf den Morgen zu warten.
Ich stieg also weiter und trat irgendwann zwischen Einbruch der Dunkelheit und Mitternacht aus dem Wald auf eine flache Lichtung. Helles Mondlicht füllte das Tal vor mir. Nur auf den Abhängen talauswärts lagen die Schattenkeile der schwarzen Berge. Die Schlangenlinie der Steigspur, die über die Wellen des Almbodens lief, verlor sich weit hinten im Dunkel einer ansteigenden Moräne. Nirgends war eine Hütte zu sehen. Nein, da war kein Geruch von Tieren; keine Lichtpunkte weit und breit.
Als ich zwischen aschfarbenen Wacholdersträuchern dahinging, hörte ich plötzlich ein ungewohntes Geräusch, ein Pfeifen, das dem Warnruf von Gemsen glich. Ich sah mich um und erfaßte im rechten Augenwinkel die Umrisse eines Zweibeiners, der zwischen den Bäumen zum Rand der Lichtung hin flüchtete, wo Dickicht aus Zwergsträuchern den Ansatz des Steilhangs überwucherte. Lautlos, vornübergebeugt, hastete dieses Wesen weiter, verschwand hinter einem Baum, tauchte als Ungeheuer wieder auf, das Mondlicht im Rücken, drehte den Kopf in meine Richtung und verharrte einen Augenblick. Wieder hörte ich dieses zornige Fauchen, das mehr ein Pfiff war, und sah einen Herzschlag lang in sein Gesicht: Augen sah ich und Zähne, aber kaum Formen oder Farben. Das Gesicht nur ein grauer Schatten, der Körper bloß ein schwarzer Umriß, ragte die Gestalt bedrohlich vor mir auf. Sie war vollkommen behaart, stand auf zwei kurzen Beinen, und die starken Arme hingen hinab bis fast zu den Knien. Ich schätzte ihre Größe auf mehr als zwei Meter. Dieser Körper schien viel schwerer zu sein als ein ebensogroßer Mensch, lief aber mit einer solchen Leichtigkeit und Kraft auf den Saum der Zwergsträucher zu, daß ich ebenso erschrocken wie erleichtert war. Daß kein Mensch mitten in der Nacht so laufen konnte, war klar, aber welches Tier hatte eine solche Gestalt? Weit hinter den Bäumen, bei den ersten Sträuchern hielt das Nachtwesen wieder inne. Als ob es Atem holen müßte. Ohne sich noch einmal umzudrehen, verharrte es regungslos in der mondhellen Nacht. Es stand da und wandte nicht einmal den Kopf. Ich war zu verwirrt, um mein Fernglas aus dem Rucksack hervorzuholen.
Diese Gestalt, die ihre Form veränderte, je länger sie im Mondlicht vor dem schwarzen Saum des Waldes kauerte, war dasselbe oder ein gleiches Tier wie das, was mich am späten Nachmittag weiter unten überrascht hatte. Wieder lag Gestank in der Luft, und seine fernen Rufe bebten in mir nach. Ich hörte noch, wie die Gestalt ins Dickicht brach, sah, wie sie auf allen vieren über den Steilhang flüchtete, immer höher hinauf, immer tiefer in die Nacht und ins Gebirge. Dann war nichts mehr zu sehen und kein Laut mehr zu hören. Keine losgetretenen Steine, kein fernes Heulen.
Erschrocken starrte ich in die Weite des Nachthimmels und dann auf meine Hände. Sie zitterten. Hatten nicht die Sherpas immer wieder erzählt, ein pfeifender Yeti bedeute Gefahr und man müßte abwärts fliehen? Ich hatte keine Waffe, und abwärts fliehen? Wie sollte ein Mensch nachts so schnell durch Unterholz und Geröll laufen? Wie gelähmt stand ich da. Ohne einmal zu straucheln, ohne zu zögern war das Tier über die mondfleckigen Hänge verschwunden. Als ob eine ungeheure Wut, von Kraft und Geschicklichkeit getragen, es lenkte.
Wo war es jetzt? Allein die Vorstellung eines erneuten Auftritts meines rätselhaften Gegenübers, was immer es war, geriet mir zum Alptraum. Vielleicht hilft die Taschenlampe, dachte ich. Raubtiere fürchteten sich doch vor dem Feuer. Vor einem angreifenden Yeti aufwärts zu fliehen oder abwärts, war unmöglich. Das wußte ich jetzt. Ich hätte mir die Beine dabei gebrochen, und auch wenn dem ›Yeti‹, wie es hieß, beim Abwärtslaufen die Haare ins Gesicht hingen, er hätte mich erwischt.
Hinter dem Lichtkegel meiner Taschenlampe folgte ich weiter dem Steig über die Hochalm. Es war mir dabei, als ob ich verfolgt oder beobachtet würde. Immer wieder blieb ich stehen, um zu lauschen. Immer öfter schaute ich mich um.
Als ich an einen Wildbach kam, hörten die Steigspuren auf, und ich blieb stehen. So sehr ich mich nach einer sicheren Unterkunft und nach ein bißchen Geborgenheit sehnte, über diesen Bach kam ich in dieser Nacht nicht mehr. Eine Brücke gab es nicht, und das Schmelzwasser stand hüfthoch. Ich hörte das Kollern großer Steine im Wasser, sah silbern aufglänzende Schaumkronen und zog mich auf die Almwiesen zurück.
Die Steine am Rand des Gletscherbachs hatte der Nachtfrost mit Eis überzogen, und die Wut des Wassers würde erst in den späten Morgenstunden nachlassen. Am späten Morgen erst, bevor weiter oben in den Gletscherregionen erneut die Schneeschmelze begann, wäre die beste Zeit, den Bach zu überqueren.
Todmüde jetzt und mit einem Gefühl der Verlassenheit, suchte ich einen Lagerplatz unter einem Steinwall, den das Wasser im Laufe der Jahrzehnte wie einen natürlichen Damm aufgeschichtet hatte. Viel Auswahl hatte ich nicht. Wenig tiefer im Talgrund war das Bett des Flusses zu sehen, das Wasser zu hören, das ich am späten Nachmittag durchquert hatte und in das der Wildbach vor mir einmündete.
Von nächtlichen Begegnungen und der eigenen Angst eingeschüchtert, richtete ich mir ein Nachtlager. Ein metallischer Glanz lag auf Steinen und Gräsern, als ich meine fingerdicke Schaumgummimatte ausbreitete. Dann schichtete ich ein Mäuerchen zwischen dem Lagerplatz und der freien Wiesenfläche auf, so daß wenigstens eine Ahnung von Geschütztsein aufkam, und schob mich in den Schlafsack. Den Kopf auf den halbvollen Rucksack gelegt, schaute ich eine Zeitlang in den nahen Sternenhimmel und sah dabei die Umrisse eines Ungeheuers, das mich über die Schulter hinweg aus einem blinden Gesicht anglotzte. Ich wollte schlafen und schloß die Augen, aber diese Gestalt war immer noch da und hielt mich wach, bis der Mond nur noch auf die Halden höher oben in einem Seitental schien.
In diesem Augenblick hörte ich wieder dieses Pfeifen. Ich riß den Kopf hoch. Nein, das war nicht der Wind gewesen, da war wieder dieses Ungeheuer. Ich starrte in den nachtschwarzen Talgrund, auf die Böschung zum Bach hin, ich hörte meinen eigenen Herzschlag und das Zischen und Klatschen des Wassers – oder war da wieder ein Pfeifen, ein Heulen? Kam diese Stimme aus der Ferne, oder war sie ganz nah?
Nein, hier konnte ich nicht bleiben. Der Widerspruch zwischen europäischer Vernunft und tibetischer Wirklichkeit war nur im Gehen zu ertragen, besser noch mit einer Taschenlampe in der Hand. Also stopfte ich den Schlafsack in den Rucksack und stieg wieder in die Nacht hinein, das Bachbett entlang, bergan.
Irgendwo mußte doch ein Übergang sein, der mich auch nachts auf die andere Seite des Baches brachte. Und wirklich, irgendwann fand ich einen Steg. Auf Holzbalken balancierte ich hoch über dem Bach und folgte dem Pfad weiter bergan. Geröllströme und Murenstriche schneidend, schob ich mich in Serpentinen einen Steilhang bis zur Gratschneide hinauf, hinter der erneut Almböden lagen – und ein paar verlassene Hütten! Da nichts zu hören war und nirgendwo Licht brannte, sah ich mich um. Das Geisterdorf war mit Dornengestrüpp und Steinwällen umzäunt und wirkte unheimlich und düster. Während ich zwischen den Pfützen am Boden und Stapeln von Brennholz, die wie langgezogene Schutzwälle vor den Häusern standen, hindurchging, bemühte ich mich, laut zu sein. Ich wollte gehört werden, mußte mich bemerkbar machen. Aber niemand schien aufzuwachen. Ich wußte, wie gefährlich es war, als Fremder mitten in der Nacht in einem Bergdorf aufzutauchen und als Einbrecher ertappt zu werden. Mein erstes »Tashi delek« hatte ich leise gerufen, jetzt schrie ich. Es rührte sich immer noch nichts. Nochmals rief ich »Tashi delek« – den üblichen Gruß der Tibeter. Wieder nichts. Kein Laut, kein Licht, kein Lebenszeichen. War das Tschagu? Das Dorf unbewohnt?
Langsam und vorsichtig ging ich einen schmalen Saumpfad entlang, lugte zwischen den Holzstapeln auf Vorhöfe und die niederen Häuser dahinter und redete halblaut vor mich hin. Zwischen Enttäuschung und Wut begann ich noch lauter zu rufen. Warum ging nicht endlich in irgendeinem der gesichtgroßen Fenster ein Licht an? Warum antwortete mir niemand? Irgendeine Tür mußte doch knarren!
Alles blieb still. Das einzige Lebenszeichen war dieser gefrierende Gestank nach Pferdemist, Fäulnis und Urin. Tschagu war kein Weiler. Tschagu war nichts als eine armselige Häuserzeile, ein Durchgangsort ohne Hoffnung – zwei Dutzend Hütten vielleicht, und alle gleich: unten gemauert, darüber ein Satteldach aus Holz. Dazwischen hockte die Finsternis wie ein aufgerissenes schwarzes Maul. In die zum Weg hin offenen Dachböden führten schmale Leitern, die neben die niederen Haustüren gelehnt waren. Obwohl die Hütten alle gleich baufällig aussahen – ich mußte hier bleiben.
Dieses Tschagu, erdrückt vom steilen Berghang dahinter, wirkte so öde und ausgestorben, daß ich bald alle Vorsichtsmaßnahmen vergaß und durch eine der Öffnungen in einem Stapel Brennholz in einen Innenhof trat, um einen trockenen Winkel für den Rest der Nacht zu suchen. Irgendwo mußte ich endlich einen sicheren Schlafplatz finden!
Beim zweiten, noch zögernden Schritt in Richtung Haustür hörte ich zuerst ein Gähnen unter der Treppe zum Dach, dann sah ich nur noch einen schwarzen Haufen mit gefletschten Zähnen und vier Augen auf mich zufliegen und taumelte rückwärts. In einer Mischung aus Wutanfall und Verzweiflung riß ich ein Scheit aus dem Holzstapel, durch den ich eben erst getreten war, und hatte mich gleichzeitig zurück auf den Weg gewunden. Schon schlugen andere Hunde an. Tibetische Mastiffs, das wußte ich – ich hatte zu Hause in Südtirol selbst welche –, trugen über ihren Augen zwei braune Flecken, die wie ein zweites Augenpaar aussahen. Diese Hunde waren groß und gefährlich.
Das armdicke, lange Holz wie einen Totschläger in beiden Händen schwingend, bedrohte ich nun meinerseits die geifernden Tiere. Ich war bereit, die Hunde der Reihe nach totzuschlagen, wenn einer von ihnen mich beißen würde. Mit dem Rücken zum Steinwall, der das Dorf von den Feldern dahinter trennte, stand ich auf dem Weg und redete auf die wütenden Hunde ein, die von links und rechts kamen, erst sieben oder acht, dann immer mehr. Sie sprangen durcheinander, und von den schwarzen Mastiffs sah ich oft nur das Gebiß, so daß es unmöglich war, die Meute in Schach zu halten und gleichzeitig zu zählen. Einmal besänftigend, dann wieder befehlend, redete ich immerfort auf die Hunde ein. Die meisten waren Mischlinge, aber keiner kleiner als ein deutscher Schäferhund. Wenn einer mir zu nahe kam, schlug ich blitzschnell zu. Das Knurren, Heulen und Bellen war inzwischen so laut geworden, daß auch ich schrie in meiner Not.
Die Dorfbewohner müßten doch endlich aufwachen, dachte ich, und sie würden mir zu Hilfe kommen. Aber es kam niemand. Langsam schob ich mich, immer mit dem Rücken am Steinwall die Häuser entlang und tastete mich, nach links und rechts schielend, den Weg zurück, den ich gekommen war. Ich ließ die Hunde nicht aus den Augen, und sie folgten mir, bis ich am Dorfanfang wieder auf eine Wiese ohne Mauern taumelte. Damit war der Spuk vorbei. Ganz plötzlich schienen die Hunde ihre Wut verloren zu haben und trotteten, knurrend der eine, winselnd der andere, zu den Hütten zurück. Ein paar von ihnen bissen sich wohl gegenseitig. Wohin jetzt und auf welchen Weg? Zurück ins Tal wollte ich nicht. Den Schrecken, den mir ein Rudel halbverhungerter Hunde einzujagen vermochte, war nichts gegen die Angst, die nach der nächtlichen Begegnung in mir nachbebte. Zehnmal mächtiger und schwerer als ein Hund war das Ungeheuer, das irgendwo in diesen Tälern hauste. Übers Gebirge war nachts kein Zurechtfinden; zudem war ich viel zu erschöpft, um weiter zu steigen. Wohin sollte ich also fliehen, wenn nicht in eines der Häuser, deren Bewohner offensichtlich alle mit ihren Yak-Herden auf die Hochalmen gezogen waren?
Tschagu, dieses Hundekaff, war meine letzte, die einzige Zuflucht. Hinter der Häuserreihe stand nur schwarz und schwer das Gebirge. Nochmals musterte ich die blinden Häuser und folgte dann dem Saumpfad zwischen Steinwall und Holzstößen, wieder zurück vor die Behausungen, die so unbehaust aussahen. Vorbei an den Pferchen vor den Hütten, ohne jetzt von den Hunden belästigt zu werden, fand ich mich schon besser zurecht. Wieder trat ich zwischen gestapeltem Brennholz durch eine niedere Öffnung in einen Vorhof, so groß wie ein Klassenzimmer, und ging weiter auf das Haus zu. Als ich sah, daß die Tür mit einem Vorhängeschloß verriegelt war, stieg ich, ohne lange zu zögern, die steile Treppe zum Dachboden hinauf, der völlig offen war. Zwischen Bodenbrettern und Dachschindeln konnte ich nur geduckt stehen. Ich tastete mich bis zu dem gemauerten Kamin, bei dem ich mein Lager einrichten wollte. Über den Rucksack gebeugt, horchte ich noch einmal in die Stille der Nacht, und nach einem letzten Blick über die Schulter kroch ich, entkleidet bis auf die Unterhose, in den Schlafsack. Nach wenigen Minuten, kaum daß sich Atem und Herzschlag beruhigt hatten, schlief ich ein.
Benommen in einer traumlosen Schwere schreckte ich aus dem Schlaf hoch und glaubte plötzlich Stimmen zu hören. Verwirrt schaute ich aus der dreieckigen Öffnung auf einen Felsgrat unter dem Sternenhimmel irgendwo im Himalaja. Ja richtig, ich hatte mich nicht getäuscht: da waren Schritte zu hören, Zischlaute, Gemurmel. Plötzlich kamen kurze gebellte Befehle zu mir herauf, dann folgten Steine. Sie polterten neben mir über den Bretterboden.
Verschreckt, noch halb im Schlafsack, robbte ich hinter den Kamin, um Deckung zu finden. Die Männerstimmen unten aber wurden lauter und zahlreicher. Ich wußte, daß ich als Eindringling nicht länger in diesem Versteck bleiben konnte. Ich mußte mich stellen, ehe sie heraufstiegen und mich totschlugen.
Gebückt, fast nackt, Kleider und Schlafsack unter dem rechten Arm, den Rucksack in der linken Hand, trat ich in die Öffnung über dem Vorhof und verharrte kurz im Mondlicht beim Einstieg zur Treppe. Dann aber, als ich die rußigen Gesichter der Männer sah, die Knüppel und Fackeln schwingend, unten warteten, balancierte ich, ohne auch nur einen Augenblick zu zögern, über die schmale, steile Außentreppe aus dem Obergeschoß zu ihnen in den Hof hinunter. Bevor ich den Erdboden vor dem Hütteneingang erreicht hatte, rissen sie mir alles, was ich bei mir trug, aus den Händen, und einer hielt mir das Windlicht vors Gesicht. Abgemagert, bleichhäutig, mit entschuldigenden Gebärden stand ich da und sah mich ihren armlangen Dolchen, ihrer Wut, ihrer Neugierde gegenüber. In meiner Pose der Unterwerfung muß ich so armselig ausgesehen haben, daß unter der Horde wilder Männer in ihren Lumpen zuerst Gemurmel, dann Gelächter einsetzte. Plötzlich starrten nicht mehr alle nur mich an. Einige flüsterten miteinander, andere stellten Fragen, die ich nicht verstand, und nach und nach steckten sie ihre Messer und Schwerter in die Scheiden aus Silber oder Leder zurück, die an ihren Gürteln hingen.
Als müßte ich all diese erschöpften und staubigen Gestalten von einem Alptraum befreien, begann ich plötzlich, wie zu meiner Entschuldigung von meiner nächtlichen Begegnung zu erzählen. Nein, ich konnte ihren Dialekt nicht sprechen, ich verstand gerade so viel Tibetisch, daß ich um Unterkunft und Buttermilch hätte bitten können. Mit Gesten und einzelnen Wortbrocken in einem Kauderwelsch aus Pidgin-Englisch, Nepalesisch, Urdu und Tibetisch, versuchte ich die Gestalt zu beschreiben, vor der ich mich hierher geflüchtet hatte, und offenbar war meine Geschichte so klar und meine Darstellung so deutlich, daß alle sofort wußten, worum es ging.
Ja, aufrecht, auf zwei Beinen war das Biest ein Stück weit gegangen, stammelte, erzählte und deutete ich. Dabei sah es viel kräftiger aus als ein Mensch und war so hoch wie diese Leiter ins Obergeschoß. Sein Pfeifen, wohl eine Art Warnung, ausgestoßen zwischen angelegter Zunge und Oberkiefer – ich versuchte den Zischlaut nachzumachen –, hatte mir die Gänsehaut über den Rücken gejagt. Ich schüttelte mich. Und dieser Gestank! Nach gefrorenem Knoblauch, ranzigem Fett und Kot roch sogar seine Spur.