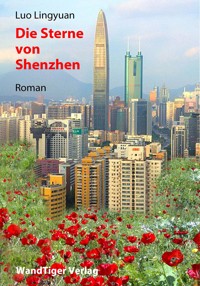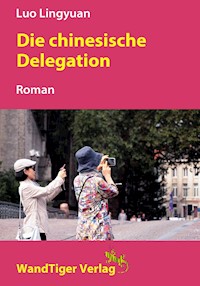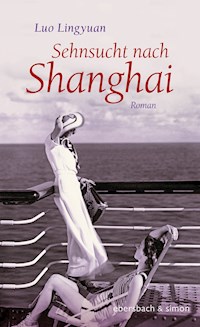6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: WandTiger Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
32 Jahre und noch immer nicht schwanger? Ein unhaltbarer Zustand – das finden zumindest die Eltern von Tingyi, einer chinesischen Fotografin, die mit ihrem deutschen Freund Robert in Berlin lebt. Während eines Neujahrsbesuches des jungen Paares in Kanton setzen diese daher alles in Bewegung, um möglichst bald ein Enkelkind zu bekommen, zu Roberts aber nicht zu Tingyis Entzücken. Dass sich gleichzeitig von ganz anderer Seite ein handfester Familienkonflikt anbahnt und Robert von einem kulturellen Fettnäpfchen ins nächste tappt, gibt Tingyi jedoch eine Atempause: Zeit, um darüber nachzudenken, welche Hoffnungen und Wünsche sie eigentlich selbst für ihre Zukunft hat. Ein verschmitzt erzählter Roman über eine deutsch-chinesische Liebesbeziehung, Fremd- und Selbstbestimmung sowie die unterschiedlichen Vorstellungen von Partnerschaft und Familie in Ost und West. Luo Lingyuan beherrscht die Kunst, ihre Figuren lebendig und mit leichten Pinselstrichen zu zeichnen, sodass man einfach mit ihnen mitfiebern, mitleiden und mitlachen muss.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Luo Lingyuan
Wie eine Chinesin schwanger wird
Roman
Inhaltsverzeichnis
Coverbild: Kinderfiguren mit Segenswünschen
zum chinesischen Frühlingsfest.
Bildrechte © WandTiger Verlag
E-Book 2016.
Alle Rechte vorbehalten.
Kein Teil des eBooks darf in irgendeiner Form ohne
schriftliche Genehmigung des Verlags verarbeitet,
vervielfältigt oder verbreitet werden.
Text, Satz und Layout: © WandTiger Verlag, Pählstraße 51, 81377 München
www.wandtigerverlag.de
Meinen Eltern in Dankbarkeit
1. Kapitel
»Du musst erst einmal essen lernen«
Die Morgensonne sticht durch die Dunstglocke und verwandelt die Wolkenkratzer in goldene Lichttürme. Der Perlfluss, in dem sich dunkelgrüne Wasserströmungen wälzen, glitzert, als wären in der Nacht alle Sterne vom Himmel hineingefallen. Alles vibriert in dieser Stadt: die Luft, die Straßen, die Autos, so dass Robert Wettstein sich fühlt, als ob er in einem pochenden Herzen herumliefe. Er ist froh, dass er sich heute Morgen nach dem Aufwachen fürs Joggen entschieden hat und ganz allein losgerannt ist.
Auf der Promenade am Fluss gibt es viel zu entdecken. Was machen die Menschen zu dieser Stunde? Sie üben Tai Chi, sie tanzen, sie stehen zusammen und schwatzen, manche erproben ihre Stimmen am Wasser, andere befingern das frische Gemüse, das die Nachbarin eingekauft hat …
Wie schnell sich das Leben verändert. Vorgestern saß er noch in seiner Wohnung in Berlin auf der Heizung, um sich den Hintern zu wärmen, während draußen der Schnee von den Ästen tropfte, und heute spürt er den warmen Südwind von Kanton im Haar. Seit gestern Abend sind sie in China, und Robert ist der Stadt augenblicklich verfallen. Wie schön, dass es hier im Februar noch wärmer ist als in Italien. Deswegen rennt er jetzt auch unter den immergrünen Bäumen auf der Uferpromenade entlang, während unter ihm links der Fluss und rechts die silberglänzenden Autos vorbeiziehen.
Aber wie kommt es, dass er in dieser fremden Welt keine Angst verspürt? Weil er einen Kopf größer ist als die anderen? Oder weil die Chinesen so offensichtlich im Frieden mit sich und der Welt zu sein scheinen? Vielleicht beides.
Auf einmal spürt der geübte Marathonläufer ein Grummeln in seinen Eingeweiden und vergrößert die Laufschritte. Gestern, kaum waren Tingyi und er angekommen, ist die ganze Familie ins nächste Sichuan-Restaurant ausgeschwärmt, um die Ankunft der beiden jungen Leute zu feiern und gemeinsam zu schmausen. Ein Feuertopf wurde bestellt und dampfte die ganze Zeit auf dem Tisch. Alles, was durch den Topf gegangen war, brannte feurig und scharf auf der Zunge. Es schmeckte Robert so gut, dass er Fleisch und Gemüse in rauen Mengen verdrückte. Und von allen wurde er für seinen geschickten Umgang mit Stäbchen gelobt! Jetzt jedoch macht sich das ungewohnte Essen bemerkbar.
He, murmelt Robert und schwingt Arme und Beine noch höher, ich jogge für euch, damit ihr euch schneller an China gewöhnt.
Aber der Bauch und die Därme wollen nicht hören. Was eben noch ein unbestimmtes Grummeln war, wird jetzt zur entschiedenen Warnung. Es blubbert und brodelt in seinem Inneren, als arbeite dort eine fleißige Abwasserpumpe. Kein Zweifel, Robert steht unter Druck! Und das gleich an beiden Enden. Mensch! Wo soll er jetzt hin? Auf der Promenade gibt es offenbar keine Toilette. Und wen soll er fragen? Er kann doch kein Wort Chinesisch …
Der Sportler presst seine Muskeln zusammen und versucht seine Würde zu wahren. Was er sucht, muss auf der Ebene unter der Promenade zu finden sein. Das sagt sein erprobter Instinkt. Die nächste Treppe, die nach unten führt, stürmt er so hastig hinunter, dass er beinahe ins Leere tritt und auf die Steinplatten fällt. Als er taumelnd die Straße erreicht, sieht er auch schon seine Rettung: Ein kleines gekacheltes Häuschen mit den zwei typischen Eingängen und verkleideten Fensterschlitzen, die so schmal sind, dass keiner hineinschauen kann. Auf dem betonierten Boden davor, ein wenig abseits der Treppe, hockt der Verwalter, ein Mann im mittleren Alter, und breitet Süßkartoffelstreifen zum Trocknen aus, damit sie alle genügend Sonne kriegen. Er wohnt mit seiner Familie in der winzigen Wohnung unmittelbar neben dem »Etablissement«, und es bleibt ihm gar nichts anderes übrig, als den von Blumenbeeten umgebenen Vorplatz für seine Haushaltszwecke in Anspruch zu nehmen. Als er sich zu seinem Gast umdreht, den Zeigefinger hochhält und »einen Yuan« sagt, ist Robert bereits in den dunklen Räumlichkeiten verschwunden.
Es sind kaum zwei Sekunden vergangen, da hört man explosive Geräusche aus dem Inneren des Häuschens. Der Chinese muss kichern und sagt zu seiner Frau, die in der Wohnung das Frühstück bereitet: »Der Westler hat eine große Bauchtrommel. Wäre das in der Nacht passiert, hätte ich gedacht, der Teufel wäre da in der Hütte.«
Als sich das Donnern ein wenig gelegt hat, ruft der Verwalter ins Häuschen: »Brauchst du vielleicht Papier?«
Robert versteht nichts, aber es ist ihm klar, dass der Mann da draußen mit ihm gesprochen hat. Denn bei der geringen Größe des Bauwerks braucht er keinen zweiten Blick, um sich zu vergewissern, dass er der einzige Gast ist. Er vermutet, dass der Chinese sein Geld haben will. Aber er hat heute Morgen außer dem Zettel mit der Adresse von Tingyis Eltern nichts in die Tasche gesteckt. Nicht einmal ein paar Taschentücher, die er jetzt gut brauchen könnte. Mit zusammengepresstem Hintern zieht der junge Mann vorsichtig seine Shorts hoch, als bewahrte er ein frisch geschlüpftes Küken darin, drückt auf die Spülung und tritt wortlos hinaus.
»Tut mir leid. Ich habe kein Geld bei mir«, sagt Robert errötend auf Deutsch und stülpt seine Hosentaschen nach außen. Als der Toilettenverwalter sich mit einem Lächeln nähert, springt Robert wie ein Hirsch die Treppen hinauf und rennt weg.
»Auch Beine hat er doppelt so lang wie wir«, meint der kleine Chinese und schaut dem Flüchtling kopfschüttelnd nach, »und beide behaart wie ein Affe.«
Tingyis Eltern wohnen in einem neuen, zwanzigstöckigen Hochhaus, haben sich aber vorsichtshalber eine Wohnung in der dritten Etage genommen. Die uniformierten Pförtner lassen ihn ohne weiteres passieren, die Gittertür aus Stahl ist nur angelehnt und die eigentliche Wohnungstür steht sperrangelweit offen, als Robert zu Hause ankommt. Er tritt leise ein, und als er Tingyis Mutter sieht, die gerade die Fliesen kehrt, sagt er »Ni hao«, wie er es gestern gelernt hat. Sie lächelt ihn an und meint auf Chinesisch: »Du siehst ein bisschen verschwitzt aus.«
Robert lächelt zurück, macht einen vorsichtigen Bogen um seine Gastgeberin und verschwindet eilig im Bad. Bald hört man die Dusche rauschen. Kurz darauf schleppt sich Tingyi ins Wohnzimmer und kratzt sich die verwuschelten Haare. Ihr Gesicht ist rund und erinnert fast an ein Kind. Ihre Augen sind vom Schlaf noch so schmal wie Kürbiskerne, und ihr Blümchenpyjama sitzt schief. Es sieht aus, als möchte sie am liebsten gleich wieder ins Bett kriechen. »Wo kommt denn diese laute Musik her?«, jammert sie. »Selbst ein Gehörloser fällt bei diesem Krach ja aus dem Bett. Und dann auch noch Carmen, My Bonnie Is Over The Ocean und Hänschen klein.«
»Nun ja, der Kindergarten will eben auch sein internationales Niveau zeigen«, lächelt die Mutter. »Wir sind auf der Höhe der Zeit. Die Vorschulkinder lernen jetzt Englisch.« Li Hong ist eine ehemalige Lehrerin. Ihre Haut ist vom Alter schon dunkel und hat ein paar Fältchen, aber wenn sie die Tochter sieht, scheint sie von innen zu leuchten wie eine Kerze. »Hör einfach weg. In einer Stunde ist es vorbei.« Sie führt die Tochter in die Küche und zeigt ihr, was sie fürs Frühstück gekauft hat. Ob es das Richtige ist, will sie wissen.
»Wir werden gleich sehen, was Robert schmeckt«, meint die Tochter und steckt sich einen Baozi in den Mund. »Mmmh, die esse ich immer gern.«
Vater Sui Kang ist schon lange auf. Er macht seine Morgengymnastik auf dem Balkon und lässt sich von den Geräuschen hinter seinem Rücken nicht ablenken. Der dünne Mann mit der runden Brille sieht nicht nur so aus, sondern ist auch wirklich ein Buchhalter. Seit er in Rente ist, macht er die Steuererklärung für kleine private Betriebe. Jedes Jahr hat er mehr Kunden. Als ihn die Tochter begrüßt, brummt er freundlich und macht weiter seine Dehnübungen. Neben ihm schlägt eine Henne, deren Fuß mit einer Leine ans Geländer gebunden ist, aufgeregt mit den Flügeln, als müsse sie dringend wegfliegen. Tingyi räkelt sich auf der Bank, die unter der großen Tafel mit den Familienfotos im Wohnzimmer steht, und blättert in der Zeitung, die neben ihr liegt. Aber ihre Mutter hat etwas anderes für sie zu tun. »Schau lieber mal nach dem Rettichkopf«, sagt sie. »Er kam vorhin rein, als hätte er Feuer unter den Füßen. Jetzt ist er schon ewig im Bad.«
Gestern beim Abendessen wollte Tingyi ihren Verwandten den Namen »Robert« beibringen. Die Eltern gaben sich auch alle Mühe, aber was die Mutter am Ende sagte, war Luo-bo-tou, und das heißt nun mal »Rettichkopf«. Das gefiel allen, auch wenn Robert mit seinen fünfunddreißig Jahren kein kleiner Junge mehr ist.
Tingyi hat Hunger. Wann kommt der Bursche endlich zum Frühstücken? Sie geht zur Badezimmertür und horcht. Man hört nur das Wasser im Waschbecken plätschern. »Roloko, alles in Ordnung?«
»Ja.« Der Wasserhahn wird weit aufgedreht und übertönt Roberts Stimme.
»Was machst du so lange? Willst du das Bad putzen? Meine Eltern werden sich freuen.« Sie drückt auf die Klinke. Nichts rührt sich.
Robert öffnet die Tür einen Spalt weit. Ein strenger Geruch weht Tingyi entgegen, so dass sie den Kopf wegdrehen möchte. Der Anblick, den ihr Freund bietet, bringt sie jedoch zum Lachen: Er steht splitternackt vor dem Waschbecken und wäscht mit voller Kraft seine Hosen.
»Hast du Durchfall?«, fragt Tingyi.
»Ja.« Vor lauter Verlegenheit wäscht Robert noch heftiger.
»Haben dich die Chilischoten umgehauen?« Tingyi stellt sich auf Zehenspitzen, um ihn zu küssen. Eigentlich reicht sie ihm nur bis zur Brust, aber wenn beide sich Mühe geben, kommen ihre Lippen doch immer zusammen. Dann öffnet Tingyi das Fenster und beginnt den nassen Boden zu wischen. Dabei schaut sie immer wieder zu ihrem Freund. Er hat eine gute Figur. »Ich muss noch ein paar Aktfotos von dir machen. Dein Po ist knackig wie ein Serrano-Schinken.« Tingyi ist Fotografin – und Feinschmeckerin. Sie isst für ihr Leben gern gute Sachen.
»Für dich tu ich alles, mein Herzchen«, sagt Robert. Man merkt, dass sich die beiden gut leiden können. Er muss lachen, als er weiteres Apfel-Shampoo ins Waschbecken spritzt.
»Gut. Dann können wir jetzt endlich essen«, meint Tingyi.
»Nee, nicht schon wieder!«, sagt Robert.
»Keine Sorge. Beim Frühstück gibt es nur harmlose Sachen«, beschwichtigt Tingyi. Sie hält ihm eine Plastikschüssel hin und gibt ihm mit einer Kinnbewegung zu verstehen, dass er die Wäsche da reintun soll. »Wir haben doch eine Maschine.«
»Ich weiß nicht, ob deine Eltern mit einer solchen Wäscheladung einverstanden sind«, zögert Robert.
»Ach, komm. Ich verpetz’ dich schon nicht.«
Als das Bad praktisch nur noch nach Apfel-Shampoo und Reinigungsmitteln riecht und die Waschmaschine zu summen beginnt, kann die Familie sich an den runden Tisch mit der Drehscheibe setzen. Tingyis Mutter hat verschiedene Leckerbissen gekauft. Alle langen kräftig zu, nur Robert nippt wie ein fastender Mönch an seinem Schwarztee mit Milch und rührt sonst nichts an. Aber er macht keinen leidenden Eindruck. Im Gegenteil, er schwärmt von dem, was er auf seinem Ausflug gesehen hat. Die unbekannten Bäume mit lang herunterhängenden Bärten, die bunt gekleideten Kinder, das elegante Panorama von Kanton, das sich vom südlichen Ufer des Perlflusses darbietet …
Tingyi hört mit halbem Ohr zu und schlürft genüsslich ihre Wintermelonensuppe mit Fleischbrühe. »Wieso bist du so früh aufgestanden? Mich hat der lange Flug schrecklich müde gemacht.«
»Die Henne hat so gegackert, da konnte ich nicht mehr schlafen. Ich wollte die Stadt sehen.«
»Aha, die Henne. Idyllisch bei meinen Eltern, nicht wahr? Ein Geschenk meiner Tante vom Land«, kichert Tingyi. Sie ist wie ein Schulmädchen, denkt Robert. Und ohne daran zu denken, dass ihre Eltern zuschauen, küsst er sie auf die Wange. »Aber sie wird nicht mehr lange gackern«, sagt sie.
»Wenn mein Vater Geburtstag hat, kommt sie in den Topf.«
»Oh, nee! Von mir aus darf sie jeden Morgen vor unserem Fenster singen«, sagt Robert.
Die Szene mit dem flüchtigen Kuss hat der Mutter gefallen.
»Tingyi, dein Rettichkopf liebt dich anscheinend sehr. Außerdem sieht er gut aus und ist kräftig gebaut. Ich denke, du kannst von ihm Kinder haben«, gibt sie ihr Urteil bekannt.
»Sogar, wenn ihr nicht gleich heiratet«, fügt sie dann leise hinzu.
»Mama, lass uns ein bisschen Zeit. Wir sind doch selbst fast noch Kinder«, jammert die Tochter.
»Hm, du benimmst dich zwar manchmal wie eine Zehnjährige, aber ein Kind bist du längst nicht mehr. Und dein Freund auch nicht«, sagt die Mutter. »Ich werde gleich herausfinden, ob dein Freund sich eine Familie wünscht.« Damit legt sie die Stäbchen beiseite und verschwindet im Schlafzimmer. Als sie zurückkommt, hat sie zwei bunt bemalte Keramikfigürchen in ihrer Hand. Beide sind nur daumengroß, halten aber ein haselnussförmiges Goldkügelchen auf den Armen.
Tingyi lacht. »Die sind aber drollig«, sagt sie. »Wo hast du die her?« Sie streckt die Finger nach den Figürchen aus.
Aber die Mutter lächelt nur Robert an. »Die schenke ich Rettichkopf.« Robert lächelt, weiß aber nicht, wie er das Geschenk einstufen soll. »Die sind schön«, sagt er. »Sind sie aus Schokolade?«
»Nein«, prustet Tingyi. »Das sind zwei Götter, die dem Haus Kinder und Reichtum bescheren sollen.«
Robert geht ein Licht auf, und er errötet. »Das ist sehr nett. Danke.« Behutsam trinkt er einen Schluck Tee. »Dann sind Kinder und Reichtum also dasselbe bei euch? Ich wünschte, so würden die Leute in Deutschland auch denken.«
Die Mutter ist begeistert. »Hast du gesehen, wie Rettichkopfs Augen strahlen?«, sagt sie zu ihrer Tochter.
Tingyi findet, dass sie ihre Mutter jetzt bremsen muss.
»Mama, wenn du unbedingt Enkel willst, dann halt dich an meine Geschwister. Kinderkriegen ist doch kein Brötchenbacken.«
»Wir helfen dir schon«, sagt die Mutter, erläutert aber nicht, was sie damit meint. Schon hat sie sich Robert zugewandt.
»Du musst essen.« Sie legt eine Sesamkugel auf seinen Teller, wo sich bereits verschiedene Leckerbissen angehäuft haben. Aber Robert greift einfach nicht zu. Eine kräftige Suppe zum Frühstück ist nicht sein Ding, und auch an normalen Tagen würde er morgens keinen Reis, kein gekochtes Gemüse, keinen Kuchen und keine frittierten Teigwaren essen.
Dass Robert nichts zu sich nimmt, gefällt Li Hong gar nicht. Wenn ein Kind nichts essen will, schrillen bei einer Mutter gleich die Alarmglocken. »Rettichkopf leidet an Appetitlosigkeit. Gib ihm von der Medizin, Vater«, sagt sie zu ihrem Mann. Das Familienoberhaupt ist etwas reservierter gegenüber dem Gast. Seine beiden anderen Kinder sind längst verheiratet, nur Tingyi noch nicht, das gibt ihm zu denken. Schweigend geht er zum großen Wandschrank, öffnet eine der geschnitzten oberen Türen und holt ein Fläschchen Huoxiang Zhengqi Shui heraus. Diese »den Energiefluss begradigende Flüssigkeit« gibt er der Tochter. »Wenn er das ausgetrunken hat, wird es ihm wieder gut gehen.«
Tingyi gibt das Fläschchen an Robert weiter. »Das ist gut gegen Durchfall«, sagt sie. Robert mustert die vielen chinesischen Schriftzeichen. »Macht euch keine Sorgen«, sagt er. »Ich brauch nichts.«
Aber die Mutter lässt natürlich nicht locker. Sie weiß, dass Robert sie nicht versteht, umso mehr kriegt dafür die Tochter zu hören. »Gib du ihm die Medizin. Der Junge muss fit sein. Ihr habt ja noch einiges vor«, sagt Li Hong.
Tingyi gibt sich Mühe. Geduldig versucht sie, den Patienten zu überzeugen. Vielleicht hilft es ja, wenn sie ihm erklärt, was der Zaubertrank alles enthält? Aber bei den meisten Pflanzen kennt sie nur die chinesischen Namen, deswegen sagt sie bald wütend: »Ach, zum Teufel mit den Details. Ich sage dir, es hat immer geholfen.«
Aber Robert bleibt stur. Als Biologe könnte er sich schon zusammenreimen, was in der Flasche ist, aber er will nun mal nicht. »Herzchen, wenn du mir sagen würdest, dass die Unsterblichkeit in der Flasche steckt, würde ich es dir sofort glauben. Aber Fasten ist nun mal besser für mich.«
An dieser Stelle scheint der Vater die Diskussionen nicht länger ertragen zu können. Er habe noch etwas zu tun, erklärt er und verschwindet mit der Zeitung im Arbeitszimmer. Tingyi stellt die Medizinflasche unauffällig zurück in den Schrank. Die Mutter geht in die Küche, um ein paar Reiswaffeln für den Magenkranken zu suchen. »Robert hat eigentlich eine eiserne Gesundheit«, sagt Tingyi. »Ich kenne ihn jetzt schon vier Jahre, und er ist noch nie ernstlich krank gewesen. Abgesehen davon hat er ja die teure Yili-Milch in den Tee gemischt, die du ihm mitgebracht hast, da wird er schon nicht verhungern.«
Aber die Mutter hat längst einen neuen Verdacht. So blass wie Robert aussieht, hat er sich bestimmt auch eine Erkältung geholt, weil er bloß mit Shorts und T-Shirt hinausgerannt ist. Er ist ganz verschwitzt nach Hause gekommen, das hat sie an seinem Rücken gesehen. Und jetzt hat er immer noch nicht viel mehr an, während sie und ihr Mann dicke Strickjacken tragen.
»Rettichkopf soll sich was Wärmeres anziehen. Du auch. Du siehst ziemlich zerknittert aus«, sagt Li Hong zu ihrer Tochter. Dann folgt sie ihrem Mann ins Arbeitszimmer, um sich mit ihm zu beraten, was abends gekocht werden soll. Sie ist fest entschlossen, die Henne schon heute zu schlachten. Eine gute Hühnerbrühe ist das beste Mittel, um einen geschwächten Körper zu stärken. Und dass Tingyi und Robert von der Kälte und der vielen Arbeit in Deutschland geschwächt sein müssen, liegt für Li Hong auf der Hand.
»Macht euch keine Umstände wegen uns. Robert ist nicht wählerisch«, ruft Tingyi ins Arbeitszimmer. Sie ist inzwischen fertig mit dem Frühstück und beschäftigt sich mit dem Stadtplan, um das Besichtigungsprogramm für den heutigen Tag vorzubereiten. Um den Familienfrieden wiederherzustellen, folgt sie ihrer Mutter ins Arbeitszimmer und fragt ihren Vater um Rat. Das gefällt dem alten Herrn sichtlich.
»Die Residenz von Präsident Sun Yatsen«, sagt er nach einigem Nachdenken. »Da könnt ihr was lernen.« Er greift nach einem Blatt Papier und malt ihr mit einem Bleistift den Weg auf. Er fügt hier und da noch ein paar Schriftzeichen mit genaueren Erläuterungen hinzu, und als er endlich zufrieden ist, drückt er seiner Tochter das Blatt in die Hand. »Es ist gar nicht weit«, sagt er abschließend. Und obwohl sie auf dem Stadtplan längst ausgemacht hat, wo sich die ehemalige Residenz des berühmten Mannes befindet, nimmt Tingyi die Zeichnung des Vaters mit der gebührenden Ehrfurcht entgegen.
Robert bleibt nicht lange im Wohnzimmer sitzen. Er geht auf den Balkon und schaut auf die lebhafte Straßenkreuzung hinunter. Busse, Taxis, Privatautos, Radfahrer, Schubkarren und vor allem Fußgänger strömen vorbei. Nie sieht man weniger als vierzig Leute zugleich auf der Kreuzung. Sind schon ein tolles Volk, die Chinesen, denkt er vor sich hin. Man wird gar nicht müde, ihnen zuzuschauen.
»Kommt pünktlich zurück«, ruft Li Hong ihnen nach, als Tingyi und Robert eine Stunde später endlich die Wohnung verlassen. »Heute Abend kommt Tuya mit ihrer Familie. Dann gibt es was Gutes zu essen.« Tuya ist die jüngere Schwester von Tingyi. Sie wohnt drei Straßen weiter, aber tagsüber ist sie bei der Arbeit.
Kanton oder eigentlich Guangzhou, die Hauptstadt der südlichen Provinz Guangdong, ist eine Stadt mit zweitausendjähriger Tradition. Als die Europäer kamen und Handelsrechte mit China verlangten, durften sie hier mit Erlaubnis des Kaisers auf einer kleinen Insel im Perlfluss die ersten Handelsniederlassungen gründen, außerdem wurde in Kanton die Gründung der chinesischen Republik vorbereitet.
Robert hat gar nichts dagegen, erst einmal bei Tingyis Eltern zu bleiben. Das spart nicht nur Kosten, sondern gibt ihm zugleich das Gefühl, China aus erster Hand kennen zu lernen. Er freut sich schon mächtig darauf, in der Fakultät als »Chinaexperte« zu glänzen.
Die ehemalige Residenz des ersten Präsidenten der Republik China ist ein elegantes Gebäude im Kolonialstil. Ursprünglich hatte ein Zementfabrikant sie als seinen Wohnsitz erbaut, aber als Sun Yatsen für seine Militärregierung eine Residenz brauchte, schenkte ihm der Unternehmer die Villa.
Was Robert überrascht, ist die Tatsache, dass in dem Haus keineswegs nur private Räumlichkeiten zu finden sind. Gewiss, es gibt ein Schlaf- und ein Arbeitszimmer, eine Küche und ein Bad mit bescheidener Wanne. Auch die Ehefrau des Präsidenten hatte ein eigenes Zimmer. Aber gleich darunter und nebenan sind die Funkzentrale, das Innen- und das Kriegsministerium untergebracht, die auch nur je einen Raum haben. »Das ist ja ein Witz!«, sagt der Deutsche. »Da ist ja schon unser Finanzamt hundertmal größer! Von hier aus hat euer Präsident versucht, ein Millionen-Reich zu regieren?«
Tingyi tritt auf den Balkon und geht auf dem hölzernen Umgang entlang. Die Schönheit dieses Hauses hat sie immer schon fasziniert. Mit seinen drei gelb gestrichenen Stockwerken, seinen schwarzen Holzbalustraden und seinem Ziegeldach macht es tatsächlich keinen pompösen Eindruck. Aber es hat einen eigenen Reiz: In einer Umgebung von glatten Hochhausfassaden ist es ein feines Puppenhaus, das wie aus einem Traum hierhergeflogen zu sein scheint.
»Der Sperling ist zwar klein, besitzt aber alle Organe«, sagt Tingyi. »Vielleicht war Dr. Sun ja nur ein Märchenstaatspräsident, der durch einen Irrtum auf der Welt gelandet ist. Deswegen ist er wohl auch gescheitert. Aber seine Ideen leben noch heute. Und außerdem hat seine Revolution schon sieben Jahre früher stattgefunden als eure.«
Sie können ungestört reden, denn es stellt sich heraus, dass sie die einzigen Besucher in diesem Märchenhaus sind. Aber das stört sie nicht, ganz im Gegenteil. Sie schlendern von einem Zimmer ins andere. Mal treffen sie sich, mal gehen sie auseinander. Im Besprechungsraum sind Sun und sein Innenminister als täuschend echte Wachsfiguren zu sehen. Mitten im Konferenzraum der Generäle steht ein junger, strammer Offizier aus Wachs, der sich heldenhaft und bedeutungsvoll von den anderen Befehlshabern abhebt. Als Robert die englischen Erklärungen liest, ist er abermals erstaunt. »Chiang Kai-shek? Das ist doch ein übler Diktator gewesen, der Feind Nummer eins der KP, oder nicht? Hat Tausende von Kommunisten erschießen und foltern lassen. Wieso darf der hier im Glanz stehen?«
»Nun, er war Suns Gefolgsmann und Nachfolger in der Kuomintang. In den 20er-Jahren ist er hier ein und aus gegangen, da muss er natürlich auch mitgezeigt werden«, entgegnet Tingyi. »Außerdem hat er ein Leben lang von der Wiedervereinigung Chinas geträumt, und auch die kommunistische Regierung teilt dieses Ziel. Bei uns Chinesen leben Yin und Yang, das Helle und das Dunkle, stets neben- und ineinander. Der Feind gehört genauso dazu wie man selbst, nichts ist absolut gut und nichts absolut böse.«
Vielleicht sind die Chinesen toleranter, als wir uns das vorstellen können, denkt Robert.
Als sie vor dem Zimmer von Suns Frau stehen, fällt Tingyi etwas ein. »Sie war eine hübsche und reiche Frau. Aber sie verlor das Baby in ihrem Bauch, als sie vor bewaffneten Putschisten aus dem Haus flüchten mussten. Danach wurde sie nie wieder schwanger«, erzählt sie nachdenklich. »Ob man Kinder kriegt oder nicht, das bestimmt wohl der Himmel.«
»Na ja, dem Himmel kann man doch nachhelfen, oder?«, sagt Robert und grinst.
Als sie nachmittags in der Alten Stadt herumschlendern, spürt Robert Kopfschmerzen aufsteigen. Heimlich nimmt er ein Aspirin, ohne dass seine Freundin es merkt. Er weiß schon, dass sie es nicht gerne sieht, wenn er »Tabletten schluckt«, wie sie es nennt. Tingyi schießt Fotos, weil sie hofft, das eine oder andere später an Agenturen verkaufen zu können. Tingyi ist ehrgeizig.
Als sie an einem Restaurant vorbeikommen, beginnt ihr der Gaumen zu jucken. Direkt am Eingang werden in großen Türmen aus Bambusgeflecht allerlei Teigtaschen mit verschiedenen Füllungen gedämpft. Ein angenehmer Fleischduft liegt in der Luft. »Wir nehmen hier etwas zur Stärkung«, sagt sie.
»Gedämpftes ist gut für dich. Es ist leicht verdaulich.«
»Hast du schon wieder Hunger?«, fragt Robert. In Berlin isst Tingyi zum Mittag nicht viel. So wie er auch.
»Es ist vier Stunden her, dass ich gefrühstückt habe«, erwidert Tingyi und bahnt sich entschlossen den Weg ins Innere des Lokals. »Chinesen essen jeden Tag dreimal warm. Jetzt bin ich zu Hause. Dann darf ich auch mal wieder eine normale Chinesin sein, oder?«
Robert lässt den Blick durch den Raum schweifen. Alle Gäste scheinen einen guten Appetit zu haben. Kleine Chinesen, großer Hunger, denkt er. Was für ein fröhliches Essvolk. »Ich brauche nichts«, sagt er.
»Komm, Roloko. Eine Brühe kannst du schon trinken, oder?«
Als Erstes kommt grüner Tee, kostenlos, farblos und eher lauwarm. Dann zwei dicke Steingutschalen mit Suppe, die seine Freundin bestellt hat. Robert schielt zum Nebentisch. Dort sitzt ein kleines Mädchen mit seiner Oma. Die Kleine lächelt viel und ist so wohlerzogen und zierlich, dass Robert gar nicht von ihr wegschauen kann. »So eine Tochter zu haben muss nett sein«, sagt er nachdenklich.
Aber Tingyi will jetzt die Suppe genießen. »Das ist eine Lebersuppe mit einer schwarzen Erdwurzel. Sie ist gut für die Blutbildung und die Blutzirkulation. Das andere ist eine Taubenfleischsuppe mit Bittermelonen. Geeignet zum Abkühlen von überhitzten Körpern. Auch gut für dich.«
Roberts Blicke versenken sich in die Suppen, erst in die schwarze und dann in die klare. In Berlin fliegen überall Tauben herum. Sie sind so schmutzig, dass niemand sie essen würde. Und was, bitte, ist eine Bittermelone? Dieses zahnradähnliche Grünzeug? Wenn sie schon bitter heißt!
»Ich brauche nichts, Herzchen. Ich hab doch gesagt, ich hab keinen Hunger.«
Tingyi nimmt die in einer Plastikfolie eingeschweißte Speisekarte wieder in die Hand. »Soll ich dir etwas anderes bestellen?«
»Nein. Nicht nötig«, winkt Robert ab. Wer weiß, was als Nächstes auf den Tisch kommt. Vielleicht eine Rabenfleischsuppe mit Kaktus?
»Du willst eine chinesische Familie haben?«, sagt Tingyi. »Dann musst du erst einmal essen lernen.«
2. Kapitel
Der kleine Prinz
Es dämmert, als die beiden Touristen mit schweren Einkaufstüten zu Hause ankommen. Tingyis Eltern sind in der Küche beschäftigt. Ein angenehmer Duft liegt in der Luft und verspricht ein leckeres Abendessen. Robert begrüßt die Eltern mit »hallo« und verschwindet schnurstracks im Gästezimmer. Tingyi zappelt sich die Schuhe von den schmerzenden Füßen und lässt sich auf einen Stuhl im Wohnzimmer plumpsen. Eben war sie noch die resolute Reiseführerin, die ihrem Freund die große Stadt Kanton gezeigt hat, aber kaum befindet sie sich unter dem Dach ihrer Eltern, verwandelt sie sich in ein Kind, das sich Zuwendung wünscht. »Könnt ihr euch so etwas vorstellen? Robert hat sich einen Hamburger gekauft! Er kommt nach China, will aber nichts essen. Und dann kauft er sich einen Hamburger! Ist das nicht eine Schande?«, fragt sie.
Ihre Mutter sieht die Angelegenheit eher pragmatisch.
»Rettichkopf hat wieder Appetit? Das ist gut.« Sie stellt eine Tasse heißes Wasser vor die Nase der Tochter und fragt, welches Getränk sie dem Rettichkopf machen soll. Die Tochter wedelt schwach mit der Hand. »Robert braucht eher Ruhe. Er hat schon zwei Kopfschmerztabletten genommen.«
Die Mutter reagiert bestürzt. »Geht es ihm also noch schlechter als heute morgen? Dann muss er zum Arzt.«
Tingyi schüttelt die Hand etwas heftiger. »Ich glaube, die Kopfschmerzen kamen vom leeren Magen. Da hat wohl der Hunger genagt.«
Jetzt wird die Mutter energisch. Sie drückt ihrer Tochter eine Tasse mit heißem Wasser in die Hand und sagt: »Bring das ins Gästezimmer! Und frag deinen Rettichkopf, ob er was essen will.