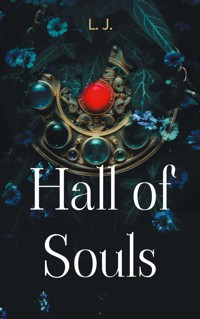Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: WunderZeilen Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Land der Dämmerung
- Sprache: Deutsch
Sie hatte keine Angst vor dem Sturm.
Sie war der Sturm.
Und die Welt beugte sich ihrem Willen.
In Daskyen, dem Land der Dämmerung, leben magiebegabte Menschen in Angst und Unterdrückung durch die Garde der Königin.
Als Tia mit ihren unkontrollierten Kräften die Aufmerksamkeit einer Gardistin auf sich zieht, ist sie gezwungen, ihr Zuhause zu verlassen, und wendet sich an die einzige Person, die ihr helfen kann: die berüchtigte Magierin Dahlya, die über eine schaurige Festung im Wald herrscht.
Sie nimmt Tia als Schülerin auf und lehrt sie, ihre Kräfte zu beherrschen – allerdings nicht aus Herzensgüte. Schon bald muss Tia sich fragen, welche Rolle sie in Dahlyas Plänen spielt, und ob sie an einem Ort voller Lügen, Wahnsinn und dunkler Magie wirklich in Sicherheit ist.
Der Auftakt einer feministischen Dark Fantasy Trilogie über Selbstfindung, innere Stärke und die Dunkelheit in uns allen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 633
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Laura May Strange
Impressum
Copyright © 2024 by
WunderZeilen Verlag GbR (Vinachia Burke & Sebastian Hauer) Kanadaweg 10 22145 Hamburghttps://[email protected]
WIE SCHATTEN IN DER DÄMMERUNGText © Laura May Strange, 2024 Story Edit: Vinachia Burke (www.vinachiaburke.com) Lektorat : Lektoratsservice: Frei & fantastisch (www.steffifrei.de) Korrektorat: Monika Schulze (www.suechtignachbuechern.de) Cover: Vinachia Burke Satz & Layout: Vinachia Burkewww.vinachiaburke.com ISBN: 978-3-98867-034-2 Alle Rechte vorbehalten.
Widmung
Für mein jüngeres Ich. Und für alle, die gegen die Dunkelheit kämpfen.
Content Notes
- Angststörung und Panikattacken - Depressionen - Suizid - Selbstverletzung - Trauma - Feuer (im Zusammenhang mit Trauma) - Tod und Trauer - körperliche und seelische Gewalt - Kindesmisshandlung - Wahnvorstellungen
ZWANZIG JAHRE ZUVOR
Die Dunkelheit begleitete sie schon ihr ganzes Leben. Sie war mit ihren Farben vertraut, kannte jede einzelne Schattierung. Doch noch nie war ihr eine derart tiefe Finsternis begegnet wie hier, im Herzen des Waldes.
Die Festung stand auf einer Lichtung zwischen Baumskeletten und verrottendem Laub. Ihre Fassade, so schwarz wie die Nacht, war von rotem Efeu umrankt, und die spitzen Türme auf dem Dach versanken halb im Nebel. Obwohl es gerade erst zu dämmern begann, schien sämtliches Licht vor dem Gebäude zurückzuweichen, so als sei es mit einem Schutzbann belegt. Oder mit einem Fluch.
Sie nahm all ihren Mut zusammen und trat auf die Steintreppe zu, die zum Eingangstor führte. Gerade als sie den Fuß auf die erste, mit Moos bewachsene Stufe setzen wollte, raschelte hinter ihr das Herbstlaub.
»Hast du dich verlaufen?«
Sie fuhr herum, konnte jedoch niemanden sehen. Nur kahle Bäume im Dämmerlicht. »Ich … suche die Magierin, die hier leben soll.«
»Du hast sie gefunden.«
Das konnte nicht sein. Dies war nicht die Stimme der Frau, die sie einst gekannt hatte. Sie hatte völlig anders geklungen; sanfter, wärmer. Diese Stimme war wie aus Schatten gewebt.
»Ich erinnere mich an dich.« Erneut raschelten die Blätter auf dem Waldboden, aber diesmal erklang die Stimme aus einer anderen Richtung. Die Magierin schien überall zu sein. »Du dienst der Frau, die meinen Tod will.«
»Nicht mehr.« Ihr gebrochenes Herz krümmte sich in ihrer Brust. »Ich habe meinen Dienst quittiert nach dem, was sie deinesgleichen angetan hat.« Vor ihrem geistigen Auge blitzten die Bilder jener Nacht auf. Erinnerungen an tödliche Flammen und eiskalten Stahl. »Ich dachte, du wärst damals auch gestorben. Wenn ich gewusst hätte, dass du überlebt hast, wäre ich früher gekommen.«
»Weshalb? Was willst du von mir?« Die körperlose Stimme klang zunehmend feindseliger. Die Schwärze, die die Festung umgab, vertiefte sich.
Sie versuchte, ihr Unbehagen zu verbergen, und sagte so gefasst wie möglich: »Ich brauche deine Hilfe.«
Die Magierin lachte – ein kaltes Lachen, grausam wie der Herbstwind. »Und warum sollte ich dir helfen?«
»Nicht mir.« Mit klammen Fingern öffnete sie die Knöpfe ihres Mantels und schob den schweren Stoff ein Stück zur Seite. Nun dürfte die Wölbung unter ihren Kleidern nicht mehr zu übersehen sein.
Ein Wispern erfüllte die Luft. Sie erschauderte, als eine unsichtbare Hand ihren Bauch streifte und das Kind in ihrem Leib sich regte.
»Oh«, sagte die Magierin, auf einmal nicht mehr so feindselig. »Wen haben wir denn da?«
Sie wich einen Schritt zurück, knöpfte den Mantel wieder zu, und verschränkte die Arme vor ihrem Körper. »Es heißt, du nimmst Kinder bei dir auf.«
»Das tue ich.«
»Dann nimm auch meines. Ich bin nicht in der Lage, für es zu sorgen. Du bist die Einzige, die ihm helfen kann. Die Einzige, die es beschützen kann.«
Ein paar Sekunden lang herrschte Schweigen. Die Blätter raschelten nicht länger, selbst der Wind schien den Atem anzuhalten.
Dann sagte die Magierin: »Wie könnte ich ein Kind der Dämmerung im Stich lassen?« Sie klang jetzt beinahe freundlich, obwohl ihrer Stimme noch immer diese Grabeskälte innewohnte.
Wie durch Geisterhand öffnete sich das Eingangstor der Festung. Im Torbogen zeichnete sich die Silhouette einer Frau in einem kurzen, bauschigen Kleid ab. Ihr Gesicht war in den Schatten verborgen, umso auffälliger war dafür das leuchtende Amulett um ihren Hals. Der Anhänger hatte die Farbe von frisch vergossenem Blut.
»Nur zu, meine Liebe. Komm herein.«
Zweifel flüsterten in ihrem Kopf, aber sie weigerte sich, zuzuhören. Mit einer Hand auf ihrem Bauch stieg sie die Treppenstufen hinauf, bis sie unmittelbar vor der Magierin stand. Dann betrat sie mit ihr gemeinsam die Festung, und die Dunkelheit hieß sie wie eine alte Freundin willkommen.
Erster Teil
Kapitel 1
Wann immer ich an meine Mutter dachte, stellte ich mir einen Herbsttag vor. Nicht golden oder mit leuchtenden Farben, sondern voller Kälte, Nebel und blassem Grau. Wie der Tag, an dem ich sie sterben sah.
Ich war zu jung gewesen, um zu begreifen, warum sie plötzlich auf diesem Hocker stand und sich die Schlinge eines Seils um den Hals legte. Warum ihr Tränen über die Wangen liefen, als sie auf mich herabschaute und mit kraftloser Stimme sagte: »Ich will nur leben.«
Das waren ihre letzten Worte.
In den zehn Jahren, die seither vergangen waren, hatte ich kein einziges Mal ihr Grab besucht. Bis heute. Ein kühler Windhauch streifte mein Gesicht, als ich den Blick über den Friedhof schweifen ließ. Die Äste der Bäume schwankten sanft, und der Boden war mit gelben, orangen und rotbraunen Blättern bedeckt, die unter meinen Stiefeln knisterten. Als Kind hatte ich den Herbst mehr als jede andere Jahreszeit geliebt. Dann lernte ich, was es heißt, wenn Liebe sich in Furcht verwandelt.
Die meisten Gräber lagen kahl und schmucklos da, einige längst zugewachsen, weil nie jemand kam, um sie zu pflegen. In der Luft hing ein Geruch nach Moder und feuchtem Laub, und ich ertappte mich dabei, wie ich mir eine Haarsträhne vor die Nase hielt. Der Jasmin-Duft meiner Lieblingsseife beruhigte mich.
»Wir hätten nicht herkommen sollen«, sagte ich. »Das war eine schreckliche Idee.«
»Schreckliche Ideen sind oft die besten.« Bess zupfte ein paar Weißdornbeeren von den Sträuchern an der Friedhofsmauer. In der anderen Hand hielt sie die Weinflasche, die sie aus dem Rathaus hatte mitgehen lassen.
Ich bemühte mich, mit ihr Schritt zu halten, aber alles in mir sträubte sich dagegen, weiterzugehen. Mein Magen war verkrampft, meine Hände kalt und feucht. Ich verbarg sie in den Taschen meines Mantels. »Im Ernst, wir sollten zurückgehen. Dermot fragt sich bestimmt schon, wo ich bin, und dein Bruder –«
»Mein Bruder findet diese Dorfversammlungen genauso öde wie ich. Er hat sich früher selbst immer rausgeschlichen.« Bess drehte sich zu mir um. Als sie bemerkte, dass ich stehen geblieben war, hielt sie inne und kam zu mir zurück. »Komm schon, Tia. Es gibt nichts, wovor du Angst haben musst. Sie kann dir nichts mehr tun.«
»Ich habe keine Angst.« Das Zittern in meiner Stimme strafte mich Lügen. Mit jedem Blinzeln sah ich meine Mutter vor mir. Wie sie im einen Moment über meine Haare strich und im nächsten meinen Kopf auf die Tischplatte drückte. Wie sie meinen Namen rief, damit ich zu ihr kam, nur um mich gleich darauf grob von sich zu stoßen und zu zischen: »Bleib weg von mir, du kleines Monster!«
Bess stellte die Weinflasche auf den Boden und legte mir beide Hände auf die Schultern. Ihr schwarzer Lippenstift war ein wenig verschmiert, ihre Wangen von der Kälte gerötet. Unter ihrer Filzmütze schauten nicht mehr als ein paar kurze, dunkle Haarsträhnen hervor. »Natürlich hast du Angst. Aber du kannst sie besiegen, das weiß ich. Danach wirst du dich besser fühlen. Und ich bin die ganze Zeit bei dir. In Ordnung?«
Ich zwang mich, tief durchzuatmen. »In Ordnung.«
Sie nahm meinen Arm und hakte sich bei mir unter. »Na los, bringen wir es hinter uns. Das Grab ist dort drüben bei den Kastanienbäumen.«
Insgeheim fand ich es gruselig, dass Bess so genau wusste, wo meine Mutter begraben lag. Allerdings verbrachte sie eine Menge Zeit hier, seit sie im Frühjahr ihre Arbeit als Totengräberin begonnen hatte. Ich ließ mich von ihr über den Friedhof ziehen und erhaschte dabei den ein oder anderen Blick auf verwelkte Blumen und Spielzeug, das Angehörige vor die Grabsteine gelegt hatten. Menschen begegneten wir zum Glück kaum, weil nahezu alle an der Dorfversammlung im Rathaus teilnahmen. Lediglich eine ältere Frau zündete Kerzen auf einem Familiengrab an.
Bess grüßte sie im Vorbeigehen, erhielt jedoch keine Antwort. Sobald wir außer Hörweite waren, flüsterte sie mir zu: »Die Gute kommt fast jeden Tag hierher. Besucht immer ein anderes Grab. Ich habe keine Ahnung, wer sie ist. Im Dorf habe ich sie noch nie gesehen. Irgendwie unheimlich, wenn du mich fragst.«
Die Frau stand mit dem Rücken zu uns. Ich sah lediglich, dass sie graue Haare hatte und einen langen, weißen Mantel trug. »Vielleicht ist sie ein Geist«, sagte ich, nur halb im Scherz.
»Unsinn. Geister spuken nicht auf dem Friedhof herum, sondern suchen Leute heim, mit denen sie noch eine Rechnung offen haben. So würde ich es zumindest machen.«
Ein unbehagliches Gefühl kroch in mir hoch. Manchmal kam es mir vor, als würde meine Mutter mich heimsuchen – ganz besonders im Herbst. Obwohl sie bereits so lange fort war, spürte ich sie bis heute in jedem Säuseln des Windes, in jedem fallenden Blatt. Es schien, als wollte sie mich wissen lassen, dass sie noch immer hier war.
Ich will nur leben.
»He, du da, verschwinde!«
Der Schreck fuhr mir in die Glieder, als Bess sich ruckartig von mir löste. Sie rannte auf einen Fuchs zu, der zwischen zwei Gräbern in der Erde buddelte. Erst als sie drohend die Weinflasche in die Höhe reckte, ergriff er die Flucht.
»Nicht zu fassen! Das ist jetzt schon das dritte Mal diese Woche, dass ich eines dieser Viecher hier am helllichten Tag erwische. Ich dachte, die wären scheu.«
Wie gebannt starrte ich auf die Stelle, an der der Fuchs gegraben hatte. Gegen meinen Willen blitzten Bilder in meinem Kopf auf: der Garten meiner Mutter; Vögel mit blutverklebten Federn; ein Fuchs mit goldenen Augen.
»Tut mir leid«, sagte Bess und riss mich aus der Erinnerung. »Ich hasse es, wenn sie die Gräber verwüsten. Aber ist jetzt egal, ich kümmere mich später darum. Das da ist das Grab deiner Mutter.«
Mein ganzer Körper versteifte sich. Bess deutete auf einen schlichten, schwarzen Grabstein. Die eingravierten Buchstaben verschwammen vor meinen Augen, dennoch wusste ich, dass dort ihr Name stand: Shaye Faerwyng.
Um das Grab herum lagen Kastanien, die mich an unsere Spaziergänge von früher erinnerten. Ich stopfte mir stets die Taschen damit voll, bevor wir nach Hause zurückkehrten, um uns vor dem Kamin mit einer Tasse Tee aufzuwärmen.
Im Herbst hatten wir das nahezu jeden Tag gemacht – zumindest an Shayes guten Tagen. An den schlechten hatte sie es kaum aus dem Bett geschafft.
Beim Anblick der Kastanien dachte ich unweigerlich an die Dunkelheit, die immerzu in ihrem Schlafzimmer gelauert hatte. An die Knoten in ihren Haaren und die Narben auf ihren Armen und den Strick um ihren Hals.
»I-ich weiß nicht, ob ich das kann, Bess.«
Sie legte mir eine Hand auf den Rücken. »Wir machen es zusammen. Hast du die Streichhölzer?«
Mit klammen Fingern holte ich die Schachtel aus meiner Manteltasche.
»Sehr gut. Und ich habe den Rest.« Bess stellte ihren Lederrucksack auf den Boden und zog daraus eine Urne sowie den Brief hervor, den wir gemeinsam geschrieben hatten. Na ja, sie hatte geschrieben, ich diktiert.
Bess war die Einzige, vor der ich mich nicht für meine Schreib- und Leseschwierigkeiten schämte. Und die Einzige, mit der ich offen über Shaye sprach. Abgesehen von Doktor Lenoir, dem Seelenheiler, zu dem Dermot mich damals nach ihrem Tod geschickt hatte, als meine Angstzustände und Panikattacken immer schlimmer geworden waren. Die regelmäßigen Gespräche mit ihm hatten mir über die Jahre sehr geholfen, doch bis heute fiel es mir schwer, mich zu öffnen, wenn es um meine Kindheitserinnerungen ging. Vor einer Weile hatte er mir deshalb geraten, meinen Gefühlen schriftlich Ausdruck zu verleihen.
Bess war begeistert gewesen, als ich ihr davon erzählt hatte. Gemeinsam bannten wir alles auf Papier, was mir seit zehn Jahren durch den Kopf spukte. Fragen, die ich meiner Mutter nie hatte stellen können.
Warum hast du mir so oft wehgetan? Warum hast du dir keine Hilfe gesucht? Warum musste ich dir beim Sterben zusehen?
Den Brief an Shayes Todestag zu verbrennen, war Bess’ Idee gewesen. Sie glaubte, ein solches Ritual könnte mir dabei helfen, die Vergangenheit loszulassen. Denn das wünschte ich mir mehr als alles andere.
Als Kind hatte ich mir nur gewünscht, meine Mutter würde gesund werden, damit sie mich lieben könnte, wie andere Mütter ihre Kinder liebten. Aber sie hatte nicht gesund werden wollen. Sie hatte sich für den Tod entschieden. Und alles, was sie mir hinterlassen hatte, war Angst. Lähmende, eiskalte Angst.
Wenn ich diese Angst in Brand setzte, würde Shaye dann aufhören, mich heimzusuchen?
Bess half mir dabei, den Brief zu zerreißen und die Papierfetzen in der Urne zu verteilen. »Wann immer du bereit bist«, sagte sie.
Weil meine Hand so stark zitterte, brauchte ich mehrere Anläufe, um ein Streichholz zu entzünden. Als es mir endlich gelungen war, hielt ich einen der Papierfetzen in die Flamme und warf ihn zu den restlichen in die Urne. Dann sah ich mit Bess an meiner Seite dabei zu, wie der Rauch in den wolkenverhangenen Himmel aufstieg.
Ich ließ meine verkrampften Schultern sinken, konzentrierte mich auf meine Atmung. Ein Blick über die Schulter verriet mir, dass die Frau im weißen Mantel mittlerweile den Friedhof verlassen hatte. Jetzt blieben nur noch Bess, ich und die Toten. Und der Herbst, der mir ins Ohr flüsterte: Ich will nur leben.
Nachdem wir die Asche über Shayes Grab verstreut hatten, öffnete Bess den Wein, und wir tranken beide einen großen Schluck aus der Flasche. Ich war dankbar, dass sie nicht fragte, wie ich mich fühlte, denn ich hätte ihr keine Antwort geben können. War es befreiend gewesen, den Brief zu verbrennen? Ein bisschen. Trotzdem würde ich erst wieder richtig atmen können, sobald wir den Friedhof hinter uns gelassen hatten.
In einvernehmlichem Schweigen liefen wir zurück zum Rathaus, das sich direkt am Marktplatz befand, im Herzen von Sylverne. Das Gebäude war alt, mit einem Turm aus rotem Sandstein und einem Brunnen auf dem Vorplatz, in dem im Sommer oft Kinder plantschten.
Die Versammlung schien gerade vorüber zu sein, denn auf den Treppen zum Eingang kamen uns einige Bewohnerinnen und Bewohner des Dorfes entgegen. Unter anderem trafen wir dort auf Bess’ Bruder Saniel und dessen Ehemann Kylian.
»O nein, sag bloß, wir haben es verpasst? Wie schade!« Bess’ Stimme triefte vor Sarkasmus.
»Mach dir nichts draus. An der Versammlung im Winter darfst du dann teilnehmen und ich bleibe zu Hause.« Saniel zog ihr die Mütze vom Kopf und wuschelte durch ihre Haare. Zur Antwort boxte Bess ihm gegen die Schulter. »Wir wollen gleich noch in die Brücke weiterziehen. Kommt ihr mit?«
Bess setzte ihre Mütze wieder auf und wandte sich mir zu. »Hast du Lust? Getränke gehen auf mich.«
Die Ablenkung würde mir sicher guttun. Ich wollte gerade zusagen, als ich Dermot entdeckte, der von der Eingangshalle des Rathauses aus auf uns zukam. »Geht schon mal vor. Ich komme gleich nach.«
»Wie du meinst.«
Wir verabschiedeten uns, und die drei machten sich ohne mich auf den Weg zur Schenke. Nach etwa zehn Schritten drehte Bess sich noch einmal um und winkte mit der halbleeren Weinflasche in ihrer Hand.
»Sag mir bitte, dass sie nicht den Wein der Bürgermeisterin gestohlen hat.« Dermot band sich gerade den Schal um und knöpfte seinen grauen Mantel zu, während er die Treppenstufen zu mir herunterstieg.
»Du hast mir beigebracht, dass ich nicht lügen soll, also ziehe ich es vor, zu schweigen.«
Er schüttelte den Kopf, konnte ein Schmunzeln aber nicht verbergen. Die Lachfältchen um seine Augen vertieften sich. »Wo wart ihr beide denn? Ihr seid mitten in der Versammlung verschwunden.«
»Ja, ich … brauchte mal frische Luft.« Mehr musste ich nicht sagen, um einen verständnisvollen Blick zu ernten. Dermot wusste, wie schwer dieser Tag für mich war. Und ich wusste, es ging ihm ähnlich. Er hatte Shaye damals auch verloren.
»Tiana! Dich habe ich ja ewig nicht mehr gesehen.« Eine Frau trat an uns heran. Elise Lavalle, die Bürgermeisterin. Sie war in Dermots Alter, hatte im Gegensatz zu ihm jedoch noch keine grauen Haare. Ihre waren dunkelbraun und glänzend, akkurat auf Kinnlänge geschnitten.
Ich rang mich zu einer höflichen Begrüßung durch, obwohl ich Lavalle nicht ausstehen konnte. Genauso wenig wie sie mich.
»Du bist ja eine richtig hübsche junge Frau geworden. Zum Glück kommst du nicht nach deiner Mutter. Wollen wir hoffen, dass es so bleibt.« Mir war klar, dass ihre Worte darauf abzielten, mich einzuschüchtern, doch die Genugtuung wollte ich ihr nicht geben. »Ein bisschen Farbe würde dir allerdings guttun. Es ist unschwer zu erkennen, dass du zu viel Zeit mit der Totengräberin, dieser Berenisse, verbringst. Sie trägt auch immer nur Schwarz.«
»Ich mag Schwarz. Und ich kann selbst entscheiden, wie ich mich kleide. Oder mit wem ich Zeit verbringe.«
Lavalle kräuselte die Lippen. »Ganz schön schnippisch. Lässt du sie so auch mit dir reden, Dermot? Ich weiß, sie hatte eine schwere Kindheit, aber ein paar Grenzen solltest du ihr schon aufzeigen.«
Ich ballte in meinen Manteltaschen die Fäuste. Was bildete diese Frau sich ein? Ich erinnerte mich nur zu gut daran, dass sie damals diejenige gewesen war, die Dermot nicht hatte erlauben wollen, die Vormundschaft für mich zu übernehmen. Stattdessen hätte sie mich nach Shayes Tod in ein Heim gesteckt – oder am besten dorthin zurückgeschickt, wo ich herkam.
Dermot schien meine Aufgebrachtheit zu spüren und legte mir zur Beruhigung eine Hand auf den Rücken. »Ich würde es begrüßen, wenn du dich nicht in meine Erziehung einmischst, Elise. Abgesehen davon ist Tia erwachsen.«
Die Bürgermeisterin blickte an mir herab, ihre dunklen Augenbrauen gehoben. »Na, wenn du meinst. Hast du ihr eigentlich schon die Neuigkeiten verraten?«
»Welche Neuigkeiten?«, fragte ich.
»Wenn du an der Versammlung teilgenommen hättest, wüsstest du das. Der Förster hat uns berichtet, dass einige Bäume und Sträucher im Wald von einer Krankheit befallen sind. Womöglich wegen dieser vermaledeiten Brücke. Einige Tiere treiben sich nun auf der Suche nach Nahrung im Dorf herum. Wir haben beschlossen, einen Teil des Waldes zu roden, um die Ausbreitung einzudämmen. Davon ist auch das Gebiet betroffen, in dem sich das Haus deiner Mutter befindet.«
Meine Gesichtszüge entgleisten.
Lavalles Lippen verzogen sich zu einem Lächeln. »Das macht dir sicher nichts aus, schließlich ist dieser Ort für dich mit dunklen Erinnerungen behaftet. Und nicht nur für dich. Wir alle haben damals unter ihrem Wahnsinn gelitten. Ihr Haus abzureißen, ist kaum ein Verlust. Ebenso wenig wie ihr Tod einer war.«
»Das reicht jetzt«, sagte Dermot. Ich hatte ihn in meinem ganzen Leben bislang erst ein- oder zweimal wütend erlebt, doch kaum, dass jemand ein böses Wort über Shaye verlor, erhob er die Stimme. »Tia, warum gehst du nicht schon mal nach Hause? Wir können später zusammen zu Abend essen.«
»Ich habe Bess gesagt, dass ich sie in der Brücke treffe.«
»In Ordnung. Aber bleib nicht zu lange. Du musst morgen früh raus.« Während er sprach, sah er Lavalle an, die noch immer ihr überhebliches Lächeln trug.
Obwohl ich es ihr gern aus dem Gesicht gewischt hätte, ermahnte ich mich selbst zur Ruhe, verabschiedete mich von Dermot und kehrte dem Rathaus den Rücken zu, ohne die Bürgermeisterin noch eines Blickes zu würdigen.
Ich hatte vorgehabt, direkt zur Schenke zu gehen, aber nach dem, was ich soeben erfahren hatte, konnte ich das nicht.
Sie wollten das Haus abreißen, in dem ich aufgewachsen war. Das Haus, in dem meine Mutter sich das Leben genommen hatte. Seit zehn Jahren hatte ich keinen Fuß mehr in die Nähe dieses Ortes gesetzt und auch nicht das Bedürfnis danach verspürt. Doch jetzt, nach unserem Besuch auf dem Friedhof, kamen mir zum ersten Mal Zweifel. Was, wenn ich dorthin zurückkehren musste, um mit der Vergangenheit abzuschließen? Wenn das meine einzige Chance war, den Geist meiner Mutter zu begraben?
Nur zu gern hätte ich Bess gebeten, mich zu begleiten, aber eine innere Stimme sagte mir, dass ich mich meinen Ängsten diesmal allein stellen musste. Also nahm ich meinen Mut zusammen und machte mich auf den Weg in den Wald.
Er lag am östlichen Rand des Dorfes und grenzte somit direkt an die Brücke – das Ungetüm aus schwarzem Stein, das am Horizont scheinbar im Nichts versank, umgeben von einem Meer aus Nebel. Wie alle, die in Sylverne lebten, war ich an den Anblick gewöhnt, dennoch bescherte er mir jedes Mal aufs Neue eine Gänsehaut.
Die Brücke war das letzte Relikt der Magie; das Einzige, was noch an ihre Existenz erinnerte. Einst soll ganz Velarien erfüllt davon gewesen sein, so wie die Länder auf der anderen Seite des Abgrunds, mit denen wir seit Jahrhunderten nichts mehr zu tun hatten. Lediglich einmal im Monat reisten Abgesandte im Auftrag der Regierung über die Brücke, doch was auf der anderen Seite geschah, galt als Staatsgeheimnis. Nicht einmal Lavalle wurde eingeweiht. Was vermutlich einer der Gründe war, warum sie allem, was mit den magischen Völkern zusammenhing, mit Misstrauen begegnete. Zum Beispiel meiner Mutter.
Shaye hatte vor zwanzig Jahren die Brücke überquert – zusammen mit mir. Wir stammten aus Daskyen, dem sogenannten Land der Dämmerung. Ich selbst besaß keine Erinnerung an meine Heimat, und meine Mutter hatte nie darüber gesprochen. Wann immer wir auf unseren Spaziergängen an der Brücke vorbeigekommen waren, hatte sie nur einen verängstigten Blick darauf geworfen und mich dann so schnell wie möglich weitergezerrt.
Ich hatte Dermot oft gefragt, was – oder wer – sie aus Daskyen vertrieben hatte, aber er behauptete bis heute, es nicht zu wissen. Er vermutete jedoch, dass Shayes Krankheit durch Magie hervorgerufen worden war.
Magie. Ob sie auch die Krankheit im Wald zu verschulden hatte? Lavalle hatte so etwas angedeutet, und tatsächlich begegnete ich unweit der Brücke den ersten sterbenden Bäumen. Ihre Stämme wiesen verfaulte Stellen auf, und der Geruch von Verwesung lag in der Luft. Ich bereute, keinen Schal zu tragen, hinter dem ich mich verstecken konnte. Stattdessen verbarg ich die Nase in meinen Haaren.
Je näher ich meinem alten Zuhause kam, desto schlimmer wurde der Gestank. Ich glaubte zuerst, es mir einzubilden, doch als das verwahrloste Gebäude schließlich zwischen den Bäumen aufragte, musste ich einen Würgereiz unterdrücken. Ein Kreis aus Dunkelheit umgab das Haus, der Waldboden war schwarz verfärbt. Erst auf den zweiten Blick erkannte ich, dass es sich um Blätter handelte, die von den Bäumen gefallen waren, allesamt verwelkt.
Am liebsten hätte ich sofort die Flucht ergriffen, aber ich zwang mich, noch ein Stück näher an das Haus heranzugehen. Ihm war anzusehen, dass es seit zehn Jahren leer stand. Unkraut überwucherte die Steinfassade, sodass ich Fenster und Eingangstür kaum erkannte. An die Stirnseite grenzte ein kleiner Garten, in dem Shaye einst Stunde um Stunde verbracht hatte, um ihre geliebten Pflanzen am Leben zu erhalten. Doch egal, wie sehr sie diese auch gepflegt hatte, sie waren ihr immer wieder eingegangen. Alles, was sie berührt hatte, war dem Tode geweiht gewesen.
Beim Nähertreten bemerkte ich, dass sich im Garten etwas regte. Zwischen dem verwilderten Gestrüpp buddelte ein Fuchs, genau wie vorhin auf dem Friedhof. Ich stapfte auf ihn zu, um ihn zu verscheuchen, aber er hob lediglich den Kopf und sah mich aus goldenen Augen an.
Abermals wurde ich von Erinnerungen überwältigt: Meine Mutter am Strick; ich selbst als kleines Mädchen, wie ich keuchend auf dem Waldboden lag; der goldäugige Fuchs, der sich neben mich legte, bis ich wieder Luft bekam.
Es konnte unmöglich dasselbe Tier sein, dennoch kam es mir für einen Moment so vor, als würde der Fuchs mich ebenfalls erkennen. Dann ergriff er allerdings doch die Flucht, rannte in den Wald und verschwand aus meinem Sichtfeld.
Als ich mich wieder der Stelle zuwandte, an der er gebuddelt hatte, entdeckte ich, dass dort etwas zum Vorschein gekommen war. Ich ging in die Hocke und griff nach einem kleinen Holzkästchen, das jemand hier vergraben haben musste. Sobald ich es berührte, fuhr ein Ruck durch meinen Körper. Zeitgleich drang eine Flüsterstimme an mein Ohr:
»Shaye?«
Vor Schreck ließ ich das Kästchen fallen, und es öffnete sich wie durch Geisterhand. Darin lag ein schwarzes Samthalsband mit einem dunkelroten Edelstein als Anhänger. Shayes Amulett. Das Schmuckstück, das sie stets getragen hatte. Ich konnte mich nicht erinnern, sie jemals ohne es gesehen zu haben. Selbst in ihren letzten Momenten hatte es sich um ihren Hals geschmiegt, zusammen mit dem Strick.
Die Härchen in meinem Nacken stellten sich auf. Ich griff nach dem Amulett, überrascht, wie warm der rote Stein sich anfühlte. Meine Hand begann zu kribbeln, und erneut erklang das geisterhafte Flüstern.
»Shaye?«
In dem Moment flog ein Vogel über meinen Kopf hinweg und knallte mit voller Wucht gegen die Hausfassade. Sein kleiner Körper fiel leblos ins Gras.
Ich sprang auf die Beine und stieß einen erstickten Schrei aus. Das Herz schlug mir bis zum Hals, als ich entdeckte, dass an derselben Stelle weitere Vögel lagen. Dutzende, alle mit blutverklebten Federn. So wie früher.
Galle brannte in meinem Rachen. Am ganzen Leib zitternd taumelte ich zurück, meine Hand noch immer um das Amulett geschlossen. Kurz erwog ich, es einfach fallen zu lassen, aber irgendetwas hielt mich davon ab. Der rote Stein – er pochte sanft in meiner Hand, so als wollte er mich beruhigen.
»Hab keine Angst«, sagte die Flüsterstimme.
Einem Instinkt folgend, steckte ich das Amulett in meine Manteltasche, ehe ich losrannte und diesem unheimlichen Ort den Rücken kehrte – diesmal, so schwor ich mir, für immer.
Kapitel 2
Wie eine Flamme erhellte der goldene Mond den Nachthimmel. Er wachte über Daskyen, beschützte das Volk vor der Dunkelheit und sagte allem, was in den Schatten lauerte, den Kampf an. Genau wie die Garde.
Kary strich über die halbmondförmigen Abzeichen an ihrer Uniform, während ihre rechte Hand am Schwertgriff ruhte. Sie genoss noch einen Moment die friedvolle Stille, die sie draußen in der Kälte umgab. Dann folgte sie ihren Kameradinnen und Kameraden in die Taverne.
Sie prallte gegen eine Wand aus Hitze. Gelächter und Stimmengewirr füllten den Schankraum, und der Duft von Speisen und Getränken umgarnte Karys Sinne. Ihr Magen knurrte, während sie sehnsüchtig auf die Schale voll gerösteter Nüsse spähte, die ein Schankjunge an ihr vorbeitrug.
Die Gardistinnen und Gardisten aus ihrer Einheit hatten sich bereits zerstreut. Manche wärmten sich vor dem Holzofen auf, andere hatten irgendwo noch einen Tisch ergattert. Kary schritt zum Tresen, wo sie einen Teil der für die Nachtwache zuständigen Einheit fand.
»Behütete Nacht«, sagte sie.
Die Frauen und Männer erwiderten den Gruß. Alle bis auf Warryn, der zuerst seelenruhig sein Getränk leerte, bevor er sich Kary zuwandte.
»Deine Wache kann unmöglich schon um sein.« Er wischte sich den Schaum vom Bart und strich sein kinnlanges schwarzes Haar zurück. »Obwohl, wenn ich dich so ansehe mit deinen roten Wangen … Das liegt bestimmt nicht daran, dass meine Gegenwart dich nervös macht. Oder etwa doch?« Er zwinkerte ihr zu.
Ein paar der anderen lachten, verstummten jedoch sofort, als Kary ihnen einen scharfen Blick zuwarf.
»Die Wache verlief ruhig«, informierte sie Warryn, ohne eine Miene zu verziehen. »Ein paar Vandalen in der Nähe des Tempels. Ein versuchter Diebstahl. Keine besonderen Vorkommnisse.«
Warryn schaute sich in der Taverne um. Er wirkte gelangweilt und schien ihr nicht zuzuhören.
Kary hob die Stimme. »Du solltest vor allem im Verbrannten Viertel wachsam sein. Letzte Nacht hatten wir dort Probleme mit –«
»Ich habe alles im Griff, Schätzchen. Du musst mir nicht sagen, wie ich meine Arbeit zu erledigen habe. Zumal du das gar nicht mehr darfst. Wir sind gleichrangig, schon vergessen?« Er deutete auf die vier Abzeichen über seiner Brust, die ihm den Rang des Kommandanten zuschrieben.
Genau wie Kary befehligte er seit Kurzem seine eigene Einheit und musste sich nur noch vor der Führungsriege der Garde verantworten: vor den Schwertmeisterinnen und Schwertmeistern. Und natürlich vor der Ersten Gardistin.
»Ich tue nur meine Pflicht. Das Protokoll sieht vor –«
»Schon klar. Du tust selten etwas anderes als deine Pflicht. Wie wäre es, wenn du zur Abwechslung mal Spaß hast?« Warryn winkte einem Schankmädchen zu und hielt sein leeres Glas in die Höhe. »Noch eins.«
Die Frau brachte ihm ein frisches Glas, gefüllt mit einer verdächtig schäumenden, grünen Flüssigkeit: Lesh Bek. Ein magischer Trank aus dem benachbarten Reich Thygonien, der seit einigen Wochen immer mehr an Beliebtheit in den Tavernen der daskyschen Hauptstadt gewann.
»Wie viel hast du davon heute Abend schon getrunken?«, fragte Kary.
»Bei Naava, nicht schon wieder.« Warryn entriss dem Schankmädchen das Glas mit einem Eifer, der Kary beinahe ängstigte. Ein Teil des Getränks schwappte über, und seinem Blick nach zu urteilen, hätte Warryn die verschüttete Flüssigkeit am liebsten vom Tresen geleckt. »Du solltest es auch mal ausprobieren. Vielleicht würde dich das endlich ein wenig auflockern.« Er trank einen Schluck, bevor er ihr das Glas unter die Nase hielt, sodass sie den Alkohol roch. »Na komm schon, Rotbäckchen, das wärmt dich auf.«
»Nein, danke. Da verbringe ich lieber noch ein paar Stunden in der Kälte.« Kary drehte sich weg und marschierte davon.
Warryn rief ihr etwas hinterher, aber der Spott prallte an ihr ab. Nach über sieben Jahren in der Garde hatte sie sich daran gewöhnt. Sollten sie sie ruhig alle für verklemmt halten. Am Ende des Tages war Spaß nicht von Belang. Was zählte, war, dass sie ihre Pflicht erfüllte. Und dass die Erste Gardistin mit ihr zufrieden war.
Kary suchte die Taverne nach einem vertrauten Gesicht ab. Rundum herrschte lautstarke Geschäftigkeit, und die Gäste drängten sich eng aneinander. Sie schunkelten vergnügt oder zogen sich in eine Ecke zurück, um ungestört übereinander herfallen zu können. Eindeutig zu viel Körperkontakt für Karys Geschmack. Glücklicherweise machten die Menschen ihr Platz, während sie mit einer Hand am Schwertgriff den Schankraum durchquerte.
Sie hielt auf einen Tisch in der hintersten Ecke zu, wo ein Dutzend Gardemitglieder in heiterer Runde beisammensaß, unverkennbar an den schwarzroten Uniformen. Kary ließ sich auf den einzigen freien Stuhl sinken.
»Kary? Du hier?« Nayomi drehte den Kopf, sodass die Tätowierung neben ihrem linken Auge zu sehen war: verschlungene Ranken, die sich in dem geflochtenen blonden Haar fortzusetzen schienen. »Was verschafft uns diese Ehre?«
»Sie ist nur hier, weil sie Hunger hat«, sagte Therys, die auf Nayomis Schoß saß und die Arme um deren Nacken geschlungen hatte. »Das hat sie während der Wache ungefähr alle fünf Minuten erwähnt.«
»Keine Ahnung, wovon du sprichst.« Kary deutete auf eine Platte mit Fleischspießen, die vor ihr auf dem Tisch stand. »Gehören die dir?«
»Nein, da sitzt Gawen«, sagte Nayomi. »Er ist kurz rausgegangen, um frische Luft zu schnappen.«
»Fataler Fehler.« Kary begann ohne Umschweife damit, die Fleischstückchen vom ersten Spieß abzunagen. Ein würzig-herber Geschmack füllte ihren Mund, und sie konnte nur mit Mühe ein Stöhnen unterdrücken.
»Armer Gawen.«
»Er würde Ja sagen, wenn ich frage.«
»Du fragst nie.« Therys löste den Haarknoten auf ihrem Kopf und schüttelte ihre schwarzen Locken. »Was bin ich froh, dass unsere Einheit für heute durch ist. Tut mir leid, dass du deine Wache noch vor dir hast.« Sie streichelte Nayomis Wange und hauchte ihr einen Kuss auf die Lippen.
»Ich werde es überleben. Wenn wir nur endlich mal aufbrechen würden. Hat Warryn was zu dir gesagt?«
»Nein«, antwortete Kary mit vollem Mund. »Er war zu sehr damit beschäftigt, mir das grüne Gift schmackhaft zu machen.«
»Das grüne Gift«, wiederholte Therys in einem dramatischen Tonfall, der Nayomi zum Kichern brachte.
»Ich begreife nicht, warum ihr alle dieses Getränk verharmlost. Bin ich die Einzige, die es bedenklich findet, dass –«
»Bitte sehr.« Ein Schankjunge trat an den Tisch und stellte in der Mitte ein Tablett ab. Die Gläser waren bis zum Rand mit Lesh Bek gefüllt. Die versammelten Gardemitglieder brachen in Jubel aus, Therys und Nayomi eingeschlossen.
»Halt!«, sagte Kary, als sie schon die Hände nach den Gläsern ausgestreckt hatten. »Das kann doch nicht euer Ernst sein. Einige von euch haben heute noch Wachdienst.« Sie blickte finster in die Runde, bevor sie sich an den Schankjungen wandte. »Nimm das wieder mit.«
Protestlaute von allen Seiten.
Kary ließ sich davon nicht beirren. »Schaff das Zeug weg, und zwar sofort!«
Der Junge neigte den Kopf. »Wie Ihr wünscht, Gardistin.«
Als er das Tablett wieder mitnahm, ging ein kollektives Stöhnen durch die Gruppe.
»Wir hatten das schon bezahlt!«
»Das heißt, die Garde hat es bezahlt«, sagte Kary. »Indem wir dieses Zeug kaufen, unterstützen wir Magie. Dabei ist es unsere Aufgabe, die Menschen vor ihr zu schützen. Wir wissen nicht einmal, wie Lesh Bek hergestellt wird. Es könnte gefährlich sein.« Sie wollte noch mehr sagen, aber Therys schnitt ihr das Wort ab.
»Alle mal herhören. Wer ist dafür, dass Kary von unserem Tisch verbannt wird?«
Ausnahmslos alle hoben die Hand.
»Tut mir leid. Kommandantinnen dürfen hier nicht sitzen.«
Kary rollte mit den Augen. »Ich wollte sowieso gerade gehen.« Sie schnappte sich den letzten Spieß, strich ihre Uniform glatt und marschierte erhobenen Hauptes Richtung Ausgang, während ein paar ihrer Kameradinnen und Kameraden sie auspfiffen.
An der Tür traf sie auf Gawen, der gerade von draußen kam. Sein Gesicht war von der Kälte gerötet, und der Wind hatte seine braunen Locken zerzaust. Ein Lächeln legte sich auf seine Lippen, als er Kary sah.
»Was machst du denn hier? Du hasst Tavernen.«
»Aber ich liebe gutes Essen.«
Sein Blick fiel auf den Fleischspieß, von dem sie soeben die letzten zwei Stückchen abnagte. Erkenntnis blitzte in seinen Augen auf.
»Ich wäre ja noch länger geblieben, allerdings wurde einstimmig beschlossen, dass ich von eurem Tisch verbannt werden soll.«
»Verbannt?« Gawens Mundwinkel zuckten. »Lass mich raten: Du hast dich wieder mal mit deiner Abneigung gegen Lesh Bek unbeliebt gemacht?«
Kary schnaubte. »Die Erste Gardistin würde sicher nicht wollen, dass ihre Untergebenen sich mit magischem Alkohol betrinken. Vor allem nicht, wenn sie im Dienst sind. Ich muss sowieso gleich zu ihr, dann spreche ich sie vielleicht darauf an.«
»Die Erste Gardistin hat dich zu sich beordert? Was hast du angestellt?«
»Gar nichts, wieso –« Kary erstarrte. Hatte sie etwas angestellt? Einen Fehler gemacht? Ihre Gedanken begannen zu rasen. Bei Naava, sie hatte doch stets genaustens darauf geachtet –
»Ich mache doch nur Spaß. Ich bin sicher, es ist nichts Schlimmes. Keine Angst.«
»Ich habe keine Angst.« Sie wich Gawens Blick aus. Manchmal hasste sie es, wie gut er sie kannte. Das war die Kehrseite einer Freundschaft, die schon von Kindesbeinen an bestand. Kary straffte die Schultern und trat einen Schritt von ihm weg. »Wie auch immer, ich muss jetzt gehen. Und du auch.« Sie deutete auf Warryn, der soeben damit begann, seine Einheit zusammenzurufen.
Gawen seufzte. »Na großartig. Dank dir darf ich jetzt hungrig Wache halten.«
»Ich mache es wieder gut, versprochen.« Kary drückte ihm den abgenagten Fleischspieß in die Hand. »Behütete Nacht. Wir sehen uns morgen beim Frühstück.«
»Wo du mir dann auch wieder alles wegisst?« Er versuchte, ihr den Spieß in das geflochtene Haar zu stecken.
Sie wich aus und warf ihm eine Kusshand zu, wobei sie ein Lächeln nicht unterdrücken konnte. Für einen Moment hieß sie das warme Gefühl in ihrem Bauch willkommen, das sie die Anspannung beinahe vergessen ließ. Dann floh sie nach draußen in die Kälte.
Die Erste Gardistin erwartete sie in ihrem Dienstzimmer. Kary klopfte, trat ein und salutierte. »Ihr wolltet mich sprechen?«
Leane Odeshyld saß hinter ihrem imposanten, ebenhölzernen Schreibtisch, vor sich eine Reihe von Schriftstücken. Sie machte sich nicht die Mühe, Kary zu begrüßen, sondern sagte lediglich: »Du kommst spät.«
»Verzeiht mir, ich wurde aufgehalten. In der Stadt gab es –«
»Du meinst, du hast dich aufhalten lassen.«
Kary ballte in ihren Lederhandschuhen die Fäuste. »Ich versichere Euch, ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte.«
Nicht schnell genug, sagte die Art und Weise, wie Leane ihre dunklen Brauen hob. Nicht gut genug. Niemals gut genug für die Erste Gardistin.
»Setz dich, Karalyna.«
Kary gehorchte. Während Leane weiter ihre Dokumente ordnete, gab sie sich alle Mühe, das Unbehagen zu verbergen, das sie stets in Gegenwart der Ersten Gardistin empfand. Die Angst, etwas falsch zu machen.
Um sich abzulenken, ließ sie den Blick durch den Raum schweifen. Die Wand hinter dem Schreibtisch war mit diversen Orden geschmückt, die Leane in ihrer Zeit beim Militär verdient hatte. Bevor sie in den Dienst der Königin getreten und zur Befehlshaberin ihrer Garde ernannt worden war, hatte sie sich als Soldatin einen Namen gemacht. Sie war in ganz Daskyen gefürchtet und nicht zuletzt für ihren gnadenlosen Kampfstil bekannt. Stellvertretend dafür stand ihr Schwert, Morgana, das unter den Orden auf einer Halterung lag. Leane stellte es gern zur Schau, was Kary ihr nicht verdenken konnte. Die Waffe war äußerst prächtig, mit Goldgravuren auf der gebogenen Klinge und einem eisernen Löwenkopf am Griff.
Kary konnte sich nur schwer von dem Anblick losreißen, als Leane ihr das Dokument reichte, nach dem sie offenbar gesucht hatte. Sofort schlug ihr der Duft von frischem Pergament entgegen. Einer der schönsten Gerüche, die sie kannte. Sie nahm Leane das Blatt ab und sah sich mit der Phantomzeichnung eines Mädchens konfrontiert, schätzungsweise zwölf Jahre alt.
»Sie wird vermisst«, erklärte Leane in ihrem nüchternen Tonfall. »Die Eltern glauben, sie wurde entführt.«
»Wann und wo ist das passiert?«
»Vor zwei Tagen. Im Schwarzen Viertel.«
Kary entspannte sich. Da hatte sie keinen Wacheinsatz geführt. Nicht, dass es die Situation besser machte, aber zumindest bedeutete es, dass Leane sie nicht hierher zitiert hatte, um sie für den Vorfall zur Verantwortung zu ziehen.
»Der Vater erzählte mir, dass das Mädchen seit Kurzem über schlimme Träume klagte. Sie will eine Stimme in ihrem Kopf gehört haben. Eine böse Stimme, wie der Mann betonte.« Leane sah Kary vielsagend an.
»Denkt Ihr etwa, dass sie ein Gegenstück ist? Dass sie den Ruf gehört hat?«
»Davon bin ich überzeugt.«
Gegenstücke waren das Resultat des Spaltungsbannes, den der Magische Rat vor nunmehr zwanzig Jahren über Daskyen verhängt hatte. Der Bann sorgte dafür, dass magische Begabungen sich nicht mehr nur in einem Menschen manifestierten, sondern auf zwei Wirte verteilt wurden: einen aktiven und einen passiven Part. Letzterer – das Gegenstück – konnte selbst keine Magie wirken, dafür jedoch die Gabe seines aktiven Parts beeinflussen und schwächen. Ein Schutzmechanismus, um zu verhindern, dass Magiebegabte ihre Macht missbrauchten, wie sie es in der Vergangenheit zu oft getan hatten.
»Das ist nicht der erste Vorfall dieser Art«, sagte Leane. »Es wurden bereits öfter Menschen entführt, bei denen alles darauf hindeutete, dass sie Gegenstücke waren.«
»Was?« Kary konnte ihre Bestürzung nicht verbergen. »Warum weiß ich davon nichts?«
»Weil ich entschieden habe, die Angelegenheit diskret zu behandeln.« Leane erhob sich von ihrem Stuhl, wobei der streng geflochtene, dunkelbraune Zopf über ihre Schulter fiel. »Sie ist diejenige, die diese Menschen entführt.«
Kary wusste sofort, von wem die Erste Gardistin sprach. Es gab nur eine Person in Sandawn, ja in ganz Daskyen, bei der alle Fäden zusammenliefen, wenn es um Magie ging. Kary war ihr nie begegnet – wie auch? –, doch durch Leanes Erzählungen konnte sie sich ein lebhaftes Bild von ihr machen. Diese Frau war eine Wahnsinnige, die einst versucht hatte, die Königin zu stürzen und die Macht an sich zu reißen. Zur Strafe war sie an einen Ort verbannt worden, von dem sie niemals entkommen würde.
»Aber sie kann doch überhaupt nichts mehr tun. Und ihren Lehrlingen ist es untersagt, in die Stadt zu kommen.«
»Sei nicht so naiv«, sagte Leane. »Die Gegenstücke sind der Grund, warum ihresgleichen geschwächt ist. Das ist ihre Art, dagegen vorzugehen: Sie raubt uns unsere Waffen. Ich vermute, dass sie sie tötet.«
Die Gleichgültigkeit in Leanes Stimme verstörte Kary. Sie sprang ebenfalls von ihrem Platz auf und beugte sich über den Schreibtisch. »Dann müssen wir etwas unternehmen. Wir –«
»Wir werden gar nichts unternehmen.« Leane kehrte ihr den Rücken zu und nahm Morgana von der Halterung an der Wand. Sie wiegte das Langschwert für einen Moment in den Händen, wie Mütter es mit Kindern taten, bevor sie es in die mit Gold durchwirkte Scheide an ihrem Gürtel schob. »Ich arbeite bereits an einem Plan. Bei Sonnenaufgang breche ich zu einer Mission auf, um die nötigen Vorkehrungen zu treffen.«
Kary horchte auf. »Was für eine Mission? Darf ich Euch begleiten?«
»Kommt nicht infrage.«
Der abweisende Tonfall versetzte ihr einen Stich. »Warum lasst Ihr mich nicht helfen? Ich kann doch –«
»Was du kannst, beurteile ich, Karalyna. Und bevor ich dich in meine Pläne einweihe, musst du mir zuerst beweisen, dass du bereit bist.«
Kary widerstand dem Drang, zurückzuweichen, als die Erste Gardistin um den Tisch herumkam und unmittelbar vor ihr stehenblieb.
»Ich wünsche, dass du als meine Stellvertreterin agierst, während ich fort bin.«
Karys Herz machte einen Sprung. Für einen Moment vergaß sie völlig, ihre aufrechte Haltung zu wahren. »Eure Stellvertreterin? Wirklich?« Ungläubig sah sie in Leanes blaue Augen. In das Gesicht, in dem sie sich selbst erkannte.
Leane verzog den Mund zu einer Art Lächeln. »Es mag dir nicht so erscheinen, aber ich traue dir eine Menge zu. Du machst dich gut als Kommandantin. Besser, als ich erwartet hatte. Und das sage ich nicht nur, weil du meine Tochter bist.«
Natürlich nicht. Ihre Beziehung zu Leane hatte Kary nie irgendwelche Vorteile eingebracht. Im Gegenteil, sie hatte stets mehr als alle anderen beweisen müssen, dass sie ihren Respekt verdiente. Dass sie sie stolz machen konnte. Zumindest klang es jetzt, als sei Leane stolz. Kary sollte nicht darauf angewiesen sein, die Bestätigung aus ihrem Mund zu hören, dennoch wünschte sie sich nichts sehnlicher als das. Nur ein einziges Mal.
Die Erste Gardistin überreichte ihr die eiserne Brosche in der Form eines Löwen, die sie stets über der Brust trug. Ihr Markenzeichen. »Ich erwarte, dass du dich in meiner Abwesenheit um alles kümmerst und dafür Sorge trägst, dass das Protokoll befolgt wird.«
»Selbstverständlich«, sagte Kary, bemüht, sich ihre Nervosität nicht anmerken zu lassen. »Ich werde Euch nicht enttäuschen.«
»Das will ich hoffen.« Leane räusperte sich. »Gut, das wäre dann alles, Karalyna.«
Es dauerte ein paar Sekunden, bis Kary begriff, dass sie entlassen worden war. Das abrupte Ende ihrer Unterhaltung verwirrte sie, obwohl eigentlich nichts Verwunderliches daran war. Ihre Mutter hasste schwache Momente. Und was auch immer das eben gewesen war, fiel anscheinend unter diese Kategorie.
»Wie lange werdet Ihr fort sein?«
»So lange, wie es eben dauert.«
Kary nickte ergeben. »In Ordnung. Dann habt eine sichere Reise.«
Leane hatte sich längst von ihr abgewandt und war hinüber zum Fenster getreten. Den Blick nach draußen gerichtet, nahm sie nicht wahr, wie Kary salutierte und den Raum verließ.
Stellvertreterin, schoss es ihr durch den Kopf, während sie die Löwenbrosche fest in ihrer Hand einschloss. Stellvertreterin der Ersten Gardistin. Der Gedanke hielt sie von innen warm, entfachte einen Funken in ihrer Brust, der alle Ängste und Unsicherheiten verbrannte. Wie eine Flamme in der Nacht.
Kapitel 3
Die Schenke Zur Schwarzen Brücke war nach dem Wahrzeichen unseres Dorfes benannt: der Brücke, die über den Abgrund führte, in die Heimat meiner Mutter. Daskyen, das Land der Dämmerung.
Lediglich eine Handvoll Tische war besetzt, sodass die kleine Gruppe um Bess, Saniel und Kylian mich sofort bemerkte, als ich eintrat. Ich winkte unbeholfen und wollte mich gerade zu ihnen gesellen, da sprang Bess bereits auf, lief mir entgegen und zog mich in eine Nische in der Nähe des Eingangs.
»Wo warst du so lange? Ist etwas passiert?« Ihr besorgter Tonfall verriet, dass mir der Schrecken immer noch anzusehen war.
Eigentlich wollte ich nicht darüber sprechen, aber ich wusste, Bess würde keine Ruhe geben, bis ich es ihr erzählte. »Ich war im Wald«, sagte ich, bemüht, das Zittern in meiner Stimme zu verbergen. »Bei Shayes Haus.«
»Du warst wo?« Ihre mit Kajal umrahmten Augen weiteten sich. »Woher kam das denn auf einmal? Vorhin hast du dich kaum mit mir auf den Friedhof getraut, und dann stellst du dich ganz allein deiner größten Angst?«
»So würde ich das nicht bezeichnen. Ich habe das Haus nicht mal betreten.«
»Vollkommen egal. Das ist ein riesiger Schritt.« Bess legte mir eine Hand auf die Schulter. »Wie geht es dir jetzt? Und wie war es, das Haus wiederzusehen?«
Vor meinem inneren Auge blitzte der verwahrloste Garten auf. Die toten Vögel und die schwarz verfärbten Blätter. Ein Schauer kroch über meinen Rücken. »Es war … unheimlich. Als würde dort etwas Dunkles lauern.« Ich dachte an die Flüsterstimme. Das Amulett. Ein Teil von mir hätte es Bess gern gezeigt, doch ich wagte nicht, das Schmuckstück aus meiner Manteltasche zu holen. Nicht hier, wo jemand es sehen könnte.
Die Eingangstür der Schenke schwang auf, und drei junge Frauen kamen herein, unter ihnen Marine, die zusammen mit mir in der Schneiderei arbeitete. Blut schoss mir in die Wangen, und ich hätte mich am liebsten irgendwo versteckt. Leider hatte sie mich bereits gesehen. Sie grüßte knapp, und ich murmelte eine ebenso steife Erwiderung. Dann stolzierte Marine an uns vorbei und zog sich mit ihren Freundinnen in die hinterste Ecke der Schenke zurück, ohne mich noch eines Blickes zu würdigen.
»Was war das denn?«, fragte Bess. »Ich dachte, du und sie …«
»Das hat sich erledigt.«
»Seit wann?«
»Na ja, wir hatten neulich eine Verabredung und –«
»Was? Warum weiß ich nichts davon?«
»Weil es eine Katastrophe war.« Die Hitze auf meinen Wangen verstärkte sich. Als Marine mich gefragt hatte, ob ich mit ihr ausgehen wollte, hatte ich mich gefreut. Ich mochte sie gern und hätte mir durchaus etwas mit ihr vorstellen können. Doch als sie mich auf dem Heimweg von unserem Spaziergang schließlich geküsst hatte … »Ich weiß selbst nicht, was mit mir los war. Ich habe einfach Angst bekommen. Also bin ich abgehauen und habe sie dort stehen lassen. Seither gehe ich ihr aus dem Weg.«
»Oh.« Bess verzog das Gesicht.
»Ja. Oh.« Ich linste hinüber zu Marines Tisch. Vermutlich erzählte sie ihren Freundinnen gerade, wie seltsam ich war. Was sonst war von Shaye Faerwyngs Tochter zu erwarten? Ich seufzte. »Ich bin einfach nicht gut in diesen Dingen.«
»Welchen Dingen?«
»Freundschaften. Beziehungen. Im Grunde alles, was mit Menschen zu tun hat.«
»Erzähl keinen Mist. Du und ich sind seit Jahren befreundet.«
»Wir wissen beide, dass das nicht mein Verdienst ist.« Wenn Bess sich damals in der Schule nicht so sehr um mich bemüht hätte, wären wir vermutlich niemals Freundinnen geworden. Mir war es schon immer schwergefallen, auf andere Menschen zuzugehen. Doktor Lenoir zufolge lag das daran, dass ich Vertrauensprobleme hatte, weil ich bei meiner Mutter nie hatte wissen können, woran ich war. Ihre Stimmung hatte sich oft im Bruchteil einer Sekunde ins Gegenteil verkehrt.
»Vielleicht hast du die richtigen Menschen noch nicht getroffen. Wenn du erst an der Universität studierst, wirst du sicher eine Frau finden, die besser zu dir passt. Und ein paar neue Freunde und Freundinnen, auch wenn ich bezweifle, dass die mir das Wasser reichen können.« Bess zwinkerte mir zu. »Die Frist, um sich für das nächste Semester einzuschreiben, ist übrigens noch nicht vorbei.«
Ich warf ihr einen finsteren Blick zu.
»Was denn? Wir wissen beide, dass die Schneiderinnenlehre nicht deine erste Wahl war. Du hast selbst gesagt, du würdest später lieber Leuten helfen, die mit ähnlichen Krankheiten zu kämpfen haben wie –«
»Die Universität wird mich niemals aufnehmen, Bess. Ich kann weder richtig schreiben noch lesen, ganz zu schweigen davon, dass ich die Letzte bin, die irgendjemandem helfen kann. Ich habe ja noch nicht einmal meine eigenen Ängste im Griff.«
»Das stimmt nicht. Du machst verdammt gute Fortschritte, und du kannst viel mehr, als du dir zutraust.« Bess hob einen Finger, ließ keine Widerrede zu. »Willst du etwa für den Rest deines Lebens hier gefangen bleiben? Du bist zu mehr bestimmt, Tia. Du gehörst nicht in ein kleines Dorf am Rand der Welt.«
Ohne es zu wollen, musste ich an die Brücke denken. An Shaye. Über sie hatten die Leute auch immer gesagt, dass sie nicht hierhergehörte. War sie womöglich deshalb krank geworden – weil Velarien nicht ihre richtige Heimat gewesen war? Würde ich eines Tages genauso enden wie sie?
Ich ballte die Fäuste, drückte die Fingernägel so fest in meine Handflächen, dass der Schmerz die Gedanken verdrängte. »Ich will darüber jetzt nicht reden. Nicht heute. Können wir bitte einfach etwas trinken?«
Bess hielt meinen Blick ein paar Sekunden fest, bevor sie mit den Augen rollte. »Na schön, von mir aus. Aber glaub nicht, dass das Thema damit erledigt ist. Ich werde nicht eher ruhen, bis du aufhörst, dir selbst im Weg zu stehen.« Sie legte mir einen Arm um die Schultern und führte mich an unseren Tisch, wo die anderen gerade eine Runde Absinth bestellten.
Die Ablenkung tat mir gut, und ich war dankbar, dass dieser dunkle Tag trotz allem noch einen schönen Abschluss fand.
Als es schließlich an der Zeit war, aufzubrechen, bestand Bess darauf, mich bis nach Hause zu begleiten. Wir verabschiedeten uns von den anderen und liefen im Schein der Gaslaternen durch das nächtliche Dorf. Außer uns war niemand mehr unterwegs. Ich genoss die Stille und den kühlen Herbstwind. Die Luft roch feucht, aber der Boden war trocken. Vermutlich regnete es heute Nacht noch.
Kurz darauf glaubte ich auch schon, die ersten Regentropfen auf meinem Gesicht zu spüren. Ich legte den Kopf in den Nacken, um sicherzugehen, als in der Ferne plötzlich ein Donnergrollen erklang. Ich erstarrte an Ort und Stelle. Meine Stiefel froren förmlich auf den Pflastersteinen fest, während mein Puls sich rasant beschleunigte. Ein Blitz verästelte sich am sternenklaren Himmel, und am Horizont war für den Bruchteil einer Sekunde die Brücke zu sehen.
Mir brach der Schweiß aus, ich fing an zu zittern. Meine Kehle war wie zugeschnürt. »Ich … ich muss nach Hause«, presste ich hervor und zwang mich, einen Fuß vor den anderen zu setzen, obwohl ich meinen Körper kaum spürte.
»Hey. Ganz ruhig, Tia.«
Mir war klar, dass Bess nur helfen wollte, aber indem sie mich am Arm festhielt, machte sie es nur noch schlimmer. Panik kroch in mir hoch, kalt und dunkel. Ich konnte nicht mehr klar denken, wusste nur noch, dass ich hier weg musste, so schnell wie möglich. »Bitte, Bess, ich muss nach Hause, ich muss sofort –«
Ein weiterer Donnerschlag, lauter als zuvor.
Meine Beine gaben unter mir nach, ich sank auf die Knie, sodass Bess gezwungen war, mich loszulassen. Sie redete auf mich ein, doch ich hörte sie nicht, hörte nur das Pochen meines Herzens und die Stimme meiner Mutter in meinem Kopf: »Wenn der Sturm kommt, geschieht etwas Schreckliches.«
Shaye hatte panische Angst vor Gewitterstürmen gehabt. Und wie so viele Ängste war auch diese auf mich übergegangen.
Tränen brannten in meinen Augen wie Feuer. Ich rollte mich auf dem kalten, nassen Boden zusammen, während der Regen unbarmherzig auf mich herabprasselte. Keuchend schnappte ich nach Luft, sagte mir selbst, dass der Sturm vorüberziehen würde. Das tat er immer. Doch obwohl das nicht meine erste Panikattacke war, fühlte es sich trotzdem so an, als würde ich jeden Moment ersticken.
In meiner Verzweiflung griff ich in meine Manteltasche, auf der Suche nach dem Beruhigungsmittel, das Doktor Lenoir mir für Notfälle verschrieben hatte. Stattdessen fand ich das Amulett. Es lag warm in meiner tauben Hand, und wie schon in Shayes Garten fuhr bei der Berührung ein Ruck durch meinen Körper.
»Ich kann dir helfen.«
Da war sie wieder, die Flüsterstimme. Und aus irgendeinem Grund wusste ich, dass sie die Wahrheit sagte. Sie konnte mir helfen, mir die Angst nehmen.
Mit zitternden Fingern zog ich das Amulett aus meiner Tasche und legte das schwarze Samthalsband um meinen Hals. Der Verschluss schnappte wie von selbst zu. Ich atmete auf, als der rote Edelstein meine Haut berührte und sanft pochte.
Wärme strömte durch meinen Körper. Der Nebel in meinem Kopf lichtete sich, die Panik ebbte ab. Ich fühlte mich nicht länger schwach, sondern fast schon … machtvoll. Unbesiegbar. Für einen kurzen Moment.
Dann zuckte ein roter Blitz über den Himmel, und zeitgleich machte sich hinter meiner Stirn ein flammender, alles verzehrender Schmerz bemerkbar. Ich konnte nichts mehr sehen, nichts mehr hören. Das Feuer war überall. Ein stummer Schrei erstarb auf meinen Lippen, ehe ich nach hinten kippte und ins Nichts fiel.
Wie so oft konnte Kary nicht einschlafen. Zu viele Gedanken hielten sie wach, all die Dinge, um die sie sich würde kümmern müssen, jetzt, da sie Leanes Stellvertreterin war. Die Stellvertreterin der Ersten Gardistin.
Alle paar Minuten spähte sie zu der Brosche auf ihrem Nachttisch, um sich zu vergewissern, dass sie es nicht nur geträumt hatte. Doch trotz der Glücksgefühle, die sie beim Anblick des eisernen Löwen durchströmten, wurde der Druck in ihrer Brust immer größer. Was, wenn sie Leane enttäuschte? Wenn sie ihren Erwartungen nicht gerecht wurde? Die Angst, zu versagen, schnürte ihr die Kehle zu.
Als Kind hatte Kary oft bei Gawen übernachtet, wenn sie nicht schlafen konnte. Auch jetzt wäre sie gern zu ihm gegangen, und sei es nur, um ihm von ihren Sorgen zu erzählen. Er schaffte es immer, sie zu beruhigen, und beklagte sich nie, wenn sie ihn um den Schlaf brachte.
Doch als sie schon aufstehen und sich zum Quartier ihres besten Freundes schleichen wollte, das lediglich ein paar Gänge weiter lag, fiel ihr ein, dass er gerade Wache hielt und sein Dienst erst in ein paar Stunden enden würde.
Seufzend rollte Kary sich herum und tastete unwillkürlich nach Malay, ihrem Schwert, das neben ihr auf der schmalen Matratze lag. Sie ließ es niemals aus den Augen, trug es sogar nachts bei sich. Das half zwar nicht gegen ihre Schlafprobleme, gab ihr aber zumindest ein Gefühl von Sicherheit. Nicht nur, weil sie sich damit verteidigen konnte, sondern vor allem, weil Malay der Beweis dafür war, dass sie keine Versagerin war. Sonst hätte die Erste Gardistin ihr das Schwert niemals überreicht.
Trotzdem wollten Karys Gedanken einfach nicht stillstehen. Irgendwann war sie es leid, sich hin und her zu wälzen, und griff stattdessen nach einem der Bücher, die sich auf ihrem Nachttisch stapelten. Wenn sie schon nicht schlafen konnte, wollte sie sich wenigstens ablenken, und nichts lenkte sie so sehr ab wie eine gute Geschichte. Sie schlug die erste Seite auf und verlor sich sogleich zwischen den Zeilen.
Als sie in die Wirklichkeit zurückkehrte, war die Kerze auf ihrem Nachttisch beinahe vollständig heruntergebrannt. Draußen begann es bereits zu dämmern, und durchs Fenster sah Kary den Hof vor der Garnison, wo eine Gruppe Gardemitglieder versammelt war, darunter auch Leane. Vermutlich würden sie in Kürze zu dieser geheimen Mission aufbrechen. Die Pferde standen bereit, und Bedienstete waren damit beschäftigt, die letzten Gepäckstücke zu verstauen.
Kary betrachtete ihre Mutter durch die beschlagene Scheibe. Aufrechte Haltung, gefühlskalter Ausdruck. Immer wieder bekam sie zu hören, dass sie der Ersten Gardistin wie aus dem Gesicht geschnitten war. Sie konnte nicht leugnen, dass dieser Umstand sie stolz machte.
Ein Lächeln schlich sich auf ihre Lippen, als sie erneut zu der Brosche auf ihrem Nachttisch spähte. Sie würde Leane nicht enttäuschen, das schwor Kary sich. Sie würde ihr beweisen, dass sie bereit war, egal wofür. Sie würde nicht versagen.
In dem Moment hörte sie einen Schrei – einen grässlichen, hohen Ton, wie der Schmerzenslaut eines Tieres, dem bei lebendigem Leib die Haut abgezogen wurde.
Bei Naava, was ist das?
Licht explodierte in ihrem Kopf, so grell, dass sie fürchtete, zu erblinden. Flammen zuckten hinter ihren Lidern, und sie presste sich beide Hände gegen den Schädel. Völlig orientierungslos sprang sie vom Bett auf und taumelte durch ihr Quartier, wobei sie erst gegen ihr Bücherregal stieß, dann gegen den Kleiderschrank und schließlich gegen das Fenster. Draußen standen Leane und die anderen Gardemitglieder noch immer beisammen.
Sieh bloß nicht her!, dachte Kary. Die Vorstellung, Leane könnte sie in einem schwachen Moment beobachten, erfüllte sie mit Scham. Und doch wünschte ein Teil von ihr, Leane würde ihr helfen, sie beschützen. Nicht die Erste Gardistin, sondern ihre Mutter.
Der Schrei in Karys Kopf wurde lauter, unerträglich. Um sie herum drehte sich alles. Sie biss die Zähne zusammen, versuchte, den Schmerz auszublenden. Sie musste nachdenken, sich konzentrieren. Was konnte solche Qualen verursachen? Es gab keinen Auslöser, keine logische Erklärung. Es war beinahe wie …
»Nein«, hauchte Kary.
Es war beinahe wie Magie.
Der Ruf, schoss es ihr durch den Kopf. Sobald die Magie des aktiven Parts erwachte, rief er sein Gegenstück zu sich. Sein Gegenstück …
»Nein! Nein, nein, nein! Bei Naava, bitte nicht.«
Kary sank auf die Knie, während die Flammen hinter ihren Augen höherschlugen.
Kapitel 4
So schnell sie konnte, rannte Kary nach draußen, doch da hatten Leane und die anderen ihre Pferde bereits durch die Tore der Garnison getrieben. Sie waren fort und Kary allein. Allein mit den Flammen in ihrem Kopf.
Für einen Moment wurde ihr vor Schmerz und Anspannung so übel, dass sie glaubte, sich übergeben zu müssen. Sie ging neben einem in der Erde steckenden Fackelhalter in die Hocke und atmete krampfhaft ein und aus. Nach einer Weile flaute das Brennen hinter ihren Schläfen ab, trotzdem konnte sie den Ruf noch immer hören. Oder eher spüren. Er war keine Stimme wie bei dem entführten Mädchen, sondern vielmehr ein Ziehen in ihrem Inneren, eine unsichtbare Hand, die sie zu lenken schien. Die Frage war nur, wohin. Wo hielt sich die magiebegabte Person auf, mit der sie auf irgendeine unheimliche Art verbunden war?
Um ihre Nerven zu beruhigen, ging Kary ein paar Schritte über das Gelände der Garnison, vorbei an den Werkstätten und Waffenschmieden, wo um diese Uhrzeit noch alles im Dunkeln lag. Die kühle Herbstluft half gegen die Übelkeit und ließ Kary endlich wieder klar denken.
Sie konnte jetzt nicht einfach gehen und ihre Pflichten vernachlässigen. Leane hatte sie zu ihrer Stellvertreterin ernannt, was einer großen Ehre gleichkam. Andererseits hatte Leane ihr aber auch die Bedeutsamkeit der Gegenstücke erläutert. Sie waren Waffen gegen Magie, die effektivsten, die der Garde zur Verfügung standen. War es da nicht ebenso Karys Pflicht, dieser Rolle gerecht zu werden? Zur Waffe zu werden?
Bei Naava, sie fühlte sich im Inneren gespalten. Ihre Eingeweide verknoteten sich, so als würden unsichtbare Hände sie gleichzeitig in entgegengesetzte Richtungen ziehen. Was würde Leane tun?, fragte sie sich, wie so oft, wenn sie nicht weiter wusste. Sie stellte sich vor, was ihre Mutter zu ihr sagen würde, diese Frau, die jede Entscheidung mit dem Kopf traf, nicht mit dem Herzen. Für sie standen die Prinzipien der Garde an erster Stelle. Das Leben der Königin. Der Schutz des Volkes. Der Kampf gegen Magie.
Und da wusste Kary, was sie zu tun hatte.
Mit mehr Zeit hätte sie womöglich anders gehandelt, aber sie hatte schlichtweg keine Zeit. Irgendwo dort draußen gab es eine magiebegabte Person, die ihre Kräfte nicht kontrollieren konnte, und es lag in Karys Verantwortung, zu verhindern, dass jemand zu Schaden kam. Also würde sie losziehen wie die Heldinnen in ihren Lieblingsbüchern, und dem Ungeheuer ohne Furcht und Reue entgegentreten.
In Windeseile legte sie ihre Uniform an und holte ihre Stute Azaleya aus den Stallungen. Dann ritt sie im Dämmerlicht des anbrechenden Tages durch die menschenleeren Gassen Sandawns, die Kapuze ihres Umhangs tief ins Gesicht gezogen, um sich vor dem Nieselregen zu schützen.
Sie merkte schnell, dass der Ruf sie aus der Stadt hinausführte, vermutlich zu einem der umliegenden Dörfer. Am Stadttor kamen ihr zwei Gardisten mit Fackeln entgegen, als sie ihr Pferd auf den feuchten Pflastersteinen zum Halten brachte. Mit Erleichterung stellte sie fest, dass einer der beiden Gawen war.
»Kary?« Der Schein des Feuers umrahmte sein Gesicht, ließ seine helle Haut rötlich schimmern. »Was machst du hier?«
»Das würde mich auch interessieren«, sagte Kole. Er diente ebenfalls in Warryns Einheit und war Kary noch nie sonderlich zugetan gewesen. Ein Umstand, der auf Gegenseitigkeit beruhte. »Das ist nicht deine Wache.«
Kary saß von ihrem Pferd ab und schlug die Kapuze zurück. Der Wind peitschte ihr ein paar lange, dunkelbraune Haarsträhnen ins Gesicht, die sich aus der Fixierung an ihrem Hinterkopf gelöst haben mussten. Aus Zeitgründen hatte sie sich statt ihrer üblichen Flechtkunstwerke mit einem einfachen, zweckmäßigen Knoten begnügt.
»Ich führe einen Sonderauftrag aus. Geh und öffne das Tor für mich.«
»Was für ein Sonderauftrag? Für wen?«
Sie deutete auf die Löwenbrosche über ihrer Brust. »Für die Erste Gardistin. Alles andere hat dich nicht zu interessieren. Jetzt geh und öffne das Tor. Das ist ein Befehl.«
Für einen Augenblick starrte Kole sie nur an, ungläubig und empört zugleich. Dann rang er sich zu einem kleinlauten »Jawohl« durch und stapfte in Richtung des Wachturmes davon.
Erst als sie mit Gawen allein war, senkte Kary ihre verkrampften Schultern. Das Ziehen in ihrem Inneren war schwächer geworden, aber noch immer deutlich zu spüren.