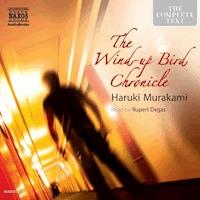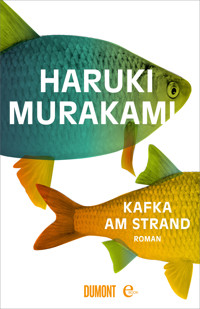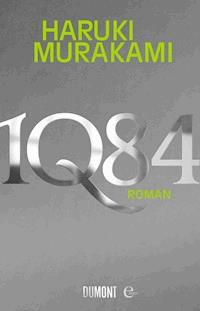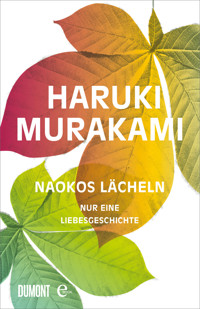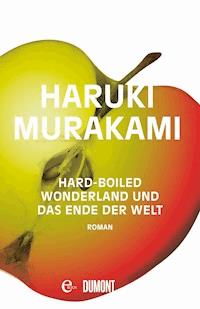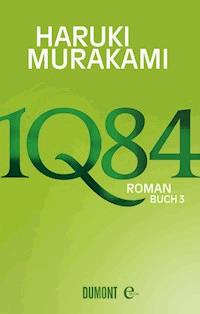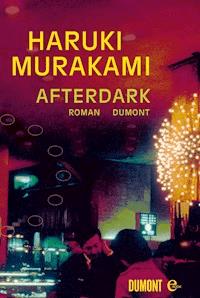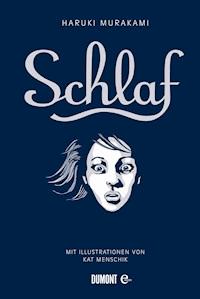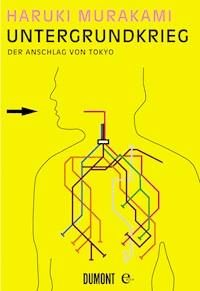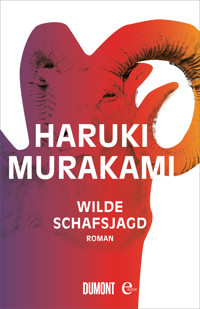
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Geschichtenzauberer Murakami entführt in eine Welt voll bizarrer Geheimnisse, in der Realität und Fantasie zu einem virtuosen Abenteuer verschmelzen. Was als wilde, sich überschlagende Jagd endet, beginnt ganz einfach: mit einem Brief, in dem das Foto eines Schafes steckt. Er ist adressiert an einen müden Endzwanziger, der als Mitinhaber einer Tokyoter Werbeagentur in einem Nebel aus Zigaretten und Alkohol lebt: Nur ein Abenteuer kann einen Ausweg aus seiner Langeweile bieten – die ›Wilde Schafsjagd‹ beginnt. Haruki Murakamis meisterhafter Bestseller um ein Schaf mit übernatürlichen Kräften, ein Teilzeit-Callgirl mit den schönsten Ohren der Welt und einen Kriegsverbrecher mit einem Gehirntumor ist ein fantastischer Detektivroman, inspiriert von den düsteren Werken Raymond Chandlers – nur dass dieser Fall unlösbar ist. »Ein Mythenerzähler für dieses Jahrtausend« NEW YORK TIMES BOOK REVIEW
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 405
Veröffentlichungsjahr: 2011
Sammlungen
Ähnliche
HARUKI MURAKAMI
WILDE SCHAFSJAGD
ROMAN DUMONT
AUS DEM JAPANISCHEN VON
ANNELIE ORTMANNS
DIE JAPANISCHE ORIGINALAUSGABE ERSCHIEN 1982 UNTER DEM TITEL
»HITSUJI O MEGURU BO–KEN« BEI KO–DANSHA, TOKYO
© 1982 HARUKI MURAKAMI
EBOOK 2011
© 1991 FÜR DIE DEUTSCHE ÜBERSETZUNG: INSEL VERLAG, FRANKFURT AM MAIN UND LEIPZIG
© 2005 FÜR DIE NEUAUSGABE: DUMONT BUCHVERLAG, KÖLN
ALLE RECHTE VORBEHALTEN
AUSSTATTUNG UND UMSCHLAG: GROOTHUIS & CONSORTEN, HAMBURG
SATZ: GREINER & REICHEL, KÖLN
DATENKONVERTIERUNG: CPI BOOKS GMBH, LECK
ISBN EBOOK: 978-3-8321-8610-4
WWW.DUMONT-BUCHVERLAG.DE
WILDE SCHAFSJAGD
ERSTES KAPITEL
25.11.1970
MITTWOCHSPICKNICKS
Von ihrem Tod erfuhr ich durch einen Freund am Telefon. Er hatte es zufällig in der Zeitung gelesen. Langsam las er mir die Notiz aus der Morgenausgabe vor. Ein ganz gewöhnlicher Artikel. Hörte sich an, als hätte man einen frisch von der Uni gekommenen Volontär daran üben lassen.
Am soundsovielten Soundsovielten wurde an irgendeiner Straßenecke irgendjemand von einem Lastwagen überfahren. Gegen irgendjemanden wird wegen Verdachts auf fahrlässige Tötung im Dienst ermittelt.
Fast wie das Gedicht der Woche im Feuilleton.
»Wo ist denn die Beerdigung?«, fragte ich.
»Hm, weiß ich nicht«, sagte er. »Hatte sie Familie?«
Natürlich hatte auch sie eine Familie.
Ich rief noch am gleichen Tag bei der Polizei an und bekam Adresse und Telefonnummer ihrer Eltern. Dort erkundigte ich mich nach dem Datum der Beerdigung. Höret, und es wird euch gesagt. Fragen ist alles.
Ihre Eltern wohnten in der Altstadt. Ich schlug meinen Plan von Tokyo auf und markierte den Häuserblock mit einem roten Kuli. Das Haus lag wirklich in einem typischen Altstadtviertel. Ein wirres Gespinst aus U-Bahn-, S-Bahn- und Buslinien, unter- und überzogen von Abwasserkanälen, Straßen und Gässchen wie das feine weiße Netz einer Melonenschale.
Am Tag der Beerdigung nahm ich von Waseda aus die Straßenbahn. Kurz vor der Endstation stieg ich aus und öffnete den Stadtplan, aber der nutzte mir so viel wie ein Globus. Bis ich in die Nähe ihres Elternhauses kam, hatte ich einige Schachteln Zigaretten gekauft und zehnmal nach dem Weg gefragt.
Es war ein altes Holzhaus mit einem braunen Bretterzaun. Hinter dem Tor war links ein kleiner Garten, gerade so groß, dass man etwas damit anfangen konnte. In einem alten, unbrauchbaren Kohlebecken aus Keramik, das man in einer Ecke abgestellt hatte, standen über fünfzehn Zentimeter Regenwasser. Der Gartenboden war dunkel und feucht.
Die stille Feier fand im engsten Familienkreis statt, vielleicht, weil sie mit sechzehn von zu Hause weggelaufen war. Die meisten Gäste waren ältere Verwandte. Ein knapp über dreißigjähriger Mann, wohl ihr Bruder oder Schwager, hielt die Zeremonie ab. Ihr Vater war ein kleiner Mann Mitte fünfzig. Mit einem Trauerflor um den Ärmel seines schwarzen Anzugs stand er fast bewegungslos neben dem Eingang. Irgendwie erinnerte er an regennassen Asphalt.
Als ich ihm zum Abschied schweigend zunickte, nickte er wortlos zurück.
* * *
Im Herbst 1969 hatte ich sie zum ersten Mal getroffen; ich war zwanzig und sie siebzehn. In der Nähe der Uni gab es ein kleines Café, wo ich mich oft mit Freunden verabredete. Der Laden war nichts Besonderes, aber man konnte dort Hardrock hören und den schlechtesten Kaffee der Welt dazu trinken.
Sie saß immer am selben Platz, die Ellbogen auf den Tisch gestützt, in ein Buch vertieft. Sie trug eine Brille, die einer Zahnspange ähnelte, und hatte knochige Hände, aber irgendwie war etwas Vertrautes an ihr. Ihr Kaffee war immer kalt, ihr Aschenbecher immer voll mit Zigarettenstummeln. Nur die Buchtitel änderten sich. Mal war es Mickey Spillane, mal Kenzaburo¯ O¯e, mal ein Gedichtband von Allen Ginsberg. Ihr schien alles recht zu sein, Hauptsache, es war ein Buch. Die Studenten, die im Café ein- und ausgingen, liehen ihr Bücher, und sie las sie vom ersten bis zum letzten Buchstaben, nagte sie förmlich wie Maiskolben ab. Damals verlieh noch jeder Bücher, deshalb gingen sie ihr nie aus.
Damals – das waren auch die Doors, die Stones, die Byrds, Deep Purple und die Moody Blues. Es knisterte in der Atmosphäre, und so gut wie alles, hatte man den Eindruck, würde augenblicklich in sich zusammenfallen, träte man nur etwas fester dagegen.
Wir tranken billigen Whiskey, hatten nicht gerade aufregenden Sex, redeten uns die Köpfe heiß und liehen uns gegenseitig Bücher aus. Und langsam, aber sicher senkte sich auch über die linkischen Sechziger quietschend der Vorhang der Weltbühne.
Ihren Namen habe ich vergessen.
Ich könnte den Zeitungsartikel über ihren Tod noch mal raussuchen und nachsehen, aber was nützt der Name jetzt schon noch. Ich habe ihn vergessen. Das ist alles.
Wenn ich Freunde von damals treffe und wir irgendwie auf sie zu sprechen kommen, können sie sich auch nicht an den Namen erinnern. Mensch, da war doch früher mal eine, die mit jedem ins Bett gestiegen ist, weißt du noch? Wie hieß die noch, hab den Namen total vergessen. Hab doch selbst oft mit ihr gepennt, was die wohl jetzt macht? Wär schon komisch, wenn ich sie mal zufällig auf der Straße treffen würde.
Es war einmal ein Mädchen, das mit jedem schlief.
So lautet ihr Name.
* * *
Genau genommen schlief sie natürlich nicht mit jedem. Sie hatte da ihre Prinzipien.
Trotzdem, objektiv und realistisch betrachtet, schlief sie mit so gut wie jedem.
Ein einziges Mal fragte ich sie nach diesen Prinzipien – aus reiner Neugierde. »Hmh …« Sie dachte etwa dreißig Sekunden nach. »Natürlich schlaf ich nicht mit jedem. Manchmal ist es mir auch zuwider. Aber ich will möglichst viele Leute kennen lernen. Um, ja, um für mich die Welt zu begreifen.«
»Indem du mit jemandem schläfst?«
»Ja.«
Diesmal war es an mir nachzudenken.
»Und – hast du sie dadurch ein bisschen begriffen?«
»Ein bisschen, ja«, sagte sie.
* * *
Vom Winter 1969 bis Sommer 1970 sah ich sie kaum. Die Uni war ständig zu – entweder wegen Studentenblockaden oder wegen Aussperrungen –, und ich hatte sowieso mit persönlichen Problemen genug zu tun.
Als ich im Herbst 1970 das Café wieder besuchte, waren ganz andere Leute da. Sie war so ziemlich das einzige bekannte Gesicht. Es lief immer noch Hardrock, aber das Knistern in der Atmosphäre war verschwunden. Nur sie und der schlechte Kaffee hatten sich in dem einen Jahr nicht verändert. Ich setzte mich auf den Stuhl ihr gegenüber. Wir tranken Kaffee und redeten über die alte Clique.
Die meisten von ihnen hatten die Uni abgebrochen. Einer hatte sich umgebracht, ein anderer war spurlos verschwunden, und so weiter.
»Und was hast du das ganze Jahr gemacht?«, fragte sie mich.
»So dies und das«, sagte ich.
»Und, bist du ein bisschen klüger geworden?«
»Ein bisschen, ja.«
An diesem Abend schlief ich das erste Mal mit ihr.
* * *
Ihre Lebensgeschichte kenne ich nicht genau. Das, was ich weiß, habe ich irgendwo aufgeschnappt, vielleicht hat sie es mir auch selbst im Bett erzählt. Als sie in der 10. Klasse war, hatte sie einen Riesenkrach mit ihrem Vater und lief von zu Hause (und von der Schule) weg. Das war im Sommer. Ja, so war’s, glaube ich. Wo sie wohnte und wovon sie lebte, wusste niemand.
Sie saß den ganzen Tag auf ihrem Stuhl im Rock-Café, trank pausenlos Kaffee, rauchte eine Zigarette nach der anderen, blätterte die Seiten ihres Buches um und wartete, bis jemand auftauchte, der ihr den Kaffee und die Zigaretten bezahlte (und das war nicht gerade Kleingeld für uns damals). Mit dem schlief sie dann meistens.
Das ist alles, was ich über sie weiß.
Von jenem Herbst an bis zum darauf folgenden Frühling besuchte sie mich jeden Dienstagabend in meinem damaligen Zimmer in Mitaka, am Rande der Stadt. Sie aß mein einfaches Abendessen, füllte meine Aschenbecher und schlief mit mir, das Radio in voller Lautstärke auf Rock gestellt. Mittwochs morgens nach dem Aufstehen spazierten wir durch den Wald zum Campus der ICU und aßen dort in der Mensa zu Mittag. Nachmittags tranken wir in der Cafeteria dünnen Kaffee, und wenn das Wetter gut war, legten wir uns auf eine Wiese im Unigelände und schauten in den Himmel.
Sie nannte das »Mittwochspicknick«.
»Jedes Mal, wenn wir hierher kommen, fühle ich mich wie bei einem richtigen Picknick.«
»Picknick?«
»Ja, überall Gras, soweit man sehen kann, und die Menschen sehen so glücklich aus …«
Sie setzte sich auf und verbrauchte mehrere Streichhölzer, um ihre Zigarette anzuzünden.
»Die Sonne geht auf und unter, Leute kommen und gehen, die Zeit streicht vorbei wie ein Lufthauch. Wie bei einem Picknick eben.«
Damals war ich einundzwanzig und würde in ein paar Wochen zweiundzwanzig werden. Hatte keine Aussicht, in absehbarer Zukunft meinen Abschluss zu machen, aber auch keinen richtigen Grund, die Uni abzubrechen. Ich steckte in einer merkwürdig depressiven Phase und konnte mich einige Monate lang einfach nicht aufraffen, irgendetwas Neues anzufangen.
Die Welt nahm ihren Lauf, nur ich hatte mich festgefahren. Im Herbst 1970 sah alles irgendwie so traurig aus, als ob überall die Farbe ausliefe. Die Sonnenstrahlen, der Geruch des Grases, sogar das leise Nieseln des Regens – alles regte mich auf.
Ich träumte damals oft von einem Nachtzug. Es war immer der gleiche Traum: Ein Zug, in dem man kaum atmen kann vor Zigarettenqualm, Toilettengestank und menschlichen Ausdünstungen. So voll, dass man fast nicht stehen kann, an den Sitzen klebt Erbrochenes. Ich halte es nicht mehr aus, stehe auf und steige an irgendeinem Bahnhof aus. Eine verlassene Gegend, kein Haus, kein Licht. Nicht einmal ein Bahnbeamter. Keine Uhr, kein Fahrplan, rein nichts.
In dieser Phase habe ich sie hart angefasst, glaube ich. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, wie. Vielleicht habe ich mich eigentlich auch nur selbst treffen wollen. Jedenfalls hat sie das in keiner Weise gekümmert. Oder (drastisch ausgedrückt) sie hat ziemlichen Spaß daran gehabt. Warum, weiß ich nicht. Zärtlichkeit war es demnach jedenfalls nicht, was sie von mir wollte. Wenn ich daran denke, befällt mich heute noch ein seltsames Gefühl. Eine Trauer und ein Schmerz, als stieße ich mit der Hand an eine unsichtbare, schwebende Wand.
* * *
Noch heute erinnere ich mich genau an jenen merkwürdigen Nachmittag des 25. November 1970. Vom heftigen Regen heruntergerissene Ginkgo-Blätter färbten die Waldwege gelb wie ausgetrocknete Bäche. Die Hände in den Manteltaschen, spazierten wir immer wieder dieselben Wege entlang. Außer dem Rascheln des Laubes unter unseren Schritten und Vogelgekreisch war nichts zu hören.
»Was beschäftigt dich eigentlich die ganze Zeit?«, fragte sie mich plötzlich.
»Nichts Besonderes«, sagte ich.
Sie ging ein bisschen vor, dann setzte sie sich am Wegesrand hin und rauchte eine Zigarette. Ich setzte mich neben sie.
»Hast du immer Albträume?«
»Ich habe oft Albträume. Meistens geht es darum, dass Automaten mein Wechselgeld nicht rausrücken wollen.«
Sie lachte, legte ihre Hand auf mein Knie und zog sie dann wieder zurück.
»Du willst bestimmt nicht darüber reden, oder?«
»Ich kann bestimmt nicht gut darüber reden.«
Sie warf die halb gerauchte Zigarette auf die Erde und trat sie mit dem Turnschuh sorgfältig aus.
»Was man wirklich sagen will, lässt sich nie leicht ausdrücken, findest du nicht?«
»Weiß ich nicht«, sagte ich.
Zwei Vögel erhoben sich flatternd vom Boden und verschwanden, als würden sie vom leeren Himmel aufgesogen. Wir sahen ihnen eine Zeit lang schweigend nach. Dann ritzte sie mit einem dürren Zweig ein paar sonderbare Figuren in den Boden.
»Wenn ich mit dir schlafe, werd ich manchmal ganz traurig.«
»Tut mir leid«, sagte ich.
»Nein, es ist nicht deine Schuld. Es liegt auch nicht daran, dass du an eine andere denkst, wenn du mich in die Arme nimmst. Das ist mir egal. Ich …« Sie verstummte plötzlich und zog langsam drei parallele Linien auf den Boden. »Ach, ich weiß nicht.«
»Ich will mich nicht absichtlich von dir abkapseln«, sagte ich nach einer Weile. »Ich begreife nur selbst noch nicht ganz, was los ist. Ich möchte verschiedenen Dingen möglichst gerecht werden. Ich möchte nichts übertreiben und auch nicht, dass alles übermäßig real wird. Aber das braucht Zeit.«
»Wie viel Zeit?«
Ich schüttelte den Kopf. »Kann ich nicht sagen. Ein Jahr, vielleicht auch zehn.«
Sie warf den Zweig auf den Boden, stand auf und klopfte sich das trockene Gras vom Mantel. »Zehn Jahre – das hört sich ja wie eine Ewigkeit an, findest du nicht?«
»Hm, ja«, sagte ich.
Wir gingen durch den Wald zum Campus, setzten uns wie immer in die Cafeteria und verdrückten Hot dogs. Es war zwei Uhr nachmittags, und im Fernseher zeigten sie ständig Yukio Mishima. Da die Lautstärkenregelung nicht funktionierte; konnten wir kaum verstehen, was gesagt wurde, aber das war uns sowieso egal. Nach den Hot dogs genehmigten wir uns noch eine Tasse Kaffee. Ein Student stieg auf einen Stuhl und fummelte eine Weile an der Lautstärke herum. Dann gab er auf, stieg herunter und verschwand.
»Ich will dich«, sagte ich.
»In Ordnung«, sagte sie und lächelte.
Die Hände in den Manteltaschen gingen wir langsam zu meinem Zimmer zurück.
Als ich aufwachte, weinte sie still vor sich hin. Ihre schmalen Schultern zitterten unter der Decke. Ich zündete den Ofen an und sah auf die Uhr. Zwei Uhr früh. Mitten im Himmel hing ein vollkommen weißer Mond.
Ich wartete, bis sie aufgehört hatte zu weinen, kochte Wasser und goss uns eine Tasse Beuteltee auf. Ohne Zucker, ohne Zitrone, ohne Milch, einfach nur heißen Tee. Ich zündete zwei Zigaretten an und gab ihr eine. Sie inhalierte tief und stieß den Rauch aus. Nach drei solchen Zügen musste sie husten.
»Hast du schon mal den Wunsch gehabt, mich umzubringen?«, fragte sie.
»Dich?«
»Ja.«
»Wieso fragst du das?«
Sie rieb sich mit den Fingerspitzen die Augen, die Zigarette noch im Mund.
»Nur so.«
»Nein, hab ich nicht«, sagte ich.
»Wirklich nicht?«
»Wirklich nicht. Warum sollte ich dich unbedingt umbringen wollen?«
»Auch wieder wahr«, musste sie zugeben. »Ich dachte nur, wäre nicht schlecht, wenn mich jemand umbrächte. Wenn ich grad fest schlafe oder so.«
»Ich bin doch nicht der Typ, der Leute umbringt!«
»Nicht?«
»Ich glaube nicht.«
Sie lachte, drückte ihre Zigarette im Aschenbecher aus, trank in einem Zug den restlichen Tee und zündete sich eine neue Zigarette an.
»Ich lebe bis fünfundzwanzig«, sagte sie. »Dann sterbe ich.«
* * *
Sie starb im Juli 1978 mit sechsundzwanzig.
ZWEITES KAPITEL
Juli 1978
1. SECHZEHN SCHRITTE
Ich wartete, bis das Zischen des Kompressors, mit dem sich die Aufzugtür schließt, hinter mir zu vernehmen war, dann schloss ich die Augen. Ich kratzte die Bruchstücke meines Bewusstseins zusammen und tat sechzehn Schritte über den Hausflur auf die Wohnungstür zu. Mit geschlossenen Augen sind es genau sechzehn Schritte, nicht mehr und nicht weniger. Vom Whiskey war mein Kopf so unbrauchbar wie eine überdrehte Schraube, im Mund hatte ich Teergeschmack von den Zigaretten.
Trotzdem, egal wie besoffen ich bin, die sechzehn Schritte kann ich mit geschlossenen Augen immer noch so gerade gehen wie auf einer mit dem Lineal gezogenen Linie. Die Frucht jahrelanger sinnloser Selbstzüchtigung. Jedes Mal, wenn ich besoffen bin, nehme ich Haltung an, hebe den Kopf und atme tief die Morgenluft und den Betongeruch des Hausflurs ein. Dann schließe ich die Augen und gehe im Whiskeynebel sechzehn gerade Schritte.
In dieser Welt der Sechzehn Schritte kommt mir der Titel »Manierlichster aller Besoffenen« zu. Ganz einfach: Man muss nur die Tatsache des Besoffenseins als solche anerkennen.
Da gibt es kein »Wenn« und »Aber«, kein »Obwohl« und »Trotzdem«. Ich bin schlicht und einfach besoffen.
Auf diese Weise werde ich zum Manierlichsten aller Besoffenen. Ich werde zum allerersten Vogel am Morgen und zum allerletzten Güterwaggon, der über die Eisenbahnbrücke fährt.
Fünf, sechs, sieben …
Nach dem achten Schritt blieb ich stehen, öffnete die Augen und atmete tief ein. Leichtes Ohrensausen. Wie Seewind, der durch einen verrosteten Drahtzaun pfeift. Da fällt mir ein, am Meer bin ich schon lange nicht mehr gewesen.
24. Juli, 6.30 Uhr morgens. Die ideale Jahres- und Uhrzeit, ans Meer zu fahren. Der Strand ist noch von niemandem verdreckt. Dort, wo die Wellen anschlagen, die Spuren von Seevögeln, zerstreut wie vom Wind abgeschüttelte Tannennadeln.
Meer?
Ich begann wieder zu gehen. Komm, vergiss das Meer. Alles Schnee von gestern.
Nach dem sechzehnten Schritt blieb ich stehen und machte die Augen auf: Ich stand genau vor dem Türgriff, wie immer. Ich nahm die Zeitungen von zwei Tagen und zwei Umschläge aus dem Briefkasten und klemmte sie mir unter den Arm. Dann kramte ich meinen Schlüsselbund aus dem Labyrinth der Hosentasche und lehnte die Stirn eine Zeit lang an die kühle Eisentür, die Schlüssel in der Hand. Hinter meinem Ohr schien es leise zu klicken. Mein Körper war mit Alkohol voll gesogen wie ein Waschlappen. Verhältnismäßig klar war nur mein Bewusstsein.
Oh Mann.
Tür etwa 1/3 öffnen, Körper durchzwängen, Tür schließen. In der Diele war es still. Zu still.
Da bemerkte ich vor meinen Füßen die roten Pumps. Vertraute rote Pumps. Zwischen den verdreckten Tennisschuhen und den billigen Strandsandalen sahen sie aus wie ein vergessenes Weihnachtsgeschenk. Umhüllt von feinstaubiger Stille.
Sie saß vornübergebeugt am Küchentisch, die Stirn auf die Arme gelegt, das glatte schwarze Haar verdeckte ihr Profil. Zwischen den Haaren konnte ich ihren weißen Nacken sehen. Aus dem Ärmel ihres bedruckten Kleides, an das ich mich nicht erinnern konnte, schaute ein Träger ihres BHs heraus.
Während ich mein Jackett und die schwarze Krawatte auszog und die Armbanduhr ablegte, bewegte sie sich kein bisschen. Der Anblick ihres Rückens rief Erinnerungen wach. Erinnerungen aus der Zeit, bevor ich sie traf.
»Hallo«, versuchte ich sie anzusprechen. Das klang nicht nach mir, sondern hörte sich an, als ob jemand von irgendwo weit weg eigens herüberriefe. Wie erwartet, keine Antwort.
Sie sah aus, als ob sie schliefe, aber auch, als ob sie weinte, und außerdem, als ob sie tot wäre.
Ich setzte mich ihr gegenüber und hielt mir die Hand vor die Augen. Das helle Sonnenlicht teilte den Tisch. Ich war im Licht, sie im dünnen Schatten. Schatten ohne Farbe. Auf dem Tisch stand der Blumentopf mit der verwelkten Geranie. Draußen besprenkelte jemand die Straße. Geräusch und Geruch von Wasser auf Asphalt.
»Möchtest du Kaffee?«
Immer noch keine Antwort.
Als ich sicher war, dass keine Antwort kommen würde, stand ich auf, mahlte in der Küche Kaffeebohnen für zwei Portionen und stellte das Radio an. Dann, als das Pulver fertig war, fiel mir auf, dass ich lieber Eistee trinken würde. Mir fällt immer viel auf, wenn es zu spät ist.
Aus dem Radio plätscherte ein morgendlich harmloser Popsong nach dem anderen. Bei dieser Musik hätte man glauben können, die Welt hätte sich in den letzten zehn Jahren kein bisschen verändert. Nur die Sänger und die Titel hießen anders. Und ich war zehn Jahre älter geworden.
Das Wasser im Kessel kochte, und ich drehte das Gas ab. Ich ließ es dreißig Sekunden abkühlen und goss etwas auf das Kaffeemehl. Als das Mehl sich voll gesogen hatte und langsam aufzugehen begann, entfaltete sich ein wohliger Duft im Zimmer. Draußen waren schon ein paar Zikaden zu hören.
»Bist du seit gestern Abend da?«, fragte ich mit dem Kessel in der Hand.
Ihr Haar auf dem Tisch bewegte sich eine Idee auf und ab.
»Du hast die ganze Zeit gewartet, oder?«
Darauf antwortete sie nicht.
Durch den Wasserdampf und die starken Sonnenstrahlen wurde es im Zimmer langsam schwül. Ich schloss das Fenster über der Spüle, machte die Klimaanlage an und stellte zwei Kaffeetassen auf den Tisch.
»Trink doch«, sagte ich. Meine Stimme nahm langsam wieder ihren normalen Klang an.
»…«
»Der Kaffee tut dir bestimmt gut.«
Sie ließ volle dreißig Sekunden verstreichen, hob dann in einer langsamen, gleichmäßigen Bewegung den Kopf von der Tischplatte und starrte auf die verwelkte Geranie. Ein paar dünne Haarsträhnen klebten an ihren feuchten Wangen. Eine Aura von feuchtem Dunst umgab sie.
»Kümmer dich nicht drum«, sagte sie. »Ich wollte nicht weinen.«
Ich hielt ihr eine Packung Kleenex hin. Sie putzte sich damit lautlos die Nase und strich sich mit den Fingern umständlich die Haare aus dem Gesicht.
»Eigentlich wollte ich gehen, bevor du zurückkommst. Weil ich dich nicht treffen wollte.«
»Und hast es dir dann anders überlegt.«
»Nein. Ich hatte bloß keine Lust mehr, überhaupt noch irgendwohin zu gehen. – Aber ich geh jetzt, keine Angst.«
»Trink jedenfalls erst mal deinen Kaffee.«
Ich hörte mir den Verkehrsbericht im Radio an, schlürfte dabei meinen Kaffee und öffnete mit der Schere die zwei Briefe. Ein Möbelladen schrieb, ich bekäme 20 % Rabatt, wenn ich dort bis dann und dann Möbel kaufen würde. Das andere war ein Brief, den ich nicht lesen wollte, von jemandem, an den ich mich nicht erinnern wollte. Ich knüllte beide zusammen, warf sie in den Papierkorb und aß ein paar übrig gebliebene Käsecracker. Sie beobachtete mich, die Lippen am Tassenrand und beide Hände um die Kaffeetasse gelegt, als wolle sie sich wärmen.
»Im Kühlschrank ist Salat.«
»Salat?« Ich sah zu ihr auf.
»Tomaten mit grünen Bohnen. War nichts anderes da. Die Gurken waren schon schlecht, deshalb hab ich sie weggeworfen.«
»Ach so.«
Ich holte die blaue Schüssel aus Okinawa-Glas mit dem Salat aus dem Kühlschrank und goss die letzten fünf Milliliter Dressing, die ich noch hatte, darüber.
Die Bohnen und Tomaten schmeckten wie kalte Schatten. Auch die Cracker und der Kaffee hatten keinen Geschmack. Wahrscheinlich wegen der Morgensonne. Die Morgensonne zerlegt alles. Ich ließ den Kaffee stehen, holte eine zerdrückte Zigarette aus der Tasche, entzündete ein Streichholz an einem Heftchen, das ich mich nicht erinnern konnte, je gesehen zu haben, und steckte sie an. Die Zigarettenspitze knisterte trocken. Dann formte sich der violette Rauch in der Morgensonne zu geometrischen Mustern.
»Ich war auf einer Beerdigung. Nach der Feier bin ich nach Shinjuku gefahren und hab mich die ganze Zeit alleine betrunken.«
Von irgendwoher kam der Kater, gähnte ausgiebig und sprang mit einem Satz auf ihren Schoß. Sie kraulte ihn ein paar Mal hinter den Ohren.
»Du brauchst mir nichts zu erklären«, sagte sie. »Ich hab damit nichts mehr zu tun.«
»Ich erkläre nichts. Ich erzähle nur.«
Sie zuckte mit den Achseln und schob den BH-Träger unter ihr Kleid zurück. Ihr Gesicht war vollkommen ausdruckslos. Es erinnerte mich an die versunkene Stadt auf dem Meeresboden, die ich irgendwann mal auf einem Foto gesehen hatte.
»Eine flüchtige Bekanntschaft von früher. Jemand, den du nicht kennst.«
»So?«
Der Kater auf ihrem Schoß reckte sich ausgiebig und schnaufte.
Ich schwieg und schaute auf die brennende Zigarettenspitze.
»Todesursache?«
»Autounfall. Dreizehn Knochenbrüche.«
»Eine Frau?«
»Ja, eine Frau.«
Die Sieben-Uhr-Nachrichten und der Verkehrsbericht waren vorbei, im Radio lief wieder Softrock. Sie stellte ihre Kaffeetasse auf die Untertasse zurück und sah mir ins Gesicht.
»Wenn ich sterben würde, würdest du dich dann auch so betrinken?«
»Das Trinken hatte mit der Beerdigung gar nichts zu tun. Höchstens das erste Glas oder die ersten zwei.«
Draußen fing gerade ein neuer Tag an. Ein neuer heißer Tag. Durch das Fenster über der Spüle sah ich die Gruppe von Hochhäusern. Heute glänzten sie noch greller als sonst.
»Möchtest du was Kaltes trinken?«
Sie schüttelte den Kopf.
Ich holte mir eine gut gekühlte Dose Cola aus dem Kühlschrank und leerte sie in einem Zug.
»Sie ging mit jedem ins Bett«, sagte ich. Welch ein Nachruf: Die Verstorbene war eine Frau, die mit jedem ins Bett ging.
»Warum erzählst du mir das?«, sagte sie.
Ich wusste selbst nicht, warum.
»Jedenfalls ging sie mit jedem ins Bett, nicht wahr?«
»Genau.«
»Aber mit dir war’s was Besonderes.«
Ihre Stimme klang irgendwie anders. Ich hob den Kopf von der Salatschüssel und sah ihr über die verwelkte Geranie ins Gesicht.
»Glaubst du?«
»Ja, irgendwie«, sagte sie leise. »Du bist so ein Typ.«
»Was für ein Typ?«
»Du hast so was. Wie eine Sanduhr. Wenn der Sand durchgelaufen ist, kommt mit Sicherheit jemand, der sie umdreht.«
»Möglich wär’s.«
Ihre Lippen öffneten sich eine Spur, dann schlossen sie sich wieder.
»Ich wollte eigentlich nur den Rest meiner Sachen holen. Wintermantel, Hüte und so was. Ich hab’s in Kartons zusammengepackt. Bringst du sie bitte zum Paket-Service, wenn du mal Zeit hast?«
»Ich bring sie bei dir vorbei.«
Sie schüttelte still den Kopf.
»Lass nur. Ich will nicht, dass du kommst. Das verstehst du doch, oder?«
Sicher, sie hatte Recht. Ich rede zu viel dummes Zeug.
»Meine Adresse hast du?«
»Ja, hab ich.«
»Das war alles. Entschuldige, dass ich so lange da war.«
»Und der Schriftkram, war alles in Ordnung?«
»Ja, alles erledigt.«
»Das ging ja ruckzuck. Ich dachte, es gäb viel mehr zu tun.«
»Das denken alle beim ersten Mal. Aber es ist wirklich ganz einfach. Wenn es vorbei ist«, sagte sie und kraulte dem Kater noch einmal den Kopf. »Bei der zweiten Scheidung ist man schon ein alter Hase.«
Der Kater schloss die Augen, reckte sich einmal und legte dann sacht den Kopf auf ihren Arm. Ich stellte die Kaffeetassen und die Salatschüssel in die Spüle und kehrte mit einer Rechnung die Crackerkrümel zusammen. Vom Sonnenlicht pochten mir die Augen.
»Die Kleinigkeiten stehen alle auf dem Zettel, den ich dir auf den Schreibtisch gelegt habe. Wo die Papiere sind, wann welcher Müll abgeholt wird und so was. Wenn du irgendwas nicht findest, kannst du mich ja anrufen.«
»Danke.«
»Hättest du gern Kinder gehabt?«
»Nein«, sagte ich. »Kinder – nein.«
»Ich hab lange überlegt und konnte mich einfach nicht entscheiden. Aber wie die Dinge sich entwickelt haben, war es vielleicht besser so. Oder glaubst du, es wäre anders gekommen, wenn wir Kinder gehabt hätten?«
»Es gibt jede Menge Paare, die Kinder haben und sich trotzdem scheiden lassen.«
»Ja, das stimmt«, sagte sie und spielte eine Zeit lang mit meinem Feuerzeug. »Ich liebe dich immer noch. Aber da liegt nicht das Problem. Das weiß ich selbst gut genug.«
2. SIE, IHRE FOTOS UND IHRE UNTERRÖCKE – ALLES VERSCHWINDET
Als sie gegangen war, trank ich noch eine Cola, duschte heiß und rasierte mich. Seife, Shampoo, Rasiercreme – alles ging mir langsam, aber sicher aus.
Ich stieg aus der Dusche, trocknete mir die Haare, trug Lotion auf und putzte mir die Ohren. Dann ging ich in die Küche und wärmte den übrig gebliebenen Kaffee auf. Jetzt saß niemand mehr mit mir am Tisch. Als ich den leeren Stuhl anstarrte, fühlte ich mich wie ein kleines Kind, das man in einer sonderbaren, unbekannten Gegend, an einem Ort wie aus einem Bild von de Chirico, alleine gelassen hatte. Aber ich war natürlich kein kleines Kind mehr. Ganz langsam schlürfte ich meinen Kaffee und dachte an gar nichts. Als ich ihn schließlich ausgetrunken hatte, saß ich noch eine Zeit lang gedankenverloren da. Dann zündete ich mir eine Zigarette an.
Dafür, dass ich ganze vierundzwanzig Stunden nicht geschlafen hatte, war ich unwirklich wach. Mein Körper war zwar träge bis ins Mark, aber meine Gedanken trotteten wie dressierte Zirkustiere immer weiter ziellos durch die Irrgänge des Bewusstseins.
Während ich den leeren Stuhl anstarrte, fiel mir ein amerikanischer Roman ein, den ich vor etlichen Jahren gelesen hatte: Da ließ ein Mann, der von seiner Frau verlassen worden war, monatelang ihren Unterrock über dem Esszimmerstuhl ihm gegenüber hängen. Je länger ich darüber nachdachte, desto weniger absurd erschien es mir. Gar keine schlechte Idee. Nicht, dass ich irgendeinen Sinn darin gesehen hätte, aber es wäre bestimmt geistreicher, als den Topf mit der verwelkten Geranie stehen zu lassen. Und der Kater – es würde ihn vielleicht etwas beruhigen, wenn etwas von ihr da wäre.
Ich öffnete ihre Schubladen im Schlafzimmer, eine nach der anderen, doch alle waren leer. Ein von Motten angefressener alter Schal, drei Kleiderbügel und Mottenkugeln – das war das Einzige, was übrig geblieben war. Sie hatte alles fein säuberlich mitgenommen.
Das auf engstem Raum im Badezimmer untergebrachte Sammelsurium von Kosmetika, Lockenwicklern, Zahnbürste, Fön, Gott weiß was für Medikamenten, Tampons und Damenbinden, sämtliches Schuhwerk von Boots bis zu Sandalen und Hausschuhen, Hutschachteln, eine Schublade voll Accessoires, Hand- und Schultertaschen, Koffer, Portemonnaies, die immer sorgfältig geordnete Unterwäsche, Strümpfe, Briefe – von den Dingen, denen ihr Geruch anhaftete, hatte sie nicht ein einziges zurückgelassen. Mir war, als hätte sie sogar ihre Fingerabdrücke abgewischt. Ungefähr ein Drittel der Bücher und Schallplatten war ebenso verschwunden – die, die sie selbst gekauft oder die ich ihr geschenkt hatte.
Ich öffnete die Fotoalben: Sämtliche Aufnahmen von sich hatte sie entfernt. Bei den Bildern, auf denen wir beide zu sehen waren, hatte sie sich selbst sauber herausgeschnitten, sodass nur noch ich zurückblieb. Aufnahmen von mir alleine sowie Landschafts- und Tierfotos waren unberührt. Die drei Alben enthielten jetzt eine Bildersammlung perfekt retuschierter Vergangenheit: Immerzu ich allein, und dazwischen Berge und Flüsse und Rehe und Katzen. Mir war, als wäre ich von Geburt an mein ganzes Leben lang allein gewesen und würde auch von jetzt an immer allein bleiben. Ich klappte die Alben zu und rauchte zwei Zigaretten.
Sie hätte wenigstens einen Unterrock dalassen können! Aber das war selbstverständlich ihre Sache, ich durfte mich da nicht einmischen. Sie hatte sich entschlossen, nichts dazulassen, und ich musste mich danach richten. Oder ich musste mir, wie sie wohl beabsichtigte, einbilden, sie hätte von Anfang an nicht existiert. Und aufgrund ihrer Nicht-Existenz konnte auch ihr Unterrock nicht existieren.
Ich spülte den Aschenbecher aus, stellte Klimaanlage und Radio ab, und nachdem ich meine Gedanken noch einmal um ihren Unterrock hatte kreisen lassen, gab ich auf und ging ins Bett.
Schon ein Monat war vergangen, seit ich der Scheidung zugestimmt hatte und sie ausgezogen war. Ein Monat beinahe ohne jeden Sinn. Ein Monat wie laues Gelee, vage und substanzlos. Ich hatte nicht den Eindruck, dass sich irgendetwas verändert hätte, und es hatte sich auch nichts verändert.
Ich stand um sieben Uhr auf, schüttete Kaffee auf, toastete Toast, ging zur Arbeit, aß irgendwo zu Abend, trank zwei, drei Bier, ging nach Hause, las im Bett noch ungefähr eine Stunde, löschte das Licht, schlief. Samstags und sonntags machte ich, anstatt zur Arbeit zu gehen, von frühmorgens an meine Runden durch die Kinos, um die Zeit totzuschlagen. Danach ging ich wie immer allein zu Abend essen, trank etwas, las etwas, schlief. Ich verbrachte diesen Monat genau wie die Sorte von Menschen, die die Tage auf dem Kalender einen nach dem anderen schwarz ausstreichen.
In gewisser Weise empfand ich ihr Verschwinden als unvermeidlich. Was geschehen war, war geschehen. Es zählte nicht mehr, wie gut es in diesen vier Jahren zwischen uns gelaufen war. Genau wie bei den bereinigten Fotoalben.
Dass sie lange Zeit regelmäßig mit meinem Freund geschlafen hatte und eines Tages bei ihm eingezogen war, zählte ebenso wenig. So etwas ist immer möglich und geschieht tatsächlich oft genug, und dass es ihr passiert ist, empfand ich gar nicht als etwas Außergewöhnliches. Letzten Endes war das ihre Sache.
»Das ist letzten Endes deine Sache«, sagte ich.
Das war an jenem Sonntagnachmittag im Juni, an dem sie mir plötzlich sagte, dass sie sich scheiden lassen wolle. Ich spielte gerade mit einem Bierdosenring.
»Das ist dir also egal?«, fragte sie. Sie sprach äußerst langsam.
»Egal nicht. Ich sage nur, dass es deine Sache ist.«
»Wenn ich ehrlich sein soll, will ich mich gar nicht von dir trennen.«
»Du brauchst dich ja nicht von mir zu trennen.«
»Aber es führt zu nichts, wenn ich bei dir bleibe.«
Sie sagte nichts weiter, aber ich glaubte zu wissen, was sie meinte. In ein paar Monaten würde ich dreißig werden, sie sechsundzwanzig. Im Vergleich zu der Größe all dessen, was uns noch bevorstand, war das, was wir bis dahin aufgebaut hatten, in der Tat winzig klein. Beziehungsweise gleich null. Wir hatten die vier Jahre damit verbracht, unsere Ersparnisse zu verfressen.
Zum großen Teil war es meine Schuld. Ich hätte nicht heiraten sollen. Zumindest nicht sie.
In der ersten Zeit hielt sie sich nicht für gesellschaftsfähig, mich dagegen für gesellschaftsfähig. Wir beide spielten unsere Rollen verhältnismäßig gut. Doch in dem Moment, da wir beide dachten, dass es ewig so weiterginge, zerbrach irgendetwas. Eine Winzigkeit nur, aber es wurde nie mehr so wie früher. Wir befanden uns mitten in einer idyllisch verlängerten Sackgasse. Das war unser Ende.
Für sie war ich jemand, den sie schon verloren hatte. Auch wenn sie mich noch geliebt hätte, es hätte nichts daran geändert. Wir hatten uns zu sehr an unsere Rollen gewöhnt. Ich konnte ihr nichts mehr geben. Sie wusste das instinktiv, ich aus Erfahrung. Wie auch immer, es gab keine Rettung mehr.
Also verschwand sie zusammen mit ihren Unterröcken für immer aus meinem Leben. Es gibt drei Möglichkeiten: Vergessenwerden, Verschwinden und Sterben. Und das ist nicht einmal überaus tragisch.
24. Juli, 08.25 Uhr morgens.
Ich sah auf die vier Ziffern der Digitaluhr, schloss die Augen und schlief ein.
DRITTES KAPITEL
September 1978
1. DER WALPENIS UND DIE FRAU MIT DEN DREI BERUFEN
Mit einer Frau schlafen kann man für ungeheuer wichtig halten oder, umgekehrt, für nichts Besonderes. Es gibt sozusagen Sex als Selbsttherapie und Sex als Zeitvertreib.
Es gibt solchen, der von A bis Z Selbsttherapie ist, und solchen, der von A bis Z Zeitvertreib ist. Außerdem gibt es Sex, der als Selbsttherapie anfängt und als Zeitvertreib endet, und umgekehrt. Was ich sagen will, ist, dass sich unser Sexualleben grundsätzlich von dem eines Wals unterscheidet.
Wir sind keine Wale – eine überaus wichtige These für mein Sexualleben.
* * *
In meiner Jugend gab es ungefähr dreißig Fahrradminuten von zu Hause entfernt ein Ozeanarium. Es herrschte dort immer kühle Aquariumsstille, nur von Zeit zu Zeit hörte man von irgendwoher dumpfes Wasserplatschen. Es war, als unterdrückte in einem Winkel der halbdunklen Gänge ein Wassermann das Atmen.
Thunfischzüge kreisten in einem riesigen Becken, Störe schwammen einen engen Kanal entlang, Piranhas schlugen ihre scharfen Zähne in Fleischklumpen, Zitteraale brachten hin und wieder winzig kleine Glühbirnchen zum Leuchten.
Es gab dort unzählige Fische. Alle hatten sie andere Namen, andere Schuppen und andere Kiemen. Ich begriff überhaupt nicht, warum es auf der Welt so viele Arten von Fischen geben musste.
Natürlich hatten sie dort keinen Wal. Ein Wal wäre viel zu groß gewesen, und selbst wenn man das Gebäude abgerissen und in ein einziges riesiges Wasserbecken verwandelt hätte, hätte man keinen halten können. Stattdessen war der Penis eines Wals ausgestellt. Als Ersatz sozusagen. Deshalb sah ich also während meiner sensiblen Jugendjahre anstelle eines richtigen Wals einen Walpenis. Immer, wenn ich genug hatte vom Spazieren in den kühlen, aquariumähnlichen Gängen, setzte ich mich auf das Sofa in der Halle mit der hohen Decke, wo absolute Stille herrschte, und verbrachte gedankenverlorene Stunden vor dem Walpenis.
Einmal sah er aus wie eine vertrocknete kleine Kokospalme, ein anderes Mal wie ein überdimensionaler Maiskolben. Wenn das Schild mit der Aufschrift »Geschlechtsorgan eines Wals, männl.« nicht gewesen wäre, hätte sicher niemand bemerkt, dass es sich um einen Walpenis handelte. Er wirkte nicht wie ein Produkt der Antarktis, eher wie ein Fundstück von Ausgrabungen in der Wüste Zentralasiens. Er unterschied sich von meinem und auch von allen anderen Penissen, die ich bis dahin gesehen hatte. Außerdem umgab ihn diese gewisse, schwer zu beschreibende Melancholie, die abgeschnittenen Penissen eigen ist.
Dieser riesige Walpenis war es, der mir einfiel, nachdem ich zum ersten Mal mit einer Frau Geschlechtsverkehr gehabt hatte. Mir tat die Seele weh, wenn ich daran dachte, welches Schicksal ihn ereilt hatte und unter welchen Umständen er in den verlassenen Ausstellungsraum des Ozeanariums gekommen war. Diese Gedanken gaben mir ein Gefühl vollkommener Hilflosigkeit. Aber mit siebzehn war ich eindeutig zu jung, um an der Welt zu verzweifeln. Deshalb kam ich damals zu folgendem, bis heute gültigen Schluss: Ich bin kein Wal.
Während ich mit meiner neuen Freundin im Bett lag und mit ihrem Haar spielte, musste ich ständig an den Wal denken.
In meinen Erinnerungen an das Ozeanarium ist es immer Herbstende. Das Glas der Becken ist eiskalt, und ich habe einen dicken Pullover an. Das Meer, das man durch das große Fenster im Ausstellungsraum sehen kann, ist bleischwarz, und die unzähligen weißen Wellen erinnern an weiße Spitzenkragen auf Mädchenkleidern.
»Woran denkst du?«, fragte sie.
»An früher«, sagte ich.
* * *
Sie war einundzwanzig, hatte einen attraktiven, schlanken Körper und ein Paar makellose Ohren von fast magischer Anziehungskraft. Sie jobbte als Korrektorin in einem kleinen Verlag, war Ohren-Fachmodell für Werbefotos sowie Callgirl in einem exklusiven Privatclub. Ich wusste nicht, welcher von den dreien ihr Hauptberuf war. Sie auch nicht.
Betrachtet man das Problem jedoch unter dem Gesichtspunkt, welcher Beruf ihrer eigentlichen Erscheinung entgegenkam, so wirkte sie als Ohren-Fachmodell am natürlichsten. Sie stimmte mir in dieser Einschätzung zu. Aufträge in diesem Spezialbereich sind jedoch äußerst begrenzt, und Status und Lohn als Modell sind erschreckend gering. Die meisten Agenten, Kameraleute, Kosmetikerinnen und Journalisten behandelten meine Freundin einfach als »die mit den Ohren«. Mit Ausnahme der Ohren wurden ihr Körper und ihr Geist vollkommen ignoriert.
»Aber das stimmt nicht«, sagte sie. »Meine Ohren, das bin ich, und ich bin meine Ohren.«
Als Korrektorin und als Callgirl zeigte sie ihre Ohren keinem Menschen, nicht einen einzigen Augenblick.
»Weil ich dann nämlich nicht wirklich ich bin«, erklärte sie.
Das Büro des Callgirl-Clubs (der unter dem Namen »Talentschuppen« lief) befand sich in Akasaka. Besitzerin war eine grauhaarige Engländerin, die von allen »Mrs. X« genannt wurde. Sie lebte schon seit dreißig Jahren in Japan, sprach fließend Japanisch und konnte fast alle wichtigen Schriftzeichen lesen.
Nur fünfhundert Meter vom Club entfernt betrieb Mrs. X noch ein Damenseminar für englische Konversation, aus dem sie vielversprechende Mädchen als Callgirls rekrutierte. Umgekehrt nahmen auch einige der Girls Englischunterricht. Natürlich zu ermäßigten Gebühren.
Mrs. X sprach alle Callgirls mit »Dear« an. Weich wie ein Frühlingsnachmittag, so klang ihr »Dear«.
Etwa so: »Zieh dir ordentliche Spitzenunterwäsche an, Dear. Und Strümpfe, auf keinen Fall Strumpfhosen!« Oder: »Du trinkst deinen Tee doch mit Sahne, Dear, nicht wahr?« Ihre Kundschaft hatte sie fest im Griff, die meisten waren reiche Geschäftsleute in ihren Vierzigern und Fünfzigern. Zwei Drittel waren Ausländer, der Rest Japaner. Mrs. X hatte eine Abneigung gegen Politiker, Greise, Perverse und Mittellose.
Meine neue Freundin sah von dem guten Dutzend Schönheiten im Callgirl-Club am unauffälligsten und durchschnittlichsten aus. Mit verdeckten Ohren machte sie in der Tat lediglich einen mittelmäßigen Eindruck auf andere Leute. Warum sie Mrs. X aufgefallen war und warum sie sie eingestellt hatte, war mir nicht ganz klar. Vielleicht, weil Mrs. X einen gewissen Glanz in ihrer Durchschnittlichkeit bemerkt hatte, oder auch, weil sie ganz einfach der Meinung war, dass ruhig ein durchschnittliches Mädchen mit in der Auswahl sein sollte. Wie auch immer, Mrs. X’ Rechnung ging auf, und meine Freundin hatte bald ebenfalls einige richtige Stammkunden. Sie trug durchschnittliche Kleidung, schminkte sich durchschnittlich, zog durchschnittliche Unterwäsche an, roch nach durchschnittlicher Seife und ging ein- oder zweimal pro Woche ins Hilton, ins Okura oder ins Prince, um mit einem Mann zu schlafen und damit so viel zu verdienen, dass sie einen Monat davon leben konnte.
Die Hälfte der übrigen Abende verwandte sie dazu, kostenlos mit mir zu schlafen. Wie sie die andere Hälfte verbrachte, weiß ich nicht.
Ihr Leben als Aushilfskorrektorin in dem Verlag war noch durchschnittlicher. An drei Tagen der Woche ging sie in die Firma im zweiten Stock eines kleinen Gebäudes in Kanda und korrigierte von morgens neun bis abends fünf Druckfahnen, machte Tee oder stieg die Treppen hinunter (einen Aufzug gab es nämlich nicht), um Radiergummis oder Ähnliches zu kaufen. Sie war zwar die einzige junge, unverheiratete Frau dort, aber niemand machte ihr je Avancen. Sie konnte je nach Ort und Zeit ihren Glanz entfalten oder unterdrücken, ganz wie ein Chamäleon.
* * *
Ich begegnete ihr (beziehungsweise ihren Ohren) Anfang August, kurz nachdem meine Frau und ich uns getrennt hatten. Ich hatte gerade über eine Werbeagentur einen Auftrag für eine Software-Firma bekommen, da traf ich zum ersten Mal auf ihre Ohren.
Der Direktor der Agentur legte den Werbeplan und einige große Schwarzweißaufnahmen auf den Schreibtisch und sagte, ich solle dafür innerhalb einer Woche drei verschiedene Schlagzeilen vorbereiten. Alle drei Fotos zeigten riesige Ohren.
Ohren?
»Warum Ohren?«, fragte ich.
»Was weiß ich! Es sind nun mal Ohren. Sie haben nichts weiter zu tun, als eine Woche über Ohren nachzudenken!«
Also verbrachte ich eine Woche damit, auf die drei Fotos mit den Ohren zu starren. Ich hatte die riesigen Aufnahmen mit Tesafilm an die Wand vor meinem Schreibtisch geklebt, und beim Rauchen, beim Kaffeetrinken, beim Sandwichessen und beim Nägelschneiden sah ich sie an.
Eine Woche später hatte ich den Auftrag irgendwie erledigt, aber die Fotos blieben weiter an der Wand. Einerseits, weil ich zu faul war, sie abzunehmen, andererseits, weil es mir zur Gewohnheit geworden war, die Fotos mit den Ohren vor mir zu sehen. Aber eigentlich nahm ich sie deshalb nicht ab und ließ sie deshalb nicht in einer Schublade verschwinden, weil die Ohren mich in verschiedenster Weise bezaubert hatten. Diese Ohren waren ein Traum! Hundertprozentige Ohren – und das ist wahrlich nicht übertrieben. Es war das erste Mal, dass mich ein vergrößerter Teil des menschlichen Körpers (die Geschlechtsorgane selbstverständlich eingeschlossen) derartig stark faszinierte. Sie ließen mich unweigerlich an riesige Strudel des Schicksals denken.
Eine Windung kreuzte mit schier unvorstellbarer Kühnheit die ganze Fläche des Bildes, eine andere schuf mit geheimnisvoller Sorgfalt kleine Schattierungen, und wieder eine andere erzählte die zahllosen Legenden eines antiken Wandgemäldes. Die Ebenheit der Ohrläppchen übertraf noch den Schwung der Windungen, und vor der üppigen Fülle ihres Fleisches verblasste alles Leben.
Einige Tage später beschloss ich, den Fotografen anzurufen, der die Bilder gemacht hatte, um mir Namen und Telefonnummer der Ohrenbesitzerin geben zu lassen.
»Wozu?«, fragte der Fotograf.
»Interessiert mich einfach. Sind halt tolle Ohren.«
»Die Ohren schon, das stimmt«, brummte der Fotograf. »Aber die Frau haut einen nicht gerade vom Hocker. Es gibt bessere – zum Beispiel das Bikinimodell, das ich vor kurzem vor der Linse hatte. Ich könnte da was arrangieren.«
»Nein, danke«, sagte ich und legte auf.
* * *
Ich rief sie um zwei, um sechs und um zehn Uhr an, aber niemand meldete sich. Sie schien ein geschäftiges Leben zu führen.
Am nächsten Morgen um zehn erwischte ich sie endlich. Ich stellte mich knapp vor und erzählte ihr dann, ich müsse kurz mit ihr über die Werbefotos sprechen, die sie kürzlich gemacht hätte, ob wir nicht mal gemeinsam zu Abend essen könnten.
»Man sagte mir, die Arbeit sei für mich erledigt«, sagte sie.
»Ja, ist sie auch«, sagte ich. Sie schien etwas überrascht zu sein, fragte aber nicht weiter. Wir verabredeten uns für den nächsten Abend in einem Café auf der Aoyamadori.
Ich rief das beste französische Restaurant an, das ich je besucht hatte, und bestellte einen Tisch. Dann schlüpfte ich in ein neues Hemd, verwandte viel Zeit darauf, eine Krawatte auszuwählen, und zog einen Anzug an, den ich erst zweimal getragen hatte.
Wie der Fotograf vorgewarnt hatte, haute sie einen wirklich nicht gerade vom Hocker. Durchschnittliche Kleidung, durchschnittliches Gesicht – sie sah aus wie eine Chorsängerin einer zweitklassigen Frauenuniversität. Aber das war mir natürlich völlig gleich. Was mich enttäuschte, war, dass sie ihre Ohren unter den glatt herabhängenden Haaren völlig verborgen hielt.
»Sie verbergen ja Ihre Ohren«, bemerkte ich beiläufig.
»Ja«, erwiderte sie ebenso beiläufig.
Wir hatten das Restaurant früher als erwartet erreicht und waren die ersten Gäste. Man dämpfte das Licht, und ein Kellner ging herum, um mit langen Zündhölzern die roten Kerzen auf den Tischen anzuzünden. Der Oberkellner inspizierte mit einer Art Heringsblick bis ins Kleinste die Anordnung der Servietten, des Bestecks und der Teller. Das im Fischgrätenmuster verlegte Eichenparkett war auf Hochglanz poliert. Angenehm klapperten darauf die Kellnerschuhe – Schuhe, die bedeutend teurer aussahen als meine. Die Blumen in den Vasen waren frisch, und an den weißen Wänden hing Modern Art – Gemälde, die man auf den ersten Blick als Originale erkennen konnte.
Ich wählte aus der Weinkarte einen fruchtig-frischen Weißwein und bestellte als Hors d’œuvres Pâté de canard, Terrine de daurade und Foie de baudroie à crème fraîche. Sie entschied sich nach sorgfältigem Studium der Speisekarte für Potage à la tortue, Salade verte und Mousse de sole, ich bestellte Soupe d’oursin, Rôti de veau garnie de persil und Salade de tomates. Und sah mein Haushaltsgeld für einen halben Monat von dannen ziehen.
»Ziemlich gutes Restaurant«, sagte sie. »Kommen Sie oft hierher?«
»Nur geschäftlich von Zeit zu Zeit. Alleine gehe ich lieber in Kneipen. Ich esse dann beim Trinken, was gerade so angeboten wird. Das ist bequemer. Man braucht nicht lange zu überlegen.«
»Was essen Sie denn so in Ihren Kneipen?«
»Das ist verschieden, aber meistens Omelette und Sandwiches.«
»Omelette und Sandwiches«, sagte sie. »Sie essen also jeden Tag in einer Kneipe Omelette und Sandwiches?«
»Nicht jeden Tag. Alle drei Tage koche ich selbst.«
»Aber an zwei von drei Tagen essen Sie in einer Kneipe Omelette und Sandwiches.«
»Ja«, sagte ich.
»Warum gerade Omelette und Sandwiches?«
»In guten Kneipen gibt es hervorragende Omelettes und Sandwiches.«
»Mhm«, sagte sie. »Sie sind schon ein merkwürdiger Mensch.«
»Überhaupt nicht«, sagte ich.
Da ich nicht wusste, wie ich das Thema wechseln sollte, schwieg ich eine Weile und sah auf die Asche im Aschenbecher.
Sie kam zur Sache: »Sie wollten doch geschäftlich mit mir sprechen.«
»Wie ich gestern schon sagte, ist Ihre Arbeit bereits abgeschlossen. Schwierigkeiten gibt es auch nicht. Es gibt also nichts zu besprechen.«
Sie nahm aus dem Seitenfach ihrer Handtasche eine schlanke Mentholzigarette, zündete sie mit den Restaurantstreichhölzern an und schaute mich an, als wolle sie sagen »Und, weiter?«
Als ich gerade ansetzen wollte, kam sicheren Schrittes der Oberkellner auf unseren Tisch zu. Er lächelte, als hätte er vor, mir das Foto seines einzigen Sohnes zu zeigen, hielt mir das Etikett der Weinflasche hin, und als ich nickte, entkorkte er sie angenehm leise, um mir dann ein wenig einzugießen. Es schmeckte wie die Quintessenz der Rechnung.
Kaum hatte sich der Oberkellner zurückgezogen, kamen zwei andere Kellner und brachten drei große und zwei kleine Teller. Als auch sie verschwanden, waren wir wieder allein.
»Ich wollte unbedingt Ihre Ohren sehen«, sagte ich ehrlich.
Ohne etwas zu sagen, nahm sie sich von der Pastete und der Seeteufelleber und trank einen Schluck Wein.
»Fühlen Sie sich belästigt?«
Sie lächelte ein bisschen. »Köstliche französische Küche ist keine Belästigung.«
»Stört es Sie, auf Ihre Ohren angesprochen zu werden?«
»Auch nicht. Kommt darauf an, von welcher Warte aus darüber gesprochen wird.«
»Ich nehme die, die Sie mögen.«
Sie schüttelte den Kopf, während sie die Gabel zum Mund führte. »Seien Sie ehrlich. Das ist mir die liebste Warte.«
Wir tranken eine Zeit lang schweigend unseren Wein und aßen weiter.
»Ich biege um eine Ecke«, sagte ich. »Aber die Person, die vor mir geht, verschwindet schon um die nächste. Ich kann sie nicht sehen. Das Einzige, was ich flüchtig erblicke, ist der weiße Saum ihres Gewandes. Aber gerade die Weißheit dieses Saumes brennt mir immer weiter in den Augen, ich werde sie nicht los. Kennen Sie dieses Gefühl?«
»Ich glaube schon.«
»Genau dieses Gefühl vermitteln mir Ihre Ohren.«
Wieder aßen wir eine Weile schweigend. Ich schenkte ihr Wein nach und goss mir auch etwas ein.
»Die Szene an sich schwebt Ihnen nicht vor Augen, es ist nur ein Gefühl, nicht wahr?«, fragte sie.
»Ja, genau.«
»Hatten Sie dieses Gefühl früher schon einmal?«
Ich dachte einen Augenblick nach und schüttelte dann den Kopf. »Nein.«
»Aber es ist wegen meiner Ohren?«
»Mit absoluter Sicherheit kann ich das nicht sagen. Absolut sicher ist man ja nie. Dass das Aussehen von Ohren bei irgendjemandem regelmäßig dieses bestimmte Gefühl hervorgerufen hätte, habe ich auch noch nie gehört.«
»Ich kenne jemanden, der immer niesen muss, wenn er Farrah Fawcett-Majors Nase sieht. Beim Niesen ist dieser psychische Faktor enorm. Sobald Ursache und Wirkung einmal verbunden sind, sind sie nur schwer wieder zu trennen.«
»Über Farrah Fawcett-Majors Nase kann ich zwar nichts sagen«, begann ich und trank einen Schluck Wein. Dann hatte ich vergessen, was ich sagen wollte.
»Es ist nicht genau das, was Sie meinten, nicht?«, sagte sie.
»Ja, die Sache liegt ein bisschen anders«, sagte ich. »Das Gefühl, das ich bekomme, ist ausgesprochen vage und trotzdem stabil.« Ich breitete meine Arme aus, sodass die Hände zirka einen Meter Zwischenraum hatten, und ließ diesen dann auf fünf Zentimeter zusammenschrumpfen. »Ich kann es nicht gut beschreiben.«
»Ein auf vagen Motiven beruhendes, konzentriertes Phänomen.«
»Genau«, sagte ich. »Sie sind etwa siebenmal klüger als ich.«
»Ich hab an einer Fernuni studiert.«
»Fernuni?«
»Ja, Fernstudium: Psychologie.«
Wir teilten uns das letzte Stück Pastete. Ich hatte schon wieder vergessen, was ich sagen wollte.
»Sie können den Zusammenhang zwischen meinen Ohren und Ihrem Gefühl noch nicht ganz begreifen, nicht wahr?«
»Nein«, sagte ich. »Ich kann nicht eindeutig erkennen, ob es unmittelbar Ihre Ohren sind, die mich ansprechen, oder aber irgendetwas anderes, mit Ihren Ohren als Medium.«
Sie bewegte, beide Hände auf dem Tisch, kaum merklich ihre Schultern. »Ihr Gefühl, ist es von der guten oder von der schlechten Sorte?«
»Weder noch. Sowohl als auch. Ich weiß nicht.«
Sie hielt mit beiden Händen ihr Weinglas und sah mich eine Weile an. »Sie sollten lernen, Ihre Gefühle etwas besser auszudrücken.«
»Und ausdrücken kann ich mich auch nicht«, sagte ich.
Sie lächelte. »So schlimm ist es auch wieder nicht. Ich habe im Großen und Ganzen verstanden, was Sie meinen.«
»Und, was soll ich nun tun?«
Sie schwieg. Sie schien an etwas anderes zu denken. Auf dem Tisch standen fünf leere Teller. Fünf untergegangene Planeten.
»Hören Sie«, unterbrach sie ihr langes Schweigen. »Ich denke, wir sollten Freunde werden. Vorausgesetzt natürlich, Sie sind einverstanden.«
Ich nickte.
Auf diese Weise wurden wir sehr, sehr enge Freunde. Nur dreißig Minuten, nachdem wir uns das erste Mal gesehen hatten.
* * *
»Als enger Freund möchte ich dich etwas fragen«, sagte ich.
»Bitte.«
»Erstens: Warum zeigst du deine Ohren nicht? Und zweitens: Haben deine Ohren jemals auf jemand anderen als mich eine besondere Wirkung ausgeübt?«
Sie starrte wortlos ihre Hände auf dem Tisch an.
»Dazu gibt es viel zu sagen«, sagte sie leise.
»Viel?«
»Ja. Aber vereinfacht ausgedrückt, läuft es darauf hinaus, dass ich mich an das Selbst gewöhnt habe, das seine Ohren verbirgt.«
»Willst du damit sagen, dass du anders bist, wenn du deine Ohren zeigst, als wenn du sie verdeckst?«
»Ja.«
Zwei Kellner räumten unsere Teller ab und trugen die Suppe auf.
»Willst du mir nicht von dem Du erzählen, das seine Ohren zeigt?«
»Es fällt mir schwer, darüber zu reden; es liegt schon so lange zurück. Um ehrlich zu sein: Ich habe meine Ohren nicht mehr gezeigt, seit ich zwölf war.«
»Aber du zeigst sie doch, wenn du als Modell arbeitest?«
»Das stimmt«, sagte sie. »Aber das sind nicht meine echten Ohren.«
»Nicht deine echten Ohren?«
»Es sind blockierte Ohren.«
Ich aß zwei Löffel Suppe und sah dann zu ihr auf. »Das musst du mir bitte etwas genauer erklären.«
»Blockierte Ohren sind tote Ohren. Ich töte sie ab. Das heißt, ich trenne bewusst die Verbindung zwischen mir und meinen Ohren … verstehst du?«
Nein, ich verstand nicht.
»Dann frag«, sagte sie.
»Die Ohren abtöten, bedeutet das, dass sie dann nicht mehr hören können?«
»Doch, sie hören noch ausgezeichnet. Aber sie sind tot. Du kannst das sicher auch.«
Sie legte den Löffel auf den Tisch, richtete sich kerzengerade auf, hob beide Schultern etwa fünf Zentimeter und schob ihr Kinn energisch nach vorn. So verharrte sie zehn Sekunden und ließ dann ganz plötzlich ihre Schultern fallen.
»Jetzt sind sie tot. Versuchs mal.«
Langsam wiederholte ich dreimal genau, was sie gemacht hatte, aber ich bekam nicht den Eindruck, dass irgendetwas gestorben wäre. Nur der Wein stieg mir schneller zu Kopf.
»Ich fürchte, meine Ohren können nicht richtig sterben«, sagte ich enttäuscht.
Sie schüttelte den Kopf.
»Das macht nichts. Da es für dich nicht notwendig ist, bringt es dir keine Nachteile, wenn du sie nicht abtöten kannst.«
»Darf ich noch etwas fragen?«
»Ja, sicher.«
»Wenn ich zusammenfassen darf, was du mir erzählt hast, kommt für mich Folgendes dabei heraus: Bis zum Alter von zwölf Jahren hast du deine Ohren gezeigt. An einem bestimmten Tag hast du sie dann verdeckt und bis heute kein einziges Mal mehr freigemacht. Bei Gelegenheiten, wo du nicht umhin kannst, deine Ohren zu zeigen, blockierst du den Durchgang zwischen ihnen und deinem Bewusstsein. Das stimmt doch?«
Sie lächelte. »Ja, so ist es.«
»Was passierte mit deinen Ohren, als du zwölf warst?«
»Nicht so schnell«, sagte sie, streckte ihre rechte Hand über den Tisch und berührte sanft die Finger meiner linken. »Bitte!«
Ich verteilte den Rest des Weines auf unsere Gläser und trank meins langsam aus.
»Zuerst will ich mehr über dich wissen.«
»Was willst du denn wissen?«
»Alles. Wie du aufgewachsen bist, wie alt du bist, was du machst und so weiter.«
»Meine Geschichte ist ganz gewöhnlich. So gewöhnlich, dass du garantiert beim Zuhören einschläfst.«
»Ich mag gewöhnliche Geschichten.«
»Meine ist von der Sorte gewöhnlich, die niemand mag.«
»Das macht nichts, erzähl schon – nur zehn Minuten.«