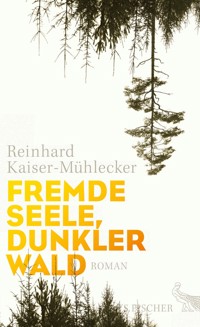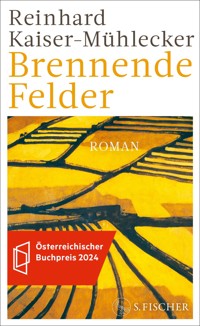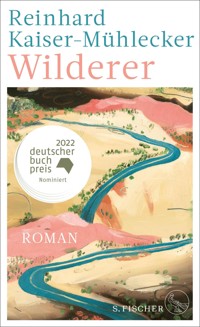
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jakob führt den Hof der Eltern und kämpft gegen den Niedergang. Als die Künstlerin Katja sich als Praktikantin anbietet, scheinen sich die Dinge zum Guten zu wenden. Gemeinsam bauen sie eine biologische Tierhaltung auf, sie heiraten und bekommen einen Sohn. Doch Jakob findet keine Ruhe, sein grausamer Zorn bricht immer wieder hervor. Hat Katja ihn getäuscht, hat sie nur mal einen wie ihn haben wollen, einen Bauern? Reinhard Kaiser-Mühlecker erzählt in seinem Roman »Wilderer« von Herkunft und existenzieller Verlorenheit in einer Welt, die sich radikal wandelt. »Vom ersten bis zum letzten Satz bannend zu lesen.« Ursula März, Die Zeit »Wie durchs dichte Unterholz geht man durch diesen Roman. Man wird ihn nicht schnell los. Er wildert noch lange in einem herum.« Elmar Krekeler, Welt am Sonntag »Ein Buch von leiser Wucht, ein Bauern- und Heimatroman, wie er moderner, eindrücklicher, illusionsloser nicht sein könnte.« Andreas Wirthensohn, Wiener Zeitung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 391
Veröffentlichungsjahr: 2022
Sammlungen
Ähnliche
Reinhard Kaiser-Mühlecker
Wilderer
Roman
Über dieses Buch
Jakob führt den Hof der Eltern und kämpft gegen den Niedergang. Als die Künstlerin Katja sich als Praktikantin anbietet, scheinen sich die Dinge zum Guten zu wenden. Gemeinsam bauen sie eine biologische Tierhaltung auf, sie heiraten und bekommen einen Sohn. Doch Jakob findet keine Ruhe, sein grausamer Zorn bricht immer wieder hervor. Hat Katja ihn getäuscht, hat sie nur mal einen wie ihn haben wollen, einen Bauern?
Reinhard Kaiser-Mühlecker erzählt von Herkunft und existentieller Verlorenheit in einer Welt, die sich radikal wandelt.
»Ich sehe es wirklich als eine Art Verpflichtung an, die Welt, die ich kenne, darzustellen, also erfahrbar zu machen – einem, der sie nicht kennt.« Reinhard Kaiser-Mühlecker
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Reinhard Kaiser-Mühlecker Reinhard Kaiser-Mühlecker wurde 1982 in Kirchdorf an der Krems geboren und wuchs in Eberstalzell, Oberösterreich, auf. Er studierte in Wien und betreibt eine Landwirtschaft. »Ich sehe es als eine Art Verpflichtung an, die Welt, die ich kenne, erfahrbar zu machen – einem, der sie nicht kennt.« Sein Debütroman »Der lange Gang über die Stationen« erschien 2008, seitdem zahlreiche weitere Romane und Erzählungen. Der Roman »Fremde Seele, dunkler Wald« stand 2016 auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. »Wilderer« wurde mit dem Bayerischen Buchpreis 2022 ausgezeichnet und war für den Deutschen Buchpreis und den Österreichischen Buchpreis nominiert. Für seinen Roman »Brennende Felder« erhielt Reinhard Kaiser-Mühlecker den Österreichischen Buchpreis 2024.«
Impressum
Originalausgabe
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2022 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Andreas Heilmann und Gundula Hissmann, Hamburg
Coverabbildung: © Grace Helmer/Bridgeman Images
ISBN 978-3-10-491454-1
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Motto]
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
Der Mond bleibt nicht immer hinter der Wolke.
Persisches Sprichwort
1
Es dämmerte; konnte kaum später als vier Uhr Früh sein. Für einen Moment dachte er, es könnte doch später sein, ein trüber, verhangener Tag, aber der Wetterbericht hatte keine Veränderung der seit Wochen anhaltenden Hochdrucklage vorhergesagt. In dem Dämmerlicht, das in seinem Zimmer herrschte, war ein Flackern, war ungreifbare Bewegung, weil die Blätter der Linde, die bis ans Fenster reichten, sich rührten; es ging ein leichter Wind – vielleicht also doch ein Wetterumschwung, der sich schließlich auch zu so früher Stunde ankündigen konnte? Diese Eindrücke schoben sich schemenhaft durch seinen Kopf, als kämen sie von weither und hätten nichts mit ihm zu tun. Und auch, dass er die Nachtkästchenlade aufzog und hineingriff, war wie losgelöst von ihm. Er drehte nicht einmal den Kopf, sah nicht einmal hin. Das Metall war nur wenig kalt. Angenehm, beruhigend fühlte es sich an, auch als es gegen seine Schläfe drückte. Er hielt die Luft an, spannte den Finger an und betätigte den Abzug.
»Klack«, machte es. Ein leeres, langweiliges Geräusch, und er stieß die angehaltene Luft wieder aus. Wie war das möglich? Seit Jahr und Tag immer nur dieses Geräusch. Es war im Grunde unmöglich, so unmöglich, als falle bei einem Würfel, wie oft man ihn auch warf, niemals die Sechs, oder niemals die Eins, niemals eine bestimmte Augenzahl, niemals die, auf die man wartete. Er seufzte, nahm den Revolver von seiner Schläfe, drehte die Trommel ein paarmal und legte die Waffe in die Lade zurück, ohne sie zuzuschieben.
Es war Ende Juli, endlich trocken, endlich heiß nach dem verregneten, kühlen Frühjahr; er könnte aufstehen, es gab Arbeit genug, und er war auch nicht mehr müde, obwohl er erst nach Mitternacht ins Bett gegangen war, aber er wollte nicht. Das Geräusch ging ihm nach, dieses leere, langweilige Geräusch, das ihn sein halbes Leben schon begleitete, ja das das Geräusch seines Lebens geworden war. Mit elf oder zwölf hatte er in einer alten Tasche unter dem Dach den Revolver gefunden, der dem Großvater gehört haben musste und in dem eine einzige Patrone gesteckt war. Vom ersten rascheren Herzschlag an schien sie ihm für ihn, für niemanden als ihn bestimmt zu sein. Alle paar Wochen, höchstens Monate wieder dieses leere, langweilige, zermürbende Geräusch: Klack … Dass ihn jemand ertappen könnte, befürchtete er nicht; seit er das obere Zimmer, das früher dasjenige seines Bruders gewesen war, bezogen hatte, betrat niemand es mehr. Und selbst wenn ihn je einer dabei erwischt hätte: Es hätte ihn nicht gekümmert, es wäre fast nicht wahr gewesen, fast nicht wirklich, weder für ihn noch für den anderen.
Als seien bis zu diesem Zeitpunkt seine Ohren vom Schlaf verschlossen, zugestöpselt, versiegelt gewesen, drang erst jetzt das Dröhnen von der Autobahn an ihn heran, und er hörte, wie die Zweige der Linde an der Scheibe rieben, ein Schaben, von Zeit zu Zeit ein Quietschen, und von unten das Schnarchen der Hündin. Alles Gewöhnliche nahm er erst jetzt wahr, davor war es ihm nicht eigens aufgefallen, weil einem das Gewohnte, täglich Gleiche kaum je einmal auffällt und weil jene Empfindung, die ihn in die Schublade hatte greifen lassen, die Verbindung zur Welt unterbrochen hatte. Etwas hatte sie wieder hergestellt. Nicht das leere Klacken; und auch nicht, dass die Empfindung gewichen wäre. Es hatte sich in das Gewohnte etwas gemischt, das er nicht zuordnen konnte; ein Geräusch, als kratze etwas über Stein, und als es abbrach, hatte er immer noch keine Vorstellung davon, was es sein konnte, stellte lediglich fest, dass nun auch die Schnarchlaute aufgehört hatten. Er richtete sich auf und warf die Decke zurück. Warum war sie aufgewacht? Machte der Vater den Platz sauber? In dem Moment ging die Haustür auf, und tatsächlich war die Stimme des Vaters zu vernehmen, bevor sie wieder verstummte. Jakob lauschte; da hörte er Landas Klauen auf den Fliesen des Vorhauses.
»Scheiße«, sagte er.
Er sprang auf, lief durch das Zimmer, riss die Tür auf und stürzte die Treppe hinab und lief durch den Flur ins Vorhaus.
»Nau«, sagte der Vater, der dort, das Handy in der Hand, herumstand. »Nau, Jakob!«
Jakob fasste nach der neben der Tür hängenden Leine und rannte hinaus. Fast stolperte er über den Mistschaber, der auf dem Boden lag; daneben ein kleiner Haufen Erde.
»He«, rief der Vater ihm hinterher. »Zieh dir doch erst mal was an!«
Instinktiv schlug Jakob die Richtung zum Bach ein, und tatsächlich entdeckte er Landa bald; sie stand auf der Wiese und krümmte sich. Er wurde langsamer. Vielleicht war sie ja doch nur deshalb rausgelaufen und würde gleich zurückkommen.
»Landa«, rief er, außer Atem, obwohl er nur ein kurzes Stück gerannt war, »Landa, komm!«
Die Hündin richtete sich auf und blickte zu ihm hin, ganz kurz, dann duckte sie sich weg, als geriete sie schon so aus Jakobs Blickfeld, als würde sie dadurch unsichtbar, und trabte in die entgegengesetzte Richtung davon. Jakob schlang sich die Leine um die Hüfte und verknotete sie vor dem Bauch. In einer Mischung aus Laufen und Schleichen folgte er der Hündin; er sah, wie sie unter der Autobahnbrücke durch- und an den Fischteichen vorbeilief, die Jakob auf der entwässerten Wiese angelegt hatte, welche früher, als das Drainagesystem noch funktioniert hatte, die Kuhweide gewesen war; die Teiche hatte er an Städter verpachtet, nicht ohne zuvor selbst versucht zu haben, Fische darin zu halten, was ihm nicht gelungen war.
Bevor sie zwischen den Erlen mit ihren wächsern glänzenden, an der Spitze eingebuchteten Blättern verschwand, blieb sie an einem der Teiche stehen, den Kopf nach vorn gereckt, die Lefzen leicht hochgezogen und eine Pfote angehoben, wie ein Vorstehhund, als hätte sie Wild gewittert. Die Morgensonne schien auf ihr Fell und ließ es glänzen. Jakob musste sich zurückhalten, um sie nicht zu rufen; aber anstatt weiterzugehen, blieb er selbst stehen und wartete, bis sie sich unversehens und diesmal, ohne sich wegzuducken, wieder in Bewegung setzte. Er war sicher, dass sie ihn nicht mehr in ihrer Nähe spürte, ihn nicht mehr wahrnahm; sie hatte sich nicht mehr umgedreht. Jetzt war sie weg; die fast mannshohen, seit Jahren nicht mehr gemähten Brennnesseln, zwischen denen sie hindurchgelaufen war, wogten noch. Jakob wusste, dass sie am liebsten bachaufwärts streifte, und er lief weiter, überwand mit einem, nein, au!, zwei beherzten Sätzen den Brennnesselgürtel und folgte dem Bachlauf entlang dem Wildwechsel gegen die Fließrichtung, obwohl von dem Hund nichts mehr zu sehen war. Die zwischen den unter dem dichten Blätterdach der Uferbäume nur vereinzelt wachsenden Gräsern und Blumen schwarze, das ganze Jahr über feuchte und kühle Erde war angenehm weich unter seinen bloßen Fußsohlen. Als er an die Stelle kam, an der das Ufer unwegsam wurde durch eine umgestürzte Esche, musste er ins Bachbett ausweichen. Aber es war nicht nur diese eine Esche; allenthalben hingen sie grau, schuppig, krank über den Bach; so viele, dass keiner mehr mit dem Entfernen hinterherkam; durch das Eschentriebsterben, einer noch jungen, durch einen eingeschleppten ostasiatischen Pilz ausgelösten Krankheit, knickten die Stämme wie Zündhölzer in der Mitte ab oder fielen einfach um; manch ein Baum verfing sich dabei in der Krone eines anderen und war so noch schwerer aufzuarbeiten. Seit es das Eschentriebsterben gab, häuften sich die Forstunfälle im Winter in einer auffälligen Weise. Fast schon regelmäßig wurde jemand von einer solchen Esche erschlagen, erst im frühen Frühjahr hatte es wieder einen erwischt, der ein paar Stunden später im Krankenhaus gestorben war. Und immer dann sagte die Mutter, Jakob solle nicht mehr ins Holz gehen, er habe doch keine entsprechende Ausbildung, als hätte sonst jemand eine.
Sobald Jakob in das eiskalte, klare, bernsteinfarbene und an dieser Stelle kaum knöchelhohe Wasser hinuntergestiegen war, entdeckte er einen Steinwurf entfernt die Hündin, die mit gespreizten Vorderläufen vor einer tiefen Stelle stand und ins Wasser zu starren schien, das da ein Grau annahm, das jenem des Schliers ähnelte, der in den hiesigen Feuchtgebieten unter dem Mutterboden lag. Jakob konnte sehen, wie die Muskeln über ihrem Widerrist zuckten. Obwohl das Rauschen des Bachs nicht sehr laut war, eher ein Plätschern, war es laut genug, dass sie ihn nicht hörte. Schritt für Schritt stieg er durch das unter ihm davonflitzende Wasser. Die Steine, abgeschliffen und überzogen von Algen oder Moos, fühlten sich weich an und waren rutschig, und nur hin und wieder trat er auf etwas Kantiges; was es jeweils war, erkannte er nicht immer, denn die durch das Blätterdach oder eher Strauchwerk dringenden Sonnenstrahlen ließen die Wasseroberfläche blitzen, so dass er geblendet war und nichts sehen konnte und vorsichtiger vorangehen und auftreten musste. Landa war nur noch ein kleines Stück entfernt. Ein paar Meter. Fast war er bei ihr. Zwei, drei Atemzüge. Jakob löste den Knoten, den er in die Leine gemacht hatte, und tat einen letzten Schritt und griff nach der Hündin, aber bevor er zufassen konnte, drang ihm etwas Spitzes mit einer solchen Wucht in die Fußsohle, dass er aufstöhnte, und obwohl er trotz des Schmerzes nicht innehielt, reichte diese kurze Verzögerung aus, um die Hündin seitwärts wegspringen zu lassen. Sie schüttelte sich, als wüsste sie, dass sie die Zeit dazu hatte, dass er zu langsam war oder nicht schneller sein konnte, weil sein Fuß schmerzte und das Wasser tiefer wurde, und lief dann, als wäre nichts gewesen, als hätte er sie nicht eben noch mit einem scharfen Ruf zu sich kommandiert, weiter.
»Verdammte Zauk«, zischte Jakob und zog seinen Fuß hoch und betrachtete die Fußsohle, aus der am Ballen hinter der großen Zehe helles Blut, dünn, dünn wie das Wasser, mit dem es sich vermischte, sickerte. »Du scheißverdammte Zauk. Ich bring dich um.«
Er verknotete die Leine wieder vor seinem Bauch und rannte, kaum noch Rücksicht auf seine durch die Kälte des Wassers tauber und tauber werdenden Füße nehmend, bachaufwärts. Er lief und lief. Schrie ihren Namen wieder und wieder. Es war eine Jagd, die von Anfang an verloren war, eine Jagd, bei der der Jäger die Gejagte nicht ein einziges Mal mehr zu sehen bekam, eine Jagd, die er aber nicht aufgab, nicht aufgeben konnte. Erst nach langem gestand er sich ein, dass es sinnlos war, weiterzulaufen, weiterzuhumpeln, weil er sie nicht einholen oder aufspüren würde, und dann gab er auf. Heiser und zerschunden war er, zerschunden und heiser. Von der Hündin keine Spur. Jakob stieg aus dem Bach und ging auf der Straße zurück. Er ging, als hätte er Holzscheite an die Füße gebunden. Als hätte er keine Zehen. Wie ein Pinguin ging er. Ab und zu kam ihm jemand entgegen, überholte ihn jemand, ein paarmal hupte ihn jemand an; er hob jeweils nur kurz das Kinn oder, bei den von hinten Kommenden, die Hand und achtete nicht einmal darauf, wer es war.
Als er zu Hause eintraf, waren seine Boxershorts immer noch nass und klebten an ihm. Seine Füße und Beine schmerzten und waren zugleich nicht zu spüren; desgleichen sein Geschlecht; nur der Puls, der dumpf darin hämmerte, war zu spüren. Die Haustür stand offen wie zuvor; wie er sie zurückgelassen hatte. Der Vater und die Mutter saßen in der Küche und frühstückten; im Radio lief Klaviermusik, blechern klimpernd wie alles, was aus dieser Kiste kam, und auf dem Plastikkruzifix an der Wand saßen zwei Gelsen.
»Wo kommst du denn her?«
»Ist noch Kaffee da?«
»Nur noch ein Schluck. Da, Jakob. Nimm ihn ruhig. Ich mache gleich noch eine Kanne.«
»Ja«, sagte Jakob.
»Ist sie wieder ausgebüxt?«
»Ja.«
»Du musst sie anketten.«
»Ja.«
»Oder einen Zwinger bauen.«
»Ja.«
»Geh dich doch umziehen, du verkühlst dich noch.«
»Ja.«
»In Spanien«, sagte der Vater, »habe ich da ziemlich ausgeklügelte Systeme gesehen. Irgendwo muss ich Fotos haben. Muss ich dir mal zeigen, Jakob, warte schnell.«
»Ja«, sagte Jakob schon im Gehen, ohne darauf zu achten, was der Vater auf seinem Handy suchte, ohne sich zu fragen, von welchen »ausgeklügelten Systemen« Bert reden mochte. »Wenn sie auftaucht, sagt es mir.«
2
Er ging in den Heizraum, stellte die Tasse – die John-Deere-Tasse, seine liebste – mit dem lauwarmen, zu schwachen Kaffee auf die Stehleiter, zog die Boxershorts aus und hängte sie am Wäscheständer auf. Er zog die Knie ein paarmal hoch und fühlte sich danach etwas besser. Er nahm trockene Wäsche und eine Hose vom Ständer und zog sich an; die Socken hingen über den Gummistiefeln; er nahm sie, zupfte ein paar Strohhalme ab und streifte sie über die immer noch tauben Füße. Die Zehen waren weiß, wie tot; berührte er sie, spürte er sie nicht. Dann stieg er in die Stiefel und griff nach der Staubmaske. Er nahm den Ohrenschutz mit eingebautem Radio vom Haken, drehte an dem einen der beiden kleinen Räder und setzte sich den Schutz auf. Es lief gerade das Journal, die Sieben-Uhr-Nachrichten; er drehte etwas leiser; immer noch war von nichts anderem als von der Seuche die Rede. Er griff nach der Tasse und verließ den Heizraum; alle paar Schritte einen Schluck nehmend, ging er in den Stall. Für einen Moment hatte er sogar Landa vergessen, aber als er die leere schwarze Tasse mit dem gelben, springenden Hirschen in grünem Feld drauf abstellte, wie immer einfach irgendwo, fiel ihm wieder ein, dass die Hündin nicht an ihrem Platz war, an seiner Seite, und in den folgenden Stunden, während er endlich seine Füße wieder zu spüren begann, hielt er ständig nach ihr Ausschau. Erst um elf war sie auf einmal zurück, und wäre sie früher aufgetaucht, wäre Jakob fuchsteufelswild geworden und hätte losgebrüllt und ihr vielleicht sogar ein paar geschnalzt; aber nach all den Stunden war eine Grenze in ihm überschritten, und er presste die Lippen aufeinander und sagte nichts, winkte sie nur zu sich her und strich ihr, der auf einmal wieder Folgsamen, über den Kopf:
»Ja, Landa. Ja.«
Landa sah ihn an, kniff die Augen zusammen und machte, als er mit dem Streicheln aufhörte, ein paar Schritte von ihm weg und streckte sich im Schatten aus und hob den Kopf nicht mehr. Jakob folgte ihr, hockte sich neben sie und streichelte sie noch ein wenig. An den Vorderpfoten sah er eingetrocknetes Blut und dachte an seinen eigenen Fuß: ein tiefer Schnitt quer über den Ballen, der nicht schmerzte.
»Hast du dir auch weh getan, Landa?«
Aber schon bevor er sah, dass sie auch an der Weiche Blut hatte, wusste er, dass es nicht ihres war. Er seufzte und erhob sich und machte sich wieder an die Arbeit. Ab und zu schaute er nach ihr; sie schlief den ganzen Tag, und ihr Fressen rührte sie nicht an, so dass er es später der Katze in die Schüssel kippte, die es allerdings ebenfalls verschmähte.
Der Tag verging. Abends, nach getaner Arbeit, schaltete Jakob die Stromversorgung des Weidezauns ein, welcher den Auslauf der Hühner begrenzte und mit dem es laufend Probleme gab, ohne dass so recht klar war, weshalb. Die Batterie entlud sich allzu rasch. Jakob fand den Fehler nicht. Er zog den gelben Stick aus der aufgenähten Hosentasche, schaltete ihn ein und überprüfte die Spannung. Der Stick piepste, die Zeichen leuchteten auf. Ja, der Zaun war scharf. Gut. In den vergangenen Wochen hatte der Fuchs mehrfach Hühner geholt, dreißig oder vierzig in Summe. Es war nicht gerade leicht zu sagen bei den knapp fünftausend; aber Jakob hatte ein gutes Auge, war ein guter Schätzer; meistens holte der Fuchs ungefähr zehn auf einmal, wenn er konnte. Hühner, die anschließend in irgendeinem Acker oder im Wald lagen und vor sich hin verwesten, madenzerfressen und schwarz, bis der Fuchs endlich wiederkam und das Aas verschlang. Der Freilauf war nicht vorgeschrieben, man bekam den Mehraufwand nicht bezahlt, aber Jakob wollte, dass die Tiere es gut hatten in ihrer kurzen Zeit, so gut wie möglich. Er mochte Tiere. Er ging in den Heizraum, nahm den Ohrenschutz ab und schaltete das Radio aus, wusch sich die Hände und Arme und zog sich um. Landa lag vor der Tür.
»Komm, Landa«, sagte Jakob, sie hob jedoch nur kurz den Kopf und ließ ihn wieder sinken.
»Komm jetzt«, sagte er und fasste sie am Halsband, zog daran, ließ aber gleich los; er wusste, wie wenig sie das mochte; wer mochte es schon, gewürgt zu werden? Aber sie verstand und kam in die Höhe, streckte und schüttelte sich und folgte ihm ins Haus. Kaum war die Haustür zu, legte sie sich auf ihre Decke und döste weiter.
Auf dem Tisch stand die Jause bereit. Jakob setzte sich und begann zu essen; er hörte die Mutter in der Stube hantieren – bügeln vielleicht oder nähen, irgendwas, er horchte nicht hin. Er aß zwei Scheiben Brot mit Dauerwurst und Schweizer Käse und ein wenig von dem Rote-Rüben-Salat mit Kümmel und Kren, der noch vom Mittagessen übrig war, und trank ein Glas Wasser. Als er fertig war, legte er das Besteck über Kreuz, schob das Brett von sich, zur Tischmitte hin, verließ die Küche und ging in den nordwärts, zur Autobahn hin gelegenen Trakt des Hauses und stieg über die steile Treppe nach oben. Er ging ins Bad und duschte sich so kalt, wie er es aushielt. Wie immer vertrieb das die Müdigkeit, die ihn nach der Jause befiel und die er im Grunde ganz angenehm fand, aber wenn er sie wirken ließ, schlief er schon um neun oder zehn ein, viel zu früh jedenfalls, denn er kam seit Jahren mit vier Stunden Schlaf aus, beziehungsweise konnte er nicht länger als vier Stunden schlafen, und nachts wach zu liegen gefiel ihm nicht, so dass er sich immer erst nach Mitternacht hinlegte – ganz gleich, ob er bis dahin noch etwas zu tun hatte oder nicht. Er hockte sich, wieder nur in Unterhose, aufs Bett und zog die noch fast volle Bierkiste hervor, nahm eine Flasche heraus und schob die Kiste zurück. Er nahm das Feuerzeug, öffnete damit die Flasche und warf den Kronkorken in die Ecke, wo der Müllkübel stand – daneben; er ließ sich in die Polster zurücksinken, nahm einen großen Schluck, griff nach dem Handy und entsperrte es: 1–2–3–4. Er öffnete den Browser und las auf der Homepage der Hagelversicherung etwas von einem möglichen Unwetter am nächsten Tag ab 18 Uhr, auf den beiden anderen Seiten, die er danach besuchte, stand davon nichts. Er überlegte, den Weizen zu ernten – dafür müsste das Wetter halten. Aber vielleicht sollte er ohnehin noch zuwarten. Niemand hatte bisher gedroschen, obwohl die Ähren überall schon geneigt waren, fast am Halm anlagen, als wären sie mit ihm zusammengewachsen, und obwohl der beinah rote, rundliche Kern hart war und nicht mehr nachgab, wenn man ihn zwischen die Zähne nahm. Die Disteln, da und dort, die das Gift überlebt hatten, blühten wie die schönsten Blumen; in Kürze würde, weiß wie Schnee im Sommer, das Verblühte dieses zähen Unkrauts durch die Luft treiben. Aber wenn wirklich ein Wetter käme? Ach was. Und genau genommen konnte man diesen verbliebenen kleinen Streifen gar nicht Feld nennen. Jakob schloss das Browserfenster und öffnete Tinder. Die App brauchte eine Weile, um zu laden. Dann marschierten sie auf, als hätte er sie herbeigepfiffen: Trixi, 18 … Emily, 23 … Mia, 20 … Er kannte sie schon alle, und sie kannten ihn wohl auch. Und sie kamen immer wieder, und immer wieder wischte er sie weg, eine nach der anderen wischte er weg, ganz langsam, nachdem er sie lange angesehen hatte … Er wusste nicht einmal, weshalb er das tat. Suchte er denn etwa? Nein. Die Frauen, die sich da tummelten, machten ihn nicht einmal wirklich heiß. Schärften ihn nicht. Vielleicht zu Beginn. War da eine Aufregung gewesen. Ein bisschen. Unruhe. Aber jetzt? Er kannte sie ja schon alle. Und auch wenn einmal eine Neue dazukam, reizte sie ihn nicht. Nicht einmal wenn er den Standort änderte und ihn dann Linzerinnen oder Wienerinnen wollten – er wollte nicht. Es war eben so ein Haufen. Dachte manchmal sogar, dass sie abstoßend waren. Irgendwie kamen sie ihm nicht sehr viel anders vor als die Mädchen aus der »Rose«. Und doch zahlte er für die App über dreißig im Monat und betrachtete die Profile derjenigen, die ihn likten oder schon gelikt hatten, immer wieder; anfangs hatte er auch zurückgelikt, aber es war nie etwas daraus entstanden. Er schrieb: »Hallo, wie geht’s? Ich bin Jakob!« Und dann antworten sie: »Hey Jakob! Wie geht’s?« Und dann schrieb man ein bisschen, dann ließ man es und wusste vielleicht selbst nicht, warum, oder wie das zugegangen war, dass man auf einmal nicht mehr wollte. Weshalb es auf einmal nichts mehr zu sagen gab, zu fragen. Gab es einen Match, war immer er es gewesen, der zuerst geschrieben hatte. Einmal dann hatte er eine zurückgelikt und nicht geschrieben. Aber die Schlampe schrieb auch nicht. Das hatte ihn so irritiert, geärgert, dass er seither keine mehr zurücklikte, sich die Angewohnheit des allabendlichen oder beinah-allabendlichen Herumwischens aber auch nicht abgewöhnen konnte. Es war noch etwas anderes gewesen, das ihn irritiert und geärgert hatte. Er dachte nicht gern daran. Einmal hatte ihn eine gelikt, unter deren Profil gestanden war, er solle ihr auf einem anderen Portal folgen, sie könne hier nicht sehen, wer ihr ein Like gibt, habe keinen Premiumaccount. Aus irgendeinem Grund hatte er die Zeile an sich persönlich gerichtet gelesen. Und irgendwie hatte er nicht daran gedacht, dass er sie ja nur zurückliken müsste, damit sie sich hier schreiben konnten. Einfach ein Denkfehler, der ihm bis zuletzt nicht auffiel. Er ging auf das andere Portal, von dem er nie zuvor gehört hatte. Es war eines für Menschen auf dem Land, ein deutsches allerdings. Na, er konnte sich ja einmal umsehen. Er registrierte sich und bekam dafür irgendwelche Credits oder Coins gutgeschrieben. Es gab sogar eine Suchfunktion hier. Vielleicht fand er sie ja so? Er tippte ihren Namen ein, und tatsächlich, da war sie. Sie war nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Ihre Fotos sahen sehr gut aus. Sie war dunkelhaarig, anziehend. Ein paar Jahre älter als er. Aber das störte ihn eigentlich nicht. Auf den alten Rädern lerne man das Fahren – hatte nicht Markus immer so gesagt? Er schrieb sie an: »Hallo, Bianca – du hast mich auf Tinder gelikt. Wie geht’s? Ich bin Jakob.« Vielleicht würde sie ja gleich antworten. Er blieb noch online und sah sich ihre Bilder an. Sie schien Handwerkerin zu sein; zwei Fotos zeigten sie in einer Tischlerwerkstatt, in der kirchliches Inventar zu sehen war, ein anderes zeigte sie beim Bogenschießen. Während er noch die Fotos durchblätterte, schrieb sie zurück: »Halo, Jakob! Was machst du?« »Hallo! Nichts. Ich komme gerade aus dem Stall.« »Du bist Bauer? Da haben wir etwas gemeinsamm!« Ihre Rechtschreibung war schlecht, das fiel ihm auf, aber es störte ihn nicht, in der Landwirtschaft kam es auf anderes an. Eine Bäuerin? Dann war sie bestimmt auch sparsam, und dieses System hier, wo die Coins oder Credits mit jeder Nachricht weniger wurden, gefiel ihr wahrscheinlich ebenso wenig wie ihm. Er fragte, ob sie nicht auf WhatsApp wechseln sollten. Er schickte ihr seine Nummer. Aber sie antwortete, das sei ihr zu früh, sie sollten sich erst ein wenig kennenlernen.
»Verstest du das, Jakob?«
Ihre Eltern hätten einen Milchviehbetrieb, auf dem sie mitarbeite, und wie denn sein Betrieb aussehe? Er antwortete, dann schrieb sie erneut. Ein paar Tage ging es hin und her. Hatte er die Frau gefunden, die er suchte? Er fragte sich das, ungläubig, dass etwas so Entscheidendes so zufällig, so plötzlich geschehen konnte. Kurz bevor die Coins aus waren, versuchte er es noch einmal. Diesmal sagte sie, vielleicht könnten sie anderntags auf WhatsApp wechseln, sie überlege es sich. »Schade, wenn du mir nich mehr schreiben wilst, Yakob.« Natürlich wollte er ihr schreiben. Sie sollte bloß nichts anderes glauben. Er kaufte Coins. Was waren schon dreißig Euro, wenn man ans Leben dachte? Und was, tags darauf, als ihr Handy plötzlich nicht mehr funktionierte und sie deshalb nicht auf einen anderen Kanal wechseln konnten, sechzig? Die Befürchtung, für geizig gehalten zu werden, und die wachsende Lust an dieser scharfen Braut, an die er Tag und Nacht dachte, standen seinem natürlichen Misstrauen im Weg. Erst nachdem er 120 Euro überwiesen hatte, begriff er oder gestand er sich ein, dass er auf einen Betrug hereingefallen war.
»Kann es sein, dass du mich verarschst?«
»Du weist, dass ich dir meine Nummer nicht geben kan.«
»Verdammt nochmal. Tagelang schon verarschst du mich!«
Und hätte sie doch einfach nur »Entschuldigung« gesagt oder auch bloß geschwiegen, dann hätte er die Episode vielleicht vergessen, aber sie begann, ihn zu beschimpfen. Er schämte sich noch wochenlang für seine Dummheit, und wann immer ihm die Geschichte einfiel, wurde ihm siedend heiß; niemals würde er sie jemandem erzählen.
So etwas machte einen zurückhaltend … Nach einer halben Stunde schaltete er das Telefon aus und legte es unters Bett und nahm sich eine neue Flasche Bier. Er trank sie halb im Liegen und während er an die Wand starrte. Es störte ihn nicht, dass das Bier nicht gekühlt war, er ließ es ohnehin nur so in sich hineinlaufen, fast ohne zu schlucken und ohne es recht wahrzunehmen. Es war ein Zeitvertreib, der eine angenehme Wirkung hatte. Er dachte an nichts, oder wenn er an etwas dachte, bemerkte er es nicht; als die Flasche leer war, nahm er sich noch eine und stellte sich damit ans Fenster. Draußen der in einem fort an- und abschwellende Lärm des Nachttransits. Er setzte die Flasche an und ließ das Bier in seine Kehle rinnen. Dann wischte er sich den Mund ab und ging, die Flasche in der Hand, nach unten. Er musste Licht machen; alle schliefen schon; Landa lag im Vorhaus und hob nicht einmal den Kopf. Jakob nahm die Taschenlampe aus der Küchenlade und ging hinaus in die Werkstatt. Die Haustür ließ er offen stehen; wenn Landa aufwachte, würde sie vielleicht abhauen, und wäre ihm das am Ende nicht doch tausendmal lieber als alles andere? Er öffnete das Werkstatttor und sog den Geruch ein, den er so mochte, den Geruch von Holz und Metall und Öl und Fett. Auf der Anrichte, neben den Schrauben, die er früher bei Schlechtwetter immer sortiert hatte, stand der weiße, mit einem Deckel verschlossene Tiegel. Er streifte sich Handschuhe über und zog den Deckel ab, nahm etwas aus dem Behältnis, verschloss es wieder und ging zurück ins Haus. Er streifte sich den einen Handschuh ab, nahm zwei Scheiben Schinken aus dem Kühlschrank und umwickelte damit, was er aus der Werkstatt geholt hatte; dann strich er noch etwas Leberwurst drauf. Er schloss den Kühlschrank, zog den Handschuh ganz automatisch wieder an und verließ die Küche. Achtlos ließ er das kleine Paket aus seiner Hand neben die auf ihrer Decke schlafende Landa fallen. Wenn es in der Früh noch daliegt, dachte er, werfe ich es in den Müll. Und es wird wohl noch daliegen, denn sie hatte den ganzen Tag über keinen Hunger und hat vielleicht auch morgen keinen. Weiß der Teufel, was sie gefressen hat. Ein Kitz? Die sind immer noch recht klein …
»Du verdammte Zauk«, sagte er, kniete sich neben sie und streichelte sie. »Du scheißverdammte Zauk.«
Auf einmal musste er lächeln; er schüttelte den Kopf, stand auf und ging nach oben und legte sich ohne einen weiteren Gedanken an den Hund ins Bett.
Wieder war es kaum vier Uhr, als er aufwachte, diesmal aber nicht von selbst. Die Rufe des Vaters weckten ihn.
»Jakob! Komm! He, Jakob!«
Es war kein übler Traum gewesen. Jakob atmete durch, stand auf und ging nach unten.
»Was ist?«, fragte er.
»Was ist! Schau dir den doch an! Was ist mit ihm?«
Jakob zuckte mit den Schultern.
»Weiß nicht.«
»Ja, was hat der denn?«
»Es ist eine Sie, Papa.«
»Ja, Herrgott, ist das jetzt wichtig? Schau ihn dir doch an!«
»Sie hat gewildert. Vielleicht plagen sie Knochensplitter.«
»Unsinn. Wie der sich windet. Der hat irgendwas erwischt. Du musst den Tierarzt rufen.«
Auch die Mutter war aufgewacht; unter ihrem alten, dünn gewordenen Pyjama bewegten sich die durchschimmernden Brüste; Jakob sah schnell weg.
»Was ist denn los? Was ist mit dem Hund?«
»Sie war wieder wildern.«
»Er hat wo einen Rattenköder erwischt.«
Die Mutter sah zuerst den Vater an, dann ihren Sohn, als überlege sie, wem sie glauben solle.
»Bring sie raus, Jakob«, sagte sie schließlich, als könne sie sich nicht entscheiden und als sei das auch nicht von Bedeutung, zumindest nicht für sie, sondern als sei einzig von Bedeutung, dass das Vorhaus nicht noch mehr verdreckte.
»Ja«, sagte er, kniete sich neben das Tier, wie er es vor ein paar Stunden ebenfalls gemacht hatte, packte es und trug es hinaus.
Der Vater ging ihm hinterher. Jakob konnte ihn in seinem Rücken spüren und hätte sich nicht gewundert, wäre der Alte ihm auf die Hacken getreten.
»Wo legst du ihn hin?«
»In die Melkkammer.«
»Ruf den Tierarzt an, Jakob.«
»Es ist vier, Papa. Warten wir einmal ab. Wenn es in der Früh nicht besser ist, rufe ich ihn an.«
Jakob trug Landa in die Kammer; auf dem Boden lag ein großer Karton, auf dem ein paar Farbdosen standen, die er zum Streichen der Fenster verwendet hatte.
»Stell die Dosen weg, Papa.«
Der Vater nahm die Dosen und stellte sie aufs Fensterbrett über dem Regal, auf dem das Gewehr lag, und rückte sie zurecht. Jakob legte den Hund ab und ging aus der Kammer. Gleich darauf kam auch der Vater hinterher. Sie standen einander gegenüber. Der Vater sah schwarz aus in dem fahlen Morgenlicht, schwarz wie ein Vogel, wie ein schwarzer Vogel.
»Machst du dir denn gar keine Sorgen, Jakob?«
»Warum machst du dir solche? Scherst dich doch sonst nicht um sie.«
Es stimmte, der Vater schien Landa bisher nie wirklich registriert zu haben, so wenig, wie er alles andere, das nicht seins war oder ihm nicht von Nutzen war, beachtete. Und das war es, was Jakob vielleicht auch meinte: Du scherst dich doch sonst um nichts.
Er ging ins Haus und hinauf in sein Zimmer; er wusste, dass der Vater draußen blieb. Sein Herz pochte, er konnte nicht noch einmal einschlafen. Eine Stunde, eineinhalb, fast zwei lag er reglos da. Um sechs stand er auf und ging wieder runter. Er ging hinaus. Es war hell, und die Vögel sangen, und ein paar Spatzen hüpften vor der Melkkammer im Staub und flogen aufgeregt zwitschernd auf, als er sich näherte. Der Vater hockte auf dem alten Melkschemel neben Landa, die ausgestreckt dalag, Schaum vor dem Fang und flach hechelnd.
»Ich glaube, ich rufe ihn an«, sagte Jakob und zog das Handy aus der Hose.
»Jetzt kannst du dir’s sparen.«
Jakob ging in die Hocke und streckte die Hand nach Landa aus, aber irgendetwas hinderte ihn, sie zu berühren. Es war still. Und obwohl keine fünf Minuten vergingen, ehe sie tot war, schien es Jakob, als sei es zumindest eine Stunde gewesen. War es der Blick des Vaters, den er immer wieder auf sich spürte? Landa hatte sich nicht mehr gerührt; hatte einfach irgendwann zu atmen aufgehört.
Der Vater stand auf und verließ die Kammer. Er versteht es nicht, dachte Jakob und korrigierte den Gedanken: Er würde es ja doch nicht verstehen. Hätte ich zulassen sollen, dass Manfred sie über den Haufen schießt, wie er es schließlich nicht bloß einmal angekündigt hatte, wenn sie nicht aufhörte zu wildern? Zulassen sollen, dass sie in ein Auto rennt und einen Unfall verursacht, bei dem am Ende noch wer stirbt? Man konnte schließlich nicht annehmen, dass immer alles gut ausging. Er stand ebenfalls auf. Den Tierarzt müsste er dennoch anrufen. Er würde ihm sagen, dass er sie so gefunden hatte. Vielleicht würde der Tierarzt sie mitnehmen und untersuchen, vielleicht aber auch bloß die Tierkadaververwertung verständigen und sie bitten, den Kadaver abzuholen – für ihn, Jakob, war das nicht entscheidend. Er ging in die Werkstatt, kehrte dann noch einmal in die Melkkammer zurück, danach zog er sich im Heizraum um und wollte in den Stall.
»Jakob?«
Der Vater tauchte von irgendwoher auf.
»Ja.«
»Was hast du in der Werkstatt gemacht?«
»Ein paar Tücher geholt, um sie abzudecken. Die alten Presstücher.«
»Ich meine in der Nacht.«
Erstarrte er? Nein, es durchrieselte ihn nur etwas, ein Schauder, der sich aber nicht unangenehm anfühlte, sondern auf eine merkwürdige Weise sogar fast angenehm.
»In der Nacht? Nichts.«
3
Lächelte auch der Vater, zu dem Jakob zwar immer noch »Papa« sagte, den er bei sich aber nur noch »Bert« nannte? Lächelte auch er, bloß so unmerklich wie Jakob selbst, für den Bruchteil einer Sekunde? Selbst wenn er etwas ahnte, war es bedeutungslos. Obwohl es lange schon so war, dass Jakob sich um alles hier kümmerte, weil der Vater ohnehin fast nie da war, waren sie doch auf eine komische Weise früher immer ein Gespann gewesen, ein Team, vor allem, weil der Vater das so gesehen hatte; seit einiger Zeit waren sie das nicht mehr, und wieder ging es vom Vater aus.
Fünf Jahre ungefähr war es her, dass die Großmutter nach dem Tod des Großvaters gesagt hatte, sie habe das auf sie übergegangene Vermögen, von dem niemand genau wusste, wieviel es war, weil der Großvater immer nur in Häusern gerechnet hatte – in Bauernhäusern, Zinshäusern; dabei handelte es nicht nur um Häuser, sondern um alles Mögliche –, der »rechten Partei«, wie sie sie absichtlich zweideutig nannte, vermacht; und dann war es trotzdem noch länger unklar, ob das tatsächlich stimmte, bis es auf einmal klar schien, denn der Vater verhielt sich seiner Mutter gegenüber verändert. Er wurde in ihrer Gegenwart nicht mehr kleinlaut und duckmäuserisch, sondern er tat so, als gäbe es sie nicht. Selbst die Alte, die kaum noch etwas mitbekam, bemerkte das. Sie wirkte verwirrt und sah Jakob manchmal an, als frage sie: Was ist los? Was ist mit ihm? Jakob freilich begegnete diesen Blicken am Küchentisch mittags oder abends, ohne eine Miene zu verziehen. Für ihn war es, als sähe eine Tote ihn an oder eine hässliche Puppe. Nein, er hatte nicht vergessen, wie sie ihn behandelt hatte, damals, als er ihre Hilfe so dringend gebraucht hätte; nein, nein; denn er vergaß nie etwas. Für ihn gab es diese Frau schon lange nicht mehr … Und dann kamen sie auch nicht mehr vor, diese Blicke. Denn der Vater nahm seine Mutter auf einmal wieder wahr. Es war, als sei die Phase zuvor etwas wie eine Zeit der Verwandlung gewesen, oder eine Zeit des Begreifens, und dann redete er wieder mit ihr. Aber wie er das tat! Er sprach nicht nur ohne jeden unterwürfigen Ton mit ihr, sondern ohne jeden Respekt: grob, dreist, mitunter richtiggehend brutal, wenn er fand, sie redete zu viel oder zu lang – man wusste oft eigentlich nicht, was der Grund war, vielleicht gab es keinen, wenn er wieder einmal sagte:
»Halt endlich dein Maul, du!«
Jetzt lächelte er, bloß so unmerklich … Hatte er aber etwas gesagt? Jakob hatte jedenfalls nichts gehört, denn er hatte sich den Ohrenschutz aufgesetzt und an dem schwarzen Rädchen rechts gedreht, und anstelle des Autobahnlärms hörte er – es war kurz nach halb acht, die Nachrichten vorbei – irgendeine fröhliche Geigenmusik, bestimmt Haydn oder Beethoven oder Mozart oder Schubert; nicht dass er etwas davon verstanden hätte, aber sie spielten ja doch nie was anderes. Obwohl ihn der Sender mit seiner ewigen klassischen Musik manchmal auch reizte, war er ihm doch immer noch lieber als die anderen, die ihn bisweilen fast zum Kotzen brachten mit ihren Moderatoren mit den verdammten Gute-Laune-Stimmen. Aber auch die waren am Ende immer noch besser als der Autobahnlärm, den er früher kaum mitgekriegt hatte, der ihn jedenfalls nicht gestört hatte, der Teil seines Lebens gewesen war und der ihn seit seiner Rückkehr vom Militär geradezu quälte, ohne dass er wusste, weshalb er ihn nicht mehr ertrug.
Er ging in den Stall und drehte lauter. Während die Geige immer wilder fiedelte, wurde auch er selbst immer schneller beim Einsammeln der Kadaver, die er in eine Tonne warf, welche er später wegbringen würde, so wie jeden Tag oder jeden zweiten, je nachdem, wie groß die Ausfälle waren, die er detailliert in den großen an der Wand hängenden Kalender eintrug, obwohl es eigentlich keine Notwendigkeit dafür gab – es änderte ja doch nichts. Er sah nach, ob das Futter im Tank noch bis zur nächsten Lieferung reichen würde oder ob er ein paar Säcke nachfüllen musste, kontrollierte die Tränken und verließ den Stall wieder. Auf einmal erinnerte er sich an die eine Kuh, die gute, die zu lahmen begonnen hatte, einfach so, als hätte sie keine Lust mehr, und deren Platz er dann lange nicht vergeben wollte, nicht einmal den Mist hatte er weggebracht, als hätte er schon da gewusst, aber nicht wissen wollen, dass das ein entscheidendes Ereignis war, ein Wendepunkt, obwohl er natürlich nichts geahnt hatte und mit ganz anderen Dingen beschäftigt gewesen war. Jahrelang hatte er die Tatsache, dass Bert auch ihr bestes Feld verkauft hatte, für diesen Wendepunkt gehalten, jetzt wusste er, dass damals, mit dieser Kuh, etwas aus dem Gleichgewicht gekommen war. Er hätte es gern verhindert zu denken, dass seit einiger Zeit, eigentlich schon lang, alles schiefging und dass das seine Schuld war oder zumindest nicht die von irgendwem anderen. Freilich, der Vater hatte viel Geld verjuxt, viel Grund verkauft, eigentlich fast alles – und doch war es nicht das gewesen. Er, Jakob, hatte schließlich immer ein, wie das hieß, Händchen gehabt für den Betrieb, für Pflanzen und vor allem für die Tiere, die ihm eigentlich lieber waren als die Menschen, weil er sie besser verstand, und warum ging seit Jahren nun schon nichts mehr auf? Und begonnen hatte es damals. Er wischte die Erinnerung an die lahmende Kuh weg. Und auch den Wunsch nach einem Krieg, den Traum davon, der immer dann kam, wenn er sich nicht mehr hinaussah. Nein, diesmal würde es besser gehen, und auch wenn das erste Masthuhnjahr ein Verlustgeschäft gewesen war, lief es allmählich besser. Doch, er hatte Hoffnung, es war überhaupt nicht aussichtslos, und auch wenn das, was er hauptsächlich tat, nicht zu seiner zugegebenermaßen altmodischen Vorstellung von einem Landwirt – und von sich – passte, war ihm das immer noch unendlich viel lieber, als vierzig Stunden in der Woche oder mehr arbeiten zu gehen, wie er es früher zu tun gezwungen war. Zwar verließen die Hoffnung und die Zuversicht ihn manchmal. In solchen Momenten dachte er an den Vater und daran, dass es tatsächlich sein konnte, dass es sogar immer wahrscheinlicher wurde, dass der am Ende doch noch erben würde. Und dass er, Bert, der Vater, ihm, Jakob, dem Sohn, vielleicht helfen würde. Zugleich wusste er, dass das nicht geschehen würde, nein, niemals, weil er es doch selber gar nicht wollte … Zugleich bemerkte er, wie er, fast von selbst, sein Verhalten dem Vater gegenüber änderte und das nicht verhindern konnte.
Im Radio lief eine Sendung über die Bedeutung des Nichtstuns, und Jakob dachte an die Fischteiche, die er angelegt hatte, nachdem es mit den Kühen zu Ende gegangen war; der Milchpreis war seit Jahren – seit der Abschaffung der Quote – im Sinkflug gewesen, dazu kamen in einem fort neue Auflagen, die angeblich immer das Tierwohl im Sinn hatten, in Wahrheit aber zu nichts anderem führten, als auch noch die letzten kleinen Höfe zu vernichten, vielleicht nicht, weil man etwas gegen sie hatte, aber weil die Großen immer noch mehr Flächen brauchten, die man ihnen verschaffen wollte. Wer wusste, wer hinter diesem System steckte, der Teufel selbst vielleicht. Jakob hatte die Teiche auf der Weide, die eine vor Jahrzehnten drainierte Feuchtwiese war, angelegt. Die Idee hatte er schon länger mit sich herumgetragen, denn Fisch war gefragt, warf etwas ab, wie regelmäßig in den drei oder vier unterschiedlichen landwirtschaftlichen Fachzeitschriften, die wöchentlich kamen, zu lesen war, es gab viel zu wenig aus heimischen Gewässern, und seit einiger Zeit wurde das Heimische wieder stärker nachgefragt – seit Ausbruch der Seuche war diese Nachfrage noch einmal größer geworden. Er fuhr mehrmals auf die Landwirtschaftskammer, die im Messegelände von Wels, der Bezirkshauptstadt, lag, und zu einem Teichbauunternehmen; da wie dort ließ er sich beraten. Dann lieh er sich einen Bagger und grub die Teiche – fünf waren es am Ende, je hundertfünfzig Quadratmeter groß und an der tiefsten Stelle fast zwei Meter – auf eigene Faust, sogar ohne um Genehmigung anzusuchen. Früher, sagte er sich, hatte es hier auch immer einen Teich gegeben, zumindest hatte der Großvater das oft erzählt, und wer kam schon hierher? Außerdem entnahm er dem Bach kein Wasser, was der Hauptgrund zu sein schien, weshalb man eine Genehmigung brauchte. Die Teiche speisten sich aus unterirdischen Quellen, die hier überall aufgingen. Er grub Abflüsse und betonierte am Ende eines jeden Teiches – dort, wo er tiefer gegraben hatte – einen sogenannten Mönch, der zum Aufstauen und Ablassen dienen sollte. Die Schalung für den Mönch lieh er sich von einem Bauern aus dem Nachbardorf. Wirklich stellte sich niemand von der Behörde oder sonstwo ein, nicht einmal von der Gemeinde fragte wer nach, ob die Teiche genehmigt seien, nicht damals, nicht später, als die Städter kamen, das war nicht das Problem. Das Problem war auch nicht der Sauerstoffgehalt des Wassers, waren auch nicht die Fließgeschwindigkeit oder die Wasserlinsen oder die Algen oder irgendwelche Pilz- oder andere Krankheiten der Fische, nein, die Setzlinge entwickelten sich vom ersten Tag an, einem Samstag im April, prächtig. Eintausend Stück hatte er eingesetzt, zweihundert pro Teich, sie hatten reichlich Platz, und er hätte die Teiche wohl leicht mit der doppelten Menge besetzen können. Täglich ging er mehrfach hin, er fütterte in kleinen Dosen, weil er gelesen hatte, das bekomme ihnen besser. Und immer rechnete er dabei: So viel Futter er hineinwarf, so viel Fisch würde er am Ende herausziehen; Fische waren perfekte Verwerter, sie setzten Futter im Verhältnis eins zu eins um. Jeden Morgen kescherte er Algen und Wasserlinsen ab und beobachtete den Bestand. Von Zeit zu Zeit schickte er dem Züchter, von dem er sie hatte, ein Foto oder ein Video, worauf der jeweils mit einem Emoji antwortete: Daumen hoch oder Zwinker-Smiley. Als fast drei Monate vorüber waren, zeigten sich die Tiere nicht mehr, als er kam, und wenn er Futter hineinwarf, sah er es durch das anthrazitfarbene glasklare Wasser auf den Grund sinken, ohne dass einer draufging. Zunächst war das nur bei einem Teich, aber bald bei allen. Freilich, es hatte geregnet. Wahrscheinlich war es das. Tagelang war Regen gefallen, so dass sie das Futter wohl nur für Regen hielten. In ein paar Tagen würden sie wieder kommen, er war sicher. Dann aber lagen eines Morgens überall, zwischen den Teichen, Fische herum, denen entweder der Kopf oder auch nur unterhalb der Kiemen ein Stück fehlte, das wie herausgesägt aussah. Jakob musste sich setzen. Ihm war übel. Es dauerte, bis er sich ein wenig gefangen hatte. Er stand auf, machte ein Foto und schickte es dem Züchter. Eine Minute später läutete das Telefon.
»Hast Besuch gehabt?«
»Was?«
»Hat dich der Otter besucht?«
»Ich weiß nicht. Hier liegen überall solche herum, wie ich dir geschickt habe.«
»Da hat dich der Otter besucht, weißt eh. Wenn er satt ist, frisst er nur noch den Kopf oder das Herz. Die besonders guten Sachen. Den Rest lässt er liegen, weißt eh.«
»Was kann man da tun?«
»Er ist geschützt. Zu mir kommt er auch, weißt eh. Ich habe eine Falle gebaut.«
»Und?«
»Zwei Enten habe ich schon gefangen. Der Otter ist schlau, der Hund.«
»Ja.«
»Weißt eh.«
Die Übelkeit hielt an und lähmte ihn. Er konnte nichts tun und stellte fest, wie der Bestand täglich noch kleiner wurde. Jemand hatte gesagt, er solle einen Zaun errichten. War das vielleicht sogar auf der Kammer gewesen? Aber einen Zaun um sämtliche Teiche? Bis er damit fertig wäre, gäbe es keine Fische mehr. Trotzdem tat er es, sobald die Starre, der Schock, ihn verlassen hatte. Eine Woche arbeitete er daran, schlug Pfähle ein und schraubte in jeden, knapp über dem Boden beginnend, im Abstand von je zehn, zwölf Zentimetern drei Isolatoren; dann mähte er mit der Motorsense das Gras zwischen den Pfählen so kurz wie nur möglich – eine Arbeit, die er regelmäßig wiederholen müsste – und