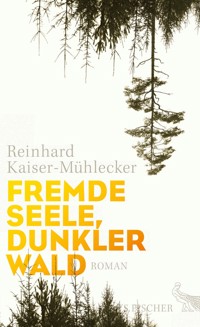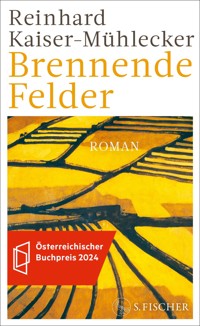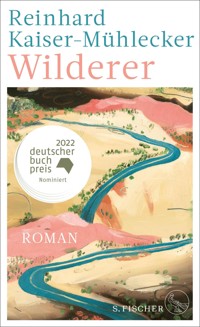9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Reinhard Kaiser-Mühlecker erzählt von menschlicher Schuld, dem Vergehen der Zeit und unserer Sehnsucht nach Erlösung. In fünf hochgelobten Romanen hat Reinhard Kaiser-Mühlecker ein großes Epos der menschlichen Schuld geschrieben. In seinen drei Erzählungen verdichtet er die existentiellen Fragen: Wie wird der Mensch schuldig? Wie verketten sich Verfehlungen, Verschweigen, Gerüchte und Lügen zu einer Lebensgeschichte? Und ist jeder unausweichlich in sein vorgezeichnetes Schicksal verstrickt? Ein ängstlicher Verrat, eine Bösartigkeit, ein perfider Freundschaftsdienst lösen ein Unheil aus, das lange nachwirkt. Mit großer poetischer Kraft erzählt Kaiser-Mühlecker von der Sehnsucht, den alten Geschichten und der Vergangenheit zu entkommen und ein eigenes, freies Leben zu beginnen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 335
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Reinhard Kaiser-Mühlecker
Zeichnungen
Drei Erzählungen
FISCHER E-Books
Inhalt
War ich der Traum des Toten:
diese Wolke Gedächtnis zu sein,
die heimatlos über das Land zieht?
Botho Strauß
Spuren
Die Villa befand sich nicht mehr als zwanzig, höchstens dreißig Schritte von der Uferlinie entfernt. Außerhalb des Gartenzauns, der das Grundstück umlief, stand das Gras wild und – zumindest in der warmen Jahreshälfte – nie still, denn eine Menge Insekten tummelte sich sicht- und hörbar darin; innerhalb des Zauns jedoch war es akkurat gemäht; nicht ein Büschel wuchs höher als der Rest. Leise und dann und wann glucksend schlug das Wasser gegen das Ufer. Es war ein sehr einfaches, mit Lärchenholz verkleidetes Haus, dem eine verglaste zweigeschossige Veranda vorgebaut war, die wie ein Wintergarten aussah. Alles an diesem Haus war alt und eher als aus dem letzten aus dem vorletzten Jahrhundert. Die Fensterstöcke und -sprossen sowie der Türstock samt der Tür waren dunkelgrün gestrichen.
Als ich es zum ersten Mal richtig sah, ging ich zu Fuß darauf zu; denn ein selbstgemachter Schlagbaum hatte mich an der Durchfahrt gehindert, und ich hatte halten und den Wagen stehen lassen müssen. Ich hatte meinen ledernen Aktenkoffer von der Rückbank genommen, noch einen Blick in den Rückspiegel geworfen, mir die Haare zurückgestrichen, einen winzigen Tropfen Parfüm auf mein Handgelenk geträufelt, es mit dem anderen verrieben und war ausgestiegen. Ich ging auf das Haus zu, und als ich einmal über die Schulter blickte und mich fragte, ob ich abgesperrt hätte, kam mir das funkelnde rote Auto fast unwirklich vor in dieser Umgebung, in der alles hell war: der See zur Linken, der durch das lichte Waldstück hindurch zu sehen war; der helle Asphalt, der in den beinah grellen Schotter überging; das im Wind silbern flackernde Gras links und rechts der Schotterstraße; und der völlig einheitlich weiße Himmel. – Ich ging weiter.
Das Gartentor war angelehnt, ich stieß es auf und betrat, einen kleinen Bogen um den seitlich hereinwachsenden tiefroten Hartriegel machend, das Grundstück. Ein aus alten Bahnschwellen gelegter Pfad lief schmal und scheinbar schmaler werdend auf das Haus zu. Es war nicht, dass ich es noch nie gesehen hätte; denn jeden Winter liefen wir so oft als möglich in Schlittschuhen über den zugefrorenen See, und es gab kein weiteres Haus direkt am Wasser; aber dennoch hatte ich es offenbar noch nie richtig angeschaut. Aus dem Gebäude drang nicht das kleinste Geräusch, und ich wartete, horchte zunächst, bevor ich an dem neben der Haustür herunterlaufenden rostigen Drahtseil zog. Schrille, markdurchstoßende und unzusammenhängende Glockenschläge ertönten. Nichts rührte sich. Nach einer Zeit zog ich wieder an dem stocksteifen Seil, und dann noch einmal. Ich fand jetzt nichts Markerschütterndes mehr an den Schlägen. Immer noch tat sich nichts. Beim Blick durch die Scheiben des Vorbaus sah ich mehrere Schuhpaare in Reih und Glied stehen; die Enden der Schuhbänder waren in die Schäfte gesteckt. An der Wand hingen ein Anorak, eine lederne Trachtenjacke und ein gelber Regenmantel – der so steif war, dass es den Anschein erweckte, jemand ohne Kopf, Hals, Hände und Unterleib stecke darin.
Bevor ich wieder fuhr, wollte ich, mehr, um die Form zu erfüllen, als in der Hoffnung, doch noch jemanden anzutreffen, eine Runde um das Haus machen – und erschrak, als ich auf einen auf der Terrasse sitzenden Mann stieß. Er trug eine grüne Jacke, einen ebensolchen, im Nacken sitzenden Hut, und seine Beine waren in eine graue, mit rot-weiß-rotem Band gesäumte Decke eingeschlagen. Ich hatte ihn nicht sofort gesehen, sah ihn erst, als ich schon knapp vor ihm stand. Bis auf die kleinen Bewegungen, die zum Rauchen nötig waren, rührte er sich nicht. Es war ein seltsames und merkwürdiges Bild: Ein Mann von höchstens dreißig Jahren, der auf eine Art angezogen war und auf eine Weise dasaß, dass man denken konnte, er wäre dreimal so alt. Und schwerhörig schien er auch zu sein. Oder weshalb erwiderte er meinen Gruß nicht? Ich stand und schaute ihn an und merkte nicht, wie die Zeit verging. Plötzlich – aber ohne jäh zu klingen; vielmehr war sein Reden, wie mir vorkam, Teil der Stille – sagte er, immer noch geradeaus blickend: »Ich brauche nichts von Ihnen.« Es klang wie Atmen, eine Fortsetzung des Atmens.
Ich wolle ihm nichts verkaufen, sagte ich nach einem Moment, in dem ich über seine ebenso wenig wie sein Alter zu der Montur passende milde Stimme erstaunt war.
»Was machen Sie dann hier?«, fragte er. Er kenne mich nicht. Er sagte das alles, ganz ohne mich anzusehen und ohne auch nur eine Spur lauter zu werden. Ich musste den Kopf etwas drehen und mich ein Stück weit vorlehnen, um jedes Wort zu verstehen.
Ich wolle ihm ein Angebot machen, ganz unverbindlich. Er müsse nichts tun, nur zuhören, sagte ich.
Nun kniff er die Augen zusammen; aber nicht, wie ich eine Sekunde lang gedacht hatte, meiner Worte wegen, sondern wegen etwas, das in seinen Blick geraten war. Dann sah auch ich es: Eine männliche Stockente war eben dabei, eine weibliche einzuholen. Beide glitten, sich vom Ufer entfernend, wie von unsichtbarer Hand gezogen, lautlos durch das Wasser. Das Grün des Männchenköpfchens schillerte bis zu uns herüber. Als das Männchen das Weibchen eingeholt hatte, geschah nichts; mit einem Abstand von vielleicht zwei, zweieinhalb Handspannen zogen sie in einem Tempo nebeneinanderher irgendwohin und verschwanden, wie sie zuvor daraus aufgetaucht waren, in den Spiegelbildern der den See einschließenden Berge. Und auch die Keile im Wasser, die sie hinter sich herzogen, vereinten sich nun zu einem einzigen, der sich als weißer Glanz von der Umgebung abhob. Von den Bergen fiel Nebel herunter, als ob Wolkenfetzen, die sich aus dem Himmel gelöst hatten, gesunken wären.
»Sie sind der Nachfolger von Peter«, stellte er fest, und mir blieb nichts, als zu nicken. Dann seufzte er. »Sie vergeuden Ihre Zeit. Ich brauche nichts von Ihnen.«
Ich beschloss, es langsam anzugehen, und sagte, er könne es sich ja überlegen, ob er wirklich keine Beratung brauche, und dann fragte ich, ob ich, vielleicht in einer Woche, wiederkommen dürfe.
»Wenn Ihnen langweilig ist«, sagte er und klopfte eine neue Zigarette aus der orangefarbenen Schachtel. In seiner Stimme war ein kaum hörbares Lachen. Der Zigarettenstummel lag nun neben dem Stuhl; schwerer, tiefgelber Rauch stieg von ihm auf. Er hatte ihn einfach fallen lassen, wie ich jetzt bemerkte. Er riss ein Streichholz an und zündete sich die neue Zigarette an. Ein paar Züge lang blieb ich noch stehen, dann fühlte ich einen Ruck – es war die Erkenntnis, schon zu lange im Grunde unberechtigt hier zu sein – und verabschiedete mich. Der Mann hob lediglich leicht die Hand und ließ sie wieder sinken. Es schien ihm völlig einerlei zu sein, ob ich blieb oder ging, hier war oder nicht hier war.
Leise schloss ich das kleine Gartentor und ging schnellen Schritts zu meinem Wagen zurück. Die Kiesel unter meinen Füßen knirschten. Ich öffnete den hinteren Schlag, legte den Koffer auf die Rückbank, warf die Tür zu und stieg vorne ein. Es war halb fünf, der Himmel begann, sich von rosarot zu violett zu färben, und mir blieb an diesem Tag nichts mehr zu tun übrig, als nach Hause zu fahren und Vorbereitungen für den nächsten Tag zu treffen. Ich startete, setzte bis an die Asphaltstraße zurück, wendete, legte den ersten Gang ein und fuhr an; dabei fiel mir ein, mich weder vorgestellt, noch meine Karte hinterlassen zu haben. Womöglich hatte er es nicht einmal bemerkt. Und doch hatte er gewusst, dass ich der Nachfolger von Peter war – einerseits; und andererseits hatte er behauptet, mich nicht zu kennen. Nachdenklich fuhr ich nach Hause.
Erst seit dem Ende des Sommers, seit einem guten Monat, hatte ich diese neue Arbeit. Nach all den schlechtbezahlten Gelegenheitsarbeiten seit dem Bandscheibenvorfall und also dem Ende meiner Tätigkeit als Zimmermann war es nach Jahren die erste Tätigkeit, von der ich mir etwas versprach – und mit mir meine Frau. Man hatte – nachdem sich Peter Gruber, mein alter Freund, im vergangenen März erhängt hatte –, anstatt hier in der Region einen Nachfolger zu suchen, jemanden aus Linz mit der Kundenbetreuung beauftragt. Die Folge war ganz natürlich, dass noch mehr Kunden ihr Geld herausnahmen, als es ohnedies schon der Fall gewesen war. Auch mein Bruder und unser Vater hatten ihr Geld unverzüglich herausgenommen, und ich, hätte ich welches gehabt, hätte es ebenso gemacht. Eines Tages erfuhr ich, dass man nun doch wieder einen Einheimischen suchte, der das Geschäft von Peter weiterführen würde. Andrea, meine Frau, erzählte es mir – und war es auch, die es, noch vor mir, entschied: »Da bewirbst du dich«, sagte sie. »Gleich morgen rufst du an!« Es ärgerte mich, dass sie nicht damit warten konnte, dass sie es sagte, während noch ihre Freundin Johanna da war; und dass nicht einmal ein Gespräch mit mir daraus wurde: Sie sagte es, und dann wandte sie sich wieder an Johanna, und die beiden redeten weiter von Weihnachtsbäckerei. Ihrer beider Meinung nach bekam man heutzutage kein ordentliches Weihnachtsgebäck mehr zu kaufen; alles, von den Keksen angefangen, sei heute zu groß, und dabei müsse gerade dergleichen doch klein und zierlich sein. Unversehens redeten sie dann von der neuen Autobahnauffahrt ein paar Dörfer weiter, die ihnen – wie auch mir und wie vielen – ein Dorn im Auge war. Ja, es ärgerte und störte mich, diese Art: Auch wenn es nicht als Befehl gemeint war, klang es so. Ich setzte mich ins Wohnzimmer und schaltete den Fernseher ein. Nun hörte ich die Stimmen aus der Küche nicht mehr. Ich sah ein, dass Andrea in der Sache recht hatte und ich selbst ebenso entschieden hätte, und ich schob meinen Ärger weg. Am nächsten Tag rief ich wirklich an und wurde prompt zu einem Vorstellungstermin eingeladen. Mir ging das alles beinah zu schnell. Gerade hatte ich noch Zeit, meine Unterlagen zusammenzustellen und mir das geforderte Motivationsschreiben abzuringen und auf Andreas elektronischer Schreibmaschine zu tippen, bevor der Termin da war und ich nach Linz fahren musste.
Dort hatte ich ein seltsames Gefühl, das ich zuerst nicht wiedererkannte: Es war das verhasste Gefühl, auf dem Prüfstand zu stehen – das Gefühl, weshalb ich den Zimmerei-Meisterkurs zwar besucht, zur abschließenden Prüfung aber nie angetreten war. Mit jeder Äußerung, so kam mir vor, als ich in dem kahlen, anonymen Büro stand, unterstrich ich mein Scheitern, das mir längst, schon mit dem ersten, mich bei meinem Eintreten musternden Blick der Dame in Schwarz, besiegelt schien. Ich hatte ja auch gar keine Ahnung vom Finanzwesen. Auf dem Heimweg war ich unendlich und unbestimmt froh, und noch zu Hause war ich froh. Andrea öffnete mir die Haustür und strahlte mich an und fragte:
»Und?«
»Ja«, sagte ich, »ich war dort.«
»Hast du den Job?«
»Nein«, sagte ich, und sie ließ meine Hände los, drehte sich um, ging in die Küche und wandte sich wieder dem Abwasch zu. Ich folgte ihr und wischte meine Hände an meiner Hose ab.
»Ich weiß es nicht«, sagte ich, mich unbestimmt erschöpft gegen die Anrichte neben der Abwasch lehnend, aber sie hörte mich durch das Plätschern und das Rauschen des Wassers hindurch wohl nicht. »Sie rufen an«, sagte ich und wusste, dass es, obwohl aufrichtig, wie eine schlechte Entschuldigung klang.
Ich nahm ein Bier aus dem Kühlschrank und setzte mich vor das Haus. Der Kopf des Nachbarn tauchte hinter der Thujenhecke auf, eigentlich nur sein blauer Sonnenhut; er wanderte, im langsamen Schrittrhythmus wie ein Boot schaukelnd, ein paar Meter von da nach dort. Später ging nach einigen Startversuchen ein Rasenmäher scheppernd an, schnurrte und ging wieder aus. Als ich mit einem energischen Kopfschütteln aufhörte nachzudenken, nahm ich das einsilbige Geklingel von Schraubschlüsseln wahr. Es war spät am Abend, und obwohl der Sommer schon beinah vorbei war, herrschte immer noch eine schweißtreibende Hitze; das Bier war eiskalt und machte mich ganz leicht, mit jedem Schluck leichter.
Wenige Tage später läutete das Telefon, und ich nahm gedankenverloren, zugleich ergeben ab. In letzter Zeit bekam ich fast nur noch Anrufe von Leuten, die, zum Teil sehr ungeduldig, nachfragten, was mit dem von mir versprochenen Zeitungs-Probeabonnement sei, das ich ihnen als Gegenleistung im Zuge einer aufwendigen Umfrage im Namen eines bestimmten Unternehmens versprochen hatte. Es war um Tiefkühlprodukte gegangen. Was sollte ich sagen? Ich selbst hatte nicht einmal das vereinbarte Honorar bekommen. Als ich versuchte, jemanden zu erreichen und zur Rede zu stellen, wurde ich vertröstet, so lange, bis ich es aufgab. Ich sagte immer dasselbe – irgendetwas. Und ich hoffte, die Leute wären vergesslich oder zumindest, ja, so ergeben, wie ich es war.
Wider alle Erwartung war, als ich abhob, die Frau in Schwarz (ich sah sie deutlich vor mir, samt Namensschild auf ihrem Tisch, aber konnte mir diesen Doppelnamen nicht merken) am anderen Ende der Leitung. Sie stellte sich wohl vor – ich jedoch identifizierte sie anhand ihrer Stimme. Sie sagte mir, dass ich sie überzeugt hätte. Ich könne und solle sofort anfangen. Sprachlos hörte ich zu. War es mir recht? Noch am Telefon wurde mir jemand zugeteilt, der mich einschulen, mich in der ersten Zeit begleiten würde.
»Andrea«, rief ich ins Wohnzimmer, nachdem ich aufgelegt hatte.
Bis vor drei Jahren hatten wir ein alles in allem sehr angenehmes Leben geführt. Die Sorgen, die wir bis dahin gehabt hatten, waren selten Geldsorgen, und wenn, dann waren es nie große gewesen. Lange, ohne es uns vor Augen zu halten, sogar ohne es richtig zu bedenken, zehrten wir von dem angesparten Geld – auch von der Abfindung, die mir ausbezahlt worden war. Aber von dem einen Tag an, als ich zum ersten Mal, seit ich ein Konto besaß, fast unmerklich in das Minus geriet, war es, als führten wir ein neues Leben, nicht nur eine, sondern gleich mehrere Stufen unterhalb von jenem, welches wir bisher gewohnt gewesen waren. Bisweilen kam es mir richtiggehend verhext vor, denn äußerlich hatte sich nichts verändert; nur kam ich nun nicht mehr aus diesem Minusbereich heraus, rutschte immer wieder hinein, als wäre mit dem einmaligen Überziehen etwas endgültig und unwiderruflich gekippt. Kaum je war jetzt einmal genug Geld da, um länger als zwei, drei Wochen sorgenlos dahinleben zu können. Jede Ausgabe wollte gut überlegt sein. Immer öfter verlor ich eine Arbeit und musste mir eine neue suchen. Als dann mit einem Mal alle Welt von der Krise sprach, wurden die ohnehin spärlichen Jobangebote noch einmal rarer. Eine Zeitlang inserierte gar niemand mehr: Die Zeitung wurde dünner. Auf der Bank hatte man längst einen neuen Blick für mich. Vielleicht hätte mich das alles gar nicht besonders gestört, oder nicht so rasch, wäre nicht Andrea gewesen, die es mir jeden Tag – und, wie mir vorkam, jeden Tag unerbittlicher – vorhielt. Sie hasste die Sorgen, die offenbar für sie eine ganz andere Dimension hatten als für mich, und sie hasste das Überlegen – sie hasste, rief sie einmal mit entwaffnender Ehrlichkeit, den Abstieg. Sie war völlig außer sich, und sie war über diese Ehrlichkeit vielleicht ebenso verblüfft wie ich; denn nach dem Ausruf verstummte sie plötzlich – mit noch offenem Mund. So lange stand ihr schöner großer Mund offen, bis sie sich fing, ihn wieder schloss, sich umdrehte und das Wohnzimmer verließ. Manchmal, wenn ich zudem gerade ohne Arbeit war, entgegnete ich ihr, sie solle sich doch einen Job suchen, sie solle doch gehen und Geld verdienen, wenn sie meine, dass das so einfach sei. Dann schnaubte sie nur und lachte auf, und ich zuckte ratlos mit den Schultern.
»Andrea«, rief ich noch einmal.
»Ja«, hörte ich sie unendlich gelangweilt sagen.
Erst am Vorabend hatten wir einen bitteren Streit gehabt – es war dasselbe wie immer. Es war auch um Kinder gegangen. Kinder – allein den einfachen Gedanken daran – tat sie mit demselben abschätzigen Lachen ab wie den Gedanken, selbst Geld zu verdienen, wie sie es früher, als Verkäuferin einmal da, einmal dort, getan hatte. Ihr müdes Gesicht tauchte in der Tür auf.
»Mach eine Flasche Wein auf«, sagte ich, »ich habe eine Arbeit.«
Ich blickte sie nicht an, aber noch aus dem Augenwinkel sah ich, wie ihr Gesicht hell wurde.
Dann saßen wir, eng aneinander, auf der Terrasse und tranken Weißwein, und es kam mir vor wie beim ersten Mal. Ich spürte die süße Wärme ihrer Haare und hörte ihren ruhigen Atem, der nach nichts mehr fragte. Sie war auf einmal davon überzeugt, dass nun alles anders werden würde, und sie sagte es so oft, bis ich derselben Ansicht war. Wir saßen und schwiegen, und es war wunderbar. Der Abend ging über in Nacht, und wir saßen immer noch, und wäre nicht irgendwann der Wein zur Neige gegangen, ich wäre noch ewig sitzen geblieben, und es wäre mir nicht aufgefallen.
Frühmorgens am nächsten Tag fuhr ich wie vereinbart wieder nach Linz und unterschrieb einen Vertrag. Das Gehalt betrug knapp über dreitausend Euro. Noch nie hatte ich so viel verdient. Ich erhielt eine Menge Unterlagen, mit denen ich mich unverzüglich vertraut machen sollte, zudem eine lange, mehrseitige Liste mit Namen, dem alphabetisch geordneten Kundenstock. Später stieß ein sehr jung aussehender Mann dazu, der mein Ausbilder sein sollte, David Weider, der aber nur Herr Weider genannt werden wollte, was ich sofort lächerlich fand. Mit ihm vereinbarte ich, dass er am nächsten Tag zu mir nach Hause käme: Von dort aus würden wir die ersten Kunden besuchen.
Es begann eine sehr arbeitsreiche und anstrengende Zeit. Weider war bloß ein einziges Mal mitgekommen, danach hatte er sich nicht wieder blicken lassen, obwohl es anders besprochen gewesen war. Ich fuhr von Haus zu Haus und spulte, wenn man mich denn ließ, mein Programm, das ich von Weider übernommen hatte, herunter. Es war ganz einfach, und nur wenige zeigten mir ihren Zorn offen. Es mochte, dachte ich nach einer Weile, mit Peter zu tun haben. Im Grunde waren es ja sie gewesen, als Masse, Kollektiv, die ihn in den Tod getrieben hatten, indem sie ihm direkt und indirekt vorwarfen, ihr Geld verspekuliert zu haben. Jemand hatte ihm sogar die Autoreifen zerstochen, und, vermutlich, ein anderer hatte mit großen Feldsteinen mehrere Scheiben seines Hauses eingeschlagen; ich war kürzlich daran vorbeigekommen: noch immer waren keine neuen eingesetzt.
Als ich meine Stelle antrat, war die Welt gerade dabei, sich von der sogenannten Wirtschaftskrise zu erholen, und der Lauf der Welt schien exakt dort wieder einzusetzen, wo er vor einem Jahr ausgesetzt hatte. Nichts hatte sich verändert, nur manches hatte sich, wie behauptet wurde, reguliert. Da und dort gab es einen Prozess gegen Finanzberater, aber nichts Ernsthaftes. Bei einer Gelegenheit lernte ich einen der Geschäftsführer meines neuen Arbeitgebers kennen, und ich sprach ihn auf einen bestimmten Gerichtsprozess an, der eben durch die Medien lief. Ich befragte ihn zu seiner Meinung über den Ausgang des Prozesses. Da lachte er nur, legte mir die Hand auf die Schulter und sagte: »Mein lieber Kollege! Was soll schon herauskommen dabei? Die können uns ja nicht alle einsperren! Oder was glauben Sie?« Dann lachte er wieder, und die Umstehenden lachten mit, einer klatschte sogar, und ich lachte ebenso.
Die Tage: arbeitsreich und anstrengend. Und wenn ich am Abend wieder zu Hause war, arbeitete ich mich bis spät in die Nacht durch die Unterlagen, lernte und lernte.
Obwohl der erste Monat sehr rasch verging, kam es mir vor, als hätte er sehr viel länger als dreißig Tage gedauert, so viel war geschehen, so viel Neues hatte ich gesehen, gehört und gelernt. Mir fing das Ganze an, Vergnügen zu bereiten. Es war Arbeit.
Aber seit ich mich zu Herbert Hauser – der Mann in dem Haus am See – begeben hatte, war etwas anders geworden. Als hätte ich seither all den Schwung, den ich innerhalb eines Monats gewonnen hatte, verloren. Warum, wusste ich nicht; denn es war ja nichts geschehen. Es gab keinen Grund. Aber so war es: Von da an machte mir die Arbeit kaum noch Vergnügen. Immer wieder sah ich mich wie von außen, und es gefiel mir nicht, was ich sah: Ich hatte mein Gesicht verloren; kein Unterschied zwischen mir und Weider war mehr erkennbar.
Die Zeit verging nun zäh. Ein nicht enden wollender Tag folgte auf den nächsten; und seit dem Beginn der kalten Jahreshälfte hatte ich entgegen aller Augenscheinlichkeit das Gefühl, die Tage würden noch einmal länger dauern.
Und doch war es eine wundervolle Zeit, immer noch, wieder; denn Andrea war wie ausgewechselt, als hätte sie sich in die fröhliche, unbeschwerte Frau, die ich vor acht Jahren kennengelernt und vor fünf Jahren geheiratet hatte, zurückverwandelt. Andrea wirkte so glücklich, dass ich vergaß, es nicht zu sein.
Der Winter verging, und ich dachte, es liege vielleicht auch an der trostlosen lichtarmen Jahreszeit, dass die Leute mit mir keine Geschäfte machen wollten, dachte, es sei der Winter womöglich einfach nicht die richtige Zeit für dergleichen. Aber als es im Frühjahr, als die Farben wiederkehrten, so weiterging, wie es begonnen hatte, fing ich an, mir im Stillen Sorgen zu machen. Einmal im Monat wurde in der Bundeslandzentrale in Linz eine Liste mit den erfolgreichsten Beratern ausgehängt; und war mein Name zu Anfang nicht auf der Liste gestanden, fand ich ihn nun seit kurzem, aber schon regelmäßig, weit abgeschlagen auf dem letzten Platz.
Andrea hatte begonnen, von einem Kind zu sprechen, was sie in unserer ersten Zeit ebenfalls getan, dann plötzlich verweigert hatte; und sie redete nun plötzlich von einem Urlaub im Sommer, redete von Griechenland, wo sie als Sechzehnjährige einmal gewesen war und wovon sie seither träumte. Einmal redete sie von dem einen, dann wieder vom anderen. Und mit einem Mal fielen diese Reden dann zusammen, und sie verkündete freudig, sie wolle im Sommer mit mir nach Griechenland und dort ein Kind zeugen. Denn im Sommer wäre es zehn Jahre her, dass sie dort gewesen war. Sie malte sich alles genau aus, und ich hörte ihr oft dabei zu. Obwohl ich es mir dann und wann vornahm, erzählte ich ihr nichts von den Listen, nichts von den Kommentaren der Frau in Schwarz, erzählte nichts. Ich tat, wenn nötig, abends so, als liefe alles sehr gut, während ich untertags von einem manchmal mitleidigen, manchmal ratlosen und manchmal ärgerlichen Kopfschütteln zum nächsten zog.
Eines Abends Ende Mai saß ich in der Dorfwirtschaft, die ungewöhnlicherweise leer war, abgesehen von zwei Pensionisten, die, wie ich bald heraushörte, von Herbert Hauser redeten. In der Hauptsache sprachen sie davon, dass er ungeheuer reich sein müsse. Er stamme von hier, erklärte der eine dem anderen, aber dieser widersprach, und jener, der eben noch geredet hatte, verstummte. Dann sagte der andere, Hauser habe geerbt, das Haus und einen Haufen Geld. Sie redeten. Ich trank Bier, baute ein kleines Haus aus Bierdeckeln und hörte nur halb zu.
Später fragte ich Andrea, ob sie Hauser kenne. Sie sagte, sie erinnere sich schwach. War er nicht mit einer ihrer Schwestern in die Schule gegangen? Er wohne jetzt in dem Haus am See, sagte ich. Und sie antwortete: »Eine solche Villa hätte ich auch gerne«, und ich schaltete verstimmt über diese Antwort den Fernseher ein.
Am nächsten Morgen, als ich eben mit über die Schulter geworfenem Sakko aus dem Haus ging, kam Weider angefahren.
Wir müssten reden, sagte er nach einer knappen Begrüßung, und ich zuckte mit den Schultern und nickte, und wir gingen gemeinsam ins Haus zurück. Andrea warf, Weider erblickend, die Zeitung von sich, sprang vom Tisch auf und verschwand im Badezimmer; sie war noch im Nachthemd. Ich seufzte und hängte das Sakko über eine Stuhllehne. Weider setzte sich, und ich machte erst danach eine undeutlich einladende Geste und setzte mich selbst – als hätte die Geste mir gegolten. Er legte seinen Koffer auf den Tisch, öffnete ihn, nahm Papiere heraus, schloss den Koffer und schob ihn an den Rand. Mehrmals räusperte er sich. Nicht einmal blickte er mir in die Augen. Als hätte ich die Listen nicht schon mehrmals in Linz gesehen, breitete Weider sie in aller Langsamkeit eine neben der anderen vor mir auf dem Küchentisch aus. Wir saßen uns gegenüber, und er legte die Listen so hin, dass ich sie lesen konnte. Als hätte ich sie noch nie gesehen; und als wüsste ich nicht oder hätte ich nicht verstanden, was sie bedeuteten, setzte er sie mir so hartnäckig auseinander, dass es mir geradezu boshaft vorkam. Die Kunden liefen scharenweise davon. Hier waren die Zahlen dazu. Andrea, jetzt in ausgewaschenen blauen Jeans und einer Bluse, aber immer noch barfuß, hatte am anderen Ende des Tischs Platz genommen, und ich brachte es nicht über mich, sie zu bitten, uns alleine zu lassen. Ich spürte, wie sie die ganze Zeit über nur mich betrachtete, nur mich. Es kam mir grotesk vor, hier, in meinem Haus, von einem gerade einmal Zwanzigjährigen gemaßregelt zu werden. Er redete und redete, erklärte mir alles Mögliche zu diesen – uns beiden; aber je unterschiedlich – unfassbaren Ziffern, und ich hörte längst nur noch von fern, was er von sich gab, und wartete. Wie beim Zahnarzt ließ ich meine Gedanken in irgendeine Ferne schweifen, um dem Jetzt zu entkommen. Ich wartete, bis er zu Ende geredet hatte. Dann standen wir fast gleichzeitig auf. Er ging zur Tür, und ich begleitete ihn. Ich sah ihm nach und sagte, weil mir sonst nichts einfiel: »Bis zum nächsten Mal.«
Da blieb er starr stehen, drehte sich um und blickte mich erstaunt an. Er kam ein paar Schritte, sehr gemessen, auf mich zu. Er zog langsam den Blick, den er mit dem Näherkommen wieder gesenkt hatte, von seinen Schuhspitzen hoch und sah mich an.
»Unsere Zusammenarbeit«, sagte er mit einem mir neuen Ton und fuhr sich mit seiner bläulichen Zunge über die Lippen, »ist beendet.«
Es klang, als redete er mit einem Idioten. Hatte er denn das zuvor schon gesagt, und ich hatte es überhört? Es war gleichgültig. Damit drehte er sich um. Als er in sein Auto stieg, blähte ich die Backen, zog die Brauen hoch, ließ die Luft aus meinem Mund und murmelte: »Ah ja. Ah ja. Beendet. Ah ja.« Ich nickte und redete wie ein Dummkopf – war für ein paar Sekunden der Idiot, als den er mich eben behandelt hatte, geworden. Dabei hätte ich ihn am liebsten an den Ohren gepackt und aus dem Auto gezerrt und ihm einem solchen Tritt verpasst, dass er nach Hause, nach Linz oder Wels oder Steyr oder sonstwohin geflogen wäre.
Eine Woche lang sprach Andrea nicht mit mir, und ich hielt es für das Beste, sie zu lassen, und als die Woche vorüber war, packte sie ihre Koffer.
»Was wird das, wenn es fertig ist?«, fragte ich sie.
Sie antwortete nicht und packte weiter; nicht einmal den Kopf hatte sie gehoben. Ihre Bewegungen kamen mir ebenso stur vor wie die einer Akkordarbeiterin. Es war früher Nachmittag. Ein paar Minuten lang sah ich ihr zu, dann ging ich nach unten, nahm die dünne Jacke von der Garderobe, warf sie mir über die Schulter und verließ das Haus. Nach kaum hundert Metern hielt ich inne und machte kehrt; ich hatte das Bedürfnis, meine Turnschuhe gegen die schwereren Bergschuhe zu tauschen. Während ich die Schuhbänder schnürte, hörte ich, wie im Obergeschoss in mehreren Versuchen ein langer, in der Mitte klemmender Reißverschluss zugezogen wurde. Wenig später verließ ich das Dorf auf der Straße Richtung See. Zunächst spazierte ich einfach dahin, froh über das Gehen und die Bergschuhe, in denen mir, wie jedes Mal, vorkam, ein anderer ginge für mich, und dachte an nichts; aber je länger ich spazierte, desto mehr Gedanken kamen mir.
Am See angelangt, drang ich durch den Waldstreifen und hockte mich an den Strand. Ich war von den Bäumen und von einem hohen Beifußstrauch geschützt und konnte den leichten Wind nicht spüren, der aufgekommen war, wie ich an der Wasseroberfläche sah, die von Südwesten nach Nordosten getrieben wurde. Die Wellen schlugen gegen das Ufer, einmal rhythmisch, dann wieder unrhythmisch, und es klang, als spielte jemand auf einem Xylophon aus Wasser. Ich warf ein paar Steine; schwer plumpsten sie in den See. Am Ufer bildete das Wasser einen schmalen, bräunlichen Saum; ein wenig weiter draußen bekam es einen gelblichen Ton, noch weiter draußen wurde es tiefgrün, bevor es sich schließlich in Tiefblau bis ans andere Ufer erstreckte. Über dem Haus stieg ein dünner Faden Rauch aus einem Schornstein in den Himmel. Ob er wohl wieder auf der Terrasse sitzt, fragte ich mich. Ich konnte nichts erkennen. Die Felswand hinter dem Seeufer färbte sich langsam zartrot, und allmählich begann auch der See, dieses Rosa anzunehmen. Die Sonne war untergegangen, und ein zunehmender Mond von der Farbe eines Kohlweißlings hatte sich im östlichen, verblassenden Himmel emporgeschoben; er sah aus wie hingemalt. Immer wieder war ich den vergangenen Monaten an dieser Stelle gehockt.
Es war spät, als ich nach Hause kam. Auf dem Heimweg war ich noch in eine Wirtschaft eingekehrt und hatte ein paar Gläser Bier getrunken und dabei die Zeit übersehen. Oder hatte ich sie schon davor, am See hockend, übersehen? Jedes Glas war wieder außen nass gewesen. Obwohl ich der Kellnerin beim Zapfen genau zusah, drang ich nicht dahinter, wie das zustande kam; vielleicht waren ihre Hände nass, und ich hatte es nicht bemerkt. Ich blieb vor meinem Haus stehen: Nur die Lichter der Straßenlaternen glänzten in den Fenstern, und in der Scheibe des Schlafzimmers zuckte ein Licht; eine Laterne hatte seit Monaten einen Wackelkontakt, und obwohl ich es bereits am Gemeindeamt gemeldet hatte, war noch niemand gekommen, um sie zu reparieren. Die Garage stand offen und leer.
Sofort hatte ich ihn gesehen, aber ich las den Zettel nicht, der auf dem Tisch lag, beschwert von dem Gebetswürfel, der sonst immer auf der Anrichte lag, weil wir ihn nicht mehr verwendeten. Ich las ihn nicht, sondern zerknüllte ihn und warf ihn in den kalten Ofen. In dem Moment wusste ich alles, was zu wissen war – wusste, dass sie weg war und nicht wiederkehren würde, und es war mir egal, ja, es war mir sogar recht. Ich war wütend. Der Anrufbeantworter blinkte. Ich hörte ihn ab. Mein Bruder hatte etwas draufgesprochen, das kaum zu verstehen war; er hatte von einer Bar im Nachbarort angerufen. Nachdem ich lange im Haus auf und ab gegangen war, nahm ich das Fahrrad aus der Garage und fuhr hin.
Mein Bruder, Zimmermann wie ich einmal, hatte an diesem Tag, vor wenigen Stunden, seine Meisterprüfung bestanden. Jetzt feierte er mit seiner Freundin und einigen Freunden. So musste es sein – wurde mir auf der Fahrt klar. Ich hatte diesen Termin vergessen. Viele Bilder standen plötzlich vor mir während dieser Fahrt und wurden zu einem Film – mir war, als radelte ich durch einen Film. Die Bilder standen und flogen vorbei wie Strom-, wie Telegraphenmasten. Lange war ich nicht mehr in dieser Bar gewesen, in der ich früher beinah täglich nach der Arbeit gesessen war, Bier getrunken und Karten gespielt hatte. Seit ich nicht mehr richtig arbeiten konnte, hatte ich mich ganz allmählich immer weniger zugehörig gefühlt, und auf einmal sogar fehl am Platz, und schließlich war ich nicht mehr hierhergekommen. Denn wozu dort mit den anderen sitzen, wenn ich eine Anspielung auf etwas am Tag oder Vortag oder vor einem Monat Geschehenes nicht mehr verstand? Es ging mir nicht ums Mitreden; aber mitgelacht hätte ich gerne noch; und als das nicht mehr ging, blieb ich fern, und die Welt wurde von einem Tag auf den anderen kleiner.
Ich stand im Dunkel vor dem Lokal und blickte durch das Fenster nach innen; ich konnte mich nicht entschließen einzutreten. Aber dann ging über der Tür eine Lampe an, und ich hörte auf, zur Nacht gehörig und unsichtbar zu sein, und ehe ich einen Schritt zurück, aus dem Licht, machen konnte, sah mein Bruder mich durchs Fenster, kam heraus, fasste mich an der Schulter, und wir gingen zusammen hinein. Auf einmal, in seiner Gegenwart, konnte ich von mir absehen, mich vergessen. Eben noch hatte er sich an der Theke stehend mit einem mir Unbekannten unterhalten, nun führte er mich an den Tisch, an dem er davor gesessen war und wo seine Jacke hing, und ich begrüßte die Runde, jeden mit Handschlag, und setzte mich dazu. Mein Bruder – mit einem schnellen Blick zählte er die Gläser, deren Inhalt zur Neige ging – rief der Kellnerin, die eben mit wehendem Rock vorbeiwischte, laut zu, sie solle noch vier Bier bringen. Und als sie sich im Gehen umdrehte und fragte: »Wie?«, antwortete er: »Schnell!«, und wir lachten.
Unter seinen Freunden waren auch zwei meiner ehemaligen Arbeitskollegen; sie hatten die Firma gewechselt, arbeiteten jetzt anderswo, für jemand anderen. Ich hatte seit langem nicht mehr mit ihnen gesprochen, sie kaum je einmal gesehen, und so war die Wiedersehensfreude groß. Derart versank ich von der ersten Minute an in diesem Fest, dass ich nicht einmal daran dachte, dass gerade diese beiden, die zwar nicht miteinander verwandt waren, aber dennoch denselben Familiennamen trugen, die nächsten auf meiner abzuarbeitenden, nun hinfällig gewordenen Liste gewesen wären. Zu Hause auf dem Schreibtisch lagen seit über einer Woche nebeneinander zwei Stapel Informationsmaterial, auf jedem klebte ein gelber quadratischer Zettel, und auf dem einen stand der Name desjenigen, der mir nun gegenübersaß, auf dem anderen der desjenigen, der neben mir saß. Ich blickte ihnen in die Augen, redete mit ihnen, stundenlang, und ich dachte nicht daran. Das in der Gegend gebraute Bier war eiskalt und herb und schmeckte, wie immer, vom Fass noch einmal besser als aus der Flasche. Ich hatte das Gefühl, der Abend, die Nacht dauerten ewig, und diese Ewigkeit war wunderbar.
Am nächsten Morgen wusste ich nicht, wie ich nach Hause gekommen war. Ich schlug die Augen auf und wunderte mich, in meinem Bett zu sein; in Gedanken war ich noch ganz in der Bar. Andrea war nicht da; ihr Kopfpolster lag wie am Vorabend auf dem Boden. Mir war heiß, und mein Kopf dröhnte. Nachdem ich aufgestanden war und in der Küche eine Tablette aus der Verpackung gedrückt und geschluckt hatte, blickte ich aus dem Fenster: Die Garage war leer. Ich stand lange dort und schaute hinaus. Es gab nichts zu sehen. Später rief ich meinen Bruder an. Es dauerte, bis eine Verbindung hergestellt war, und dann hörte ich es im Wohnzimmer klingeln; ich ging durch die Küche, zog die Tür auf und sah meinen Bruder auf einer zitronengelben Campingmatte am Boden liegen. Er starrte stirnrunzelnd an die Decke. Neben ihm lagen sein Mobiltelefon und ein zerknitterter Zettel.
»Morgen«, sagte ich, und er antwortete: »Was ist morgen?«
Jetzt grinste er mit müdem und zerstörtem Gesicht. Ich warf ihm die Tablettenschachtel zu. Er legte sie neben sich. Ich hauchte mir in die Hand. Wieder fiel mein Blick auf den Zettel neben ihm, und ich begriff.
»Hast du den Brief gelesen?«
»Ja«, antwortete er. »Mir war kalt, und ich wollte Feuer machen.«
»Wir haben schon fast Juni.«
»Mir war trotzdem kalt.«
»Und«, fragte ich, »was steht drin?«
Erstaunt sah er mich an.
»Hast du ihn denn nicht gelesen?«
»Nein.«
Er klang immer noch betrunken, seine Stimme war brüchig und rau. Mühsam richtete er sich auf und fasste sich an die Knie und rieb sie.
»Ja«, sagte er, »was steht drin. Dass du ein verdammter Lügner bist. Und ein Taugenichts. Das steht da mehrmals. Mit anderen Worten.«
Mir war übel. Weshalb lag er in meinem Wohnzimmer? Ich ging in die Speisekammer und holte eine Flasche Mineralwasser. Meine Haut brannte, und ich hatte ungeheuren Durst. Ich konnte mich nicht erinnern, aber ich roch, dass wir Schnaps getrunken hatten, Tequila oder Rum. Aber wahrscheinlich Birnenschnaps. Wenn ich zu viel trank, wollte ich immer irgendwann den Birnenschnaps. Es war elend. Als ich in das Wohnzimmer zurückkehrte, lag er wieder, jetzt zur Seite gedreht, ein Bein angezogen; es sah aus, als wäre er hingefallen. Es schien ihm egal zu sein, dass ich ihn unverhohlen beobachtete. Oder er merkte es nicht.
»Hast du keinen Brand?«, fragte ich.
»Doch«, sagte er und streckte den Arm in meine Richtung aus, »und was für einen. Als hätte ich die Hölle verschluckt.«
Ich gab ihm die Flasche und setzte mich auf die Couch. Dann lag mein Kopf schwer und fremd wie ein Fels in meinen Händen. Die Kohlensäure zischte und säuselte. Was hatte das alles mit mir zu tun, und was ging es mich an?
»Wie sind wir eigentlich nach Hause gekommen?«, fragte ich.
»Ich weiß es nicht«, antwortete er, drückte eine Tablette aus der Packung und schluckte sie. »Ich weiß nicht einmal, warum ich hier bin und nicht bei mir zu Hause. Und meine Geldtasche und die Schlüssel sind auch weg.«
Ich schaltete den Fernseher ein und las die Schlagzeilen im Teletext; dann las ich, ebenfalls meiner Gewohnheit entsprechend, den Wetterbericht und schaltete wieder ab.
»Gibt es was Neues?«, fragte er.
Ich zuckte mit den Schultern. Nichts von dem Gelesenen hatte ich behalten.
»Nicht viel«, sagte ich.
Erst jetzt bemerkte ich, dass ein Fenster offen stand; der Vorhang hatte sich stark nach außen gebläht. Wie von unsichtbarer Hand gezogen und geformt. Draußen hörte ich es in der Heckenrose rascheln, und kurz darauf setzte der Gesang eines Amselpaars ein – es klang wie ein Gespräch. Mir fiel das Gefühl ein, das ich hatte, als wir die Bar betraten. Wann war es mir mit Andrea zum letzten Mal geschehen, dass ich sie und mich nicht als zwei scharf voneinander abgegrenzte Einzelne, sondern als eins empfunden hatte? Der Wind ließ den Vorhang los. Ich fragte meinen Bruder, wie es ihm mit Marion gehe. Gut gehe es, sagte er und verzog das Gesicht, um daraufhin die rechte Schulter mehrmals zu kreisen; leise krachte das Gelenk. Sie würden im nächsten Jahr heiraten, im Mai.
»Ja?«, sagte ich.
»Ja«, sagte er, »sie will es, und mir ist es recht. Warum auch nicht? Wir verstehen uns.«
Es werde Zeit, dass er von der Baustelle weg und ins Büro komme, sagte er nach einer langen Pause. Ich schloss die Augen und spürte jeden meiner Wirbel.
Als ich Schotterknirschen hörte, zog es in meinen Eingeweiden, und ich ging in die Küche, um dort aus dem Fenster zu blicken. Aber es war nicht Andrea, sondern Marion. Das Ziehen ließ nach. Kein Gedanke kam mir. Marions Hand war ausgestreckt zur Klingel, als ich schon die Tür aufzog. Nach einer kurzen Begrüßung ging sie, die Luft vor sich mit der Hand wegfächernd, an mir vorbei, schnurstracks ins Wohnzimmer. Ich ging ihr nach. Knapp vor meinem Bruder blieb sie stehen, stemmte die Hände in die Hüften und sagte:
»Na, du Säufer? Ausgeschlafen?«
Noch einmal blickte ich, mich umdrehend, aus dem Fenster; nur ihr Auto stand da und glänzte weiß in dem lichten Morgen, kein weiteres. War Andrea zu ihren Eltern gefahren? Zu einer ihrer Schwestern? Es sei ganz schön anstrengend gewesen, uns beide hierherzuschaffen, hörte ich Marion sagen. Ich konnte nicht bestimmen, ob sie zornig war oder nicht. Aber wie auch immer es gemeint war: Alles klang selbstverständlich, wie gerade entstanden. Bei Andrea klang es immer wie auswendig gelernt und nie spontan. Man hörte ihr Denken mit, wenn sie redete. Ein Spatz flatterte ein paar unzählbare Flügelschläge lang über dem Autodach. Mehrmals hörte ich meinen Bruder hartnäckig und doch etwas kleinlaut beteuern, das wisse er doch alles.
Marion kam nach einer Weile wieder in die Küche, und jetzt lächelte sie mich an. Das Gespräch war zu Ende. Dann bereitete sie Kaffee zu und bewegte sich dabei in der Küche, als wäre es ihre eigene. Kein Zögern, und kein Handgriff saß nicht. Ich dachte an früher, als ich noch als Zimmermann gearbeitet hatte. War sie jemals hier gewesen? Nicht öfter als einmal, meinte ich. Endlich erhob sich mein Bruder mit einem lauten Ächzen, und wir setzten uns alle an den Tisch. Ich hatte in der Speisekammer Kekse gefunden, die ich auf einen Teller schüttete und in die Tischmitte stellte. Wenn Andrea und ich Streit hatten, weigerte sie sich zu kochen und ernährte sich tagelang ausschließlich von diesen trockenen Vollkornkeksen – von denen sich nun nur Marion bediente. Mein Bruder fragte, vor sich hinstierend, ob ich keine Kartoffelchips oder Salzstangen hätte. Der Kaffee dampfte und war sehr stark; schon nach den ersten Schlucken begann mein Herz, schneller und, wie mir vorkam, dann und wann unrhythmisch zu schlagen. Und doch trank ich, wie auch die anderen, nach der ersten Tasse eine zweite.