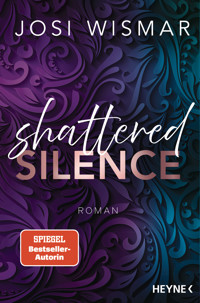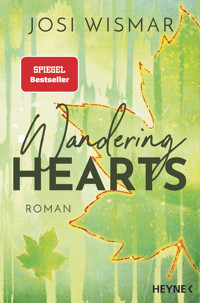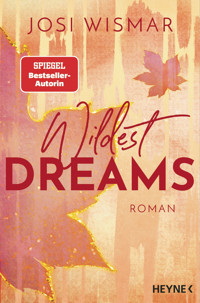
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Wild-Hearts-Reihe
- Sprache: Deutsch
Wenn wilde Herzen und atemberaubende Natur aufeinandertreffen
Zwei Jahre sind vergangen, seit Tara Kanada überstürzt verlassen musste. Zwei Jahre, seit Jaimie und sie sich zuletzt gesehen haben. Auch wenn die Zeit in Kanada mit schmerzhaften Erinnerungen verbunden ist, wagt sie einen Neuanfang und zieht nach Vancouver. Als sie dort auf Jaimie trifft, ist sie schockiert. Obwohl sie weiß, dass er immer noch verletzt ist, kann sie sich nicht von ihm fernhalten. Doch er hat sich verändert. Was ist passiert, dass er so gebrochen wirkt? Während Tara sich bemüht, einen Job in einer Tierklinik zu finden, kämpft Jaimie zusehends mit den Schatten seiner Vergangenheit. Bei einem gemeinsamen Ausflug in die Berge flammen alte Gefühle wieder auf, und einen wunderbaren Moment lang sieht es so aus, als würde ihre Liebe eine zweite Chance bekommen. Doch manche Wunden heilen nie vollkommen ...
Josi Wismar ist #BookTok Autorin des Jahres 2024!
Spice-Level: 3 von 5
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 473
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Das Buch
Zwei Jahre sind vergangen, seit Tara Kanada überstürzt verlassen musste. Zwei Jahre, seit Jaimie und sie sich zuletzt gesehen haben. Auch wenn die Zeit in Kanada mit schmerzhaften Erinnerungen verbunden ist, wagt sie einen Neuanfang und zieht nach Vancouver. Als sie dort auf Jaimie trifft, ist sie schockiert. Obwohl sie weiß, dass er immer noch verletzt ist, kann sie sich nicht von ihm fernhalten. Doch er hat sich verändert. Was ist passiert, dass er so gebrochen wirkt? Während Tara sich bemüht, einen Job in einer Tierklinik zu finden, kämpft Jaimie zusehends mit den Schatten seiner Vergangenheit. Bei einem gemeinsamen Ausflug in die Berge flammen alte Gefühle wieder auf, und einen wunderbaren Moment lang sieht es so aus, als würde ihre Liebe eine zweite Chance bekommen. Doch manche Wunden heilen nie vollkommen …
Die Autorin
Josi Wismar studiert Buchwissenschaft in Mainz, und fast ihr gesamtes Leben ist mit der Buchbranche verknüpft. Auf ihren Social-Media-Kanälen tauscht sie sich gerne mit ihren Leser*innen aus, schreibt in Livestreams gemeinsam mit der Community an ihrem neuesten Buch und verbringt einen gefährlich großen Teil ihrer Bildschirmzeit auf BookTok. Wenn sie nicht gerade versucht, für ihren Buch-Podcast #Ausgelesen mehr zu lesen als ihre Podcast-Partnerin Sarah, steht sie auf dem Fußballplatz oder vermisst die Berge, in die sie ganz dringend mal wieder fahren muss.
Lieferbare Titel
Words I Keep
Words You Need
Words We Share
Wandering Hearts
JOSI WISMAR
Roman
Band 2 der Wild Hearts-Dilogie
WILHELM HEYNE VERLAG MÜNCHEN
Liebe Leser*innen,dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte. Deshalb findet sich auf der letzten Seite eine Contentwarnung. Achtung: Diese enthält Spoiler für das gesamte Buch. Wir wünschen allen das bestmögliche Leseerlebnis.Josi Wismar und der Heyne VerlagDer Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Originalausgabe 10/2024
© Josi Wismar 2024
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Michael Gaeb.
Copyright © 2024 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Silvana Schmidt
Umschlaggestaltung: bürosüd, www.buerosued.de
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-30259-7V002
www.heyne.de
Für JuliIch sehe dich. Glaub mir, ich sehe dich und bin jeden Tag unglaublich stolz. Auf dich, den Menschen, der du bist, und dass ich deine Schwester sein darf.Du machst das schon, Lütte.
KAPITEL 1
Tara
Packlisten zu schreiben, war mir schon immer leichtgefallen.
Aber wie schreibt man eine Packliste, wenn man nicht mehr zurückkommt? Wenn das kein Urlaub ist, für den man packt, sondern ein neues Leben?
Ich schob den Gedanken an später beiseite und konzentrierte mich auf den Computer vor mir. Einen letzten Tag hatte ich in der Praxis meiner Eltern gearbeitet. Einen letzten Tag hatte ich Haustiere behandelt, während die Stimme meines Bruders durch die dünne Wand seines Behandlungszimmers zu mir rübergedrungen war. Ich speicherte zum dritten Mal meinen Behandlungsordner auf dem Praxis-PC ab und schaltete ihn dann aus. Ab Montag würde eine neue Ärztin hier anfangen, die die Praxis zusammen mit meinem Bruder Matty leiten würde. Mich ersetzen, während ich nach Kanada auswanderte.
Ich ging immer und immer wieder durch, was ich hier noch erledigen musste. An meinem letzten Tag in der Praxis. Ich schielte auf die Notiz auf meinem Handy und war froh, dass ich als Einzige länger geblieben war, während es verdächtig hinter meinen Augen brannte. Kurz und schmerzlos hatte ich mich von allen verabschiedet. Es ist ja nicht für immer, aus Gewohnheit gesagt, auch wenn das eine Lüge war. Es war für immer. Ich verließ diese Praxis, ich verließ Deutschland, ich verließ meine Familie. Zumindest den Teil, der noch davon übrig war.
Licht ausschalten und abschließen.
Der einzige Punkt, vor den ich noch keinen Haken gesetzt hatte. Also ließ ich meine Hand ein letztes Mal über den Lichtschalter gleiten und starrte in die Dunkelheit vor mir. Die Ruhe, die über der Tierarztpraxis lag, war selten und doch seltsam vertraut. Die Befriedigung, die mich überkam, breitete sich in meinem ganzen Körper aus, und ich deutete es als Zeichen, dass ich das Richtige tat. Dass die Last, die da war, seit ich gesagt hatte, dass ich die Praxis zusammen mit Matty übernehmen würde, endlich abfiel.
Der Schlüssel drehte sich klirrend im Schloss, und ich atmete ein letztes Mal ein und aus.
Das war’s. Das war es wirklich gewesen.
»Hast du auch an alles gedacht?« Mein Vater saß mir gegenüber an unserem massiven Esstisch, der mir viel zu groß vorkam, seit wir nur noch zu dritt waren.
»Ich vergesse ja immer meine Ladekabel. Hast du die alle? Für Laptop und Handy und eReader und was du sonst noch alles hast?« Er tippte ein paarmal mit der Gabel in der Luft herum, und die Kartoffel, die darauf aufgespießt war, wackelte gefährlich.
»Ja, Papa.« Ich lachte leise, während sich die Erinnerung an meinen letzten Flug nach Kanada in den Vordergrund schlich. Am Abend davor hatten wir auch an diesem Tisch gesessen und gegessen. Gemeinsam mit meiner Mutter. Sie und mein Vater hatten vehement so getan, als würde ich nicht fliegen. Weil sie es nicht gewollt hatten. Heute verstand ich, warum. Zumindest teilweise. So ganz würde es nie in meinen Kopf gehen, warum man seinem Kind so etwas verheimlichte, auch wenn man glaubte, die eigenen Kinder auf diese Weise zu schützen.
»Was ist los, Tara?« Matty lehnte sich zu mir rüber und schaute mich besorgt an.
»Es ist gerade alles etwas viel«, antwortete ich wahrheitsgemäß, auch wenn diese Worte wenig hilfreich waren. »Ich frage mich einfach, ob ich das Richtige tue.« Mein Blick glitt zu dem leeren Platz neben meinem Vater. »Ich weiß, dass ihr beide immer wolltet, dass Matty und ich die Praxis übernehmen.« Schuldbewusst musterte ich meinen Vater. »Und jetzt … gehe ich einfach … schon wieder.« Ich wollte diese starke, selbstbewusste Frau sein, die zu ihren Entscheidungen stand. Schließlich hatte ich nicht leichtfertig beschlossen, nach Kanada zu ziehen. Und an den meisten Tagen konnte ich das auch sein. Aber eben nicht immer. Und vor allem nicht dann, wenn ich dem leeren Platz meiner Mutter gegenübersaß, am Abend, bevor mein Flug ging. Der Flug, für den ich ein One-Way-Ticket gebucht hatte.
»Wir haben das doch schon durchgesprochen, Tara.« Mein Vater sah mich mitfühlend an. »Du hast die letzten zwei Jahre alles für uns getan.« Er machte eine kurze Pause und sah mich eindringlich an. »Für mich«, fügte er hinzu und legte den Kopf leicht schief. »Jetzt wird es Zeit, dass du etwas für dich tust.« Matty, der neben mir saß, griff bei den Worten unseres Vaters meine Hand. Ich nickte sanft.
»Danke, Papa.« Meine Stimme kaum mehr als ein Krächzen. Wochenlang hatten wir darüber gesprochen, dass ich nicht zufrieden war.
»Ich will dich doch nur glücklich machen.« Ich presste die Lippen aufeinander, wusste nicht, woher diese Worte kamen. Mein Vater seufzte leise, aber es schwang kein Vorwurf darin mit. Vielmehr Verständnis und Liebe.
»Ich will vor allem, dass du dich selbst glücklich machst, Tara, Liebling.« Mein Vater schluckte, und ich bemerkte, wie seine Schultern sich leicht verspannten. »Das ist mein Job als Vater. Auch wenn ich diesen in den letzten Jahren eher weniger gut gemacht habe. Ich habe viel aufzuholen, weißt du.« Er lachte leise, aber das Lachen erreichte seine Augen nicht. Wir alle hatten Fehler gemacht. Allen voran er und meine Mutter. Vieles war schnell verziehen, und über die anderen Dinge hatten wir zum Glück in den letzten Monaten immer mehr gesprochen. Ich stand auf, ging um den Tisch und stellte mich zu meinem Vater.
»Ich hab dich lieb, Papa«, flüsterte ich, während ich mich zu ihm runterbeugte und ihn in eine feste Umarmung zog. Plötzlich schlangen sich zwei weitere starke Arme von hinten um mich.
»Ich werde dich vermissen«, nuschelte mein Bruder, der sein Gesicht in meinen Haaren vergrub.
»Ich euch auch.« Ich zog beide noch enger an mich und nahm diesen Moment so gut es ging in mir auf. Denn morgen Abend würden die beiden nur noch zu zweit am Esstisch sitzen.
Meine Flugnummer prangte an der großen Anzeige im Abflugterminal, und ich notierte mir den Schalter, an dem ich gleich mein letztes Gepäck abgeben würde. Meine restlichen Klamotten würde zum Glück die Spedition in ein paar Tagen liefern. Zusammen mit den wenigen Kisten, in denen Bücher, Fotos und das Stethoskop, das mein Vater mir zum Studienabschluss geschenkt hatte, Platz fanden.
»Mach’s gut, Schwesterherz.« Ich sah meinen Zwillingsbruder an, der genauso hin- und hergerissen schien, wie ich mich fühlte. Ganz klassisch: ein lachendes und ein weinendes Auge zugleich.
»Lass mal was von dir hören«, sagte mein Vater mit dieser rauen Stimme, die ich nur zu gut kannte. Von den Momenten, in denen er von meiner Mutter sprach. Momenten, in denen er traurig war. Wie jetzt.
»Das mache ich, versprochen.« Ich zog die beiden in eine dicke Umarmung und spielte kurz mit dem Gedanken, sie einfach nie wieder loszulassen. Die Beziehung zu meinem Vater hatte sich zunächst kompliziert gestaltet, nachdem ich zurückgekommen war. Es war nicht einfach gewesen, wie er – und auch meine Mutter – sich mir gegenüber verhalten hatten. Aber man verzeiht so viel, wenn es um den Tod geht.
»Ich erwarte mindestens ein Foto pro Woche«, sagte Matty mit erhobenem Zeigefinger.
»Und ich mindestens einen Besuch im Jahr«, fügte mein Vater hinzu.
»Versprochen«, sagte ich erneut und dachte zurück an den Moment, als ich das letzte Mal nach Kanada aufgebrochen war. Mit meinen Eltern hatte ich nicht geredet, und Matty hatte keine Zeit gehabt, also war ich allein mit meiner besten Freundin Mila zum Flughafen gefahren.
Zwei Jahre später stand ich wieder hier, im selben Terminal, auf dem Weg, in ein Flugzeug zu steigen. Vielleicht sogar dasselbe.
Doch dieses Mal war alles anders. Mein Vater war hier, meine Mutter konnte es nicht sein. Mein Bruder hatte uns gefahren, und meine beste Freundin wartete auf der anderen Seite des Globus auf mich.
Sie konnte es bestimmt kaum erwarten, mir mein Zimmer in unserer kleinen Wohnung in Vancouver zu zeigen.
Ich fischte mein Handy aus dem Fach des Sitzes vor mir und verspürte das dringende Bedürfnis, meine Beine auszustrecken. Ich war nicht für Langstreckenflüge gemacht. Oder langes Sitzen. Oder beides.
Ein Business-Class-Ticket war es mir dann aber doch nicht wert gewesen.
19:37 Uhr
Ich starrte auf das helle Display, bis es schwarz wurde und mir meine eigene Reflexion entgegenblickte. Mein müdes Spiegelbild rang sich nicht einmal ein Lächeln ab. Die Zeit wollte während dieses Fluges einfach nicht vergehen. Vor allem dann, wenn wir landeten, mein Handy auf die kanadische Zeit umstellte und neun Stunden zurücksprang, war es noch unerträglich lang, bis dieser blöde Tag endlich enden würde. Ich freute mich unfassbar. Aber für Abschiede war ich einfach nicht gemacht.
»Ich vermisse dich jetzt schon«, tippte ich eine Nachricht an meinen Bruder und starrte auf die winzige Uhr neben der Nachricht, aus der kein Haken wurde. Die gleichen fünf Worte hatte ich ihm am Flughafen heute Morgen schon häufiger gesagt, als ich zählen konnte. Aber es stimmte. Ich würde meinen Bruder vermissen, wenn ich nach Vancouver auswanderte.
Oh Gott, und ich tat das wirklich. Ich streckte mich nach oben und drehte die schmale Lüftung voll auf, um die mit einem Mal aufkommende Wärme in mir zu regulieren.
Durchatmen, Tara.
Tief durchatmen.
Immer und immer wieder, einfach weiteratmen.
Und wenn ich lange genug weiteratmete, würde ich irgendwann ankommen.
Ich zog die dünne Softshelljacke aus, die mir im klimatisierten Flugzeug den Hintern gerettet hatte. Aber schon auf den ersten Metern der Ankunftshalle in Vancouver hatte ich gemerkt, dass wir Ende Juli hatten und ich dringend ein paar Schichten Kleidung loswerden musste. Abrupt blieb ich stehen. Nichts hatte sich verändert, und doch war alles anders.
Ich stand am oberen Treppenabsatz, starrte auf die gigantischen Totempfähle links und rechts davon und die riesige Halle dahinter. Die Menschen, die von Absperrbändern getrennt liefen, ihre Reisepässe einscannten und Fragen zur Einreise beantworteten. Keiner von ihnen wusste, dass ich schon mal hier gewesen war, und doch fühlte es sich an, als würden alle mich anstarren.
»Entschuldigung, darf ich mal?« Ich zuckte zusammen, als ein Finger mich an der Schulter antippte und sich kurz darauf ein älterer Herr an mir vorbeidrückte. Zurück aus meiner Trance, lief ich die letzten Stufen runter und folgte den Absperrbändern, die mich zu dem vorgesehenen Schalter lotsten. Ich scannte meinen Pass, stellte mich an und wartete darauf, den Zweck meines Aufenthalts erklären zu müssen. Aber diesmal war ich vorbereitet.
Mein Handy vibrierte in meiner Tasche. Im Flugzeug noch hatte ich die kanadische Sim-Karte eingesetzt und jetzt direkt die erste Nachricht von Mila erhalten.
Ich steh oben bei den Taxis, einfach die ganze Halle entlanglaufen und dann raus
Ich antwortete, meinem inneren Boomer folgend, nur mit einem nach oben gestreckten Daumen und folgte den Schildern, die mich erst zur Gepäckausgabe und dann zu dem Ausgang lotsten, an dem Mila hoffentlich auf mich warten würde. Ich lief die Halle entlang, und alles um mich herum verlief in Zeitlupe. Einen Schritt nach dem anderen, während vor meinem inneren Auge die Bilder und Erinnerungen abliefen, die ich so gut verdrängt hatte. Wie im zweiten Teil eines Films, der mit einer klassischen Was-bisher-geschah-Rückblende startete.
Links.
Meine erste Nacht in Beths Haus, die Unsicherheit über das Ungewisse.
Rechts.
Das Seeotterbaby, das ich an meinem ersten Tag versorgt hatte.
Links.
Jaimie, der mich hasste.
Rechts.
Zoey und Beth und jede Minute im Wildlife Rescue Center.
Links.
Jaimie und ich im Van in den Rockies.
Rechts.
Jaimie und ich, wie wir Chubby, das süße verwaiste Bärenbaby, retten.
Links.
Jaimie und ich.
Rechts.
Jaimie.
Links.
Jaimie.
Rechts.
Jaimie. Jaimie. Jaimie.
»Oh mein Gott, da bist du ja!« Milas Gekreische riss mich aus meinen Gedanken, und das Lächeln auf meinen Lippen war ehrlich. Ich schloss meine beste Freundin in die Arme und war unendlich froh, endlich hier zu sein. Angekommen zu sein.
»Mila«, flüsterte ich gedämpft an ihr Haar und roch das vertraute Shampoo, das sie seit der siebten Klasse verwendete. Ob es das hier in Kanada auch gab? Oder würden ihre Haare in ein paar Wochen plötzlich ganz anders riechen?
»Tara«, flüsterte sie zurück, und ich konnte mein Glück kaum fassen.
»Oha, Moment!« Mila drückte mich von sich und fischte ihr Handy aus der Hosentasche. »Das müssen wir festhalten! Unser gemeinsamer Neustart!« Sie zog mich an sich, rückte das Handy in Position und schoss ein Selfie nach dem anderen.
Sie hatte recht. Das mussten wir festhalten.
Unseren gemeinsamen Neustart.
KAPITEL 2
RÜCKBLICK
Tara
»Was hat die Ärztin noch mal gesagt, wann sie aufwachen soll?« Ich sah zu meinem Bruder, der neben dem Bett meiner Mutter saß und ihre Hand hielt.
»Sie rechnen in den nächsten Stunden damit.« Ich rutschte auf meinem unbequemen Stuhl hin und her und dachte an die Worte der Ärztin, die meinte, dass es nur ein ganz grober Richtwert war. Letztlich wusste niemand, wann meine Mutter aufwachen würde. Die Frage des Ob wollte ich mir nicht stellen.
Mein Handy vibrierte in meiner Jackentasche, und ich starrte kurz auf das Display, während Jaimies Name darauf leuchtete. Etwas mehr als zwei Wochen war es jetzt her, dass wir uns das letzte Mal gesehen hatten, und auch wenn wir versuchten, oft zu telefonieren, war es schwer. Es war schwer, so weit voneinander entfernt zu sein, plötzlich so unterschiedliche Leben zu führen und gleichzeitig nicht an das erinnert werden zu wollen, was wir gerade alles verpassten.
»Wenn du noch länger starrst, legt er einfach wieder auf.« Ich schaute hoch. Natürlich wusste Matty, dass es Jaimie war. Es hatte die letzten Wochen kaum ein anderes Thema gegeben. Außer vielleicht meine Mutter, die verdammt noch mal Krebs hatte und darum kämpfte, nicht zu sterben. Das Leben konnte so beschissen sein.
»Sorry, ich geh kurz …« Ich deutete zur Tür, stand auf und nahm im Gehen den Anruf an.
»Hey«, flüsterte ich, um meine Mutter nicht zu wecken. Wobei ich genau das vielleicht doch wollte.
»Hey.« Seine Stimme jagte mir einen warmen Schauer über den Rücken. Immer noch. Der bloße Klang seiner Stimme reichte aus, um Erinnerungen vor meinem inneren Auge ablaufen zu lassen. Von Berührungen und Küssen, von geteilten Momenten und geteilten Gefühlen.
»Na, was macht das Leben?« Die Worte fühlten sich falsch und verknotet an. Vermutlich, weil ich die Antwort kennen würde, wäre ich immer noch in Kanada. Bei ihm. Stattdessen war ich zurück in Deutschland. Bei meiner Mutter, die gegen den Krebs kämpfte, meinem Vater, der jeden Tag ein kleines bisschen mehr daran zerbrach, und meinem Bruder, der verzweifelt versuchte, das alles zusammenzuhalten. Und ich war irgendwo dazwischen. Schwebte zwischen all diesen Gefühlen und dem verzweifelten Wunsch, nicht hier zu sein und doch jede Sekunde mit meiner Mutter zu haben. Jede Sekunde, die uns noch blieb.
»Wie geht’s?«, schob ich hinterher, weil ich die Stille nicht ertrug.
»Es geht«, sagte er nur, und ich kannte diesen bemüht monotonen Klang zu gut. Es ging nicht. Bei keinem von uns beiden. Aber niemand wollte darüber reden, wie es uns eigentlich ging. Da es keinen Ausweg gab. Nichts, was man tun konnte. Ich lief den Gang der Station entlang, vorbei an Menschen in Kitteln, Patientinnen und Patienten und anderen Familien, aber dennoch war ich allein. Dieses Telefonat fühlte sich seltsam an. Wir schwiegen mehr, als dass wir Worte fanden.
»Ich …«
»Warte kurz, sorry«, unterbrach ich ihn, da Matty vor mir aufgetaucht war und mich abwartend ansah.
»Alles gut?« Ich hielt das Handy weg von meinem Ohr und sah ihn erwartungsvoll an.
»Sorry, ich wollte dich nicht …«
»Matty!« Ich verdrehte die Augen.
»Der Onkologe möchte noch mal mit uns reden, kommst du mit?« Ich nickte betrübt und spürte gleichzeitig die allgegenwärtige Schwere, die sich immer weiter um mein Herz schloss. Solche Gespräche bedeuteten nie etwas Gutes. Für gute Nachrichten kam er einfach vorbei. Für Schlechte bestellte er uns ein. Das hatte ich schnell gelernt.
»Jaimie?« Ich drückte mir das Handy wieder ans Ohr.
»Ja?«
»Ich muss los, kann ich dich später anrufen? Oder die Tage irgendwann?« Kurz überlegte ich, welcher Wochentag war. Die Zeit verschwamm so schnell, wenn man von morgens bis abends damit beschäftigt war, sich zu fragen, wie viel davon einem noch blieb.
»Hast du nicht noch fünf Minuten? Ich würde gerne …«
»Jaimie …«, unterbrach ich ihn. »Das ist wirklich wichtig.« Ich drehte mich weg von meinem Bruder, der immer noch neben mir stand.
»Ich weiß, aber der Onkologe kann doch sicher fünf Minuten warten, und ich würde dir so gerne …«
»Nein, tut mir leid«, unterbrach ich ihn wieder, auch wenn es mir nicht gefiel, das zu tun. Ich wollte noch etwas sagen. Ihm erklären, dass es nun mal einfach wichtiger war und ich keine Minute verschwenden wollte. Und schon gar nicht fünf. Stattdessen schwieg ich.
»Okay …« Jaimies enttäuschte Stimme versetzte mir einen Stich. Ich konnte es nachvollziehen, aber er musste doch auch mich verstehen. »Dann wohl … bis die Tage, nehme ich an.«
»Ja, bis dann«, sagte ich schnell und legte auf. Ich nahm mir einen Atemzug Zeit, jegliche Gedanken an dieses Gespräch zur Seite zu schieben und mich stattdessen auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren, die genau vor mir lagen.
Jaimie
Ich ließ das Telefon sinken und starrte auf das schwarze Display. Ich konnte sie verstehen, wirklich. Aber die Tatsache, dass sie nicht einmal fünf Minuten für mich hatte, schmerzte dennoch. Die Enttäuschung saß tief. Ich zog den Reißverschluss meiner Daunenjacke zu und starrte in das Feuer vor mir. Ich rappelte mich auf, griff nach dem Stock, auf den ich eben das Marshmallow gepikst hatte, und hielt ihn ins Feuer. Nicht darüber. Mitten in die Flammen. Sollte es doch verbrennen, wenn Tara nicht hier war. Es war egal. Den Stock weiter im Feuer, schaute ich auf die Box neben mir, auf der das Notizbuch lag. Das Reisetagebuch, das Tara mir mit auf den West Coast Trail gegeben hatte. Das Reisetagebuch, in dem wir einen Punkt nach dem anderen abgehakt hatten.
S’Mores essen in Jasper
Der Punkt, den ich heute abhaken wollte. Mit ihr. Ich hatte ihn auf die Liste geschrieben und ihr erzählt, dass wir am Lagerfeuer vor unserem Zelt sitzen würden. Ich hatte ihr von dem atemberaubenden Sternenhimmel berichtet, weil es in Jasper so gut wie keine Lichtverschmutzung gab. Sie hatte mich angesehen und gelächelt. Dieses einnehmende, aufheiternde Lächeln, das ich schon wochenlang nicht mehr gesehen hatte. Erinnerte ich mich überhaupt richtig daran? Ich schaute zurück ins Feuer und sah, wie mein in Flammen stehendes Marshmallow vom Stock schmolz und in die Glut fiel. Es tat weh. Ich vermisste sie. Trotzdem hatte ich ihr das versprochen. Wir hatten es uns versprochen. Weitermachen und zueinander zurückkommen, so schnell es ging. Also griff ich ein weiteres Marshmallow aus der Tüte, spießte es auf und hielt es in sicherer Höhe über das Feuer. Ich würde ein Foto knipsen, ausdrucken und neben meine aufgeschriebenen Erinnerungen kleben. Neben die Dinge, die ich ihr gerne sagen würde.
Ich würde nicht aufgeben.
KAPITEL 3
Jaimie
Ich hatte es aufgegeben, mich über die Kundschaft aufzuregen. Auch wenn das alles andere als leicht war. »Geht das noch mit Hafermilch, bitte? Hatte ich total vergessen zu sagen, ups!« Ich zog das Kännchen weg von der Aufschäumlanze, mit der ich die Kuhmilch gerade aufschäumen wollte. Etwa zweieinhalb Sekunden brauchte ich, den bissigen Kommentar runterzuschlucken. Dann lächelte ich die Kundin an und zuckte nur mit den Schultern.
»Klar! Kein Problem.« Ich stellte das Kännchen in die Spüle, in der Hoffnung, es für den nächsten Kaffee verwenden zu können, und griff nach einem neuen, in das ich dann die Hafermilch füllte. Ein Schritt nach dem anderen, genauso wie es mir in meiner wochenlangen Einarbeitungsphase gezeigt worden war. Man sollte meinen, Kaffee zu kochen war ein recht simples und geradliniges Konzept. Die Zeit, bis ich mich offiziell Barista nennen durfte, hatte mich allerdings eines Besseren belehrt.
»Venti Vanilla Latte mit Hafermilch, extra Espresso Shot und Sweet Cream Cold Foam für Anni!« Ich ratterte die Bestellung runter und schob den Becher über den Tresen.
»Danke!« Ich nickte zur Antwort und wollte mich schon wieder wegdrehen, als sie weitersprach. »Ich find’s übrigens so cool, dass ihr jetzt diese wiederverwendbaren Bambusbecher im Angebot habt.« Ich seufzte laut und sah sie an. »Vielleicht wollen wir so einen Bambus-Kaffee mal zusammen trinken?« Sie hob leicht einen Mundwinkel an, und auch wenn sie sich nicht an diesem Schlafzimmerblick versucht hätte, hätte ich den Wink mit dem Zaunpfahl verstanden.
»Bringst du dann auch wieder deine Echtlederhandtasche mit, oder trägst du dann ausnahmsweise nur deinen Pelz?« Ich versteckte meine Geringschätzung nicht weiter und schaute demonstrativ auf den halben Nerz, der um ihren Hals baumelte. Empört sah sie mich an, während ich nur die Augenbrauen hochzog.
»Möchtest du wirklich so mit einer Kundin reden?«
»Habe ich doch eben getan, oder?« Völlig unbeeindruckt blieb ich stehen. Sie hatte ihren Kaffee bereits gekauft und ich den Umsatz für meinen Chef gemacht. Der Rest war egal.
»Das ist ja wirklich eine Frechheit«, versuchte sie es erneut, und ich wartete nur darauf, dass sie verlangte, mit meinem Manager zu sprechen.
»Ja, genau wie die Tatsache, dass immer noch echte Pelze verkauft werden, aber manchmal ist man einfach machtlos.« Noch bevor sie ein weiteres Wort sagen konnte, drehte ich mich weg und ging den Tresen entlang zurück zur Siebträgermaschine, um wieder einmal alles zu reinigen. Aus dem Augenwinkel sah ich, wie sie aus dem Laden stürmte, den Vanilla Latte fest umklammert.
Vor zwei Jahren hätte ich mich ausgelacht, hätte mir einer erzählt, ich würde als Barista bei Crystal Cup in Vancouver arbeiten. Vermutlich hätte bereits der Fakt, dass ich in Vancouver lebte, gereicht, um mich zum Lachen zu bringen. Aber mittlerweile brachte mich kaum noch etwas zum Lachen.
»Na, entspannte Schicht gehabt?« Ich lief durch die kleine Seitengasse, die zu meinem Hauseingang führte. Der Dampf, der aus einem der Rohre an der Hauswand kam, fügte sich perfekt ins Bild der Kartonberge und stinkenden Mülltonnen ein.
»Ich hätte dir nicht erzählen dürfen, wo ich arbeite, Ray.« Ich blieb ein paar Schritte vor der Eingangstür stehen und sah Ray an, der in dem gleichen dreckigen braunen Mantel wie immer steckte.
»Du kannst mir einfach keinen Wunsch abschlagen, James.« Ray stopfte seine Handschuhe in die Taschen seines Mantels, während ich seufzte.
»Wirst du jemals verstehen, dass ich nicht James heiße?« Ich rieb mir die Nasenwurzel und schüttelte den Kopf. Ray schwieg und grinste mich stattdessen an. »Du verhältst dich wie ein Kleinkind, dabei bist du sicher siebenundachtzig.«
»Vorsicht, Junge!« Ray hob die Hand und zeigte auf mich. »Die Straße mag mich alt gemacht haben, aber in mir steckt noch der gleiche junge Feger, der ich schon immer war.« Ich lachte auf, während Ray immer noch auf mich zeigte.
»Feger sagt man schon seit etwa zwei Jahrzehnten nicht mehr. Und was soll dich alt gemacht haben?« Ich schielte an ihm vorbei in die Ecke des Hinterhofs. »Du lebst in einer Burg, die mehr Quadratmeter hat als mein Apartment, und isst jeden Abend mit mir.« Ray zuckte nur mit den Schultern und drehte sich ebenfalls zu seiner Konstruktion aus alten Plastik- und Metallteilen, über die der Vermieter seit Jahren hinwegsah. Das hier war Rays Zuhause, genauso wie es meines war. Ich schloss die Tür auf und drückte sie gegen den schweren Widerstand auf.
»Kommst du jetzt endlich? Es gibt Nudeln.«
Ich löffelte die Nudeln aus der Verpackung, in der sie kamen, und schielte zu Ray, der das Gleiche tat. Auf dem kleinen, alten Fernseher lief die Wiederholung irgendeiner Navy-CIS-Folge.
Ich scrollte durch Instagram, während Ray gespannt die Handlung der Serie verfolgte. Wie jeden Abend wischte ich einen Beitrag nach dem anderen weg, wollte eigentlich längst das Handy zur Seite gelegt haben, schaffte es aber nicht, die App zu schließen.
Plötzlich ließ ich meinen Löffel fallen, beachtete das Klirren auf dem Boden aber schon gar nicht mehr. Zu gefesselt war mein Blick von dem hellen Bildschirm in meiner Hand.
Jetzt auch auf Instagram!, verkündete mir der beworbene Beitrag in Buchstaben, die fast meinen ganzen Bildschirm einnahmen.
Wildlife Rescue-Center Nanaimo – wo deine Spende etwas Gutes tut.
Dahinter ein Bild von Loui und Chester. Die zwei Waschbären würden sicher für viele begeisterte Kommentare sorgen. Meine Mundwinkel zuckten, aber der Ansatz des Lächelns verschwand schnell wieder, als mir klar wurde, worauf ich hier starrte.
»Was ist?« Ray drehte sich zu mir.
»Nichts …«, sagte ich schnell und starrte dabei weiter auf das Handy in meiner Hand.
Das Rescue-Center war jetzt auf Instagram und schaltete Werbung. Das war bestimmt auf Zoeys Mist gewachsen. Vielleicht hatte auch Beth selbst den Account erstellt.
Zoey.
Beth.
»Ah ja«, unterbrach Ray meine Gedanken. Wir wussten beide, dass ich ihn anlog. Aber Ray ließ es auf sich beruhen. Deshalb aß er jeden Abend Tütennudeln mit mir. »Wenn’s nichts ist, dann sieh doch bitte in Zukunft davon ab, mich bei meiner Lieblingsserie zu unterbrechen.« Ich schüttelte kurz den Kopf und schielte zu Ray, bevor ich mich wieder der Anzeige auf dem Bildschirm widmete.
Ich wüsste, wer diese Werbung geschaltet hatte, wenn ich nicht seit über einem Jahr mit niemandem von ihnen mehr Kontakt hätte. Wenn ich nicht hier leben würde und jeder Tag so aussah, wie er nun mal aussah. Wenn alles einfach anders gekommen wäre. Wenn ich noch da wäre. Und sie auch. Wenn …
Ich griff die leere Pappschale und pfefferte sie einmal quer durch den Raum. Sie knallte mit einem dumpfen Ton gegen den Fernseher, von dem jetzt die Käsesoße tropfte.
»Sorry.« Ich stand auf, stapfte in die Küche, griff das Küchenpapier und wischte den Fernseher ab. So wütend hatte bestimmt noch niemand einen Fernseher gewischt.
»Beeil dich einfach, gleich kommt die Auflösung.« Ray wedelte mit der Hand durch die Luft und verscheuchte mich vom Fernseher, auch wenn er immer noch verschmiert war.
Mit einem Ächzen ließ ich mich auf das alte Sofa fallen, wo mein Handybildschirm immer noch hell aufleuchtete. Ich klickte die drei kleinen Punkte neben der Werbeanzeige an und tippte auf den Button, der dafür sorgen würde, dass ich mich nicht weiter damit befassen würde müssen.
Nicht interessiert.
KAPITEL 4
RÜCKBLICK
Jaimie
Ich drückte die Werbung für Lederschuhe im Angebot weg und hoffte, dass mein Klick auf nicht interessiert dafür sorgen würde, weniger solcher Anzeigen sehen zu müssen. Ich likte Zoeys neues Foto, auf dem sie vor dem Bärenkäfig von Dawson stand, auch wenn es schon wieder länger her war, dass wir uns gesprochen hatten. Als sie mir diesen Instagram-Account erstellt hatte, konnte ich nur den Kopf schütteln. Damit du auch ohne Anrufe mitbekommst, was wir hier tun. Ich kenn dich doch, du Griesgram. Meine beste Freundin hatte gelächelt, als ich sie das letzte Mal gesehen hatte. Und sie hatte recht. Wie immer. Ich benutzte diesen Account, um mich ihnen nah zu fühlen, auch wenn ich immer weiter weglief. Kurz nach Taras Abreise war ich aufgebrochen und seitdem nicht zurückgekehrt. Ich wollte unsere Bucketlist abarbeiten und Erinnerungen schaffen, auch wenn sie nicht da war. Vor allem wollte ich aber noch nicht zurück. Nicht, solange sich alles dort so schmerzhaft anfühlte. So leer. Ohne Tara. Ich scrollte weiter und erstarrte bei der nächsten Anzeige.
Bald am Mount Cartier. Ihr neues Wellness-Resort ab 2026
Natürlich würde noch eine Ewigkeit vergehen, bis der Bau begann. Aber er würde beginnen. Das Naturschutzgebiet kam nicht zustande, und der Mount Cartier würde ein Wellness-Resort werden. Weil wir nicht reichzeitig die Beweise für ein schützenswertes Naturschutzgebiet hatten liefern können, die es ganz klar gegeben hatte. Johnson & Co war für die Vergiftung am Berg verantwortlich, genau wie für den Tod von Chubbys Mutter, davon war ich überzeugt. Es kam damals einfach zum perfekten Zeitpunkt, gerade als wir einen ersten Ansatzpunkt gefunden hatten, der uns hoffen ließ. Aber wir hatten ihnen nichts nachweisen können, und durch das Insektizid war die Ammer weitergezogen, und wir konnten nichts mehr beweisen. Nicht, nachdem Tara einfach abgereist war und das Treffen mit einer potenziellen Quelle – die uns Beweise gegen Johnson & Co liefern wollte – nicht stattgefunden hatte.
Mein Handy vibrierte in meiner Hand, und am oberen Bildschirmrand wurde mir Taras Name angezeigt.
»Hey!« Ich nahm an und versuchte die Gedanken der letzten Minuten einfach abzuschütteln. Es war sowieso nicht mehr zu ändern.
»Hey …« Auch wenn es schwer war, machte ihre Stimme alles ein kleines bisschen erträglicher.
»Was gibt’s Neues?« Ich lehnte an der Tür meines Trucks und überlegte, wie viel Uhr es bei ihr jetzt war, wenn die Sonne in Whistler gerade erst aufging.
»Nicht viel«, antwortete sie, aber ich hörte, dass sie etwas bedrückte. Ich wartete und gab ihr die Zeit, die sie brauchte. »Ich springe erst mal für meine Eltern in der Praxis ein.« Sie klang nicht glücklich, und es überraschte mich nicht. Sie hatte nie in der Kleintierpraxis ihrer Eltern arbeiten wollen.
»Okay«, sagte ich, unsicher, ob sie darüber reden wollte. Unsicher, wie ich dazu stand.
»So ist es aktuell einfach am sinnvollsten, da Matty allein überfordert ist und mein Vater gerade wirklich nicht kann.«
»Okay …«, sagte ich noch mal und verlagerte mein Gewicht aufs andere Bein. »Und … für wie lange etwa?« Ich sah zur Gondel, die in wenigen Stunden öffnen und mich nach oben auf den Berg bringen würde. Die zweitlängste freischwebende Bergbahn, auch wenn sie bei den Touris immer noch als die längste beworben wurde. Tara hätte diesen Fakt geliebt und bestimmt direkt in ihr Buch geschrieben. In unser Buch.
»Ich weiß es nicht.« Ihre Stimme klang, als wüsste sie es ganz genau. Ich wartete darauf, dass sie weitersprach, während mir das Schild des Whistler Nationalparks ins Auge sprang. Ein Naturschutzgebiet. Im Gegensatz zum Mount Cartier, auf dem in wenigen Jahren ein Wellness-Resort gebaut werden würde.
»Ich glaube schon, dass du es weißt.« Ich schnaubte und hoffte, falschzuliegen. »Wann kommst du zurück, Tara?« Ich konnte ihr keinen Vorwurf machen. Und doch tat ich es. Ich vermisste sie.
»Jaimie.« Ich sah sie vor mir, wie sie den Kopf in den Nacken legte und die Augen verdrehte. »Ich weiß es nicht, erst mal … nicht.« Sie flüsterte das letzte Wort. Es schmerzte zu hören, was ich eigentlich schon wusste. Sie war weg, und wir hatten verloren. Ich fuhr mit meinem Truck in der Weltgeschichte herum und ertrug es nicht mehr, in den Bergen oder auch nur in der Natur zu sein. Weil mich einfach verdammt noch mal alles daran erinnerte, dass Tara nicht da war und ich versagt hatte. Ich dachte darüber nach, selbst ein Flugticket zu kaufen, zu ihr zu fliegen. Für sie da zu sein. Bei ihr zu sein. Auch wenn mein Kontostand, der es bald notwendig machen würde, einen neuen Job zu finden, dagegensprach, war es doch sicher irgendwie machbar. Oder?
»Tara, ich …«
»Jaimie, ich werde erst mal hierbleiben«, unterbrach sie mich. »Ich werde in der Tierklinik arbeiten und hier sein.«
»Klar, lieber Daddys Träume erfüllen als deine eigenen.« Die Worte hatten meinen Mund verlassen, ehe ich noch mal darüber nachdenken konnte.
»Wow.« Mehr sagte sie nicht.
»Tut mir leid.« Ich wartete auf eine Reaktion, stattdessen kratzte es am Hörer, und ich hörte gedämpfte Stimmen.
»Tara?« Irgendjemand rief sie. Kurz darauf glaubte ich zu hören, dass sie ihr Handy wieder an ihr Ohr hielt.
»Ich muss los«, sagte sie nur.
»Aber Tara …«
»Wenn du nicht noch weitere verletzende Worte loswerden willst, würde ich dann jetzt auflegen.« Ihre müde Stimme traf mich. »Ich hab noch was vor.«
»Ist das dein Ernst?«
»Was, Jaimie?« Sie spuckte die Worte förmlich aus.
»Du darfst enttäuscht und wütend sein, ich aber nicht?« Ich wusste, dass ich sie nicht anschreien wollte, das wussten wir beide. Trotzdem tat ich es.
»Oh, tut mir leid, dass dein Leben in den Nationalparks Kanadas, oder wo auch immer du gerade bist, nicht ganz so komfortabel ist.« Sie wüsste es, wenn sie mir zuhören würde. Wenn sie sich die Zeit für mich nehmen würde.
»Mein Leben in den …« Aber ich brachte es nicht fertig, ihre Worte zu wiederholen. »Genau«, sagte ich nur, anstatt ihr zu widersprechen. Weil sie es besser wusste, mich kannte. Eigentlich.
»Dann geh du doch deinen Vater glücklich machen, und ich knipse das nächste Cover der neuen National Geographic, und wir hören uns, wenn ich zur Preisverleihung für den Schnappschuss des Jahres eingeladen werde. Also, wenn du es einrichten kannst, natürlich.« Ich legte auf und starrte auf das Display. Mein Atem ging schwer, und ich steckte das Handy weg. Die Lust war mir vergangen, aber immerhin war es der letzte Punkt auf der Liste. Danach konnte ich in die nächstgrößere Stadt fahren und mich von Bergen fernhalten, während Tara weiter die Krallen von irgendwelchen Meerschweinchen schnitt.
Tara
»Kommst du?« Matty legte seine Hand auf meine Schulter, während ich immer noch mein Handy anstarrte. Er hatte einfach aufgelegt. Ich schaute über meine Schulter und sah meinen Bruder an. Ich schluckte und wollte das Gefühl loswerden, Jaimie schütteln zu wollen, bis er zur Vernunft kam. Ich konnte nicht hier weg. Sollte er doch herkommen, wenn es so wichtig war.
»Ah, da sind die beiden.« Mein Vater schaute zu uns, während wir das Büro des Onkologen betraten. Der Anblick seiner dunklen Augenringe ließ mich schwer schlucken. Er schlief jede Nacht am Krankenhausbett meiner Mutter. Meine Mutter, die von Tag zu Tag weniger wach war und dafür immer schwächer wurde.
»Gut, also …« Der Onkologe räusperte sich und schob einen Stapel Papiere vor sich her. Ich spürte, wie mein Bruder sich neben mir anspannte. »Ich würde gerne mit Ihnen über die Option sprechen, Ihre Frau, Ihre Mutter, auf eine Palliativstation zu verlegen.« In meinen Ohren rauschte es. Der Arzt sprach weiter, vereinzelte Worte kamen bei mir an, aber es reichte nicht, um ganze Sätze zu bilden. Ich wusste, dass es nicht gut um meine Mutter stand. Ich wusste es, aber es aus dem Mund eines Facharztes zu hören, war ein Schlag ins Gesicht.
»Aber …« Ich schaute zu meinem Vater, der sichtlich um Worte rang. Er war es, der uns vor wenigen Wochen erzählt hatte, dass die letzte OP nicht erfolgreich gewesen war und es damit nichts mehr gab, was die Ärztinnen und Ärzte tun konnten. Sein Mund öffnete und schloss sich immer wieder.
»Gibt es aus Ihrer Sicht noch andere Optionen?«, sprang mein Bruder ein, und ich legte meine Hand auf seinen Oberschenkel. Das hier war etwas, das niemand von uns aushielt. Der Arzt sah meinen Bruder lange an, senkte den Blick dann auf seine Papiere, und noch bevor er lang ausatmete, kannte ich die Antwort.
»Es tut mir leid, ich wünschte, ich könnte Ihnen einen Ausweg bieten.« Er hielt inne, sah zu meinem Vater und schließlich mir direkt in die Augen. »Aber es gibt nichts mehr, was wir tun können.« Sie würde sterben. Das war es, was er eigentlich sagen wollte. Meine Mutter würde sterben, aber er hatte es nicht so deutlich formuliert. Vielleicht aus der gleichen Angst, die ich hatte. Dass keiner von uns dieses Wort wirklich greifen oder verarbeiten konnte. Tot. Was passierte, wenn man tot war? Wo ging man hin? Gab es so etwas wie einen Himmel? Meine Mutter würde es bald herausfinden. Ich würde sie zwar fragen können, aber eine Antwort würde ich nie bekommen.
KAPITEL 5
Tara
»Und? Und? Und?« Mila hüpfte wie ein kleiner Flummi auf und ab, kaum war ich durch die Tür des mehrstöckigen Gebäudes nach draußen getreten. Außer dem kleinen roten Schild wies nichts darauf hin, dass sich im dritten Stock eine Kleintierpraxis befand.
»Sie melden sich am Mittwoch, aber ich glaube, ich hab den Job.« Ich versuchte mich an einem Lächeln, war mir aber noch nicht sicher, ob ich mich wirklich darüber freute. Über den Job. In einer Kleintierpraxis.
»Das sind doch tolle Neuigkeiten.« Mila stockte und sah mich an. »Oder?« Ich zuckte nur mit den Schultern. »Na gut, ich weiß, dass das nicht unbedingt dein Traum ist. Aber das ist ja noch lange nicht das Ende der Fahnenstange!« Mila griff meine Hand und drückte sie zur Aufmunterung. »Das ist doch gerade erst der Anfang.« Ich versuchte mich wieder an einem Lächeln, und dieses Mal fühlte es sich besser an. Auch wenn ich wieder in einer Kleintierpraxis landete, konnte ich erst mal etwas Geld sparen und dann immer noch herausfinden, was ich machen wollte. Vielleicht wollte ich auch in einer Kleintierpraxis bleiben. Nur halt in Kanada.
»Komm, darauf stoßen wir an!« Mila zog mich mit sich, und ich war froh, dass ich weder etwas sagen noch Entscheidungen treffen musste.
Keine zwanzig Minuten später saßen wir im Velvet Bean am Robson Square, einer Filiale des Franchise, bei der Mila als Feelgood-Managerin arbeitete. Ein Job, von dessen Existenz sie mich erst mal hatte überzeugen müssen.
»Hier!« Mila stellte meinen dampfenden Kaffee vor mich und setze sich mit ihrem mir gegenüber. Der Platz am Fenster eignete sich perfekt, um die Leute auf der anderen Seite der Glasscheibe zu beobachten. Immer wieder sah ich dabei zu, wie Menschen in das kleine Café gegenüber gingen und es wieder verließen. Crystal Cup. Wer nannte denn bitte sein Café Crystal Cup?
»Und?«
»Hmm?« Ich sah auf, und meine Verwirrung stand mir sicher in Großbuchstaben auf die Stirn geschrieben. »Sorry«, schob ich schnell hinterher, denn offensichtlich hatte ich Milas Frage verpasst.
»Wie fühlt es sich an, seinen ersten Job in Kanada ergattert zu haben?« Ich rührte den Zucker in meinen Kaffee und sah zu meiner besten Freundin.
»Gut … denke ich?« Seit ich die Praxis verlassen hatte, fragte ich mich, ob mein Vater mich weiterhin so unterstützen würde, wenn er hörte, dass ich in einer Kleintierpraxis arbeitete. Aber jeder fing mal irgendwo an. Zumindest hoffte ich das.
»Das klang jetzt wirklich sehr überzeugend.« Mila lachte, und ihre Leichtigkeit steckte mich an.
»Aber …«, begann ich stattdessen ein anderes Thema, um nicht länger über mich oder Kanada sprechen zu müssen. Oder über mich in Kanada. »Du musst mir jetzt noch mal erklären, was genau du hier eigentlich machst. Feelgood-Managerin ist keine Jobbeschreibung, mit der ich was angefangen kann …« Ich rührte weiter in meinem Kaffee herum und erinnerte mich an das Telefonat, in dem Mila mir berichtet hatte, dass sie jetzt den idealen Job für sich gefunden hatte und nach der erfolgreichen Apartmentsuche jetzt endlich alles perfekt war.
»Also …«, begann sie, ein breites Grinsen auf den Lippen. »Eigentlich geht es einfach um das Arbeitsklima, Teamwork und dass man sich wohlfühlt am Arbeitsplatz. Ich bin irgendwie eine Art Kummerkasten für die Filialen in Vancouver, aber organisiere auch so was wie das Welcome Weekend.«
»Welcome Weekend?«, fragte ich mit hochgezogenen Augenbrauen und schlürfte an meinem heißen Kaffee.
»Ja.« Mila zuckte mit den Schultern, als wäre das alles selbstverständlich. »Alle Mitarbeitenden, die neu bei uns anfangen, werden zu einem verpflichtenden langen Wochenende in den Bergen eingeladen.« Ich schmunzelte bei ihrer Formulierung und nickte. »Da gibt es dann einige Vorträge über die Corporate Identity, Workshops aber auch Teambuilding-Maßnahmen.« Vor meinem inneren Auge formte sich ein amüsantes Bild des Barista-Anwärter-Bootcamps. »Ist schon einfach ein ziemlich genialer Job.« Mila ließ sich tiefer in ihren Sessel sinken, den Kaffeebecher fest mit beiden Händen umschlossen.
»Es klingt auf jeden Fall perfekt für dich.« Ich musterte Mila und war froh, sie so begeistert zu sehen. Sie war glücklich. Etwas, das ich mir schon immer für meine beste Freundin gewünscht hatte. Auch wenn ich sie für völlig durchgedreht erklärt hatte, als sie mir erzählte, dass sie nach Kanada zieht. Ganz so, wie wir es aus Spaß schon vor zwei Jahren gesagt hatten. Noch absurder war, dass sie von Anfang an behauptet hatte, ich würde bald nachkommen. Und jetzt saß ich hier.
»Außerdem gibt’s immer gratis Kaffee.« Sie lachte, und ich prostete ihr mit meinem vollen Latte macchiato zu. Ein Fakt, von dem auch ich mehr als profitierte.
Mein Handy vibrierte, und ich stellte den Kaffee schnell ab, als ich Zoeys Namen aufleuchten sah.
OMG, ich bin ja so froh, dass du dich meldest!
Mir fiel ein Stein vom Herzen, und ich atmete erleichtert auf. Als ich mich endlich getraut hatte, Zoey gestern Abend zu schreiben, wusste ich nicht, mit welcher Reaktion ich rechnen musste. Wenn ich überhaupt eine bekommen würde …
»Was ist los?« Milas besorgte Stimme ließ mich aufsehen. Ich lächelte ihr beruhigend zu und hielt ihr mein Handy hin.
»Was schreibe ich denn da jetzt?« Ich starrte auf Zoeys Worte, unsicher, wie ich das eigentliche Gespräch beginnen sollte.
»Na ja, scheinbar ist sie dir weder böse noch nachtragend, dass du dich monatelang nicht gemeldet hast. Dir stehen also alle Möglichkeiten offen.« Mila nahm einen weiteren großen Schluck von ihrem Kaffee.
»Genau das ist ja das Problem«, sagte ich und ließ mein Handy mit einem Seufzen auf den braunen Holztisch vor mir sinken. Mila musterte mich, sagte aber nichts. Sie gab mir den Raum, mich selbst zu entscheiden.
Es tut mir leid, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe, tippte ich die gleichen Worte noch mal, mit denen auch meine Nachricht gestern Abend gestartet war.
Wie geht es dir? Was habe ich verpasst? Wollen wir vielleicht mal telefonieren?
Ich schickte die Nachricht ab, noch bevor ich ins Grübeln geraten konnte, und sperrte den Bildschirm.
»Geschafft«, ich atmete erleichtert aus und nickte Mila zu. »Sorry, das kam jetzt irgendwie dazwischen. Wo waren wir?« Ich legte meine Finger um die warme Tasse und sah meine beste Freundin an.
»Ach, Quatsch. Wir haben noch so viel Zeit, uns über den besten Job der Welt zu unterhalten.« Sie lächelte mich aufmunternd an. »Aber das da ist wichtig.« Wie aufs Stichwort leuchtete mein Bildschirm erneut auf.
Witzig. Ich wollte dich gerade das Gleiche fragen.
Ich schmunzelte bei Zoeys Antwort und war froh, dass ich bald ihre Stimme hören würde. Vielleicht würden wir es ja sogar schaffen, einander zu besuchen.
Zwei Jahre hatten wir uns nicht gesehen. Fast ein Jahr nicht gehört oder geschrieben. In dieser Zeit hatte sich alles verändert. Wobei jetzt, wo ich mit Zoey schrieb und mich freute, sie vielleicht sogar wiederzusehen … vielleicht hatte sich nicht alles verändert.
Zwei Stunden später saßen wir in unserer Wohnung und schauten die neuste Staffel Drive to Survive auf Netflix. Ich zückte mein Handy und schoss ein Foto, das ich Matty schickte. Gleich darauf filmte ich ein Video und drehte mich einmal um mich selbst, um die ganze Wohnung abzufilmen. Das Sofa, das quasi der Mittelpunkt unseres Zuhauses war, eignete sich perfekt.
Deine persönliche Roomtour, schrieb ich darunter und schaute mir das Video noch mal an. Man sah unser Wohnzimmer mit offener Küche und drei Türen, die abgingen. Das Bad, Milas Zimmer und mein Zimmer. Mehr brauchte es nicht.
Noch schlief mein Bruder bestimmt, aber ich mochte die Vorstellung, wie er mit einer Nachricht von mir aufwachte und gleich darauf meinem Vater zeigte, wie Mila und ich in Vancouver wohnten. Ich schluckte und wollte das Brennen in meinen Augen ignorieren. Meine Mutter hätte es geliebt, was Mila aus dieser kleinen Wohnung gemacht hatte. Und gleich danach hätte sie uns gesagt, dass das eine Bild an der Wand hinter dem Fernseher schief hing.
Unverschämt teuer, tippte ich in den Chat und atmete durch. Der Verlust der eigenen Mutter wurde mit der Zeit nicht unbedingt einfacher. Sich ständig gedanklich mit den letzten gemeinsamen Momenten konfrontiert zu sehen, gefolgt von der Beerdigung, die sich immer und immer wieder in Dauerschleife in den Erinnerungen abspielte, weil man es einfach nicht wahrhaben wollte. Aber die Momente, in denen es sich unerträglich anfühlte, als würde man von innen heraus zerbrechen, wurden seltener. Weil man besser darin wurde, sich selbst zusammenzuhalten.
»Wir könnten da vorne noch ein paar Regale anbringen und dazwischen Fotos aufhängen, oder?« Ich zeigte auf die kahle weiße Wand links neben der Badezimmertür.
»Oh ja, und auf die Regale dann ein paar kleine Pflanzen, das sieht bestimmt gut aus.« In meinem Kopf formte sich ein Bild, was wir wo an der Wand platzieren würden. Interessant, wie die Dinge sich entwickelten. In der Mittelstufe hatten Mila und ich darüber fantasiert, wie wir später einmal unser gemeinsames Haus gestalten würden. Jetzt saßen wir in unserer gemeinsamen Wohnung und richteten sie ein. In Vancouver. Unserem neuen Zuhause.
»Und dann könnten wir noch eine Wasserwaage im Baumarkt kaufen und dafür sorgen, dass alle Bilder gerade hängen.«
KAPITEL 6
RÜCKBLICK
Jaimie
Ich zuckte zusammen, als ein Auto auf der Straße neben mir laut hupte. Meine Hose wurde langsam unangenehm nass, und bei vier Grad und Nieselregen, der seit Tagen nicht aufhören wollte, würde sie auch nicht trocknen. In den Bergen würde mir der Schnee bis zur Hüfte reichen. Hier, inmitten der Großstadt, reichte es nur für graues Nasskalt. Ich war immer weiter von den Bergen und Weiten der Natur weggerannt, bis ich schließlich in immer größere Städte floh. Jeder, der wusste, dass ich in Vancouver lebte, hätte mich ungläubig ausgelacht. Zum Glück wusste es außer mir niemand.
Hast du später Zeit zu telefonieren?
Ich las Taras Nachricht, steckte das Handy aber gleich wieder weg und meine Hände in die warmen Jackentaschen. Ich würde mir auch später noch einen Grund zurechtlegen und absagen können. Ich hatte wirklich keine Lust zu telefonieren. Es waren bald drei Monate, seit sie verschwunden war. Und entgegen allen Behauptungen wurde rein gar nichts mit der Zeit leichter.
Ich wartete an der Ampel und schaute die Straße runter, die geradewegs zum Hafen führte. Zum Teil verstand ich, was andere Menschen an dieser Stadt fanden. Die Symmetrie, die abstrakten Hochhäuser neben alten viktorianischen Bauten. Die ungewohnte Freundlichkeit der Großstadtmenschen und das Wissen, hier nie allein zu sein. Auch wenn das täuschte. Man war allein. Immer und überall. Erst recht unter Menschen.
Die Ampel sprang auf Grün, und mein Handy vibrierte erneut, während ich die Straße überquerte. Vielleicht war es Tara doch wichtig, dass wir sprachen? Aber was gab es zu sagen, wenn wir uns doch wieder nur anschwiegen?
Ich mache mir langsam echt Sorgen.
Ich blieb abrupt stehen, woraufhin mich eine Passantin anrempelte und mir einen verwirrten Seitenblick zuwarf. Schnell ging ich weiter. Mitten auf der Straße stehen zu bleiben, war auch mir zu viel.
Ich weiß, dass du Zeit brauchst. Ich würde nur wirklich gerne wissen, dass es dir gut geht. Ich …
Ich schnaubte und las die Worte auf meinem Sperrbildschirm immer und immer wieder. Was hinter den drei Punkten stand, würde ich nicht herausfinden. Dazu müsste ich auf die Nachricht auch klicken. Auf den Chat mit Zoey. All ihre Worte, Fragen und Sorgen lesen und mich damit auseinandersetzen, dass ich meine beste Freundin ignorierte. Irgendwann würde ich es vielleicht nicht mehr tun. Irgendwann würde ich ihr antworten, ihr erklären, dass ich die Zeit gebraucht hatte, es mir jetzt wieder gut ging und dass ich zurückkommen würde. Irgendwann war nur nicht heute. Ich stellte mich seitlich an die Glasfront einer Hausfassade, um nicht noch mal über den Haufen gerannt zu werden.
Tara wartete auf eine Antwort.
Zoey wartete auf eine Antwort.
Ich hielt das Handy in meiner Hand, bis ich zu zittern begann und meine Finger taub wurden. Ich sah auf, schaute mich um und betrat den Laden in meinem Rücken. Die große Glastür ließ sich einfach aufdrücken, und der Geruch verriet mir sofort, dass ich in einem Coffeeshop gelandet war. Zielsicher machte ich den abgelegensten Tisch in einer der Ecken aus und platzierte mich auf dem durchgesessenen Polster, das unerwartet bequem war. Ich starrte immer noch auf mein Handy, das mir die ungelesenen Nachrichten von Zoey und Tara meldete, während meine Finger langsam wieder auftauten. Sie kribbelten unangenehm, aber das war mir egal. Je länger ich daraufstarrte, desto mehr entfernte ich mich von mir selbst. Was tat ich hier eigentlich? Nicht hier, in diesem Café. Hier, in diesem Leben. Es war, als betrachtete ich mich von außen. Stand vor mir und schaute mich an, wie ich kläglich an diesem Tisch kauerte, ein Smartphone fest umklammert. Nasse Hose, dreckige Schuhe, zittrige Hände. Leerer Blick. Nicht traurig, oder enttäuscht oder niedergeschlagen. Leer.
»Hey, kann ich dir was bringen?« Ich ließ den Blick gesenkt, auch wenn die Stimme nett klang.
»Nein, danke«, nuschelte ich.
»Wir haben Kaffee, Matcha, Chai …«
»Nein danke«, wiederholte ich monoton und hoffte, sie würde aufhören zu reden.
»Du bist in dieses Café gekommen und willst hier sitzen bleiben, daher bin ich mir sicher, dass du was bestellen willst.« Ich schaute auf, direkt in das Gesicht einer jungen Frau, die mich anlächelte. Ihr Gesichtsausdruck war freundlich und offen, als hätte sie keine meiner pampigen Antworten wahrgenommen.
»Ich, ähm …«
»Da oben steht alles, was wir zur Auswahl haben.« Sie zeigte auf die hölzerne Tafel an der Wand hinter dem Tresen. Ich kniff die Augen zusammen und entzifferte einen Schwall an Kaffee-Variationen, die mir sowieso alle nicht schmecken würden.
»Wir müssen das auch gar nicht so unangenehm werden lassen. Du sagst mir eine Nummer, ich bereite das schnell zu, und dann kann die Tasse da gerne stundenlang stehen. Hauptsache, mein Chef sieht eine Tasse. Dann haben wir alle unseren Job erledigt und sind glücklich.« Ich stockte, wollte irgendeine beschissene Nummer sagen, als ich an meinen Kontostand dachte, der gerade noch so für die Miete reichte. Wenn ich mir nicht bald einen Job suchte, würde ich in ein paar Wochen bei dem Obdachlosen im Hinterhof einziehen müssen. Seine Konstruktion sah stabil und warm aus, vielleicht war das gar keine so schlechte Idee.
»Tut mir leid«, sagte ich stattdessen. »Ich … habe leider mein Portemonnaie zu Hause liegen lassen.« Ich verzog entschuldigend den Mund. Sie ließ ihren kleinen Block und Stift sinken und sah mich an. Sie musterte mich genau, vermutlich um abzuwägen, wie sie mich jetzt möglichst freundlich rausschmeißen könnte.
»Ich kann dir einen Filterkaffee aufs Haus anbieten.« Ich starrte sie an, während sie ihre Mundwinkel hob.
»Aber … du hast doch gerade gesagt, dass du mir etwas verkaufen musst.«
»Ich habe dir vom Tassen-Gesetz meines Chefs erzählt. Das Wort verkaufen kam da gar nicht drin vor.« Sie schüttelte den Kopf. »Wirklich, du musst ein bisschen besser zuhören.« Ich sah sie weiter an und regte mich nicht. Sie hob ihren Block wieder näher an die Brust und kritzelte darauf herum. »Ein Filterkaffee, kommt sofort.« Sie machte auf dem Absatz kehrt und lief zum Tresen, wo sie die Kanne von der Warmhalteplatte hob und eine Tasse eingoss. Ich wandte schnell den Blick ab, bevor ich noch länger unangenehm starrte. In diesem Moment vibrierte mein Handy erneut.
Ich vermisse dich
Tara schrieb diese Worte fast jeden Tag. Es änderte sich ja auch nichts an unserer Situation. Alles war beschissen. Wir wollten uns wiedersehen. Ziemlich sicher. Nur wie?
Die Kellnerin stellte die dampfende Tasse mit schwarzer Brühe vor mir ab, und ich nahm einen kleinen Schluck. Angewidert verzog ich das Gesicht.
»Tut mir leid, ich hätte dir sagen können, dass unser Filterkaffee eher wie Spülwasser schmeckt.« Sie zuckte nur mit den Schultern.
»Macht nichts, ich hab ja jetzt eine Tasse vor mir stehen.«
Sie zeigte mit dem Finger auf mich. »Du hast ja doch zugehört, Griesgram.«
Innerlich zuckte ich zusammen. So hatte mich Tara auch ab und zu genannt. Kurz nachdem sie mich gefragt hatte, ob ich mir auch manchmal vorstellte, dass ein riesiger Krake im Lake Louise lebte.
»Alles gut?«
Ich schluckte die Gefühle runter, was sicher wieder nur dazu führen würde, dass sie mir schwer im Magen lagen. So konnte es nicht weitergehen.
»Ja … ihr …«
Fragend hob sie eine Augenbraue.
»Ihr sucht nicht zufällig noch einen Mitarbeiter?«
Etwas musste sich ändern.
KAPITEL 7
Tara
»Critter Care Center, Geene hier, was kann ich für dich tun?« Eine monotone Frauenstimme begrüßte mich, und ich spürte, wie mein Herz schneller schlug.
»Ja, hey, Geene, hier ist Tara«, begann ich, als müssten diese vier Buchstaben ihr irgendetwas sagen. »Ich, ähm«, versuchte ich schnell weiterzumachen, verhaspelte mich aber erneut. »Arbeitet Sit noch bei euch?« Ich hielt die Luft an, während ich auf Geenes Antwort wartete. Was machte ich nur, wenn Sit nicht mehr im Critter Care Center arbeitete? Würde sich jemand anderes noch an uns erinnern? An mich und …
»Ja, klar.« Mehr sagte sie nicht, und das folgende Kruscheln ließ mich hoffen, dass sie ihn holen würde.
»Hallo?«, flüsterte ich unsicher. Aber die ausbleibende Antwort sagte mir, dass sie wirklich aufgestanden war und mich nicht mitgenommen hatte. Oder eher das Telefon, in dessen Leitung ich hing und wartete. Und wartete … und wartete …
»Critter Care Center, Sit hier, was kann ich für dich tun?« Meine Mundwinkel hoben sich, als ich die gleiche Begrüßung ein zweites Mal innerhalb weniger Minuten hörte, doch dieses Mal war es Sit.
»Hey, Sit, hier ist Tara, ich weiß nicht, ob du dich noch an mich …«
»Tara! Oha, damit hab ich ja so gar nicht gerechnet«, unterbrach Sit mich mit einer Euphorie in der Stimme, die selbst durchs Telefon ansteckend war. »Erzähl! Wie geht’s dir?«
»Ähm, gut«, erwiderte ich schwerfällig. Diese Antwort fühlte sich so schwachsinnig an.
»Also was gibt’s? Was bringt dich dazu, den alten Sit mal wieder anzurufen?« Ich lachte bei dem Gedanken, wie er sein Marvel-Shirt zurechtzupfte und sich dabei alt nannte. Ich wusste es natürlich nicht genau, hatte ihn damals aber etwa auf mein Alter geschätzt.
»Ich, ähm …« Heute war wohl der Tag der lauten Überlegungen. »Damals, als wir Chubby gerettet haben, hast du dich doch um einen dauerhaften Aufenthalt im Reservat gekümmert, richtig?« Ich biss mir auf die Lippe bei der Erinnerung an Chubbys trauriges Quieken, während er auf der Suche nach seiner Mutter war. Seiner toten Mutter. Witzig, wie sich das Leben veränderte. Ich weiß jetzt, wie du dich fühlst, Chubby.
»Ja, klar! Armes kleines Kerlchen!« Ich friemelte am Saum meines Pullovers und rückte mich auf dem Sofa zurecht. »Ich hatte damals ein Reservat gefunden, das sich um verwaiste Fälle wie ihn kümmert, genau.« Er klang, als würde er mehr mit sich selbst sprechen, um seine Erinnerung wieder aufzufrischen. »Die haben ihn, soweit ich weiß, versorgt, aufgezogen und dann ins Reservat ausgewildert, wo er zusammen mit anderen Flaschenkindern oder Problemfällen lebt.« Flaschenkind. Das war Chubby also geworden, nachdem jemand seine Mutter vergiftet hatte. Jemand, der auf keinen Fall wollte, dass Chubbys Zuhause ein Naturschutzgebiet wurde.
»Du hast nicht zufällig den genauen Namen des Reservats oder vielleicht sogar Kontaktdaten?« Meine Stimme wurde mit jedem Wort leiser. Die Welt würde nicht untergehen, wenn ich Chubby nie wieder sah oder nicht wusste, was aus ihm geworden war. Aber die Welt würde sich ein klein wenig besser anfühlen, wenn ich hörte, dass es ihm gut ging.
»Aber klar doch!« Sit lachte, und ein Strahlen erfüllte mich von innen heraus. »Ich weiß es nicht mehr auswendig, aber ich hab die Daten sicher hier irgendwo rumliegen. Kann ich sie dir schicken? Ist das hier deine Telefonnummer, von der du anrufst?« Ich nickte eifrig, bis ich mich daran erinnerte, dass Sit mich gar nicht sehen konnte.