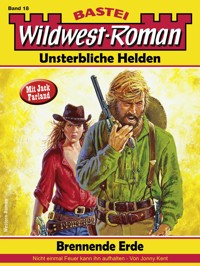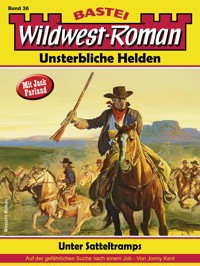
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Wildwest-Roman – Unsterbliche Helden
- Sprache: Deutsch
Wenn Jack Farland im Voraus gewusst hätte, was ihn in Clinton City erwartet, hätte er die Stadt wahrscheinlich gemieden. Obwohl der Mann aus Ohio normalerweise prinzipientreu ist, verliert er dort nicht nur sein Geld, sondern auch den Revolver und das Pferd an einen Betrüger. Da es für einen Cowboy nichts Schlimmeres gibt, als ohne seine treuen Begleiter dazustehen, setzt Farland nun alles daran, sein Hab und Gut zurückzubekommen. Doch dabei gerät er von einer misslichen Lage in die nächste. Es kommt schließlich so weit, dass er mehr einstecken muss, als er austeilen kann. Bald darauf hängt sein Leben nur noch am seidenen Faden ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 150
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Cover
Unter Satteltramps
Vorschau
Impressum
Unter Satteltramps
Von Jonny Kent
Gnadenlos gab die Sonne seit dem frühen Morgen eine wahre Gluthitze auf die Savanne ab.
Der Mann, der da durch das hügelige Land ritt, hatte den Hut tief in die Stirn gezogen. Starkes Blondhaar wucherte unter der breiten Krempe hervor und fiel ihm hinten auf das schwarze Halstuch. Er hatte ein kantiges, scharf geschnittenes Gesicht, in dem ein smaragdgrünes Augenpaar stand. Sein Hemd war aus grauem Kattun-Stoff und vielfach von Schweißstellen durchnässt. Um die Hüften trug er einen breiten, mit Patronen gespickten Waffengurt, der tief über dem linken Oberschenkel einen schweren Remington-Revolver hielt. Enganliegend war die graue Levis, deren Hosenbeine unten über die Schäfte seiner hochhackigen Stiefel ausliefen.
Schon seit Stunden trottete sein brauner Wallach durch das mit Büschen durchsetzte, unübersichtliche Gelände westwärts ...
Es war ein weiter Weg, den der Ohioman von den Ufern des Eriesees bis hierher, in die Prärie von Kansas hinter sich hatte. Jack Farland suchte einen Job als Cowboy. Man hätte meinen können, dass das leicht sein musste in diesem Land. Aber das war keineswegs der Fall. In den heißen Sommermonaten war der Bedarf an Weidereitern nicht so groß wie im Frühjahr und im Herbst.
Das Büschelgras der Savanne streifte fast die Stiefel des Reiters und ließ seinen gelbgrünen, pulvrigen Staub darauf zurück. Farland, der hin und wieder völlig unabsichtlich den Blick über die Silhouette der Hügel streifen ließ, kniff plötzlich die Augen zu schmalen Schlitzen zusammen. Bis ins Mark erschrak er, und fast hätte er den Wallach zurückgerissen. Denn das, was er da gesehen hatte, war sehr wohl dazu angetan, einen einsamen Mann, der durch dieses Land streifte, mit tiefster Beklemmung zu erfüllen. Drüben auf einem der Hügel hielt ein Reiter an, der bewegungslos auf seinem Pferd saß.
Obgleich Farland den Mann keineswegs erkennen konnte, wusste er doch, dass es ein Indianer war.
Jack Farland hatte, wie jeder weiße Mann in diesem Land, eine unbewusste Abneigung gegen die Indianer. Eine Abneigung, die auf den Erzählungen von den vielen Kämpfen, die zwischen Rot und Weiß stattgefunden hatten, beruhte.
Niemals bisher hatte er eine Rothaut zu Gesicht bekommen. Er hatte sich oft vorgestellt, als er in den Westen aufbrach, wie es wohl sein würde, wenn er zum ersten Mal einen Indianer sehen würde. Vorstellungen von geschwungenen Kriegsbeilen, zischenden Pfeilen, pfeifenden Kugeln und gellendem Kriegsgeschrei waren dabei wirr durch seinen Kopf gezogen.
Mit der Zeit aber hatte er alles vergessen. Er war in den Westen gekommen und war nur weißen Männern begegnet, und der Kampf mit ihnen war oft hart genug gewesen. Niemals zuvor in seinem Leben hatte er in so kurzer Zeit so viele Banditen getroffen, wie auf seinem Ritt nach Kansas.
Nun aber war da plötzlich ein Indianer.
Farland musste sich gewaltsam dazu bringen, den Kopf nach vorne zu richten, um den Beobachter drüben auf dem Felsgrat nicht merken zu lassen, dass er ihn entdeckt hatte.
Er tastete mit der rechten Hand, die er meist beim Reiten herunterhängen ließ, über die Hinterhand des Pferdes, tat, als habe er dort etwas entdeckt, das nicht in Ordnung war, hielt das Pferd an und stieg ab. Dabei hob er den Kopf nicht etwa an, sondern blickte scharf unter der Hutkrempe nach Osten hinüber.
Die Konturen der Hügel, aus deren Nähe er sich nur unmerklich entfernt hatte, schienen plötzlich wie mit herausstehenden Nägeln besetzt zu sein. Aber das waren keine Nägel und auch keine Bäume oder Steine, das waren Menschen.
Indianer! Mann an Mann standen die Roten da und rührten sich nicht.
Der Mann vom Eriesee griff sich unwillkürlich an die Kehle. Dann strich er über den Sattel, so als wäre da Staub wegzuwischen, setzte den linken Fuß in den breiten Steigbügel und zog sich auf den Pferderücken. Er ritt weiter.
Aber er spürte, dass winzige Schweißperlen unter seinem Hutrand hervorgetreten waren und seine Stirn bedeckten. In Sekundenschnelle war sein ganzer Körper schweißgebadet, das Hemd klebte ihm am Leibe. Er wischte sich über die Stirn, presste den von der Sonne glühend heißen Hemdsärmel auf seine Augen und starrte unverwandt nach Westen.
Ruhig bleiben! Keine Eile zeigen. Im selben Trott weiterreiten. Er musste sich die Formeln, die jeder weiße Mann, der dieses Land betrat, unbewusst lernte, immer wieder vorsprechen. Wer einem Indianer gegenüber Angst zeigte, der hatte schon verspielt. Bloß jetzt nicht nach rechts hinübersehen!
Als er hundert Schritt weitergeritten war, vermochte er der Versuchung aber nicht länger zu widerstehen und wandte wie unabsichtlich den Kopf nach rechts. Im Augenwinkel hätte er sie sehen müssen.
Aber er sah nichts mehr, gar nichts. Er warf den Schädel förmlich herum und starrte zu den blassgrünen Hügelrändern hinüber, die ihre Konturen gegen den stahlblauen Kansas-Himmel schoben.
Mit einem Ruck hielt er sein Pferd an, kniff die Augen fest zusammen, riss sie wieder auf und schüttelte dann den Kopf. Er fuhr sich durch das schweißnasse Gesicht, riss das Halstuch herunter und wischte den Schweiß weg, der ihm über die Brauen in die Augen gedrungen war.
»Damned! Was ist denn das ...?« Er sah sich jetzt nach der anderen Seite um, starrte dann wieder zu dem Grat hinüber, der sich über viele Meilen von Südosten nach Nordwesten zog, nahm plötzlich die Zügel mit einem harten Ruck an sich und presste dem Wallach die Sporen in die Weichen.
Das Tier schoss wie mit einem Panthersprung vorwärts und fiel in einen harten, stoßenden Galopp.
Ich muss von den Hügeln weg, weiter in die Savanne hinein!, schoss es ihm durch den Kopf.
Kaum hatte er auch die zweite Hand an die Zügel gebracht, als er eine Entdeckung machte, die ihm das Blut in den Adern stocken ließ. Nicht ganz hundert Schritt von ihm entfernt war zwischen zwei Büschen ein Reiter aufgetaucht.
Ein Indianer!
Reglos, wie eine Statue verharrte er zwischen den trockenen Tecca-Sträuchern und blickte dem weißen Mann entgegen.
Farland hatte das Pferd unwillkürlich angehalten und stierte fassungslos zu dem Indianer hinüber. Wie war das möglich? Der Mann konnte auf keinen Fall in dieser kurzen Zeit von den Hügeln herunter in die Talsenke geritten sein, um sich hier zu verbergen. Das bedeutete also, dass er schon vorher hier gewesen sein musste – und das wiederum bewies nichts anderes, als dass die Indianer hier überall steckten und auf ihn warteten.
Sie haben es auf mich abgesehen!, brannte es in seinem Hirn.
Er presste die Zähne aufeinander und ritt langsam vorwärts. Unmerklich hatte er den Revolver im Holster gelockert.
Als der Ohioman bis auf zwanzig Schritt an den Reiter herangekommen war, hielt er sein Pferd an.
Die beiden Männer fixierten einander. Jack Farland blickte unverwandt in das Gesicht des Indianers. Es war ein schmales, fast hageres Gesicht, in dem ein tiefbraunes Augenpaar stand. Der Mann hatte scharf nach oben gezogene Brauen und eine leicht gebogene Nase.
Farland war erstaunt, wie wenig typisch indianische Merkmale dieses Gesicht aufwies. Es war ein gut gemeißeltes Antlitz, das einem vielleicht vierzigjährigen Mann gehörte.
Farland presste die Knie zusammen und trieb damit den Wallach weiter vorwärts. Nur etwa neun Schritt trennten ihn jetzt noch von der Rothaut.
Auf diese Distanz erst sah man, dass das Gesicht des Indianers von winzigen Falten durchzogen war, sodass er jetzt sehr viel älter wirkte. Auch sah Farland, dass sich durch das schwarze strähnige Haar viele Silberfäden zogen.
Der Mann hatte eine weiße Feder hinten im Haar stecken, deren Spitze schwarz gefärbt war. Eine Kette aus Tierzähnen lag um seinen Hals. Sein Oberkörper steckte in einer Art von Jacke, die aus hellem, gegerbtem Leder bestand. Seine Hosen waren aus dunklerem Leder und ebenso wie die Jackenärmel mit langen Fransen besetzt. Um die Hüften trug er einen Gurt, in dem ein Revolver steckte.
Aus unergründlichen Augen blickte der Rote den Weißen an. Plötzlich nahm er sein Pferd herum und ritt langsam zwischen den Tecca-Büschen hindurch nach Norden hinüber, den Hügeln entgegen.
Farland sah ihm mit geweiteten Augen und offen stehendem Mund nach. Als er sich jetzt mit der Linken durchs Gesicht wischte, war sie nass, als hätte er sie in eine Pferdetränke getaucht.
Jetzt keine Hast zeigen! Um keinen Preis. Ganz langsam weiterreiten, so als ob gar nichts wäre!
Es brannte ihm dennoch unter der Haut, und am liebsten hätte er dem Wallach die Sporen in die Weichen getrieben, um ihn zu größter Eile anzutreiben. Aber er ritt im selben Tempo weiter. Als er nach einer Weile einen Blick zur Seite riskierte, war der Indianer verschwunden.
»Unheimlich ...!« Er blickte sich um, als ob das Wort, das über seine Lippen gekommen war, von jemandem hätte gehört werden können.
Unbehelligt ritt er weiter.
Von Minute zu Minute riskierte er unmerklich einen Blick zu den Hügeln hinüber, suchte mit den Augen die Bodenunebenheiten vor sich ab, die Büsche, die Senken und Erhebungen. Aber es geschah nichts. Die roten Männer zeigten sich nicht mehr.
Es war gegen zwei Uhr am Mittag, als er in der Ferne eine Stadt auftauchen sah.
Heftig trieb er den Braunen an. Schaumflocken flogen dem Tier vom Maul und blieben an den Stiefeln des Reiters kleben.
Als er die gerade Straße, die meist aus den Städten noch ein Stück in die Savanne hinauslief, endlich erreicht hatte, hielt er an, blickte sich um und starrte in den sich nun langsam legenden Staub, den er zurückgelassen hatte. Über ihm selbst stand eine wahre Glocke von pulverfeinem Sand, der sich nur sehr langsam niederließ und alles hellbraun färbte.
Als die Sicht hinter ihm wieder klar war, sah er nur eine stille, friedliche Hügellandschaft. Er nahm das schwarz-weiß karierte Tuch aus der Tasche und wischte sich damit durchs Gesicht. Langsam hielt er auf die Stadt zu.
Vor dem ersten Haus hingen an einem Baum zwei Bretter, auf die der Name der Stadt gepinselt war.
Clinton City.
Eine Stadt, die im flammenden Mittagslicht so hoffnungslos öde wirkte wie das Land ringsherum. Die Vorbauten, die in der hochstehenden Sonne nur kurze harte Schatten warfen, lagen leer da wie die Straße selbst. Wie ausgestorben wirkte dieses Nest.
Der Reiter blieb auf der Straßenmitte, bis er vor einem Hof eine Pferdetränke entdeckt hatte. Er hielt darauf zu, rutschte aus dem Sattel, ließ den Braunen das lauwarme Nass in durstigen Zügen saufen und warf sich selbst ein paar Hände voll Wasser über das staubverkrustete, brennende Gesicht. Dann nahm er den Hut ab, füllte ihn mit Wasser und stülpte ihn sich kurzerhand über den Kopf.
Er wischte sich mit der Rechten das Wasser aus den Haaren und dem Gesicht, setzte den Hut wieder auf und wartete noch einen Augenblick, bis der Wallach seinen Durst gestillt hatte. Dann führte er das Pferd am Zügel weiter, hielt sich dicht an den Vorbauten, als könnten sie ihm Schatten spenden.
Aber damit geizten die Häuser, denn die hochstehende Sonne warf nicht einmal drei Zoll davon auf den glühenden Straßenrand. Immer, wenn einer der Gehsteige zu Ende war, weil eine Hofeinfahrt kam, beschleunigte Farland seinen Schritt.
Plötzlich blieb er stehen und blickte verblüfft zur Seite. Die enge Häuserreihe auf der rechten Seite war zu Ende, und eine Art von Seitenstraße zog sich nach Norden, die jedoch nur aus wenigen Häusern bestand.
Drüben an der Ecke war eine Schenke, vor der mehrere Pferde standen, die die Köpfe tief hängen ließen. Eine Brutalität, die Tiere in dieser Hitze stehenzulassen. Jack hatte so etwas immer gehasst, wo er es auch gesehen hatte. Er führte sein Pferd neben das Haus, wo es wenigstens eine Spur von Schatten fand, warf die Zügel um die Haltestange und stieg die drei Stufen auf den Vorbau. Der Sand knirschte unter seinen Stiefelsohlen, als er auf die Saloontür zusteuerte.
Das mittlere Drittel des Eingangs war durch einen Schwingarm versperrt, der primitiv zusammengenagelt war und federnd in zwei Angeln hing. Farland warf einen Blick über den Schwingarm und versuchte, seine Augen an das Dunkel zu gewöhnen, das vor ihm in dem Schankraum herrschte.
Rechts war die Theke, die sich fast vom Eingang durch die ganze Länge des schmalbrüstigen Saloons zog. Mehrere Männer lehnten da und starrten vor sich hin. Hinter der Theke stand ein gnomenhafter Mensch mit einem langen, beinahe kahlen Schädel, der nur von einem grauen Haarkranz umsäumt war. Der Mann war damit beschäftigt, Gläser in einer Wanne zu spülen, die neben ihm auf einem Hocker stand.
Farland schob den Schwingarm auf und verursachte damit ein knarrendes Geräusch, das die Männer aber nicht veranlasste, die Köpfe nach rechts zu drehen, um zu sehen, wer da kam. Im Gegenteil sahen sie alle nach links, zu einem gewaltigen Spiegel, der über der Theke hing und ihnen alles zeigte, was sich am Eingang tat.
Der Ohioman blieb gleich am Ende der Theke stehen, stützte sich mit dem rechten Arm auf und wartete, bis der Keeper sich dazu herabließ, einen Blick zu ihm hinüberzuwerfen.
Jack tippte grüßend an den Hutrand und sagte: »Ein Bier.«
Der Keeper fuhr sich mit dem Handballen über seine knollige Nase und nickte. Dann schenkte er ein und schubste das Glas mit einem gekonnten Ruck über die ganze Länge der Theke auf Farland zu. Ganz sicher hätte es den Ohioman auch erreicht, wenn nicht urplötzlich eine braune, haarige Hand nach vorne geschossen wäre, um es aufzuhalten.
Jack hob den Blick und sah in ein gelblich flimmerndes Augenpaar, das dem Besitzer dieser Hand gehörte. Es war ein Mann von vielleicht fünfunddreißig Jahren, mit einem quadratischen Schädel, der auf einem massigen, muskulösen Rumpf saß.
Er hatte aschblondes Haar und struppige Brauen, sein Mund war schmal, und als er ihn jetzt zu einem Lächeln verzog, sah man, dass ihm im Oberkiefer mehrere Zähne fehlten. Er trug ein verwaschenes blaues Hemd, eine graue abgetragene Hose und abgelaufene Stiefel.
An jeder Hüftseite hatte er einen Revolver hängen und im Gurt dazu noch ein Bowiemesser stecken. Jetzt feixte er und meinte: »Hier ist die Zollstation. Hier wird gezahlt.«
Jack hatte seinen Blick schweigend direkt auf die Augen des Mannes gerichtet, den er um eine halbe Haupteslänge überragte. Der andere nahm das Glas von der Theke und ging damit quer durch den schmalen Schankraum auf einen mit grünem Filz bezogenen Tisch zu, der in einer Fensterecke stand.
»Was soll das bedeuten?«, rief Farland ihm nach.
»Komm, wir werden pokern. – Keeper, Whisky!«
Jack presste die Zähne aufeinander. Der Durst brannte ihm wie Feuer in der Kehle, und die Zunge klebte wie ein ausgetrocknetes Lederstück am Gaumen. Er spürte förmlich, wie die Augen der vier anderen Männer auf ihm ruhten, stieß sich mit einem Ruck von der Theke ab und folgte dem anderen. Als er den Spieltisch erreicht hatte, griff er nach seinem Bier.
Der Gelbäugige erhob sich, legte die Linke auf Farlands rechten Unterarm und meinte, ohne beim Sprechen das Gesicht zu verziehen: »Ich bin Ric Flegger.«
»Aha«, entgegnete Farland schroff, nahm sein Glas und wollte damit zur Theke zurück.
»Augenblick!«, hörte er da hinter sich die schnarrende Stimme Fleggers.
Farland blieb auf der Stelle stehen und wandte langsam den Kopf. Er wäre am liebsten weitergegangen, aber das, was er auf seinem Ritt bisher erlebt hatte, veranlasste ihn jetzt doch, vorsichtiger zu sein.
»Was gibt es?«, fragte er.
»Ich hatte die Absicht, Sie zu einem Drink einzuladen, Mister.«
So gern Farland das abgeschlagen hätte, es ging nicht.
Ein abgeschlagener Drink war mit einer ausgesprochenen Beleidigung gleichbedeutend.
Wohl oder übel kam Jack an den Tisch zurück und ließ sich Flegger gegenüber nieder. Jetzt musste er auch noch warten, bis der Salooner den Whisky brachte. Aber der gnomenhafte Mann watschelte schon damit von der Theke durch die Tischreihe auf den Spieltisch zu.
»Thanks«, schnarrte Flegger.
Während Jack sein Glas hob, um ein paar tiefe Züge zu nehmen, die den brennendsten Durst löschten, hatte er Gelegenheit, sein Gegenüber zu betrachten. Er sah eine breite Visage, eine wulstige, zerschlagene Nase, aufgeworfene Lippen und abstehende rote Ohren. Er war stiernackig, und insgesamt gefiel er Jack überhaupt nicht. Aber der Mann vom Eriesee hatte schon so viele seltsame Gestalten in diesem Land kennengelernt, dass er erst einmal beschloss, kein Urteil zu fällen.
»Wie wär's mit einem Spielchen?«, fragte Flegger, aber es klang eher wie ein Befehl.
Jack zog die Schultern hoch: »Ich muss heute noch weiter.«
»Na und? Deshalb werden wir uns doch ein Spiel erlauben können?«
»Meinetwegen«, entgegnete Jack, der allerdings nur wenig Lust zum Pokern hatte.
Später hatte Farland oft versucht, sich das, was in dieser Nachmittagsstunde geschah, genauer ins Gedächtnis zurückzurufen. Sie spielten Double-Poker, ein Spiel, das nur zu zweit gespielt werden konnte und in moralischer Hinsicht keineswegs angenehmer ist, da immer einer der beiden der Verlierer sein muss. Farland gewann das erste Spiel, auch das zweite, verlor dann aber das dritte, das vierte und auch noch das fünfte.
Die nächste Partie verlor Flegger. Er griff plötzlich in die Tasche und legte zehn Dollar neben sich auf den Tisch.
Jack schüttelte den Kopf. Die paar Dollars, die er noch in der Tasche hatte, konnte er nicht verspielen. Als er den Blick hob, sah er, dass die Männer von der Theke herangekommen waren und um den Tisch herumstanden. Ein übles Gefühl kam in seiner Magengrube auf.
Damned! Dieser Flegger hatte ihn in die Hölle geritten mit seinem Einsatz. Was blieb ihm anderes übrig, als ebenfalls zehn Dollar dagegenzusetzen.
Jack gewann.
Flegger verzog das Gesicht, hob die Schultern, griff dann wieder in die Tasche, holte einen goldenen Eagle, ein Zwanzigdollarstück hervor und warf es auf den Tisch.
Farland starrte auf die große Münze, rutschte zweimal auf seinem Stuhl hin und her und nahm schließlich auch zwanzig Dollar heraus.
Wieder gewann er.
Da grub sich eine scharfe Falte zwischen Fleggers Brauen.
»He, mir scheint, Sie sind ein Glücksvogel.«
»Absolut nicht«, entgegnete Farland. Er kippte den Rest seines Bieres runter und wollte sich erheben.
Da streckte Flegger plötzlich die rechte Hand aus, schüttelte den Kopf und knurrte: »He, ich erwarte Revanche.«
Farland, der die Hand schon nach dem Geld hatte ausstrecken wollen, zog ebenfalls die Brauen zusammen. »Meinetwegen«, meinte er dann.
Flegger nahm gleich eine große Summe Geld aus seiner Hosentasche und legte es rechts vor sich hin.
Leise flippten die Karten auf dem grünen Filz. Es war rasch entschieden. Flegger hatte gewonnen.
Ein Lächeln huschte über das Gesicht des Mannes vom Eriesee. Er schob seinen Stuhl etwas zurück und blickte Flegger an, ohne etwas zu sagen.