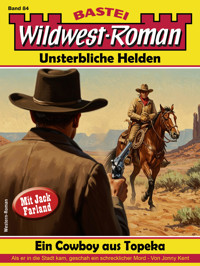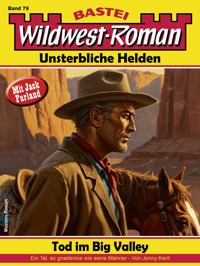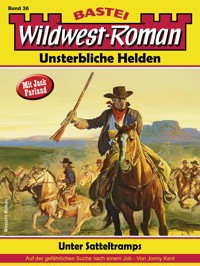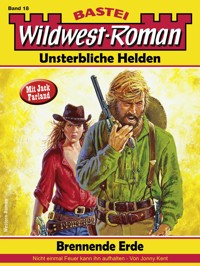1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Jack Farland hat bereits viele Herausforderungen gemeistert und ist zuversichtlich, in Dodge City eine neue Anstellung zu finden. Aber die Nacht, die dem Ohioman nun in der Prärie bevorsteht, wird alles bisher Erlebte übertreffen. Plötzlich reißt ihn der heimtückische Überfall eines Banditen aus dem Schlaf. Der Angreifer raubt ihm nicht nur seinen Besitz, sondern schlägt auch brutal mit dem Gewehr auf ihn ein. Während Jack bewusstlos und verwundet zurückbleibt, scheint die Wildnis jetzt über ihn zu triumphieren. Doch in der gnadenlosen Weite seiner Umgebung wird in ihm so etwas wie ein Funken Hoffnung entfacht. Es ist ein unbezwingbarer Wille, zu überleben und zurückzuschlagen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 170
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
Der Mann aus Key West
Vorschau
Impressum
Der Mann aus Key West
Von Jonny Kent
Die Nacht, in der es geschah, war warm und mild.
In einer kleinen Bodenmulde mitten in der Savanne lag im hohen Büffelgras ein Mann. Er hatte sich in seine Pferdedecke eingewickelt und blickte in den mit Sternen übersäten Himmel hinauf. Neben ihm erhob sich die Silhouette seines Pferdes.
»Komm, Brauner, leg dich nieder.«
Jack Farland hatte einen ziemlich weiten Ritt hinter sich, als er sich zwei Stunden nach Einbruch der Dunkelheit hier in der Pawnee-Prärie zur Nachtruhe niederlegte.
Der Ohioman, der von den Ufern des Eriesees aufgebrochen war, um in den fernen Westen zu reiten, hatte kein Glück gefunden. Er war eine Zeit lang auf einer Horse-Ranch gewesen, hatte das Cowboyhandwerk gründlich gelernt und war dann weiter von Ranch zu Ranch gezogen, bis er über die Grenzen von Missouri schließlich nach Kansas gekommen war ...
Von Topeka war er auf der großen Overlandstraße nach Salina geritten und von dort nach Südwesten hinüber zum Cheyenne-See gelangt. In Mustang City hatte er einen schweren Zusammenstoß mit den Holyoke-Brothers gehabt. Er war jetzt auf dem Weg nach Südwesten und hoffte, irgendwo unten bei Kinsley oder weiter südwestlich bei Dodge City einen Job auf einer Ranch zu finden.
Er führte ein unruhiges Leben, der junge Jack Farland. Ahnte er, dass es nur ein sehr kurzes Leben sein würde? Spürte er, dass seine Frist nur allzu kurz bemessen war?
Noch eine volle Stunde hatte er die Augen offen, blickte in die flimmernden Sterne hinauf und dachte an die Eltern daheim und an die Schwester, die am Rand der Stadt Cleveland im Vorort Lakewood lebten und sich sicherlich manche Gedanken um ihn machten.
Es musste so gegen halb zwölf sein, als ihm die Augen endlich zufielen. Um ihn herrschte die Stille der Prärie.
Aber sie war gar nicht so still, die Prärie, wie es schien. Sie begann, gegen Mitternacht ihr seltsames Leben zu entfalten. Die Hyänen verließen ihr Versteck, streiften durch die schmalen Wege, die die Raubtiere in das hohe Büffelgras getreten hatten und spähten nach Beute aus. Die kleinen Präriehasen verließen ihre Löcher, lugten zum Himmel auf und hopsten dann umher, um ebenfalls für ihr Futter zu sorgen. Auch die wenigen großen Tiere der Savanne machten sich jetzt auf den Weg. Allen voran der gefährlichste Räuber der Wildnis, der schwarze Puma. Aber auch der graue Bär, der meist nur oben in den Bergen lebte, strich zuweilen durch die Grasebenen und jagte nach Beute; im Allgemeinen geschah dies jedoch meist zur Winterszeit, wenn die Nahrungssuche in den Bergen wegen des hohen Schnees und der starren Kälte für ihn sehr schwierig wurde.
Ein Summen, Raunen, Wispern und Flüstern umgaben den schlafenden Mann – und doch schien eine absolute Stille zu herrschen.
Das gefährlichste Raubtier aber, das sich in unmittelbarer Nähe des Schläfers befand, war zweibeinig.
Ein Mensch.
Er kauerte, nicht ganz dreihundert Yards von dem Mann in der Schlafdecke entfernt, hinter einer Buschgruppe und spähte zu der Stelle hinüber, auf der er vorhin den Reiter bemerkt hatte.
Es war ein großer Mensch mit einem harten Gesicht, das aussah, als wäre es aus Eichenholz geschnitzt. Pulvergrau waren die Augen, die darin standen, und der Schnurrbart, der unter der Nase wucherte, unterstrich noch die Härte und die Kälte im Gesicht dieses Gorillatyps. Er trug einen Tuchanzug, ein Kattunhemd und eine schwarze Halsschleife.
Über die Jacke hatte er einen breiten, patronengespickten Waffengurt geschnallt, der an der rechten Hüftseite, dem Oberschenkel zugeschoben, ein ledernes Holster trug, in dem ein schwerer .38er-Revolver vom Fabrikat Smith & Wesson steckte. Überdies hatte er schwarze Stiefeletten mit Sporen am Absatz.
Jetzt richtete er sich etwas auf, nahm die Sporen ab, schob sie in die Jackentasche und hob dann sein Gewehr vom Boden auf. Geduckt schlich er vorwärts.
Es war keineswegs einfach, sich an einen schlafenden Menschen mitten in der Savanne anzuschleichen, aber das menschliche Raubtier, das sich da an sein Opfer heranmachte, schien einen solchen Weg nicht zum ersten Mal zu bestreiten. Vorsichtig, jede Bodenunebenheit und jedes Gesträuch ausnutzend, bewegte sich der Mann auf die Bodenmulde zu.
Als er bis auf fünfzig Schritte herangekommen war, duckte er sich tiefer zum Boden nieder und benutzte jetzt die Hände, um sich aufzustützen; wie ein Tier bewegte er sich vorwärts: langsam und lautlos.
Nur noch fünfzehn Schritte trennten ihn von dem Schläfer. Ohne den geringsten Laut zu verursachen, schlich er weiter. Er ließ sich sehr viel Zeit, denn ein Mann ohne Sattel und ohne Pferd, der hatte Zeit.
Als er bis auf acht Schritte an den Lagerplatz herangekommen war, wieherte der braune Wallach des Ohioman leise. Jack Farland war sofort wach, rührte sich aber nicht, sondern blieb ruhig liegen und blickte zum Muldenrand hinauf.
Leider aber lag er auf der rechten Körperseite und blickte nach Westen hinüber. Der Mann, der sich an ihn heranschlich, näherte sich von Osten her, und zwar mit Bedacht. Von Westen her kam der Wind, sodass er dem Pferd keine Witterung bringen konnte. Aber das Wiehern des Pferdes veranlasste ihn dazu, seine Vorsicht trotzdem noch zu verdoppeln. Er kauerte über der Erde und wartete. Eine volle Viertelstunde wartete er. Dann erst bewegte er sich langsam weiter vorwärts und kam jetzt an den Muldenrand heran.
Der Wallach des Mannes vom Eriesee war kein besonders edles Pferd und auch nicht durch eine indianische Schule gegangen, sonst hätte er jetzt eine weitere Warnung folgen lassen.
In dem Augenblick, in dem der Bandit sich aufrichtete, um zum Sprung anzusetzen, warf sich Jack Farland herum. Er hatte das Geräusch im allerletzten Moment vernommen und wollte jetzt hochschnellen. Aber in dieser Sekunde traf ihn schon ein schwerer Schlag mit dem Gewehrlauf am Schädel und warf ihn nieder. Der nächste Schlag rutschte vom Kopf ab und erfasste die rechte Schulter.
Er war wie paralysiert auf der rechten Seite, vermochte sich dennoch aus dem Unterbewusstsein heraus nach links zu retten und entging so dem dritten Hieb, den der Mann aus dem Dunkel mit dem Gewehrkolben gegen ihn führte.
Instinktiv hatte Farland das Messer mit der linken Hand aus dem Gurt gerissen und hochgenommen, da aber traf ihn ein Fußtritt unter dem linken Arm. Mit aller Gewalt hielt er das Messer fest, riss es herunter und zog es dem Mann quer über den rechten Oberschenkel.
Der aber hatte den taumelnden, noch in seine Decke verwickelten Mann wieder und wieder am Kopf getroffen.
Schwer betäubt fiel Jack Farland zu Boden. Er spürte den nächsten Hieb nicht mehr, der auf ihn niederkrachte.
Keuchend stand der Verbrecher über ihm, wischte sich mit dem rechten Jackenärmel den Schweiß aus dem Gesicht, bückte sich nieder und war sich sicher, sein Opfer erschlagen zu haben. Er wälzte den Reglosen auf den Rücken, tastete ihn ab und zog ihm die lederne Brieftasche aus der Weste, nahm ihm aus dem Gurt einen kleinen Beutel mit Geld; dann suchte er den Revolver des Überfallenen, konnte ihn aber nicht finden, obgleich er den Boden abtastete. Schließlich stieg er auf das Pferd und preschte nach Westen davon.
Noch war es dunkel, aber die letzten Sterne wurden schon blasser am Himmel, und über dem Horizont im Osten stieg bereits der erste silbergraue Lichtschein des kommenden Tages auf.
Der Mann, der in der Savannenmulde lag, starrte aus schmerzenden Augen in den grauschwarzen Himmel.
Was war geschehen?
Farland brauchte eine volle Minute, bis ihm zu Bewusstsein kam, was da passiert war. Als er sich aufrichten wollte, merkte er zu seinem eisigen Schrecken, dass es nicht ging. Er konnte zwar die Augen bewegen, aber sein übriger Körper schien gelähmt zu sein.
Wo war das Pferd? Um Himmels willen! Das Pferd war weg!
Sein Schädel schien riesengroß zu sein wie eine Kesselschmiede, und das Hämmern darin wollte ihm jeden Nerv töten. Er wusste nicht, wie lange er so dagelegen hatte, als sich das erste orangerote Licht über den Horizont schob und mit leuchtenden Strahlen der Feuerball der Sonne über den Ostrand des Landes aufglühte und alles mit seinem purpurnen Licht erhellte.
In diesem Augenblick entdeckte der gelähmte Mann am Südrand der Mulde ein Tier. Es hatte einen länglichen, spitzen Kopf und zurückgelegte große Ohren, ein struppiges gräuliches Fell und glimmende Augen.
Ein Hund? Als das Tier den Kopf jetzt zur Seite nahm, konnte er es deutlich sehen: Es war ein Steppenwolf!
Sengende Angst durchzuckte den reglos in seinem Blut liegenden Mann.
Der Wolf der mittleren amerikanischen Savannen galt als eines der gefährlichsten Tiere, die dieses Land durchstreiften. Zwar geschah es nur selten, dass der Steppenwolf sich in diese Gegenden verirrte, aber es kam doch hin und wieder vor. Die große Dürrezeit hatte ihn aus seinem Jagdbereich vertrieben und hierher in die Pawnee-Prärie geführt.
Der graubraune Steppenwolf war dafür bekannt, dass er, ähnlich wie sein Bruder aus der russischen Tundra, einen offenen Angriff auf einen Menschen nicht scheute, wenn er vom Hunger geplagt wurde.
Wie viel weniger würde er einen reglos auf der Erde liegenden Mann fürchten?
Der Wolf sicherte noch nach allen Seiten seine Umgebung ab, wandte sich dann um, kam langsam die Mulde hinunter, blieb vor den Stiefeln des Mannes stehen und fixierte dessen Gesicht.
Plötzlich schreckte er zurück. Aber nur einen halben Yard. Er hatte gemerkt, dass der Mann am Boden nicht tot war. An dessen Augen, die sich bewegten, hatte er es festgestellt. Aber im Gegensatz zu manch anderem Raubtier, das sich schon durch den Blick der menschlichen Augen in die Flucht schlagen oder doch zumindest zurücktreiben ließ, blieb der graue Wolf mit zurückgenommenem Kopf stehen und fletschte die Zähne. Ein ekelhaftes Fauchen drang aus seinem Rachen.
Siedende Angst fuhr durch das Gehirn des wie gelähmt auf der Erde liegenden Mannes.
Der Wolf kam wieder heran, ging vorsichtig an den Beinen des Mannes vorbei und beugte sich plötzlich über dessen Kopf. Sein fauliger Atem schlug dem Mann entgegen. Seine Lichter suchten noch den Blick des Menschen. Und vielleicht war etwas in diesem Blick, das das Raubtier zur Vorsicht mahnte. Es wich etwas zurück, ging mit eingezogenem Schwanz im Krebsgang zum Muldenrand, kam dann aber plötzlich herangeschnellt und hieb einen vorsichtigen, prüfenden Biss in den linken Oberarm seines Opfers.
Dieser Biss musste den Krampf gelöst haben, in dem der Mann lag.
Farland zuckte zusammen und stieß einen unartikulierten Laut aus, der den Wolf über den Muldenrand flüchten ließ. Aber oben blieb er abwartend und lauernd stehen.
Der Mann lag noch immer auf der Erde, stützte sich auf den linken Ellenbogen, krampfte die Hände in die Grasbüschel und zog sich unter Aufbietung aller Kräfte in eine sitzende Stellung empor.
Oben stand der Wolf. Aber was war das? Plötzlich drehte er sich nach links, immer weiter bewegte er sich im Kreis, und alles ringsherum ging mit ihm: Die Grassilhouette, die sich scharf gegen das flammende Rot der aufgehenden Sonne neigte, der Himmel, alles ...
Ein Schwindelanfall!
Jack sah den Kopf des Wolfes wieder größer werden und näher kommen.
Um Himmels willen, er war zurückgerutscht, lag wieder auf der Erde, krampfte die Hände in die Grasbüschel und zerrte sich erneut hoch. Wieder brach ein heiserer, unartikulierter Laut aus seiner Kehle, der den Wolf noch einmal zurücktrieb.
Plötzlich fiel der Blick des Mannes auf einen Gegenstand, der durch das hohe Gras schimmerte.
Sein Revolver! Der schwere .45er-Remington-Colt! Da lag er im Gras. Der andere hatte ihn nicht gefunden.
Unter Aufbietung aller Kräfte zerrte er sich vorwärts, wobei er weiterhin das knurrende Fauchen ausstieß. Endlich hatte er den Colt erreicht. Mit zitternder Hand griff er nach der Waffe, spannte die Finger darum, zog mit dem Daumen den Hahn zurück und richtete den Lauf nach vorne.
Der Schuss brüllte auf und röhrte durch die Mulde. Der Tierkörper oben bekam einen Stoß, taumelte zurück, richtete sich dann wieder auf und – tatsächlich tauchte die Bestie jetzt wieder am Muldenrand auf. Der schwer verwundete Wolf stellte sich zum Kampf.
Jack, der den Revolver noch in der Rechten hielt, spürte, dass seine Hand so zitterte, dass er sich auf keinen zweiten sicheren Schuss verlassen konnte. Er richtete sich auf die Knie auf, schwankte hin und her, griff auch mit der Linken nach der Waffe, stützte sie mit beiden Händen und feuerte noch einmal.
Ein Stück vom rechten Ohr des Wolfes wurde nun förmlich weggefetzt. Da erst wich das Tier zurück und sprang davon.
Jack kroch auf allen vieren den Muldenrand hinauf und sah den Wolf weit drüben davonhumpeln, eine Blutspur hinter sich herziehend. Er wusste, dass diese Tiere oft viele Meilen weit laufen konnten, selbst wenn sie lebensgefährlich verletzt waren. Doch ob der Wolf wirklich lebensgefährlich verletzt war, war ja auch noch eine Frage.
Jedenfalls war er ihn jetzt erst einmal los. Er versuchte aufzustehen, brach aber sofort wieder in das rechte Knie ein, stützte sich auf den Boden, versuchte es dann noch einmal und stand schließlich schwankend auf den Beinen.
Ein riesengroßer Mensch mit breiten Schultern, schmalen Hüften, einem kantigen Gesicht, das von der Sonne der Prärie und von den scharfen Wettern tief gebräunt war.
Blut klebte an seinem Gesicht, war über der schweren Wunde links über seiner Stirn geronnen, klebte auch hinten in seinem Genick, wo es aus einer Wunde am Hinterkopf gekommen war. Seine Hände, seine Handrücken und seine Hose, sogar seine Stiefel – alles war voller Blut.
Wenn nur nicht dieser hämmernde Schmerz gewesen wäre. Der Bandit musste ihm zwei Schläge und vielleicht mehr über den Schädel gezogen haben. Mit einem Gewehrkolben!
Den Muldenrand zu erreichen, bedeutete für den schwer verletzten Mann eine ungeheure Anstrengung. Endlich war es ihm gelungen. Auf Händen und Füßen zerrte er sich über den Rand hinaus, kniete dann da und blickte nach Osten hinüber in die leuchtende Sonnenkugel, die jetzt frei über dem Horizont schwebte.
Der Tag hatte begonnen. Es war der schlimmste Tag, den Jack Farland jemals erlebt hatte.
Nachdem er sich einmal um sich selbst gedreht hatte und dabei fast wieder in die Mulde gestürzt wäre, hatte er sich für die Richtung nach Westen entschieden.
Dahin zurückzugehen, wo er hergekommen war, wäre Wahnsinn gewesen, denn dann hätte er sich sicher sein können, dass er die nächste Ansiedlung nicht mehr lebend erreichen würde. Viel zu weit lag sie von hier entfernt. Den ganzen Tag war er gestern geritten und noch weit in die Dunkelheit hinein.
Vor ihm zog sich durch die silbergrün schimmernden Büffelgräser die dunkle Spur, die der Mann gezogen hatte, der ihn überfallen hatte und mit seinem Pferd geflüchtet war. Sicher war der Verbrecher davon überzeugt gewesen, ihn erschlagen zu haben. Sonst hätte er ihn schwerlich so liegen lassen. Welch ein Glück, dass er den Revolver nicht entdeckt hatte, sonst hätte er sich vielleicht noch dadurch gesichert, dass er ihm eine Kugel in den Kopf schickte. Fast schien es Jack, dass es so am besten gewesen wäre. Eine Kugel hätte ihm die Leiden, die er jetzt durchzustehen hatte, diese entsetzlichen Schmerzen erspart.
Fuß vor Fuß setzend, bewegte er sich vorwärts. Schleppend, immer wieder bedroht von der Gefahr, hinzustürzen und ohnmächtig zu werden.
Stunde um Stunde verrann. Als er sich einmal umdrehte, über die Spur zurücksah, erschrak er. Da drüben war die kleine Anhöhe, hinter der die Mulde lag. Ein lächerlich kleines Wegstück hatte er erst geschafft!
Das Schlimmste war, dass mit der fortschreitenden Tageszeit eine Hitze aufkam, die ihm mehr und mehr zu schaffen machte. Dreimal schon hatte er Rast gemacht, sich mit allen vieren auf den Boden gestützt und jedes Mal dabei vermieden, sich hinzusetzen. Denn wenn er erst saß, fiel er auch, und wenn er lag, gab es kein Aufstehen mehr. Das wusste er sicher. Weiter ging der furchtbare Marsch durch die aufsteigende Wärme des Savannengrases. Am frühen Vormittag war es der Dunst, der aus den feuchten Gräsern hochstieg und ihm zu schaffen machte. Aber gegen elf Uhr wünschte er sich den verdunstenden Tau zurück, denn er hatte ihm doch eine gewisse Kraft gegen die sengende Hitze der Sonne gegeben. Jetzt war das Gras pulvertrocken, knisterte, wenn er drauftrat. Die Luft schien zu stehen, nicht der leiseste Windhauch wehte.
Es war zum Verzweifeln.
Mittag konnte nicht mehr sehr weit sein, als er glaubte, fern am Horizont im Südwesten ein Haus entdeckt zu haben. Diese Entdeckung gab ihm neue Kraft. Er stampfte vorwärts, zuckte aber sofort zusammen und trat nach wie vor nur mit den Zehenspitzen auf; fiel hin und wieder erschöpft auf die Absätze zurück, um dann erneut die schon verkrampften Zehen wieder zum Aufsetzen zu benutzen. Nur so konnte er hoffen, sein Ziel zu erreichen.
War es ein Ziel? Das Haus, das er vorhin zu sehen geglaubt hatte, und das jetzt wieder verschwunden war?
Der Horizont war wieder grün und silbrig schimmernd im gleißenden Licht der Mittagssonne. Nirgends ein Creek, nirgends ein kleines Rinnsal, an dem er sich hätte laben können, seinen brennenden Durst wenigstens etwas stillen.
Würde er diesen Tag überleben? Sollte er bis zum Untergang der Sonne aushalten, dann wollte er diesen Tag auch überleben. Und dann wehe dem Mann, der ihn an diesen Abgrund gebracht hatte!
War es eine Fata Morgana gewesen, das Haus, dessen Dach er doch so deutlich über dem endlosen Grün der Prärie gesichtet zu haben glaubte?
Seine Schritte waren wieder langsamer geworden, torkelnd, hoffnungslos. Aber sein Auge haftete nach wie vor am Horizont. Ein eiserner Wille hielt diesen Mann auf den Beinen. Mit letzter Kraft kämpfte er sich vorwärts durch die von Meile zu Meile undeutlicher werdende Spur. Die Strahlen der Sonne hatten die Gräser wieder so weit aufgerichtet, dass die Spur nur noch schwer zu erkennen war.
Plötzlich blieb er stehen. Hinter einer Buschgruppe, die vor ihm lag, war das Dach jetzt wieder aufgetaucht. Scharf und deutlich zeichnete es sich gegen den flimmernden Himmel ab; dahinter waren noch zwei weitere Dächer zu sehen.
Eine Ranch!, zuckte es durch sein Hirn. Das muss die Rettung sein!
Zwar war es noch weit bis dorthin, vielleicht eine Meile, aber was sagte das schon: Eine Meile, das war doch gar nichts.
Das Land stieg an, das Gras war kürzer geworden, dafür der Boden darunter unebener und steiniger. Der leichte Hügelhang wurde für ihn zu einem wahren Berg. Weiter ging es, Schritt für Schritt, immer einen Fuß vor den anderen schiebend. Und immer wieder zuerst die Zehen aufsetzen, um dann den Fuß langsam folgen zu lassen; der Kopf durfte nicht von dem Stoß der Schritte erschüttert werden.
Wieder verhielt der Mann seinen Schritt.
Das waren nicht nur zwei Häuser, die da vor ihm am Horizont lagen, sondern viel mehr. Keine Ansiedlung, sondern eine richtige Stadt. Das beflügelte seine Kräfte wieder, gab ihm neuen Auftrieb. Wo eine Stadt war, da musste es auch Hilfe geben, vielleicht sogar einen Arzt. Und ein Mann, der noch gehen konnte, der war noch nicht verloren.
Der Lebenswille, der am Morgen dieses Tages so schwach gewesen war, stieg jetzt gewaltig in ihm auf und trieb ihn vorwärts. Nach Luft japsend, keuchend, mit einer Zunge, die wie ein ausgetrocknetes Blatt am trockenen Gaumen klebte, hechelte der Unglückliche vorwärts. Plötzlich rutschte sein rechter Fuß über einen lockeren Stein – und er fiel der Länge nach hin. Es war kein Abfedern mehr, was er mit den Armen versuchte. Hart schlug er auf. Dass er den Kopf vor dem Boden abfangen konnte, war alles.
Eine schwere Betäubung wollte ihn überkommen, eine bleierne Ohnmacht. Aber er kämpfte sie nieder, schüttelte sie von sich ab, wartete, bis das rasende Hämmern im Schädel nachließ, und richtete sich dann wieder auf. Aber er sah alles nur wie durch einen Schleier. Verklebt waren seine Augen; sie brannten vom Staub, den er selbst durch seine Schritte und sein langsames Vorwärtskommen im trockenen Boden aufwirbelte.
Aber der Anblick blieb: Häuser – oben am Rand des Hügels.
Farland richtete sich auf und stand taumelnd da. Mit zusammengebissenen Zähnen stolperte er weiter, langsamer, vorsichtiger. Er durfte nicht noch einmal stürzen.
Dann ganz plötzlich ließ die Steigung nach, und der Weg führte fast eben auf die Häuser zu.
Eine heiße Freude war in ihm aufgestiegen, als er die Anhöhe überwunden hatte. Es kam ihm vor, als hätte er einen großen Sieg errungen.
In seiner blinden Freude war ihm bisher nichts aufgefallen. Er war bis auf zweihundert Schritte herangekommen, beschleunigte seinen Gang jetzt wieder, kam auf eine breite Straße, die von der Savanne schon überwuchert wurde, was ihm nicht auffiel, einem gesunden Jack Farland aber ganz bestimmt aufgefallen wäre. Er sah nicht, dass sich die Prärie mit ihrem zähen Gras bis in die alte Main Street hineinfraß, dass die Grasbüschel schon an den ersten Häusern vorbeigewachsen waren und somit ein unnatürliches Bild abgaben.