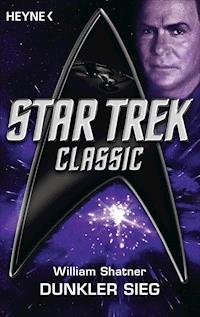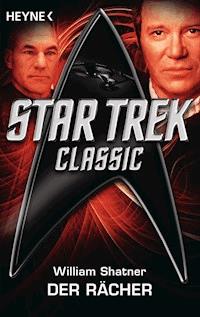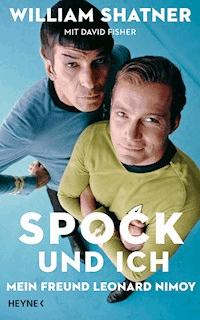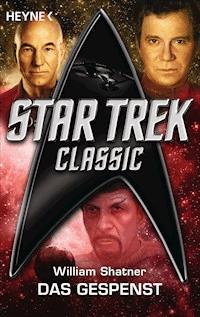14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schwarzkopf & Schwarzkopf
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In seiner Autobiographie blickt William Shatner auf sechzig Jahre im Showgeschäft zurück und erzählt mit dem für ihn so typischen Witz aus seinem bewegten Leben. Der Schauspieler berichtet von seiner Kindheit im kanadischen Montreal, seiner aufblühenden Leidenschaft fürs Theater und ersten Auftritten in Toronto und New York sowie den ersten Rollenangeboten in großen Hollywoodproduktionen, die ihm anfangs Achtungserfolge, aber kein Geld einbrachten. Shatner enthüllt detailliert, wie die Rolle des Captain Kirk sein Leben veränderte und wie er sich zunächst überhaupt nicht mit Leonard Nimoy, dem Darsteller des Mr. Spock, verstand, obwohl beide heute eine tiefe Freundschaft verbindet. Neben zahlreichen witzigen Anekdoten aus der Film- und Fernsehwelt gewährt der Schauspieler auch Einblicke in sein Privatleben. Die Autobiographie ist ein spannender Rückblick auf eine außergewöhnliche Karriere und zeigt voller Selbstironie die menschliche Seite des bekannten und sympathischen Kultschauspielers.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 604
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
William Shatner Mit David Fisher
DURCH DAS UNIVERSUM BIS HIERHER
Die Autobiographie
Aus dem amerikanischen Englisch von Thorsten Wortmann
Schwarzkopf & Schwarzkopf
Widmung
Ich habe schon einige Bücher und diverse andere Schriften verfasst, wobei mir die Widmung immer besonders wichtig war. Jetzt kann man sogar mein ganzes Leben durchblättern, das von verschiedensten Menschen oder Ereignissen geprägt ist, die mich während meiner Zeit auf diesem Planeten begleitet haben. Aber bisher habe ich noch nie meinem Vater und meiner Mutter gedankt: meinem hart arbeitenden, umsorgenden, liebevollen Dad und meiner lustigen, manchmal frustrierten, sanftmütigen Mom. Alles, was ich bin oder hätte sein können, ist ihnen zu verdanken. Ich verneige mich mit größtem Respekt in ihre Richtung.
Kapitel 1
Ein kleiner jüdischer Junge aus Montreal
Eigentlich wollte ich meine Autobiographie mit diesen Worten beginnen: Ich bin Captain James T. Kirk. Sergeant T. J. Hooker. Rechtsanwalt Denny Crane. Bob Wilson, der Flugpassagier von Twilight Zone. Der Großkopfträger aus Hinterm Mond gleich links. Oder Heinrich V. oder Buck Murdock oder …
Tja, da wird die Sache schon schwierig. Ich arbeite seit über einem halben Jahrhundert als Schauspieler und habe so viele verschiedene Rollen auf der Bühne, im Fernsehen und auf der Kinoleinwand dargestellt, dass es einfach unmöglich ist, sich auf nur eine davon zu beschränken. Abgesehen davon ist meine Karriere als Schauspieler natürlich nur ein Teilaspekt meiner Geschichte. So war mir schnell klar, dass ich mein Buch nicht auf diese Weise beginnen kann …
Ich entschied mich, in der Einleitung lieber über meine Begegnung mit der Gorilladame Koko zu berichten: Im Jahr 1988, als ich der Gorilla Foundation half, die Bewohner Kaliforniens für den Schutz gefährdeter Tierarten zu begeistern, durfte ich Koko in ihrem Quartier besuchen. Sie war ein außergewöhnliches Tier, das sogar gelernt hatte, mit Menschen zu kommunizieren. Die Gorilladame beherrschte über sechshundert Wörter in der amerikanischen Zeichensprache, und – was noch beeindruckender war – sie verstand auch deren Bedeutungen, wie mir die Tierpfleger erklärten. Koko kannte beispielsweise die Zeichen für »Wasser« und »Vogel«; als sie zum ersten Mal eine Ente auf einem See landen sah, machte sie beide Zeichen. Koko konnte das Gesehene geistig verarbeiten und mit der gelernten Gebärdensprache ausdrücken. Sie war also intelligent.
Man erlaubte mir, zu ihr in den Käfig zu gehen und allein mit ihr zu sein. Als ich den Käfig betrat, erinnerten mich die Tierpfleger nochmals daran, dass Gorillas sehr kräftige Tiere sind – sie erzählten mir, dass Gorillas, die wesentlich kleiner als Koko waren, schon aus Wut einem Mann wie mir den Arm abgerissen hätten. Ich bin eigentlich kein ängstlicher Typ, aber ich muss zugeben, dass mir in dieser Situation etwas mulmig zumute war.
Es gibt eine Form des Schauspielens, die sich nach diesem Grundsatz richtet: Fühle es, dann sage es und so wird dieses Gefühl durch deine Worte hindurchscheinen. Ich kenne eine Variante, die etwas anders lautet: Sage es, dann fühlst du es. Um mir selbst die Angst zu nehmen, als ich mich diesem riesigen Tier näherte, murmelte ich immer wieder vor mich hin: »Ich liebe dich, Koko, ich liebe dich.« Ich sagte es ernst und aufrichtig, und ich sah Koko dabei direkt in die Augen. Ich beugte mich ein wenig nach vorn, um Unterwürfigkeit zu zeigen, und ging immer weiter auf das Tier zu, weil ich Koko deutlich machen wollte, dass ich keine Angst vor ihr hatte. Ich sagte immer wieder: »Ich liebe dich, Koko, ich liebe dich.« Plötzlich fing ich an, diese Liebe wirklich zu verspüren. Ich blieb direkt vor Koko stehen und schaute in ihre dunkelbraunen Augen, sah ihre verrunzelte Stirn und ihre riesigen Hände. Ich liebe dich, Koko.
Plötzlich schnellte ihre Hand nach vorn, und sie packte mich bei den Eiern. Sie sah mir direkt in die Augen. Nach einem kurzen Moment versuchte ich – in einer erheblich höheren Stimmlage –, weiterhin mit ihr zu reden: »Ich liebe dich, Koko!« Diese Worte hatten jetzt noch mehr Bedeutung als ein paar Sekunden zuvor.
Der Tierpfleger, der vor der Tür stand, sagte: »Bleiben Sie ganz ruhig stehen. Koko möchte Sie mit in ihr Schlafzimmer nehmen.« Also verharrte ich, weil ich nicht in ihr Schlafzimmer gehen wollte. Ich glaube kaum, dass jemals jemand so still gestanden hat wie ich in diesem Moment. Gleichzeitig schlug im Käfig nebenan ein junger männlicher Gorilla, von dem die Pfleger hofften, dass er sich eines Tages mit Koko paaren würde, wütend wie ein eifersüchtiger Ehemann gegen die Käfigtür. Hier war ich nun, gefangen in einem typischen Beziehungsdreieck und starr vor Angst, während eine Gorilladame mich bei den Eiern hielt. Schließlich wurde es ihr aber zu langweilig und sie ließ mich los …
Mein Buch mit dieser Geschichte beginnen zu lassen, würde den Leser gleich darauf einstimmen, dass sich meine Memoiren nicht nur auf meine Karriere als Schauspieler beschränken. Ich würde außergewöhnliche Begebenheiten beschreiben, die es mir ermöglichten, die Welt zu erkunden. Ich könnte auch von zahlreichen fantastischen Abenteuern erzählen, wie von jener dunklen Nacht in Afrika, als ich einen wilden Elefanten verfolgte. Oder als mich ein Hubschrauber auf einem Gletscher in 6000 Metern Höhe absetzte und ich mir in meinem ganzen Leben noch nie so einsam vorgekommen bin – einschließlich jenes denkwürdigen Augenblicks, als ich Außerirdische in der Wüste entdeckte. Ein solcher Anfang würde dem Leser auch zeigen, dass es in diesem Buch viele Lacher geben wird – natürlich fast alle auf meine Kosten. Dann aber wurde mir wieder bewusst, dass mich die Leute eigentlich nur durch meine Arbeit als Schauspieler kannten, sodass diese Einleitung auch nicht ideal wäre. Daher verwarf ich die Idee.
Schon bald fiel mir etwas anderes ein. Ich wollte das Buch mit einem Song beginnen, den ich über den tragischen Tod meiner Ehefrau Nerine Shatner geschrieben hatte. Das Buch auf diese Weise zu eröffnen – mit der größten Tragödie meines Lebens –, hätte mir viel bedeutet. Es wäre auch sofort deutlich geworden, dass dies ein offenes und ehrliches Buch ist, aber es wäre ein sehr trauriger Anfang geworden und das, obwohl ich in meinem Leben so viel Schönes erlebt habe. Hinzu kommt, dass dieser Verlust ein so einschneidendes Erlebnis für mich war, dass ich darüber lieber in aller Ausführlichkeit schreiben möchte. Deshalb wollte ich doch einen anderen Anfang für mein Buch finden.
Dann gibt es da eine extrem bekannte Phrase, die ich definitiv nicht als Einleitung verwenden wollte: »Beam mich hoch, Scotty!« Eigentlich habe ich mir vorgenommen, dass dieser Satz überhaupt nicht in diesem Buch auftaucht. Ich wusste, dass das Interesse der Leser sofort nach den ersten Worten geweckt werden, dass ich sie neugierig machen muss, dass ich sie vielleicht sogar dazu bringen müsste, sich zu fragen: Will der mir einen Bären aufbinden? Das führte zu folgender Idee: Als ich zum ersten Mal in meinem Leben nach New York kam, erreichte ich die Stadt in einem Kanu. Ich war den ganzen Weg von Montreal dorthin gepaddelt …
Das gefiel mir, aber es schien nicht das herüberzubringen, was mein Leben im Kern ausgemacht hatte. Irgendwie kam es mir zu sehr wie Effekthascherei vor, es war zu gestellt. Deshalb wusste ich gleich, dass ich das Buch nicht so beginnen konnte. Mein Gedanke dazu war dann, dass ich die Idee vielleicht später wieder aufgreifen könnte, im ersten Kapitel zum Beispiel.
Ich entschied mich also, das Buch mit der Beschreibung jenes Tages zu beginnen, als ich zum letzten Mal auf meinem wundervollen Pferd Sultan’s Great Day ausritt. Was war er doch für ein Prachtkerl, als er noch bei internationalen Reitturnieren antrat! Er war eindeutig der beeindruckendste Hengst, den ich jemals gesehen habe. Das meine ich ganz ernst. Die Leute bewunderten ihn regelrecht, egal wann und wo ich mit ihm erschien. Sie sahen ihn an und …
Diesen Anfang wollte ich nehmen, um meine Leidenschaften zu beschreiben, jene, die meinem Leben den Touch des Außergewöhnlichen gegeben haben. Dazu gehören natürlich auch ganz besonders die Liebe zu wundervollen Frauen, die Liebe gegenüber meiner Familie und meinen Töchtern, zu meinem Handwerk als Schauspieler, meiner Kunst sowie das unstillbare Verlangen, alle Facetten des Lebens kennenzulernen. Manchmal erstaunt es mich, wenn ich merke, dass mein heutiges Leben immer noch auf denselben Zielen beruht, die ich mir als junger Mann gesetzt habe: der Wunsch, als Schauspieler zu arbeiten, Liebe zu geben und geliebt zu werden, aber auch die Befähigung, die Freuden eines guten Essens oder eines gelungenen Witzes zu erkennen und – was mir sehr wichtig ist – meine Freundschaften zu pflegen.
Aber einfach nur von meinen Leidenschaften und Vernarrtheiten, wie meiner Liebe zu Hunden und Pferden, zu erzählen, kam mir für einen Buchanfang doch etwas zu banal vor. Vielleicht, so dachte ich, sollte ich meine Memoiren gleich richtig unterhaltsam einleiten, indem ich die Leser mit meinem verschrobenen Humor bekannt mache. Vielleicht würde ich sie zum Lachen bringen. Ich könnte zum Beispiel einen Zeitungsartikel zitieren, in dem von der wohl verrücktesten Aktion meines Lebens berichtet wird:
(AP) 17.01.2006: Der Schauspieler William Shatner gab am Montag bekannt, dass er seinen Nierenstein für 75.000 Dollar an ein Online-Kasino verkaufen würde. Der Erlös soll der Hilfsorganisation Habitat For Humanity gespendet werden.
Das wäre sicherlich ein witziger Anfang, aber er schien mir doch zu pietätlos zu sein. Stattdessen kam mir die Idee, dass das Buch vielleicht nachdenklich beginnen und sich der Anfang eher auf mein Leben als Ganzes beziehen sollte. Und da fiel mir ein, dass ich mein bisheriges Leben nicht besser in Worte fassen kann, als es der Drehbuchautor David E. Kelley für die Figur Denny Crane getan hat, die ich in der Serie Boston Legal spiele:
Abends. Crane und Shore sind auf dem Balkon von Cranes Büro.
Crane: Alan Shore glaubt also, dass der Mensch eine Seele hat! Wer hätte das gedacht.
Shore: Du glaubst es nicht? Ist das hier etwa alles, was den Menschen erwartet? Wenn ja, haben wir da nicht unsere Zeit verplempert …?
Crane: Ich habe nicht eine Sekunde meines Lebens verplempert! Ich habe es genossen, in vollen Zügen.
Shore: Aber wird unser Leben irgendwie von Bedeutung sein?
Crane: Du kennst doch den alten Witz, Alan. Ein Mann kommt am Himmelstor an und sieht dort einen Typ im Nadelstreifenanzug, mit Aktenkoffer und Zigarre, ein richtiger Angeber. Der Mann fragt Petrus: »Wer zum Teufel ist das?« Und Petrus sagt: »Oh, das ist bloß Gott. Er glaubt, er sei Denny Crane.«
Shore: Was würdest du tun, Denny, wenn du Gott eines Tages wirklich begegnen würdest?
Crane: Weiß nicht. Ich würde wahrscheinlich mit ihm zum Angeln fahren.
Ich hatte mich für einen kurzen Moment entschieden, dass dies die beste Möglichkeit sei, das Buch zu beginnen, als ich eine neue Idee hatte. Sollte Denny Crane doch sein eigenes Buch schreiben! Urplötzlich kam mir ein Geistesblitz – ich hatte etwas, von dem ich glaubte, dass dies ein einzigartiger und perfekter Einstieg sei:
»Haben Sie auch die Nase voll davon, viel Geld für Bücher wie dieses hier zu bezahlen? Sehr gut, das müssen Sie nämlich nicht mehr. Sie können so viele Exemplare dieses Buches kaufen, wie Sie wollen – und Sie bestimmen den Preis! Jawohl, Sie bestimmen den Preis, den Sie zu zahlen bereit sind. Nur bei Priceline.com geht das so einfach. Und so funktioniert es …«
Es wäre witzig, das Buch auf diese Weise zu eröffnen, und irgendwie auch passend, weil mich viele Leute durch meine Auftritte in Werbespots für Firmen wie Priceline kennen. Falls wir dadurch ein paar Bücher mehr verkaufen, hätte unser Verlag sicher nichts dagegen. Und wenn mein Agent in angemessener Weise mit Priceline verhandeln würde, hätten sie eventuell Interesse daran, die Rechte am ersten Absatz in meinem Buch zu erwerben. Natürlich nicht zum vollen Preis.
Aber vielleicht wäre dieser Anfang, wie andere zuvor, zu krass für meine Autobiographie gewesen. Ich überlegte, ob dies wirklich das war, was mein Leben und meine Karriere besonders gut beschrieb. Außerdem stellte sich mir die Frage, ob Priceline mit meinen Preisvorstellungen einverstanden sein würde. Deshalb verwarf ich auch diese Idee.
Schließlich kam mir der rettende Gedanke: Ich brauche gar keine Einleitung! Wenn die Leser bei diesem Absatz angelangt sind, hat meine Autobiographie schon längst begonnen. Meine Karriere verlief übrigens sehr ähnlich – ich war bereits mittendrin, als ich feststellte, dass sie begonnen hatte.
Als ich zum ersten Mal auf einer Bühne stand, brachte ich das Publikum zum Weinen. Ich war sechs Jahre alt und nahm am Rabin’s Camp teil, einem Sommerferienlager für jüdische Kinder, deren Eltern kein Geld für Urlaubsreisen hatten. Das Camp wurde von meiner Tante geleitet und befand sich in den Bergen nördlich von Montreal. Ich wollte unbedingt ins Boxteam – andere Leute zu schlagen, hörte sich für mich recht lustig an –, aber meine Tante steckte mich stattdessen in eine Theatergruppe, die ein Stück namens Winterset aufführen sollte. Meine Rolle war die eines Jungen, der sein Zuhause verlassen musste, weil die Nazis auf dem Vormarsch waren. In einer sehr dramatischen Szene musste ich mich von meinem Hund verabschieden, den ich nie wiedersehen würde. Mein Hund wurde von einem anderen Kind aus dem Camp gespielt, das ein Kostüm aus bemaltem Zeitungspapier trug. Wir führten das Stück am Besuchswochenende der Eltern auf. Das Publikum bestand größtenteils aus Leuten, die vor den Nazis geflohen waren oder die noch Verwandte hatten, die im naziverseuchten Europa festsaßen. Die meisten Leute waren also betroffen, hatten ihren Besitz, ihre Verwandten und Bekannten zurücklassen müssen – und da war ich nun und sagte meinem kleinen Hündchen Lebewohl.
Ich weinte, das Publikum weinte, alle weinten. Ich erinnere mich daran, wie ich mich nach dem Stück verbeugte und dabei sah, wie die Leute sich die Tränen abwischten. Ich erinnere mich auch, wie ich die Wärme spürte, als mein Vater mich an sich drückte, während die Leute ihm nach der Aufführung sagten, was für einen wundervollen Sohn er habe. Was für eine Wirkung das auf ein sechsjähriges Kind hatte, kann sich wohl jeder vorstellen. Mir wurde bewusst: Ich konnte Leute zu Tränen rühren und ich bekam Beifall dafür.
Irgendwie wollte ich schon immer auf der Bühne stehen, wollte Aufmerksamkeit bekommen und ein Publikum erfreuen. Meine Schwester erinnert sich gern an die Geschichte, als unsere Mutter meine Schwester und mich mit in die Stadt genommen hatte. Das war einige Jahre vor meinem Debüt als Schauspieler im Sommercamp. Angeblich bin ich damals verlorengegangen, und die beiden haben mich aufgeregt gesucht. Schließlich fanden sie mich lachend und tanzend vor einem Leierkastenmann.
Woher kam dieses Verlangen, Leute zu unterhalten? Woher kam der Mut, mich vor lauter fremde Menschen zu stellen und Ablehnung zu riskieren? In meiner Familie hatte es diese Neigung bis dahin nicht gegeben. Die Shatners haben polnische, österreichische und ungarische Vorfahren, und einige meiner Urahnen waren Rabbis und Lehrer. Wie so viele jüdische Immigranten arbeitete mein Vater im sogenannten Schmatta-Gewerbe. Er schneiderte preisgünstige Anzüge für die französisch-kanadischen Herrenboutiquen. Die Kleidung war in der Regel für Arbeiter bestimmt, die sich nur einen einzigen Anzug leisten konnten. Joseph Shatner war ein ernster, aber liebevoller Mann, der hart arbeitete. Wenn ich meine Augen schließe und an früher denke, kann ich mich an den Geruch seines Arbeitszimmers erinnern. Das unvergessliche Aroma von Serge und Tweed, zu Ballen aufgerollt, gemischt mit dem Duft der Zigaretten meines Vaters. Er ruhte sich nur samstagnachmittags aus, wobei er auf der Couch lag und sich die Übertragungen aus der New Yorker Metropolitan Opera im Radio anhörte. Er war im Alter von 14 Jahren von Osteuropa nach Montreal gekommen und hatte als Zeitungsverkäufer und in anderen arbeitsintensiven Jobs gearbeitet. Er fing in der Textilindustrie als Packer an und wurde daraufhin Vertreter, und später eröffnete er seinen eigenen kleinen Betrieb. Er war der Erste seiner Familie, der nach Nordamerika ging, und er half schließlich seinen zehn Geschwistern, Europa zu verlassen.
Mein Freund Leonard Nimoy macht gern Witze darüber, dass ich pausenlos arbeite. Er äfft mich dann nach und sagt: »Es ist Viertel vor vier. Was ist für zehn nach vier geplant? Wenn ich das bis halb fünf erledigt habe, könnten wir mit der nächsten Sache um zehn vor fünf beginnen …« Vielleicht steckt ein Fünkchen Wahrheit darin. Jeder Schauspieler hat Tage, gar Monate damit verbracht, aufs Telefon zu starren, in der Hoffnung, dass es endlich klingelt. Und jeder muss mit der Angst leben, dass es vielleicht nie wieder klingeln wird. Man vertreibt sich mit den seltsamsten Dingen die Zeit: Man streicht die Wände seiner Wohnung immer und immer wieder, während man auf das nächste Angebot wartet.
Nachdem meine Karriere begonnen hatte, habe ich zwanzig Jahre lang nie wirklich Urlaub gemacht, da ich große Angst hatte, einen Anruf verpassen zu können. Weil ich bereits die Erfahrung gemacht hatte, auf Ladeflächen von Pick-up-Trucks auf Parkplätzen von Sommertheatern hausen zu müssen, habe ich viele Gelegenheiten beim Schopfe gepackt. Ich habe den Ruf weg, dass ich fast jedes Angebot annehme, aber das ist nicht wahr. Es ist nicht mal zwei Jahre her, dass ich eine Rolle abgelehnt habe! Wie jedem Schauspieler graut es auch mir davor, dass mich die Leute irgendwann nicht mehr sehen möchten, weil sie mich zu oft sehen. Deshalb spiele ich nur in ausgewählten Theaterstücken und Fernsehproduktionen; ich akzeptiere Engagements als Sprecher in Dokumentarfilmen oder als Gameshow-Moderator; ich bin in Kinofilmen zu sehen und mache Werbespots oder gelegentlich beteilige ich mich an Benefizshows, moderiere Radioprogramme, erscheine in Webcasts, Videoclips oder bei Star TrekConventions sowie in Sendungen über Pferde oder Hunde; nebenbei schreibe ich Bücher und nehme Platten auf, betätige mich als Erfinder, Regisseur und Produzent von Gameshows, gebe Konzerte oder bin in Talkshows, Reality-Gameshows und bei Preisverleihungen zu sehen. Aber das ist auch schon alles, was ich so tue. Ich mache zum Beispiel keine Bar-Mizwas und bin auch noch nie als Stand-up-Comedian in den Catskill Mountains aufgetreten.
Meine Arbeitsmoral habe ich jedenfalls von meinem Vater geerbt. Sein Traum war es, dass ich irgendwann seinen kleinen Betrieb übernehmen würde. So wie er es getan hatte, arbeitete auch ich in einer Fabrik als Packer. Noch heute bin ich ein Meister im Einpacken. Ich weiß, wie man einen Anzug faltet: Die Schultern müssen sich außen berühren und die Ärmel nach unten hängen, damit der Anzug keine Falten bekommt. Ich weiß auch, wie man Hosen faltet und sie in eine Schachtel legt. Wäre ich kein Schauspieler geworden, hätte ich bestimmt eine große Karriere als Anzugfalter vor mir gehabt.
Aber Schauspieler? Was wusste mein Vater schon über das Schauspielen? Das war nicht, was rechtschaffene Leute taten, das war kein echter Job. Es war nicht das, womit man sich seinen Lebensunterhalt verdient.
Von meinem Vater lernte ich, dass Bildung einen hohen Wert hat, dass ich die Leute um mich herum respektvoll behandeln und stets pünktlich und fleißig sein muss. Er sagte immer: »Fünf nach elf ist nicht elf.« Mein ganzes Leben lang war ich pünktlich und bereit zu arbeiten. Wie tief diese Moral in mir steckt, wird an folgendem Beispiel deutlich: 2007 wurde ich vom Fernsehsender ABC eingeladen, an einer Show namens Fast Cars And Superstars teilzunehmen, einer Art NASCAR-Rennen mit Prominenten. Dies war eine gute Gelegenheit zum Rasen, ohne Gefahr zu laufen, dass man dabei geblitzt wurde. Eine Rennbahn ist der einzige Ort der Welt, wo man so schnell fahren kann, wie es einem das eigene Können und der Mut erlauben. Das war genau das Richtige für mich. Ich sagte: »Na klar, ich wäre liebend gern dabei!« Dann begann ich zu verhandeln, denn ich wollte natürlich auch etwas Geld bei der Sache verdienen.
Als ich das Set von Boston Legal verließ, um nach Charlotte, North Carolina, zu fliegen, sagte einer der Produzenten zu mir: »Denk dran, Bill, du musst Donnerstagmorgen um sieben wieder hier am Set sein. Wenn du nicht erscheinst, wenn du verletzt bist oder es nicht rechtzeitig schaffst, wenn du gegen eine Wand fährst und dir Arme oder Beine brichst, wenn sich das Auto überschlägt und du irgendwo zugegipst im Krankenhaus liegst, sodass du nicht rechtzeitig zurück bist, kann die Produktionsfirma dich verklagen.« Dann hielt er kurz inne und grinste übers ganze Gesicht: »Abgesehen davon wünsche ich dir viel Spaß.«
Ich war mein ganzes Leben lang in schnelle Autos vernarrt gewesen und habe die großen Rennfahrer stets bewundert. Aber ich war mir auch der Gefahren voll bewusst. Ich kannte das Schicksal von Dale Earnhardt Sr. Die traurige Wahrheit ist, dass Rennfahrer tödlich verunglücken können. Sie überschlagen sich mit ihren Fahrzeugen und der Wagen fängt Feuer, ich habe diese Bilder oft gesehen. Aber natürlich ging ich davon aus, dass es mich nicht treffen würde. Ich hatte in zahlreichen Fernsehserien und Kinofilmen mitgespielt und war fest überzeugt: Der Star verletzt sich nicht.
Bei der Veranstaltung gab es zwölf Kandidaten, die in vier Gruppen aufgeteilt wurden. Jede Gruppe erhielt ein Auto. Aus Sicherheitsgründen war immer nur ein Fahrer auf der Rennbahn, was bedeutete, dass wir um die beste Zeit fuhren und nicht direkt gegeneinander antraten. Meine Gruppe bestand aus mir, Bill Cowher, dem früheren Coach der Pittsburgh Steelers, sowie dem Model und Beachvolleyballstar Gabrielle Reece. Wir fuhren morgens eine Proberunde. Ich kam auf ungefähr 250 km/h, und als ich in die Kurven ging, war ich mir sicher, dass der Wagen ausbrechen und gegen die Mauer knallen würde. Das tat er zum Glück nicht, aber mit meinen mickrigen 250 km/h war ich auch dummerweise einer der langsamsten Teilnehmer.
Ich nahm mir vor, im wirklichen Rennen eine wesentlich bessere Zeit zu fahren. Ich hatte mich nämlich während des Probelaufs auf den Geraden etwas zurückgehalten, weil ich mich auf die nächste Kurve konzentrieren musste. Abends wollte ich ordentlich aufs Gaspedal treten, damit ich im Rennen bleiben würde. Es gab für mich nur eine Frage: Wer würde aus meiner Gruppe zuerst ausscheiden – Cowher oder Reece?
Meine Gruppe sollte an einem Dienstagabend fahren. Cowher war der Erste. Er flog irgendwann aus der Kurve und krachte gegen die Mauer – das Auto im Wert von 500.000 Dollar war nur noch ein Schrotthaufen. Wir mussten über eine Stunde auf einen Ersatzwagen warten, dann konnte Cowher seinen Lauf wiederholen. Gabrielle Reece war in ihren Proberunden gute Zeiten gefahren, aber während des Rennens wurde auch sie aus der Kurve getragen und wäre beinahe mit der Mauer kollidiert. Danach war ich an der Reihe.
Ich trug einen feuerfesten Overall, einen großen bauchigen Helm sowie eine Gesichtsmaske, die meinen ganzen Kopf bedeckte. Als man mich festgurten wollte, bemerkte ich, dass irgendetwas nicht stimmte. Der Wagen war für Cowher und Reece eingestellt worden, zwei sehr große Menschen, und meine Füße berührten nicht einmal die Pedale. Den Sitz konnte man auch nicht bewegen. Das Einzige, was sich bewegen ließ, war das ausfahrbare Lenkrad. Das ursprüngliche Lenkrad war zu groß gewesen, sodass es gegen ein wesentlich kleineres ausgetauscht worden war, das sich jetzt in meinen Bauch drückte. Es war viel kleiner als die Lenkräder, die ich kannte. Zu diesem Zeitpunkt war es schon ein Uhr morgens, ich war müde und durch die grellen Halogenlampen, die auf die schmutzige Windschutzscheibe leuchteten, hatte ich keine besonders gute Sicht.
Es blieben mir nur noch wenige Minuten, bevor ich auf die Piste ging und schneller als 250 km/h fuhr – mit einem Lenkrad, das sich in meinen Bauch drückte, und Kissen, die hinter mich gestopft worden waren, damit ich die Pedale erreichen konnte, sowie einer Windschutzscheibe, durch die ich nichts sah. Das war verrückt, und ich wusste es. Ich dachte nur: Was zum Teufel tue ich hier? Ich könnte dabei draufgehen!
Ich trat auf das Gaspedal und raste los. Beim Karate habe ich gelernt, dass sich das Qi, also das Zentrum für Lebensenergie, unter dem Bauchnabel befindet und dass man es bei jeglicher körperlicher Aktivität durch kraftvolles Ausatmen aktivieren kann. Ich habe das schon oft getan. Ich wollte mein Qi durch lautes Schreien herauslassen, während ich meine Runden drehte. Nun ja, der exakte Wortlaut klang eher so: »Oooooooooooooooh! Oooooooooooooooooooh!«, wobei ich weiter über die Rennbahn sauste.
Ich ließ mein Qi nicht heraus, sondern ich versuchte bloß, meine Angst zu unterdrücken. Ich hatte den Tod vor Augen, ich wusste, dass ich sterben würde. Ich hatte so gut wie keine Kontrolle über das Auto. Ich konnte nicht sehen, wohin ich fuhr, und war schneller als 250 km/h. Ich hätte mich niemals in diese Situation bringen dürfen! Einige Rennfahrer hatten mir mal etwas über den Zen-Zustand erzählt, den sie während eines Rennens verspürten und bei dem sie eins mit dem Wagen wurden. An jenem Abend fühlte ich diesen Zustand nicht, sondern kam mir eher vor wie ein Fremdkörper, den das Auto schnellstmöglich loswerden möchte.
Endlich hatte ich meine drei Runden überstanden. Ich erfuhr allerdings nie meine Zeit, weil ich wegen eines technischen Fehlers disqualifiziert wurde. Später fragte ich mich, warum ich dieses Risiko eingegangen war. Ich hatte mein Leben für eine Fernsehsendung aufs Spiel gesetzt? Das hatte ich wirklich und ich musste mir eingestehen, dass ich es nur getan hatte, weil mich Fernsehkameras dabei filmten. Wären diese Kameras nicht da gewesen, hätte ich mich auf diese Sache bestimmt nicht eingelassen. Aber sie waren da, es war ein Auftritt, ein Engagement. Wie mein Vater es mir eingebläut hatte, war ich pünktlich vor Ort erschienen und hatte den Job erledigt.
Meine Mutter Ann Shatner war es, die mich ermutigte, Schauspieler zu werden. Sie schickte mich zur Schauspielschule und verpasste nie eine meiner Aufführungen. Sie ging damals mit mir zum Vorsprechen für Rollen in Radiohörspielen, und als ich mal einen Part nicht bekam, rief sie den Produzenten, Mr Rupert Kaplan, an und beschimpfte ihn, weil er mir die Rolle nicht gegeben hatte. Im Unterschied zu vielen anderen Müttern brachte sie mich aber nicht morgens mit dem Wagen zum College – sie musste es nicht, da wir bloß zwei Meilen vom Campus des McGill entfernt wohnten.
Meine Mutter könnte man, natürlich ganz freundlich gemeint, als etwas naiv beschreiben. Sie kam aus reichem Hause und war vielleicht ein bisschen verwöhnt. Der Kontrast zwischen dieser liebenswerten jungen Frau, die so viel besaß, und einem hart arbeitenden Mann, der darum gekämpft hatte, seine Familie aus Europa nach Nordamerika zu holen, muss extrem gewesen sein. Meine Mutter hatte einen ausgeprägten Hang zum Dramatischen. Sie wollte, dass ihr Leben ausschweifend und pompös war. Wenn wir beispielsweise abends essen gingen, sagte sie den Kellnern oftmals, dass jener Tag ihr Geburtstag sei. Es ist mir immer noch peinlich, wenn ich daran denke. Sie saß dann immer voller Freude auf ihrem Stuhl, während wir uns am liebsten unter dem Tisch verkrochen hätten, als die Kellner sich um unseren Tisch versammelten und laut Happy Birthday sangen. Ich bin mir sicher, dass die Leute uns angesehen und sich gefragt haben, warum diese Familie betreten auf den Tisch starrte und jener wundervollen Frau kein Ständchen zum Geburtstag brachte. Was für einen Ruf müssen wir gehabt haben? Diese Shatners singen ihrer Mutter und Ehefrau kein Geburtstagsständchen, das muss man sich mal vorstellen! Meine Mutter hat jedenfalls mehr Geburtstage gefeiert als jeder andere auf der Welt.
Sie hat sich über meine Erfolge immer sehr gefreut – und sie hatte noch mehr Freude daran, den Erfolg zu teilen. Ich weiß noch genau, wie sie zu jedem gesagt hat: »Ich bin William Shatners Mutter.« Ich kann mich so genau daran erinnern, weil sie es wirklich ständig gesagt hat. Egal, wo sie war. Wenn sie einen Fahrstuhl betrat, sagte sie, bevor sich die Türen schlossen: »Hallo alle zusammen, ich bin William Shatners Mutter.« In Einkaufsläden, in jedem Restaurant. »Ich bin William Shatners Mutter.« Hin und wieder, wenn ich an Bord eines Flugzeugs ging, sagte mir die Stewardess, dass sie auf einem ihrer Flüge meine Mutter als Passagier gehabt hätte. Ich brauchte sie nicht zu fragen, woher sie wusste, dass es meine Mutter gewesen war. Ich bat sie immer und immer wieder, dies zu unterlassen. Es war mir peinlich, ich habe es gehasst. Ich sagte ihr: »Bitte lass das!« Dann sah sie mich traurig an und sagte: »Okay, ich werde es nicht mehr tun.« Gleich darauf drehte sie sich um und sagte: »Hi, ich bin William Shatners Mutter.«
Mein Vater sagte oft mit Nachdruck zu mir: »Sie ist immer noch deine Mutter!« Ganz gleich, was sie getan hatte oder ob ich ihre Handlungen verstand oder nicht – ich hatte sie mit Respekt zu behandeln, denn sie war und blieb meine Mutter.
Von Beruf war sie Lehrerin für Sprechtechnik. Sie brachte ihren Schülern korrektes Sprechen bei, also unter anderem die richtige Betonung und Aussprache. Ich vermute, dass meine Mom gern Schauspielerin geworden wäre und dass sie womöglich frustriert war. In Montreal gab es einfach keine Angebote für eine jüdische Frau mittleren Alters, die drei Kinder hatte und auf der Bühne stehen wollte. Deshalb gab sie sich damit zufrieden, zu Hause für sich allein Monologe zu sprechen. Als ich sieben oder acht Jahre alt war, meldete sie mich bei der Dorothy-Davis-Schauspielschule an, die von Miss Dorothy Davis und Miss Violet Walters im Keller eines Wohnhauses geleitet wurde. In diesem Keller lernte ich alles Nötige, um auf den Brettern, die die Welt bedeuten, bestehen zu können: auf die Bühne gehen, meine Worte sagen, die Bühne verlassen. Diese Fähigkeiten ermöglichten es mir bald, so unvergessliche Rollen wie Prinz Eisenherz und Tom Sawyer in einem Theater im nahegelegenen Stadtpark zu spielen. Ich bin sehr stolz darauf, der wohl berühmteste Abgänger der Dorothy-Davis-Schauspielschule zu sein!
Ich kann mich nicht daran erinnern, dass man mir das Schauspielen tatsächlich beigebracht hat. Wir haben einfach drauflosgespielt. Die Schule nahm Eintrittsgelder, damit die Leute uns beim Üben zusehen konnten. Ich persönlich glaube nicht, dass man die Schauspielerei lehren kann, aber man eignet sich Disziplin an, wenn man regelmäßig seinen Text lernen, auf die Bühne gehen und dort seine Worte sagen muss.
Als Kind war ich recht einsam. Ich ging immer allein zur Schule, und am Valentinstag schickte ich mir selbst Valentinskarten. Das waren die einzigen, die ich je bekam. In einem Jahr habe ich sogar ganze sechs Valentinskarten von mir selbst erhalten! Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, warum ich nur sehr wenig enge Freunde hatte. Vielleicht hatte das etwas mit der Nachbarschaft zu tun, in der wir wohnten. Während alle meine Verwandten im jüdisch besiedelten Stadtteil von Montreal wohnten, lebte meine Familie in einem gemütlichen Haus in der Girouard Street, die sich in einem wohlhabenden, größtenteils katholischen Stadtteil namens Notre Dame de Grâce befand.
Es gab immer Ärger zwischen den jüdischen und katholischen Kindern. Antisemitismus machte sich bemerkbar. Wenn ich zum Hebräischunterricht ging, benutzte ich die gegenüberliegende Straßenseite und tat so, als würde ich nicht mal wissen, dass sich gegenüber die Synagoge befand. Als ich auf Höhe der Synagoge war, blickte ich nach links und rechts und rannte schnell zum Eingang, sodass mich niemand sehen konnte. Ich hatte mir diese Strategie extra ausgedacht, um sicher zur Synagoge zu gelangen. Nicht dass ich etwas gegen eine Prügelei gehabt hätte – ich war zwar kein stämmiger Bursche, aber ich ließ mir auch von niemandem etwas gefallen. Es gab fast jeden Tag eine Prügelei. Mein Spitzname lautete »Toughie«, und jeder sagte: »Hey, passt auf, da kommt Toughie Shatner!« Dem kleinen Lenny Nimoy, ebenfalls ein jüdischer Junge, der zur selben Zeit in Boston aufwuchs, erging es nicht anders. Aber wir ließen uns nichts gefallen. Ich hatte damals Geschichten von jüdischen Soldaten gehört, die gerade aus dem Krieg zurückgekehrt waren; und darüber, dass ein oder zwei Männer es mit einer ganzen Gang von Antisemiten aufgenommen hatten, wobei sie sie mit einem Axtgriff bis zur völligen Unterwerfung verprügelten.
Während meiner Zeit auf der Highschool spielte ich American Football und lief Ski. Ich liebte diese beiden Sportarten, aber es war die Schauspielerei, die mich gänzlich ausfüllte. Sie machte mich zu etwas Besonderem, und ich war einfach gut darin. Ich hatte nie Schwierigkeiten damit, so zu tun, als wäre ich jemand anderes.
Im Sommercamp brachte ich nicht nur die Erwachsenen zum Weinen, sondern trieb auch mal einen Jungen an den Rand des Zusammenbruchs. Ich arbeitete damals gemeinsam mit einem Freund, der den seltsamen Namen Hilliard Jason trug, als Camp Leader. Wir waren für ein Zelt zuständig, in dem Kinder schliefen, die den Holocaust überlebt hatten; Kinder, die hatten zusehen müssen, wie ihre Eltern grausam ermordet worden waren. Ich kam gut mit den Kids zurecht, weil ich der Geschichtenerzähler des Camps war. Wenn es Nacht wurde, las ich ihnen, unter Verwendung all meiner Schauspielkünste, Poe und Kafka vor. Eines Abends rezitierte ich aus Das verräterische Herz von Poe: »Sie meinen, ich sei verrückt? Verrückte wissen doch nichts. Da hätten Sie mich aber sehen sollen!« Ein Junge bekam vor lauter Angst ganz plötzlich eine Panikattacke. Die Situation war einfach zu viel für ihn, er wurde regelrecht hysterisch. Es schien, als ließe er alle Emotionen aus sich heraus, die sich so lange in ihm aufgestaut hatten. Am nächsten Tag schickte man ihn heim. In eine Decke eingewickelt, sah ich ihn auf dem Rücksitz eines Autos sitzen. Was hatte ich bloß getan? Ich fühlte mich schrecklich, denn das war ganz bestimmt nicht meine Absicht gewesen. Wieder einmal wurde mir bewusst, welche außergewöhnliche Kraft Worte haben, wie sie Emotionen hervorrufen können. Seht, das alles kann man mit ein paar Worten tun!
Ich habe während meiner gesamten Kindheit Theater gespielt. Als Dorothy Davis das Montreal’s Children Theatre gründete, führten wir unsere Theaterstücke im Victorian Theatre im Stadtpark auf und machten Hörspiele für das Lokalradio. Fünf Jahre lang rettete ich in der Sendung Saturday Morning Fairy Tales eine Jungfrau nach der anderen, auch wenn ich mir nicht ganz sicher war, was eine Jungfrau eigentlich war. Welcher Achtjährige wollte nicht Prinz Eisenherz sein? Oder Ali Baba? Oder Huck Finn? Ich spielte sie alle. Für mich war das Theaterspielen eine fantastische Freizeitbeschäftigung, und sie ging mir leicht von der Hand. Einmal legte ich meine Schwester Joy herein, als sie ihren 16. Geburtstag feierte. Ich tauchte dort als Greis verkleidet auf, und Joy hatte absolut keine Ahnung, dass ich es sein könnte. Sie kam zu mir und sagte ganz höflich: »Entschuldigen Sie bitte, aber wer sind Sie?« Als sie nahe genug an mich herangetreten war und mir in die Augen schaute, erkannte sie mich plötzlich.
Aber die Idee, dass ich mein Hobby zum Beruf machen könnte, dass sich damit Geld verdienen ließe … Als Kind kam mir diese Idee jedenfalls nicht. Die Schauspielerei machte mir damals einfach nur viel Spaß. In der Highschool spielte ich dann vor allem American Football und nahm an verschiedenen Theateraufführungen teil. Dort begann ich auch zu träumen. Unter meinem Foto im Schuljahrbuch des Abschlussjahrgangs verkündete ich meinen Wunsch zum ersten Mal öffentlich: »Ich möchte Schauspieler werden.« Meinem Vater verriet ich nichts von meinen Plänen.
Während meiner Zeit auf der Highschool erhielt ich auch meinen ersten richtigen Job am Theater – als Bühnenmanager am Orpheum Theatre in Montreal. Ich war 15 Jahre alt und hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung. Wenn ich heute zurückblicke, vermute ich, dass ich den Job nur bekommen habe, weil ich jung und gutaussehend und so schrecklich naiv war. Ein sehr bekannter französischer Sänger spielte damals in einem Theaterstück am Orpheum, wo alle Theatergruppen auftraten, die sich auf Tournee befanden. Das war absolut aufregend. Ich war in einem großen Theater, zwar hinter der Bühne, aber immerhin. Der Hauptdarsteller war groß und gutaussehend, und irgendwann fragte er mich, ob ich mit ihm zum Abendessen gehen wollte.
Ich dachte nur: Ich muss ja ein großartiger Bühnenmanager sein, wenn mich der Hauptdarsteller zum Essen einlädt! Natürlich nahm ich seine Einladung an, und als wir das Theater nach der Vorstellung verließen, fragte er mich, ob ich eine Jacke bei mir hätte. »Nein«, sagte ich.
»Das ist gut«, sagte er lässig. »Ich habe eine Jacke in meinem Hotelzimmer.«
Willkommen im Showbiz, Shatner. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie er mich in seinem Hotelzimmer rund ums Bett gejagt hat. Die Footballsaison war gerade vorbei, deshalb war ich konditionell in guter Verfassung und kräftig. Ich konnte mir den Typen vom Hals halten. Es mag zwar total unglaubhaft klingen, aber damals wusste ich wirklich nicht, was er von mir wollte. Ich kannte Homosexualität nicht und hatte noch nie davon gehört, dass sich Männer zu anderen Männern hingezogen fühlen können. Darüber wurde in einer jüdischen Familie aus der Mittelschicht nicht gesprochen.
Was an jenem Abend passierte, veränderte meine Sicht auf Frauen für immer. Ich verstand den Zorn und die Frustration einer Frau, wenn sie einem Mann gegenüber »Nein« sagt und auch »Nein« meint, er aber glaubt, von ihr ein »Ja« vernommen zu haben.
Die Schauspielerei war mittlerweile zu meiner Leidenschaft geworden. Ich verspürte eine gewisse Sehnsucht danach, vor einem Publikum zu stehen und zu spielen. Ich nahm jede Gelegenheit wahr, die sich mir bot. Als ich 16 war, bekam ich eine Rolle in einer Inszenierung von Clifford Odets’ Stück Waiting For Lefty, das in der Versammlungshalle einer kommunistischen Organisation in Montreal aufgeführt werden sollte. Jeder junge Schauspieler, der seinen Job ernst nahm, wollte in bedeutungsvollen Theaterstücken mitspielen. Ich wusste nichts über Kommunismus, aber ich kannte Clifford Odets’ Geschichte und das Group Theatre. Ich erinnere mich, wie ich auf der Bühne stand, großmütig mit erhobener Faust zur Decke blickte und rief: »Streik! Streik!« Und das Publikum – mein Gott, die Leute drehten förmlich durch! Sie stimmten alle mit ein: »Streik! Streik!« Als das Publikum auf mich einging, spürte ich die Stärke meiner Darbietung. Ich, der kleine Billy Shatner aus einem kleinen Stadtteil am westlichen Rand von Montreal, hatte dieses Publikum in der Hand. Streik! Streik! Es war überwältigend und wunderschön.
Ich hatte absolut keine Ahnung, was ich dort oben auf der Bühne tat. Ich hatte keine Ahnung von Politik. Ich stand dort als Schauspieler, mehr nicht. Ich hauchte Worten, die jemand zu Papier gebracht hatte, Leben und Emotionen ein. Die Kommunistenhetze begann erst ein paar Jahre später, als ich gerade meine Karriere in den USA startete. Ich hatte damals Angst, dass mich jemand über meine Arbeit für die kommunistische Partei ausfragen würde.
In der West Hill Highschool war ich nie ein guter Schüler, aber eher aus mangelndem Interesse als aus mangelndem Können. Zu Schulzeiten interessierten mich jene Dinge über die Welt noch nicht, die mich eines Tages faszinieren und begeistern würden. Ich wollte einfach nur auf der Bühne stehen oder Football spielen, das war alles. Ich hatte die Highschool kaum beendet, als ich auch schon einen Studienplatz an der McGill University in der School of Commerce, der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre, bekam. Ich schaffte die Aufnahme durch eine jüdische Quote, welche die Uni zu jener Zeit erfüllen musste. Anhand meiner Noten hätten sie mich sicher nicht genommen.
Meine Familie ging davon aus, dass ich zur Uni gehen würde, um Betriebswirtschaftslehre und Management zu studieren und irgendwann mein Wissen im Unternehmen meines Vaters einbringen zu können. Sie dachten, ich würde seine kleine Bekleidungsfirma in eine erfolgreiche Aktiengesellschaft umwandeln, sobald ich meinen Abschluss in der Tasche hätte. Ich hingegen wusste, dass ich nur wegen der Theatergruppe zur McGill University ging.
Ich verbrachte wesentlich mehr Zeit in jener Theatergruppe, als dass ich am Unterricht teilnahm. Ich boxte mich irgendwie durch, wie ich mich immer durchboxte, aber noch viel wichtiger war, dass ich verschiedene Campus-Aufführungen selbst verfasst und inszeniert habe und auch in ihnen aufgetreten bin. Nebenbei verdiente ich mir etwas Geld als Radiosprecher bei der Canadian Broadcasting Company, kurz CBC. »Bleiben Sie dran für unsere nächste spannende Sendung!« – Das war ich.
Als ich aufwuchs, wollte ich wie die Kids aus Westmont sein, einem sehr reichen Stadtteil Montreals. Ich wollte wie die englischen Jungs aus der Oberschicht mit einem teuren Wagen zum College fahren. Ich erinnere mich noch daran, dass ich mit fünf oder sechs Jahren einen Fünf-Dollar-Schein fand. Für ein Kind waren fünf Dollar alles Geld der Welt, aber ich wollte den Schein unbedingt mit meinem einzigen Freund teilen – deshalb riss ich ihn in der Mitte durch.
Ich verstand die Wichtigkeit von Geld – aber für mich war es wichtiger, auf der Bühne zu stehen. Mir war irgendwie klar, dass ich als Schauspieler nie so viel Geld verdienen würde wie mein Vater mit seiner Bekleidungsfirma, aber es war mir egal.
Ich vermute, dass jeder Schauspieler zu Beginn seiner Karriere eine bestimmte Vorstellung davon hat, was er verdienen möchte. Mein Ziel waren einhundert Dollar die Woche. Ich dachte, wenn ich als Schauspieler einhundert Dollar in der Woche verdienen könnte, wäre ich ein sehr glücklicher Mensch. Leonard, dessen Vater Friseur war, wollte zehntausend Dollar im Jahr verdienen, aber Leonard hatte schon immer sehr extravagante Träume.
Meinem Vater von meinem Berufswunsch zu erzählen, war eine der schwierigsten Aufgaben, die ich in meinem Leben erledigen musste. Der Traum meines Vaters war, dass wir eines Tages zusammenarbeiten würden. Als Teenager habe ich ihn öfters zu seinen Verkaufsterminen begleitet. Wir hatten uns unsere besten Anzüge angezogen und fuhren in die kleinen französischen Dörfer außerhalb Montreals. In jedem Ort hatte er Freunde – »Das ist mein alter Freund Jake, mein alter Freund Pierre, mein alter Freund Robert ...« –, und es waren alles Leute, denen er schon seit Jahren seine Waren verkaufte. Stolz stellte er mich diesen Männern vor: »Das ist mein Sohn.« Die Männer sagten dann immer, wie groß ich sei, wie ähnlich ich meinem Vater sähe. So lief es ab in der Welt eines Verkäufers. Ich wurde in den Familienbetrieb eingearbeitet.
Ich wusste nicht, wie ich es meinem Vater erzählen sollte. Eines Nachmittags waren wir beide aus irgendeinem Grund in meinem Zimmer, und er fragte mich beiläufig, ob ich mir schon Gedanken über meine Zukunft gemacht hätte. Genauso beiläufig sagte ich ihm, dass ich Schauspieler werden möchte – und es brach ihm das Herz. Er setzte sich auf mein Bett, weil ihn diese Neuigkeit so umhaute.
Er verstand Theater nicht. Die Schauspielerei war kein richtiger Beruf für einen Mann, Schauspieler waren bloß Faulenzer. Für ihn waren sie wie Straßenmusiker. Die Chancen, auf diese Art erfolgreich zu sein und irgendwie ein erfülltes Leben zu führen, hielt er für sehr, sehr gering. Ich wusste, dass er am Boden zerstört war, aber das Einzige, was er zu mir sagte, war: »Du musst das tun, was du für richtig hältst. Für dich steht die Tür zu diesem Haus immer offen. Ich habe nicht das Geld, um dich zu unterstützen, aber ich werde dir helfen, so gut ich kann.« Das Einzige, worum er mich bat, war, kein »Taugenichts« zu werden. Damit meinte er, nicht abhängig von anderen Leuten zu sein, nicht von der Sozialhilfe zu leben, kurzum kein Mensch zu werden, der sich nicht selbst über Wasser halten kann.
Wie tapfer er war, mit so viel Fassung seinen Traum aufzugeben, nur damit ich meinen verwirklichen konnte. Es muss ihn sehr getroffen haben. Er war ein Mann, für den ein monatlicher Gehaltsscheck noch etwas Leibhaftiges war. Das Leben eines Künstlers hingegen war für ihn unvorstellbar. Aber statt mir meinen Traum auszureden oder mir väterliche Ratschläge zu geben, gab er mir meine Freiheit. Außerdem machte er mir klar, dass ich immer ein Zuhause haben würde. Man wusste ja nicht, was noch alles auf einen zukam.
Ich machte meinen Abschluss an der McGill University und stürzte mich sogleich in die Arbeitswelt. Mrs Ruth Springford, die Direktorin des Sommertheaters Mountain Playhouse, hatte mich schon in einigen ihrer Theateraufführungen spielen lassen. Nachdem sie gesehen hatte, was ich konnte, stellte sie mich als ihren Assistenten ein. Die Theatergruppe führte in der Regel Broadwaystücke mit nur einem einzigen Set auf, wie etwa Roman Candle oder Das verflixte 7. Jahr. Damals schrieben die Autoren die Stücke so, dass es nur minimale Sets und so wenig Szenenwechsel wie möglich gab. Wenn das Stück am Broadway Erfolg hatte, hing die Anzahl von Inszenierungen an kleineren Theatern (und somit die Tantiemen, welche die Autoren mit jeder Aufführung verdienten) größtenteils damit zusammen, wie viele Sets benötigt wurden. Meist handelte es sich bei diesen Stücken um seichte Komödien, deren Protagonist ein junger Mann war – oftmals ein schüchterner oder tollpatschiger Kerl mit einem unschuldigen Lächeln, welches so breit war, dass es sogar die Zuschauer in der letzten Reihe sehen konnten.
Ich war ein schrecklich unbegabter Assistent, eine Schande für alle Absolventen der McGill University. Ich verlor ständig Eintrittskarten und brachte Platzreservierungen durcheinander, wobei es nur diese beiden Bereiche waren, in denen ich wirklich Verantwortung trug. Schauspieler konnte man leicht auswechseln, aber das Überleben des Theaters hing vom Verkauf der Eintrittskarten ab. Um das Mountain Playhouse zu retten, wurde ich schließlich meines Postens enthoben und erhielt einen Job als Schauspieler. Schon bald war ich der fröhliche junge Mann, der in all diesen seichten Komödien erscheinen durfte.
Die Broadwaystücke kamen also nach Kanada und das Publikum ließ sich gerne unterhalten. Mein Trick bestand darin, meinen Text gut zu beherrschen und zu warten, bis die Leute mit dem Lachen aufhörten, um erst dann weiterzusprechen. Ich hatte nie umfangreichen Schauspielunterricht genommen. Damals las ich Zeitungsartikel über Schauspieler in New York und das Method Acting. Nun, ich hatte meine eigene Methode. Ich brachte den Text ganz einfach so, als wäre ich die Figur. Ich lernte das Schauspielen durchs Schauspielen. Das Publikum brachte mir bei, wie man sich verhielt. Wenn ich etwas tat, worauf das Publikum reagierte, machte ich es noch einmal. Jeden Abend zu arbeiten, neue Rollen anzunehmen, Texte zu lernen, mit Bewegungen und Gesichtsausdrücken zu experimentieren, all das war mein Schauspielunterricht.
Ein paar Jahre später, als ich zum Ensemble des kanadischen Stratford Shakespeare Festivals gehörte, gab es dort Kurse für Schauspieltechnik, Stimmeinsatz und sogar Schwertkampf. Das Problem war allerdings, dass wir als Schauspieler viel zu viel arbeiten mussten, als dass wir Zeit gehabt hätten, an allen Kursen teilzunehmen. Als ich anfing, einige der Techniken zu beherrschen, lief bereits unser zweites Stück der Saison, und wir bereiteten schon das dritte vor. Einige meiner Kollegen beim Stratford Festival waren klassisch ausgebildete Schauspieler, unter anderem James Mason und Anthony Quayle. Wir arbeiteten also jeden Tag mit erfahrenen Schauspielern zusammen, probten mit ihnen, übernahmen kleine Rollen oder bildeten die zweite Besetzung. Wenn wir nicht auf der Bühne standen, schauten wir uns die Stücke an. Ich lernte meinen Beruf auch, indem ich anderen Schauspielern zusah, mit ihnen zusammenwohnte und nebenbei viel über die Schauspielkunst las.
Ich nahm die Schauspielerei sehr ernst, aber leider verdiente ich kein Geld mit ihr. Diese Phase meines Lebens war eine gute Vorbereitung für spätere Zeiten, als ich ein bekannter Fernsehschauspieler war und immer noch kein Geld auf meinem Konto hatte. Ich träumte unverändert davon, eines Tages einhundert Dollar pro Woche einzunehmen, aber zu jener Zeit schien ich sehr weit davon entfernt zu sein. Wenigstens einmal am Tag, manchmal auch öfter, gab ich 27 Cent für einen Fruchtsalat im Supermarkt aus. Ich ernährte mich nur von Fruchtsalat, bis ich ihn nicht mehr sehen konnte.
Den einzigen Luxus, den ich mir gönnte, war ein Auto, für das ich vierzig Dollar bezahlt hatte – mehr war es auch nicht wert. Die Fahrertür klemmte, weswegen ich immer durchs Fenster ins Auto kletterte. Außerdem verbrauchte der Wagen so viel Öl, dass ich alle vierzig oder fünfzig Meilen an einer Tankstelle halten musste. Damals konnte man noch sehr günstig Öl kaufen, das in anderen Fahrzeugen schon zum Einsatz gekommen war. Genau das Richtige für mich, denn ich musste fast jeden Tag Öl nachfüllen.
Als der Sommer beim Mountain Playhouse vorüber war, empfahl mich Mrs Springford dem Canadian National Repertory Theatre in Ottawa – wieder als Assistent. Auch dort schaffte ich es, Eintrittskarten zu verlieren und Reservierungen zu vertauschen (gelegentlich verlor ich auch Reservierungen und vertauschte Eintrittskarten). Die Geschichte wiederholte sich. Ich verlor meinen Job und wurde als Schauspieler eingestellt – diesmal bei einem Gehalt von 31 Dollar pro Woche!
Während meiner zweiten Spielzeit in Ottawa kontaktierte mich eine Frau und erzählte mir mit ernster Miene, dass sich im Moment eine Theatergruppe formieren würde, um Shakespeare im kanadischen Stratford zu spielen, und sie lud mich ein, dieser Gruppe beizutreten. Ich hielt das zunächst für einen Witz. Ich sollte einen sicheren Job aufgeben, bei dem ich immerhin 31 Dollar die Woche verdiente, nur um in einem Provinznest Mitglied eines Shakespeare-Ensembles zu werden, von dem kein Mensch jemals etwas gehört hatte? Was glaubte sie, was ich sei … ein Schauspieler?
»Danke«, sagte ich, »aber ich habe einen festen Job und den behalte ich auch.«
Das Stratford Shakespeare Festival fand in jenem Jahr zum ersten Mal statt und dauerte damals noch von Mai bis September. Innerhalb kürzester Zeit wurde es nicht nur in ganz Kanada mit Lob überschüttet, sondern rund um die Welt gefeiert.
Aber ich war zufrieden, ich hatte meine Engagements. Ich arbeitete im Sommer für das Mountain Playhouse und im Winter für das Canadian Repertory. Wir führten jede Woche ein anderes Stück auf, probten und spielten täglich. Wie zuvor handelte es sich in Ottawa um Broadway-Komödien, welche die Leute zum Lachen bringen sollten. Aber meistens lachten sie nicht. Wenn etwas witzig sein soll und das Publikum nicht lacht, kann diese Stille wirklich ohrenbetäubend sein. Man kann die Stille nicht nur hören, sondern wird von ihr regelrecht durchbohrt. »Oh nein, was habe ich bloß falsch gemacht?« So hämmert es einem im Kopf. »Bei der Aufführung gestern haben die Leute gelacht, was habe ich da bloß anders gemacht?« Wenn man auf der Bühne steht und die Leute lachen nicht, verspürt jeder Schauspieler ein lautes Dröhnen – man versucht sofort, umzuschalten und den richtigen Rhythmus zu finden.
Ich spielte diese Komödien etwa drei Jahre lang. Ich dachte, dass ich das schlimmstmögliche Dröhnen im Kopf bereits hatte ertragen müssen, als ich viele Jahre später einen wirklich großartigen Einfall hatte. Es war lange nachdem Captain James T. Kirk so bekannt geworden war. Es handelte sich um eine dieser besonders schlechten Ideen, die erst so gut zu sein schienen und einen später dazu brachten, sich unendlich dafür zu schämen. Ich wurde gefragt, ob ich beim Comedy Club in Los Angeles auftreten wollte, und ich sagte: »Ich habe eine ganz tolle Idee. Ich werde so tun, als würde Shatner glauben, dass er Captain Kirk sei, und ich werde so tun, als würde Kirk denken, er sei witzig.« Der Clubbesitzer sah mich ernst an. »Bill, das ist nicht lustig«, sagte er bloß.
Nun mal ganz ehrlich, wer weiß denn schon, was wirklich lustig ist? Der Schauspieler, der einige Jahre damit verbracht hat, anspruchslose Komödien in Kanada zu spielen, oder der Besitzer eines Comedyclubs, bei dem jeden Abend Stand-up-Comedians auftreten? Ich sagte: »Lass es mich erklären. Das wird urkomisch, weil das Publikum verstehen wird, dass ich Captain Kirk bin, der denkt, dass er witzig ist, aber er ist gar nicht witzig – und genau aus dem Grund wird er witzig sein!«
Ich kann mich noch gut daran erinnern, auf welch seltsame Art er mich anblickte. Mir war augenblicklich klar, dass er von Comedy nichts verstand. Also ging ich auf die Bühne und erzählte die üblichen Weltraum-Witze. Das Publikum lachte wie eine Delegation vom Planeten Vulkan. Das Problem war nämlich, wie ich nun einsehen musste, dass die Zuschauer die Raffinesse meiner Darbietung überhaupt nicht zu würdigen wussten. Sie verstanden einfach nicht, dass ich Captain Kirk spielte, der dachte, dass er witzig sei, aber in Wirklichkeit gar nicht witzig war, und sie sahen mich nur an und dachten aller Wahrscheinlichkeit nach: »Wow, der Shatner ist wirklich grottenschlecht!«
Das war der schlimmste Comedyabend meines Lebens. Aber Ottawa hatte mich bereits auf solche Momente vorbereitet. Ich hatte eine schwere Zeit dort. Der Satz meines Vaters, dass ich immer ein Heim haben würde, schwirrte mir im Kopf herum. Dennoch wäre es falsch zu behaupten, dass ich am Hungertuch genagt hätte. Ich verdiente nicht mal genügend Geld, um an einem Hungertuch zu nagen! Mein Vater steckte mir irgendwann ein paar tausend Dollar zu und bemerkte: »Mehr kann ich dir nicht geben.« Es war genug zum Überleben, aber nicht genug, um ein vernünftiges Leben zu führen. Mein Vater fühlte sich damals sicher hin und her gerissen: Einerseits wollte er mir helfen, aber andererseits wollte er auch, dass ich am eigenen Leib spüre, wie schwierig das Leben ist, das ich mir auserwählt hatte.
Nach meinem dritten Jahr beim Canadian Repertory wurde ich erneut eingeladen, dem Ensemble des Stratford Festivals beizutreten. Dieses Mal nahm ich das Angebot an. Der Initiator des Festivals war der Kanadier Tom Patterson. Er wollte in seiner in Ontario gelegenen Heimatstadt, die nach Shakespeares Geburtsort »Stratford« benannt worden war, eine Theatergruppe auf die Beine stellen. Sie sollte größtenteils aus kanadischen Schauspielern bestehen und die klassischen Shakespeare-Stücke aufführen. Patterson reiste nach England und überzeugte Sir Tyrone Guthrie, damals einer der berühmtesten Theaterregisseure der Welt, nach Stratford, Ontario, zu kommen und Pattersons Ensemble zu leiten.
So geschah es. Guthrie brachte einige der führenden Set-Designer und Schauspieler Englands mit. Alec Guinness spielte in der ersten Aufführung. Das Stratford Shakespeare Festival genoss von Anfang an den Ruf, das beste klassische Theater Nordamerikas zu sein.
Ich packte mein Hab und Gut (das war nicht viel) auf den Rücksitz eines gebrauchten Morris Minor, den mir mein Vater gekauft hatte, und machte mich auf den Weg zu den grellen Lichtern der Großstadt Toronto. Ein Morris Minor war ein Kompromiss zwischen einem sehr kleinen Wagen und gar keinem. Auf dem Weg nach Toronto kam ich in ein heftiges Unwetter mit Platzregen. Als ich auf einer Brücke über den Ottawa River fuhr, kam mir ein riesiger Truck mit hoher Geschwindigkeit entgegen. Die Wucht des Trucks und das Regenwasser, das durch seine riesigen Reifen gegen meinen Wagen geschleudert wurde, hätten mich fast von der Brücke in den Fluss stürzen lassen. Ich erinnere mich, was ich in jenem Augenblick dachte; wenn mein Auto im Ottawa River gelandet wäre, hätte es so gut wie keinen Beweis für meine Existenz gegeben. Nichts wäre von mir übrig geblieben, bis auf die Trauer meiner Eltern. Ich hatte keine Freunde, die sich Sorgen um mich machten, und keine Freundin, mit der ich irgendeinen Pakt eingegangen wäre. Ich konnte keine nennenswerten Erfolge oder sonstigen Errungenschaften vorweisen. Das war ein niederschmetternder Gedanke. Ich fühlte mich an eine Zeile aus Macbeth erinnert: »Eine Geschichte, von einem Narren erzählt … die nichts besagt.«
In Stratford führten wir drei Stücke pro Saison auf, von Mai bis September. Wir probten zunächst das erste Stück, und als es lief, bereiteten wir gleich das nächste vor. In den drei Stücken agierten immer dieselben Schauspieler. Ich war einer der sechs jungen Männer, die in der Gruppe mitspielten. Es herrschte stets große Konkurrenz, wenn es um die Rollenverteilung ging. Meistens bekamen wir Nebenrollen. Wenn man ein paar Textzeilen sagen durfte, war das schon ein großer Erfolg. Wir alle lebten in Ehrfurcht vor dem Gott Tyrone Guthrie, der in Stratford menschliche Form angenommen hatte. Guthrie war eine Legende. Alle großen Schauspieler verehrten ihn. Als er nach Kanada kam, dachte die Schauspielerriege dort, dass sich der Horizont auf sie zu bewegte. Und so zitterten wir vor Ehrfurcht, als wir ihn sahen, diesen großartigen Mann, der zu uns gekommen war, um sein Wissen mit uns zu teilen.
Guthrie war etwa zwei Meter groß und hatte einen mächtigen Bierbauch sowie eine Habichtsnase. Das Theater in Stratford war eine Art Loch im Boden, über das ein großes Zelt gespannt worden war. Wir standen alle auf der schrägen Bühne auf dem Grund des Loches sozusagen, und plötzlich öffnete sich der Zelteingang, die Sonnenstrahlen leuchteten grell ins Innere. Aus diesem hellen Licht schritt Tyrone Guthrie in Richtung Bühne. Was für ein Auftritt! Später stand er dort und verkündete seine Entscheidungen, was die Inszenierung betraf: »Du wirst die Rolle des … spielen.«
Es war wie Hypnose. »Ja, ich werde die Rolle des … spielen.«
Tyrone Guthrie war kein Lehrer, er gab nicht viele Instruktionen. Um eine Textzeile passend wiederzugeben oder die Bedeutung dieser Zeile zu interpretieren, musste man sich allein durch den Text arbeiten und es für sich selbst herausfinden. Aber er war ein Meister darin, großes und außergewöhnliches Theater zu schaffen und erinnerungswürdige Momente auf die Bühne zu zaubern. Ich erinnere mich, wie er mal seine Hand auf meine Schulter legte und sagte: »Bill, erzähl mir was über Method Acting.« Ich sollte Sir Tyrone Guthrie Method Acting erklären? Ich fing an, das wiederzugeben, was ich in all jenen Zeitungsartikeln gelesen hatte, wie ein Schauspieler in die Figur eintauchen muss, um deren Emotionen in sich zu spüren …
Nachdem ich ihm mein bescheidenes Wissen mitgeteilt hatte, fragte er mich: »Warum denken die Schauspieler nicht einfach an einen wunderschönen Sonnenuntergang?«
Ich verstand, dass es keine ernst gemeinte Frage war, sondern eher ein Vorschlag. Er erinnerte mich daran, dass ein schöner Sonnenuntergang dem Schauspieler ein breiteres Farbspektrum gibt, als wenn er einfach nur irgendein Gefühl abruft, um einer Figur gerecht zu werden. Außerdem sollte ein Schauspieler nicht so verbittert an der perfekten Schauspieltechnik arbeiten, dass er dabei von der Schönheit der Worte und von alldem, was um ihn herum passiert, nichts mitbekommt.
Als ich erst wenige Wochen in Stratford war, durfte ich bereits eine kleine Rolle in dem Historiendrama Heinrich V. übernehmen, in dem auch Christopher Plummer mitspielte. Chris Plummer und ich sind etwa gleichen Alters, aber anstatt zum College zu gehen, hatte er sofort am Theater angefangen und war nun so etwas wie der bekannteste Jungschauspieler Kanadas. Er gehörte zum äußerst kleinen Kreis erfolgreicher Schauspieler in Montreal und verkehrte unangefochten in der Welt der Reichen und Schönen. Er war ein begabter Schnellstarter und ich war neidisch auf ihn. In Stratford spielte er fast nur Hauptrollen. In Heinrich V. erhielt ich die Rolle des Duke of Gloucester, für die ich etwa fünf Minuten lang auf der Bühne stand. Außerdem war ich die Zweitbesetzung für Chris Plummers Rolle.
Die Rolle des Königs Heinrich V. ist eine der längsten und umfangreichsten, die Shakespeare jemals geschrieben hat. Wenn wir keine Probe hatten, lernte ich den Text auswendig. Immer wenn ich ein wenig Zeit für mich hatte, nachts oder im Bad, prägte ich mir all seine opulenten Ansprachen ein. Da wir das Stück bereits nach wenigen Wochen aufführten, gab es keine Zeit für einen Durchlauf mit der Zweitbesetzung. Während der Inszenierung behielt die Zweitbesetzung die Hauptdarsteller immer im Auge, aber niemand von uns glaubte damals wirklich daran, eines Tages einen der Hauptdarsteller ersetzen zu müssen, wenn dieser krankheitsbedingt ausfiel. Die Gruppe bestand aus jungen, gesunden und wohlgenährten kanadischen Schauspielern; es gab nicht einen einzigen Krankheitsfall. Im Grunde bestand auch die eiserne Regel: Egal wie krank man war, wenn man mehr als zwei Mal die Minute ein- und ausatmete, galt man als den Lebenden zugehörig und musste irgendwie weiterarbeiten.
Das Stück erhielt exzellente Kritiken, nachdem es angelaufen war. Die New York Times nannte es eine »beeindruckende Inszenierung … eindringlich, ein Feuerwerk«. Auch Chris Plummer wurde von den Kritikern in den höchsten Tönen gelobt, und jede Aufführung des Stückes war ausverkauft. Das war zu jenem Zeitpunkt mit Abstand mein erfolgreichstes Engagement als Schauspieler. Ich war Mitglied einer angesehenen Theatergruppe und arbeitete mit den namhaftesten Schauspielern Kanadas. Natürlich war es eindringlich und ein Feuerwerk! Der Montag war der einzige Tag in der Woche, den ich frei hatte, und eines Montagmorgens, als das Stück seit zwei Wochen lief, erhielt ich einen Anruf vom Produktionsbüro: Chris Plummer leide unter einem Nierenstein, ob ich heute Abend für ihn einspringen könne?
Ob ich einspringen könne? Ob ich heute einspringen könne und Plummer in einer der wohl großartigsten Rollen, die für die Theaterbühne je geschrieben worden sind, ersetzen könne? Absolut. Ohne Zweifel. Natürlich.
Es war komplett verrückt. Ich hatte den Text nicht ein einziges Mal laut vorgesprochen, sondern ihn mehr oder weniger auf dem Klo vor mich hin gemurmelt. Ich hatte nie eine Probe in der Rolle, sodass ich die Regieanweisungen nicht kannte. Ich hatte mich nicht mit den anderen Schauspielern über die Rolle ausgetauscht. Jeder Schauspieler, der noch ganz bei Sinnen war, hätte in diesem Moment gesagt: Sir, was fällt Ihnen ein, mich darum zu bitten, auf die Bühne zu gehen und meinen guten Ruf zu riskieren? Oder so ähnlich.
Normalerweise hätte man mir auch antworten müssen: Das geht natürlich nicht. Es ist unmöglich. Wir müssen die Aufführung absagen und den Leuten das Geld zurückerstatten und …
Geld zurückerstatten? Moment, da liegt also der Hund begraben! Das Produktionsbüro versuchte, eine Notfallprobe auf die Beine zu stellen, aber Schauspieler aufzufinden, die einen freien Tag hatten, war schwieriger, als einen Gewinnbeteiligungsscheck von einem Filmstudio zu erhalten. Gegen fünf Uhr nachmittags sagte mir jemand, dass ich zur Kostümprobe gehen sollte, um sicherzustellen, dass mir das Kostüm passte. Zum Glück hatten Chris und ich in etwa dieselbe Größe, sodass es wie angegossen saß.
Seltsam war, dass ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht begriffen hatte, was mich erwartete. Ich war völlig ruhig und selbstsicher. Es kam mir nicht in den Sinn, dass ich meine Karriere aufs Spiel setzte – nicht dass ich zu jenem Zeitpunkt eine Karriere gehabt hätte, aber wenn dies ein Debakel geworden wäre, hätte ich dafür geradestehen müssen. Und das Ganze hatte jenes große Debakelpotenzial, aus dem Comedyautoren ihre Inspiration ziehen.
Tyrone Guthrie war nicht anwesend. Kurz bevor ich auf die Bühne ging, fragte mich der Theaterleiter Michael Langham: »Ist alles in Ordnung?«