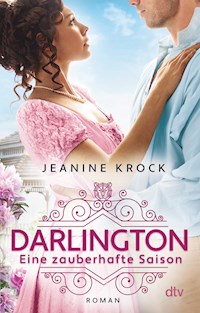4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Liebe durch alle Zeiten
Nach dem Ende einer desaströsen Beziehung ist die junge Hamburger Journalistin Johanna am Boden zerstört. Kurzerhand beschließt sie, ihre Freundin Caitlynn in Schottland zu besuchen, um ihren Liebeskummer zu überwinden.
Tatsächlich scheint die betörend schöne Landschaft der schottischen Highlands wahre Wunder zu bewirken, und Johanna fühlt sich bald besser. Nicht zuletzt auch wegen des attraktiven Alan, der ihr dort immer wieder begegnet und der ihr, aller guten Vorsätze zum Trotz, heftiges Herzklopfen bereitet.
Noch ahnt sie nicht, dass dieser harmlose Flirt ihr Leben für immer verändern wird. Denn Alan stammt aus einer anderen Zeit, in der er Chieftain eines wehrhaften Clans ist – und plötzlich findet sich auch Johanna auf magische Weise im Schottland des 18. Jahrhunderts wieder.
Doch die Sitten in Alans Clan sind rau, und auch ihn selbst scheint ein düsteres Geheimnis zu umgeben. Ist Johannas Liebe stark genug, alle Widrigkeiten zu überwinden?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
WIND DER ZEITEN
EIN ZEITREISE-ROMAN
JEANINE KROCK
Dieses Buch habe ich meinem Vater gewidmet, der mich das Schreiben, Sehen und Fragen gelehrt hat und einen guten Single Malt zu genießen wusste. Er starb in der Nacht, in der ich von meiner Recherchereise für diesen Roman aus Schottland zurückkehrte.
Tha mi gad ionndrainn.
WIND DER ZEITEN
Ach, gäbe uns eine Macht die Gabe der Feen, uns selber zu sehen, wie andere uns sehen!
ROBERT BURNS
Eine Liebe, die Jahrhunderte überbrückt – raue Highlander und liebende Herzen.
Nach dem Ende einer desaströsen Beziehung ist die junge Hamburger Journalistin Johanna am Boden zerstört. Kurzerhand beschließt sie, ihre Freundin Caitlynn in Schottland zu besuchen, um ihren Liebeskummer zu überwinden. Und tatsächlich scheint die betörend schöne Landschaft der schottischen Highlands wahre Wunder zu bewirken, und Johanna fühlt sich bald besser. Nicht zuletzt auch wegen des attraktiven Alan, der ihr dort immer wieder begegnet und der ihr, aller guten Vorsätze zum Trotz, heftiges Herzklopfen bereitet.
Noch ahnt sie nicht, dass dieser harmlose Flirt ihr Leben für immer verändern wird. Denn Alan stammt aus einer anderen Zeit, in der er Chief eines wehrhaften Clans ist – und plötzlich findet sich auch Johanna auf magische Weise im Schottland des 18. Jahrhunderts wieder. Doch die Sitten in Alans Clan sind rau, und auch ihn selbst scheint ein düsteres Geheimnis zu umgeben. Ist Johannas Liebe stark genug, alle Widrigkeiten zu überwinden?
Am Ende des Buches befindet sich ein Glossar.
Impressum • Glossar • Newsletter
INHALT
November 1746
1. Meine Reise
2. Ausflug zu Pferd
3. Am Steinkreis
4. Eine neue Welt
5. Freundschaft
6. Cèilidh
7. Lachlan
8. Gerichtstag
9. In den Highlands
10. Das Attentat
11. Die Lady
12. Flucht
13. Unterwegs
14. Eine Zofe im Eis
15. Hochzeit
16. Argyle
17. Ein Traum
18. Wieder auf Reisen
Die Autorin
Eine Bitte …
Bücherbrief und Dank
Impressum
Buchstabenmagie
Glossar
Buchempfehlungen sind für Autorinnen und Autoren wie das Licht für Blumen, die Luft zum Leben und das Wasser für die Erde.
Wenn Ihnen mein Buch gefällt, freue ich mich sehr über eine freundliche Rezension – oder erzählen Sie es einfach ihren Freundinnen und Freunden.
Herzlichen Dank!
Ihre Jeanine Krock
Neuerscheinungen, exklusive Buchverlosungen, Textschnipsel und private Einblicke in meine Schreibwerkstatt gibt es im Newsletter »Bücherbrief«.
NOVEMBER 1746
Der Krieger lehnte sich gegen den Wind und zog das Plaid fester um die Schultern. Nicht die Kälte ließ ihn frösteln, als er mit zusammengekniffenen Augen über Gleann Grianach blickte. Einst hatte er den Namen dieses Tals mit Stolz getragen, doch das war lange bevor der Krieg zum letzten Mal seine tödlichen Tentakel bis hoch in den Norden Schottlands ausgestreckt und seine Heimat zerstört hatte. Jetzt ragte der alte Turm von Castle Grianach wie ein mahnender Finger in den bleiernen Winterhimmel, sein ehemaliges Zuhause war unbewohnbar. Er vermisste den typischen Geruch der Torffeuer, und die schwarzen Ruinen vieler Gehöfte ließen dem Mann das Herz schwer werden. Es war alles seine Schuld.
Er hätte wissen müssen, dass sein Stiefbruder den Clan für ein freies Schottland in die Schlacht führen würde, hätte dem glühenden Jakobiten niemals die Verantwortung als Chieftain übertragen dürfen. Doch zuallererst hätte er an jenem Johannistag vor achtzehn Jahren nicht versuchen dürfen, den Helden zu spielen. Ein bitteres Lachen kam über seine Lippen, wo es sofort in der eisigen Luft gefror. Er kannte sich aus mit Helden und mit dem Krieg. Als Söldner hatte er in Culloden unzähligen braven Schotten den Tod gebracht. Das Einzige, was er für seine Landsleute getan hatte, war, ihnen ein schnelles Ende zu bereiten, statt sie verkrüppelt und sterbend den Krähen und Plünderern zu überlassen.
Ein letzter Blick über das Tal, ein stiller Abschied. Er wandte sich zum Gehen, als ein Schrei die Luft zerriss. Krähen flogen auf, und ein Eichelhäher floh schimpfend. Das war einer dieser Laute, die ihm nachts bis in seine Träume folgten, ein Echo der schmerzgequälten Rufe auf dem Schlachtfeld, das Klagen und Wimmern der Frauen, denen er die Nachricht vom Tod ihrer Brüder, Männer, Söhne überbrachte. Wie oft hatte er sich gewünscht, selbst zu fallen, dem Martyrium endlich ein Ende zu machen. Doch stets hatten diese unseligen Feen ihre schützenden Hände über ihn gehalten.
Ist es noch nicht genug?, fragte der Krieger lautlos, als ein weiterer Schrei ertönte. Mit dem Schicksal würde er später hadern. Er rannte den Hügel hinab, durch immer dichter werdendes Buschwerk, hinunter zum Bach.
Drei englische Soldaten. Sie pressten seinen jüngsten Bruder auf den Boden. Einer von ihnen hielt den Dolch wie eine Trophäe in die Höhe, Mordlust entstellte sein Gesicht. Er war tot, bevor er den Arm zum fatalen Stoß senken konnte. Von einem Faustschlag getroffen, taumelte der zweite und stürzte rücklings auf einen Felsbrocken. Der dritte wehrte sich verbissen, doch schließlich war auch er bezwungen.
Nach Luft ringend hielt der Krieger einen Moment lang inne und betrachtete die Männer mit einem resignierten Gesichtsausdruck, als habe er sie in besseren Tagen einmal gekannt.
Und dieses Zögern kostete ihn das Leben. Als das Messer in seinen Rücken glitt, spürte er im ersten Augenblick so gut wie nichts. Doch er wusste, der Schmerz würde kommen.
Ein letztes Mal nahm der Krieger die verbliebene Kraft zusammen, hob sein Schwert, wirbelte herum und nahm seinen Mörder mit in einen sicheren Tod.
Bevor er das Bewusstsein verlor, hörte er die Rufe seines Bruders, und plötzlich blickten ihn purpurfarbene Feenaugen an. Sie allein folgten ihm in die alles verschlingende Dunkelheit.
MEINE REISE
Nachdem die Rücklichter des Zugs von der Nebelwand verschluckt waren, wurde es still. Während ich am Bahnhof in Inverness gewartet hatte, war mir klar geworden, dass Frühling in Schottland anders aussah als zu Hause in Hamburg, wo rund um die Alster längst die ersten Krokusse mutig ihre Köpfe durch den harten Boden der Rasenflächen streckten. Meine Jacke war nicht annähernd so warm, wie ich sie mir in diesem Augenblick gewünscht hätte, und der einzige dicke Pullover, den ich eingepackt hatte, lag ganz unten im Koffer. Fröstelnd zog ich mir die Mütze tiefer ins Gesicht und beobachtete, wie mein Atem in kleinen Wölkchen davoneilte, als könne er es gar nicht erwarten, sich mit dem großen Weiß um uns herum zu vereinigen. Außer mir schien hier nur ein einziger Fahrgast ausgestiegen zu sein, und der war gerade vorbeigeschwebt. Geschwebt? Mit vorsichtigen Schritten folgte ich seinem dunklen Schatten, der sich schnell im Nebel auflöste, und hoffte auf dem richtigen Weg zu sein, als über mir ein Gespenst auftauchte. Erschrocken sah ich nach oben. Natürlich glaube ich nicht an Geister und erkannte bei genauerem Hinsehen, dass nur das sanfte Licht einer Laterne mich erschreckt hatte. So einen dicken Nebel hatte ich noch nie zuvor erlebt, dabei gab es bei uns an der Küste davon reichlich. Amüsiert über meine eigene Ängstlichkeit ging ich weiter und – trat ins Nichts. Haltsuchend ruderte ich mit den Armen, griff zunächst ins Leere und fand schließlich doch etwas, an dem ich mich festklammern konnte. Allerdings entpuppte es sich schnell als der Ärmel eines Mantels aus edlem Tuch.
Kräftige Hände legten sich um meine Taille, ich wurde aufgefangen und hatte Sekunden später wieder festen Boden unter den Füßen. Erstaunt fuhr ich herum und blickte eine Reihe von Mantelknöpfen hinauf in das Gesicht eines Engels. Das heißt, falls es im Himmel erlaubt war, so unverschämt attraktiv auszusehen, dass fremde Frauen durch bloßes Starren zu willenlosen Opfern ihrer eigenen nicht ganz jugendfreien Fantasien wurden. Ganz gewiss fügte sich dieser Mann problemlos in eine lange Reihe historischer Herzensbrecher ein.
»Sie sollten aufpassen, wohin Sie treten«, warnte mein Retter, und seine tiefe Stimme löste ein seltsames Flattern meiner Nerven aus, die plötzlich alle irgendwo in der Tiefe meines Körpers zu enden schienen.
»Vielen Dank für den Hinweis. Darauf wäre ich von selbst gar nicht gekommen.« Stress brachte nicht unbedingt meine liebenswürdigste Seite zum Vorschein. Und die Selbstverständlichkeit, mit der er nach meinem Koffer griff und mich am Ellbogen wortlos zum menschenleeren Bahnhofsvorplatz dirigierte, trug nichts zu meiner Entspannung bei.
»Werden Sie abgeholt?« Er stellte den Koffer auf einer hölzernen Sitzbank ab.
»Ja, wahrscheinlich haben sich meine Freunde wegen des Wetters verspätet. Ich komme schon zurecht, danke.«
Der Fremde sah aus, als wollte er widersprechen, dann zuckte er mit den Schultern. »Gut«, entgegnete er, drehte sich um und verschwand so lautlos, wie er gekommen war.
Überrascht starrte ich hinter ihm her. Ich hatte höflichen Protest erwartet und das Angebot, mit mir zu warten. Aber offenbar war es dem Kerl vollkommen gleichgültig, ob ich in dieser unwirtlichen Einsamkeit erfrieren oder vom Nebel aufgeweicht werden würde. So sah also die viel gerühmte Gastfreundschaft der Schotten aus. Auch wenn man den landestypischen Akzent kaum herausgehört hatte, seine wahre Herkunft konnte mein unfreundlicher Retter nicht verleugnen. Die Erinnerung daran, wie er das R rollte, ließ mich erneut erschaudern und wünschen, er wäre nicht fortgegangen. Du bist überreizt, wies ich mich zurecht.
In diesem Augenblick brummte ein Motor, und kurz darauf stand der nächste Prachtkerl vor mir. »Caitlynn hätte mich wirklich vorwarnen können, dass die Männer hier alle aussehen, als wären sie einem dieser romantischen Romane entstiegen.«
Der Mann musste mein Murmeln gehört haben. Fragend hob er eine Augenbraue, bevor er feststellte: »Du bist Johanna.« Ich nickte etwas verlegen, und er fuhr fort: »Es tut mir leid, dass du warten musstest …« Er machte eine entschuldigende Geste in den unvermindert dichten Nebel.
»Aber das Wetter …«
»Oh, das ist schon in Ordnung. Der Zug hatte sowieso Verspätung. Iain, nehme ich an?« Das also war Caitlynns neuer Freund.
Er reichte mir eine große, warme Hand: »Herzlich willkommen in Ghàidhealtachd.«
Die Art, wie er dieses Wort aussprach, erinnerte mich daran, dass hier teilweise noch schottisches Gälisch gesprochen wurde.
Iain lud meinen schweren Koffer und die große Reisetasche in den Kofferraum und grinste, als ich die Tür öffnete, um einzusteigen. »Du möchtest fahren?«
»Um Himmels Willen, nein.« Zu spät erinnerte ich mich, dass hier Linksverkehr herrschte und die Fahrzeuge entsprechend seitenverkehrt gebaut waren. Lachend umrundete ich den Wagen und stieg auf der anderen Seite ein.
Innen war es angenehm warm, und die Anspannung, die mich seit der Begegnung mit dem dunkelhaarigen Fremden befallen hatte, ließ langsam nach. Der Wagen kroch eine gewundene Straße hinab, die so schmal war, dass ich insgeheim hoffte, niemand außer uns würde so verrückt sein, die Strecke bei dem Wetter zu fahren.
Iain allerdings wirkte unbekümmert. Er erzählte mit angenehmer Stimme, in der ein neuer, schwer einzuordnender Akzent mitschwang, dass Caitlynn ganz geknickt gewesen sei, mich wegen des Wetters nicht selbst abholen zu können, aber er kenne sich hier einfach besser aus und habe sie auf keinen Fall fahren lassen wollen. Zudem solle ich nicht enttäuscht sein, falls ich während der Zugreise wenig von der Gegend gesehen hätte. Für morgen sei ein sonniger Tag vorhergesagt, und dort, wo sie lebten, gäbe es auch genügend Landschaft, fügte er verschmitzt hinzu.
Ich mochte ihn auf Anhieb. Mit seiner ruhigen Gelassenheit schien er der ideale Gefährte für meine quirlige Freundin zu sein.
Nach etwa einer Stunde Fahrt durch eine Landschaft, die ihre legendäre Schönheit heute nicht preisgab, erreichten wir ihren gemeinsamen Gasthof Sithean Inn. Gasthof war ein bescheidenes Wort für dieses Gebäude, das eher wie ein viktorianischer Landsitz aussah und jedem stolzen Clanchef als Wohnsitz zur Ehre gereicht hätte. Bisher hatte ich nicht herausfinden können, ob Iain das großzügige Estate geerbt oder gekauft hatte. Im Internet fanden sich nur wenige Hinweise auf dessen Existenz, die zudem noch recht widersprüchlich klangen, und Caitlynn hatte nichts dazu beigetragen, meine Neugier zu befriedigen.
Wie auch immer – im Licht der dezent unter Buschwerk verborgenen Strahler sah es zauberhaft, aber auch ein bisschen unheimlich aus. Wie von Iain versprochen, hatte sich der Nebel hier, in der Nähe der Küste, jedoch gelichtet, und es hingen nur noch zarte Schleier wie vorsichtig abwartende Geister in den Efeuranken, die sich zwischen den Türmchen, Erkern und zahlreichen Kaminen an der Fassade hinaufwanden.
Meine Schulfreundin Caitlynn stürzte im selben Moment aus dem Haus, in dem der Wagen knirschend auf dem Kiesweg zum Stehen kam. Sie zerrte mich praktisch aus dem Auto, umarmte mich, und ehe ich noch etwas sagen konnte, rief sie Iain zu: »Bringst du das Gepäck hinauf?« Dabei zog sie mich zum Haus, ohne seine Antwort abzuwarten. »Und du hast deinen Verlobten tatsächlich dabei erwischt, wie er am helllichten Tag diese Frau … auf seinem Schreibtisch? Wirklich?«, flüsterte sie so laut, dass jeder im Umkreis von fünfzig Metern ihre Worte hätte hören können.
Glücklicherweise war der Hof – soweit ich das sehen konnte – mit Ausnahme von uns menschenleer. Iain ließ sich nicht anmerken, ob er sie gehört hatte, als er an uns vorbei zum Haus ging. Wie ich meine Freundin kannte, war er vermutlich ohnehin längst über alle Details aus meinem traurigen Liebesleben informiert, die ich mit ihr geteilt hatte.
Ich fürchtete schon, Caitlynn würde nach den Einzelheiten der entwürdigenden Szene fragen, die mich letztendlich veranlasst hatte, hierher zu kommen, um in Ruhe und Abgeschiedenheit meine Wunden zu lecken und einige grundsätzliche Dinge in meinem bisherigen Leben zu überdenken.
Doch sie plapperte bereits weiter: »Wie ordinär. Deine Hände sind ganz kalt.« Resolut schob sie mich durch eine dunkle Holztür, die Iain uns aufhielt. »Hattest du eine gute Fahrt? Dieser verdammte Nebel, du brauchst einen Drink.« Damit stieß sie eine weitere Tür auf. Warme Luft und Stimmengemurmel schlugen uns entgegen.
Neugierig trat ich ein und schaute mich um. Das Pub wirkte einladend und sehr behaglich, obwohl – oder gerade weil – die Einrichtung sicher schon einige Generationen von Gästen gesehen hatte. Aus zahlreichen E-Mails meiner Freundin wusste ich, dass sie viel Zeit darauf verwandt hatten, die Einrichtung alter Landgasthäuser im ganzen Land zu sichten und die besten Stücke aufzukaufen. Es musste ein Vermögen gekostet haben, aber der Effekt war beeindruckend. Niemand würde vermuten, dass dieser Gastraum nicht schon von Generationen engagierter Wirtsleute liebevoll gepflegt und erhalten worden war.
Rechts sah ich eine Reihe Fenster mit alten, bleigefassten Scheiben. Davor ein gutes Dutzend Tische, mit Stühlen und Sesseln aus verschiedenen Epochen, was erstaunlicherweise dennoch sehr harmonisch auf mich wirkte. Gegenüber befand sich die lange, für Pubs so typische Bar, an der ein paar Leute standen, die sich jetzt neugierig nach uns umblickten.
Caitlynn nickte ihnen freundlich zu und schob mich zum Kamin, in dem ein kleines Feuer glomm. Bei genauerem Hinsehen entpuppte sich das Brennmaterial als Torf – das erklärte auch den eigentümlichen Geruch, der draußen in der Luft gehangen hatte und hier noch stärker geworden war.
»Bei Nebel zieht der Kamin nicht gut«, entschuldigte sie sich. Tatsächlich war der Raum rauchgeschwängert, wofür man kaum den an einer Pfeife kauenden Gast allein verantwortlich machen konnte. Er saß bequem zurückgelehnt in einem Sessel und hatte nicht einmal aufgesehen, als wir hereingekommen waren. Die Männer an der Bar allerdings musterten uns interessiert, bis sie Caitlynn erkannten und sich mit einem gemurmelten Gruß wieder ihrem Ale und einem Würfelspiel zuwandten.
»Meine beste Freundin. Sie wird eine Weile bei uns wohnen«, erklärte Caitlynn über die Köpfe der anderen Gäste hinweg. Nun sahen mich alle an und ich kämpfte gegen die aufkeimende Verlegenheit, während ich mich um ein Lächeln bemühte, das auch mein Erstaunen verbergen sollte, denn Einheimische anzutreffen, damit hatte ich nicht gerechnet. Iain und Caitlynn mussten beliebt sein, wenn die Bewohner des Dorfes den Weg auf sich nahmen, um ihre Abende hier und nicht im Dorf-Pub zu verbringen, an dem wir auf der Herfahrt vorbeigekommen waren. Die Männer begrüßten mich respektvoll, und mir war klar, dass am nächsten Tag die gesamte Gemeinde von meiner Ankunft erfahren haben würde.
Caitlynn wies auf das samtbezogene Sofa neben dem Kamin. »Du musst Hunger haben. Wir werden dir etwas Leckeres machen, aber erst einmal gibt es einen Wee Dram, einen winzigen Schluck Whisky zum Aufwärmen.« Damit winkte sie das junge Mädchen herbei, das hinter der Bar hervorkam, und flüsterte ihr etwas zu.
Die Kellnerin, der die Vorstellungsrunde entgangen war, warf mir einen neugierigen Blick zu, nickte dann und verschwand in der Küche, während ich in den weichen Polstern versank. Caitlynn entschuldigte sich. »Ich bin gleich wieder da.«
Diese kurze Pause ließ mir Zeit, die Wanddekoration über dem steinernen Kamin in Ruhe zu betrachten. Zwischen zwei riesigen Schwertern hingen die blaue schottische Flagge mit dem weißen Kreuz, ein rundes Holzschild und eine Axt. Obwohl die Waffen sehr alt aussahen, wirkten sie beunruhigend gebrauchsbereit.
Vor meinem geistigen Auge nahm eine kriegerische Szene Gestalt an. Das Bild des wilden Highlanders, der sein Breitschwert über dem Kopf kreisen ließ, bevor er mit einem markerschütternden Schrei auf seine Kontrahenten in roter Uniform zusprang, schien plötzlich so greifbar nahe, dass ich erschrocken zurückfuhr und mein Herz wie wild zu schlagen begann.
Iain, der lautlos mit Whisky und einer Karaffe Wasser erschienen war, drückte mir wortlos mein Glas in die Hand, und für die Dauer eines Wimpernschlags glaubte ich, Verständnis in seinen Augen zu lesen. Aber das war natürlich Unsinn – die Reise hatte mich mehr erschöpft als angenommen, und meine Fantasie spielte mir einen Streich. Caitlynns Freund konnte unmöglich wissen, dass meine lebhafte Einbildungskraft wieder einmal mit mir durchgegangen war.
Die goldgelbe Flüssigkeit hinterließ einen öligen Film auf dem Glas, und eine Flamme brannte sich ihren Weg in meinen Magen. Zurück blieben ein rauchiger Geschmack und der Duft von Honig und Sommerwiesen. »Wie alt ist dieser Whisky?«, fragte ich ehrfurchtsvoll und war nicht überrascht, als Iain mit seiner dunklen Stimme antwortete: »Vierundzwanzig Jahre.«
Er küsste Caitlynn, die wieder hinter ihm aufgetaucht war, sanft auf den Mund, bevor er sich setzte. »Ein besonderes Getränk, für zwei besondere Frauen. Slàinte mhath. Zum Wohl. Willkommen in Schottland«, fügte er lächelnd hinzu. Für einen so großen Mann, ich schätzte ihn auf nahezu einsneunzig, glitt er ungewöhnlich elegant neben sie auf das Sofa. Ihre Augen leuchteten glücklich, und sie berührte zärtlich und wie zufällig seine Hand.
»Du bist ein waschechter Schotte …« Ich ließ offen, ob es eine Feststellung oder eine Frage hatte sein sollen. Normalerweise war ich gut im Erkennen von Akzenten, aber in Iains rollender Aussprache schwang etwas Fremdartiges mit, das ich immer noch vergeblich einzuordnen versuchte.
Er zögerte einen Moment, als müsse er über seine Antwort nachdenken, bevor er sagte: »Aye, das bin ich.«
Die Kellnerin erschien und tischte uns ein köstliches Abendessen auf. Der ungewohnte Alkohol und das reichhaltige Mahl taten bald ihre Wirkung. Meine Augenlider wurden schwer, und ich unterdrückte ein Gähnen.
Caitlynn bemerkte es und erhob sich: »Es war ein langer Tag. Möchtest du, dass ich dir dein Zimmer zeige?«
Iain stand ebenfalls auf und verabschiedete sich damit, dass er noch ein paar Dinge zu erledigen habe. Kurz bevor er die Tür erreicht hatte, drehte er sich noch einmal um und sagte etwas auf Gälisch.
Ich verstand nicht alles, denn sein Dialekt klang fremd in meinen Ohren, aber es hörte sich an, als habe er Caitlynn mitgeteilt, dass sie in seinen Augen ebenfalls äußerst bettreif wirkte. Die Männer an der Bar lachten und zwinkerten ihm zu. Der leichten Röte nach zu urteilen, die ihre helle Haut überzog, hatte ich ihn richtig verstanden.
»Ich habe dir hier im Hauptgebäude ein Zimmer vorbereiten lassen«, sagte sie entschuldigend und ging mir voraus eine steile Treppe hinauf. »Es hat eine Kochnische, komplett mit Kühlschrank. Damit bist du unabhängig. Unser Wohnhaus ist leider noch nicht vollständig renoviert. Wahrscheinlich wird es niemals fertig«, fügte sie mit einem Blick an die Zimmerdecke hinzu. »Reparaturarbeiten können in den Highlands erschreckend langsam vonstattengehen, wenn man nicht bei jeder Gelegenheit selbst Hand anlegt. Momentan haben wir drüben nicht einmal warmes Wasser.«
»Wirklich?« Bei dem Gedanken an die zahllosen eisigen Duschbäder, die wir während unserer gemeinsamen Schulzeit hatten ertragen müssen, schüttelte es mich. »Du hast also nicht vergessen, dass ich für eine heiße Dusche jederzeit bereit wäre, ein Verbrechen zu begehen.«
»O nein, ich erinnere mich daran, du Nixe. Irgendwie hast du es meistens geschafft, den Eisbädern zu entgehen.« Sie umarmte mich fest. »Ich freue mich so sehr, dass du gekommen bist. Du wirst sehen, wir werden viel Spaß haben, und dein unwürdiger Verlobter ist bald Geschichte.« Sie schloss eine Zimmertür auf und drückt mir den Schlüssel in die Hand.
»Schön wär’s.«
»Gute Nacht. Wir sehen uns morgen zum Frühstück.« Damit wirbelte sie herum, und kurz darauf hörte ich sie summend die Treppe hinabhopsen – zweifellos voller Vorfreude auf eine gemeinsame Nacht mit ihrem Freund, dachte ich ein wenig neidisch.
Das Zimmer war wunderbar. Ein Teppichboden mit Tartanmuster mochte gewöhnungsbedürftig sein, doch mir gefiel er, und das breite Himmelbett wirkte sehr einladend. Die angekündigte Teeküche befand sich in einer Nische und fiel kaum auf, weil sich der gesamte Raum an einer Gebäudeecke befand und L-förmig geschnitten war. Vor einem Fenster stand ein kleiner Tisch mit zwei antiken Stühlen, an dem ich schreiben, aber auch essen konnte. Das Bad war äußerst luxuriös. Hier fühlte ich mich sofort wohl.
Das Wichtigste war bald ausgepackt, und ich hatte mich nach einer heißen Dusche in das gemütliche Bett gekuschelt, als mir einfiel, dass meine Handtasche noch auf dem Sofa im Pub lag. Also würde ich wohl oder übel noch einmal hinuntergehen müssen. Rasch stieg ich aus dem Bett und lauschte. Es war nach Mitternacht, und die letzten Gäste waren inzwischen fort. Sollte ich dennoch jemandem begegnen, würde der bestimmt glauben, das hauseigene Gespenst zu sehen, dachte ich erheitert und tappte auf bloßen Füßen zur Zimmertür. Im kaum beleuchteten Gang war niemand zu sehen, irgendwo tickte eine Uhr. Behutsam zog ich die Tür hinter mir zu und ging zur Treppe. Plötzlich bewegte sich etwas hinter mir. Mein Herz tat einen Sprung, ich drehte mich um, machte einen Schritt zurück und – trat ins Leere. »O nein.«
Kräftige Arme umfingen mich und hinderten mich daran, rücklings die Treppe hinabzufallen. Mein Puls raste noch schneller, als ich in die Augen desselben Mannes sah, der mich schon am Bahnsteig vor einem Sturz bewahrt hatte. Wenn er jetzt eine dumme Bemerkung macht, fange ich an zu schreien.
Vielleicht hatte mein Retter mir angesehen, dass ich nicht zu Späßen aufgelegt war. Jedenfalls verzichtete er darauf, mich zusätzlich durch humorige Bemerkungen zu demütigen. Allerdings ließ er mich auch nicht los, und so spürte ich die Wärme seines festen, kräftigen Körpers beunruhigend deutlich durch mein Nachthemd. Vergeblich versuchte ich mir weiszumachen, dass das Prickeln auf meiner Haut die Folge der heißen Dusche war. Um wieder zu Verstand zu kommen, schloss ich kurz die Augen. Ein Fehler, denn sofort übernahmen die anderen Sinne deren Aufgabe. Er roch nach wilder Heide, dunklem Harz und nach … Mann.
Ich hätte dahinschmelzen können. Doch stattdessen zwang ich mich, ihn anzusehen. »Sie können mich jetzt wieder loslassen, die Gefahr ist vorüber«, sagte ich, konnte jedoch nicht verhindern, dass es mehr nach verführerischem Gurren als nach einer sachlichen Aufforderung klang.
»Ich glaube, es wird erst jetzt richtig gefährlich.« Einen Augenblick lang dachte ich, er wollte mich küssen.
O ja. Bitte, nur ein winziger Kuss, bettelte meine Libido, und ich wusste, wohin das führen würde. Dennoch war ich geneigt, ihrem Flehen nachzugeben. Seine Berührung fühlte sich einfach zu verlockend und merkwürdigerweise irgendwie vertraut an.
Doch statt sinnlicher Hingabe verdunkelte ein Schatten sein Gesicht. »Ich habe schon einmal gesagt, Sie sollten besser Acht geben, wohin Sie treten.« Er drehte sich um und ging über den Flur davon.
Rüpel. Ich konnte dem Impuls nicht widerstehen, ihm die Zunge herauszustrecken, bevor ich mit zitternden Knien die Treppe hinablief, um meine Tasche zu holen.
Am nächsten Morgen wurde ich von warmen Sonnenstrahlen auf meinem Gesicht geweckt. Seit Monaten fand ich nachts kaum Ruhe und wachte morgens ebenso erschöpft auf, wie ich abends ins Bett gefallen war. Und auch heute war mein Bett zerwühlt, als hätte darin ein Kampf stattgefunden. Das Kissen lag auf dem Boden, und mein Flanellnachthemd, dessen flauschige Wärme mir als Seelentröster diente, hatte sich wie eine Würgeschlange um mich herumgewickelt. Dennoch war irgendetwas anders. Orientierungslos blickte ich mich um. Ein Schatten der Erinnerung verharrte kurz in meinem Kopf, bevor er unwiederbringlich davonschwebte und eine eigenartige Leere hinterließ.
Was mir blieb, war der Duft der Heide, von dem umfangen ich, in die Arme des geheimnisvollen Fremden geschmiegt, eingeschlafen war. Es heißt, die Träume der ersten Nacht in einem neuen Zuhause gingen in Erfüllung. Ob dies auch für Hotelzimmer galt?
Doch es würde keine Gelegenheit geben herauszufinden, ob an diesem Volksglaube etwas dran war, denn ich hatte vorerst die Nase von Männern voll, selbst wenn sie so fantastisch aussahen wie mein geheimnisvoller Retter. Ganz besonders dann, bestärkte ich mich noch einmal in meinem guten Vorsatz und stieg aus dem Bett.
Es war schon spät, als ich endlich so weit war, mein Zimmer zu verlassen, und so hatte ich den Frühstücksraum im Erdgeschoss fast für mich allein. Er befand sich auf der Rückseite des Gebäudes und war in sanften Farben geschmackvoll eingerichtet. Natürlich durfte auch hier das obligatorische Tartan-Karo nicht fehlen, aber es zierte nur dezent die Stuhlkissen und Sets auf den Tischen. Der Raum strahlte einen ebenso heiteren ländlichen Charme aus wie das Zimmer, das nun für viele Wochen mein neues Zuhause sein würde. Caitlynns gestalterisches Talent war in zahllosen Details zu erkennen. Ich konnte mir gut vorstellen, wie lange sie gebraucht hatte, um das Geschirr auszusuchen oder die geschmackvolle Beleuchtung. Es war wunderbar, dass sie mit Iain offensichtlich einen geeigneten Partner gefunden hatte, mit dem sie ihren langgehegten Traum von einem gastlichen Haus wahrmachen konnte. Dank ihres Talents hatte sie nach dem Studium schnell einen gut bezahlten Job gefunden. Schon immer war es ihre Leidenschaft gewesen, Häuser einzurichten, und es gab viele Menschen, die sich ein repräsentatives Heim eine Menge kosten ließen. Nun investierte sie in ihr eigenes Zuhause.
Zum Estate gehörten auch Cottages, die sie nacheinander restaurieren und neu einrichten wollte. Sie selbst wohnte mit Iain im alten Verwalterhaus, das von außen bereits großartig aussah. Aus meinem Fenster hatte ich vorhin allerdings eine kleine Armada von Handwerker-Fahrzeugen gesehen. Sie hatte offenbar nicht damit übertrieben, dass es dort noch eine Menge zu tun gab.
In der Ferne glitzerte das Meer, und auf einmal wusste ich, dass es die richtige Entscheidung gewesen war, hierher zu kommen. Große Fenster erlaubten einen weiten Blick über die herrliche Landschaft. Noch war das Gras der Wiesen vom langen Winter braun, aber einen Hauch von Grün konnte ich bereits entdecken. Ich suchte mir einen sonnigen Platz und setzte mich.
Erst jetzt bemerkte ich Iain, der in der Tür zur Küche stand und mir freundlich zunickte, bevor er sich weiter leise mit einem Mann unterhielt, der in eine Art unordentlichen Kilt gewickelt war. Fasziniert beobachtete ich, wie Tröpfchen des Breis, den er aus einer Schale löffelte, in seinem Bart glitzerten. Er fuchtelte mit dem Löffel in der Luft herum, um seinen Worten besonderen Nachdruck zu verleihen, und warf mit einer ungeduldigen Kopfbewegung sein Haar über die Schulter zurück.
»Das ist Angus. Er kann einem Angst machen, nicht wahr? Die Leute hier nennen ihn den Pferdemagier, und glaube mir, er vollbringt wahre Wunder«, flüsterte Caitlynn mir zu, bevor sie sich setzte. »Guten Morgen.« Sie musterte mich anerkennend: »Aus dir ist eine richtige Lady geworden. Ich kann mich nicht erinnern, dich je in solch feinem Zwirn gesehen zu haben. Dann stimmt es also – die reiche Erbin darf ihr Geld jetzt selbst ausgeben?«
Plötzlich war mir mein offensichtlicher Wohlstand furchtbar peinlich. Caitlynns Familie war arm, und sie hatte das teure irische Klosterinternat, in dem wir uns kennengelernt hatten, nur besuchen dürfen, weil dort auch Kinder aus der unmittelbaren Nachbarschaft unterrichtet wurden. Ein Stipendium hatte ihr später ermöglicht, in London zu studieren. Erbarmungslos fuhr sie mit ihrer Inspektion fort: »Und eine nette Figur hast du bekommen, du treibst doch nicht etwa Sport?« Lachend langte sie über den Tisch und zog an einer dicken Strähne, die sich schon wieder aus meinem Zopf gelöst hatte. Meine dunklen Haare waren viel zu glatt und schwer, um frisierbar zu sein. »Aber gut, dass sich an deiner Frisur nichts geändert hat. Du wärst ja sonst schon nahezu unheimlich makellos.«
Waren ihr die dunklen Ringe unter den Augen und meine viel zu knochigen Schultern entgangen? Offenbar will sie mich aufmuntern, dachte ich und versuchte ein Lächeln. Dabei traten mir aber Tränen in die Augen, denn ich musste daran denken, wie mich mein Ex mehr als einmal am Haar gepackt und gegen die Wand geschleudert hatte, wenn ihm – wie so oft – etwas nicht gefiel. Meine wenigen Freunde hatte nicht bemerkt, wie ich direkt vor ihren Augen ganz allmählich Stolz und Selbstachtung verloren hatte. Ich galt schon immer als wunderlich, und wahrscheinlich beneideten die meisten Frauen mich sogar um meinen Freund, der sich in der Öffentlichkeit charmant und fürsorglich gab.
Gerade noch rechtzeitig hatte ich begriffen, was mit mir geschah. Und ich hatte mich entschieden zu fliehen – mehrmals. Aber jedes Mal war er mir gefolgt und hatte mit Engelszungen auf mich eingeredet, ich möge doch zu ihm zurückkehren, er habe es nicht so gemeint, und überhaupt liebe er mich doch. Was er liebte, war zweifellos mein Geld. Ich war ihm vollkommen gleichgültig. Das hatte ich ihn selbst sagen hören.
Dieses Mal war meine Entscheidung endgültig. Ich würde nicht mehr zurückkehren, bevor ich mit mir selbst ins Reine gekommen war. Das hatte ich mir geschworen, und die einzige, die mir helfen würde, bei meiner Entscheidung zu bleiben, war Caitlynn. Meine Freundin pflegte eine sehr pragmatische Einstellung zu Männern und hatte mir einmal geraten: Ab und zu musst du eine emotionale Kosten-Nutzen-Bilanz ziehen. Wenn du ins Minus rutschst, ist es höchste Zeit zu gehen. Ich hätte schon viel früher auf ihren Rat hören sollen.
Caitlynn bemerkte meinen Stimmungsumschwung und lenkte ab: »Hast du etwas Schönes geträumt?«
Die Erinnerung an meine romantischen Fantasien sandte eine heiße Welle der Verlegenheit durch meinen Körper.
Caitlynn grinste, als wisse sie genau, was in mir vorging. Misstrauisch blickte ich sie an. Mit den roten Haaren, die ihr Gesicht wie Flammen umzüngelten, sah sie nicht nur aus wie eine wilde irische Fee, sie besaß manchmal tatsächlich eine erstaunliche Intuition, wie man sie den Wesen aus der Anderswelt nachsagte. Von der gestrigen Begegnung mit dem Unbekannten konnte sie jedoch auf keinen Fall etwas wissen, beruhigte ich mich und schwieg.
Nach dem Frühstück führte sie mich stolz durch ihr Hotel.
Ich fand es wunderbar und sagte ihr das auch.
»Ohne Iain wären wir noch längst nicht so weit. Er ist unglaublich geduldig und versteht sich wie kein anderer auf alte Handwerkstechniken.« Sie zeigte auf eine Sammlung alter Schwerter und lachte. »Und wehrhaft ist er auch. Ganz zu schweigen natürlich von seinen anderen Qualitäten.« Dazu machte sie alberne Kussgeräusche und lachte zwischendurch wie ein Kobold.
Irgendwo im Haus schlug eine Uhr, und Caitlynn wurde wieder ernst. »So spät schon.« Eilig erklärte sie mir, wie ich zu den Pferden gelangte. »Eigentlich wollte ich dich begleiten, aber wir bekommen heute Getränke geliefert. Darauf muss eine gute Wirtin ein Auge haben. Kommst du allein zurecht?« Ich versicherte ihr, dass ich auf dem kurzen Stück zum Pferdestall, dessen Dach ich vom Frühstückszimmer aus hinter einem flachen Hügel gesehen hatte, bestimmt nicht verloren gehen würde.
Im Davonlaufen rief sie mir noch über die Schulter zu:
»Wenn du Angus triffst, sprich bloß kein Englisch mit ihm.« Dann war sie verschwunden, und ich folgte wenig später dem breiten Spazierweg, der zwischen den Koppeln hindurchführte. Mein erster Eindruck hatte mich nicht getäuscht.
Es würde noch einige Wochen dauern, bis die Pferde erstmals das Gras in diesem Jahr genießen durften.
Während ich meine Lungen mit frischer Meeresluft füllte und über ihre seltsame Bemerkung nachdachte, tauchte hinter der nächsten Biegung der Stall auf. Die Tiere konnten frei entscheiden, ob sie sich innen oder auf dem großzügigen Auslauf vor dem Gebäude aufhalten wollten. Caitlynn hatte mir geschrieben, dass sie anfangs von Iains Vorschlag, sie in einem offenen Stall zu halten, nicht begeistert gewesen war. Sie hatte zu bedenken gegeben, dass die Pferde im Winter ein dichteres Fell bekämen und die Gäste keine Lust haben würden, auf solche wilden Biester zu steigen. Ein Irrtum, wie sich schnell herausgestellt hatte. Die Reittouristen waren entzückt, und bald hieß es, dass man hier die besten Highland Ponys fand, die ganz Schottland zu bieten hatte. Sogar im Winter hatten sich immer wieder genügend Reiter für Ausflüge in die Highlands angemeldet, die natürlich im Sithean Inn übernachteten und auch die kulinarischen Angebote des Pubs zu schätzen wussten. Die kleine Herde döste so friedlich in der blassen Mittagssonne, dass ich unwillkürlich lächelte. Tiere hatten oft diese beruhigende Wirkung auf mich. Ich zählte zwei Fuchstuten mit ihren Fohlen, fünf Braune, einen Rappen und einen Schimmel. Ausgerechnet der ging – wie sollte es anders sein – in die Knie, um sich genüsslich im Sand zu wälzen. Von dieser Rasse hatte ich bisher nur gehört. Zunächst erinnerten mich die struppigen Kreaturen an Islandpferde. Diese Schotten waren zwar etwas größer, besaßen jedoch, genau wie ihre isländischen Verwandten, einen kompakten Körperbau, eine wundervoll üppige Mähne und – das sagte man ihnen zumindest nach – einen äußerst freundlichen Charakter. Letzteres gedachte ich so schnell wie möglich herauszufinden, denn ich liebte Pferde und ritt, seitdem ich denken konnte.
Als ich mich dem hölzernen Gatter näherte, ertönte ein lautes Wiehern, und der schönste Rappe, den ich je gesehen hatte, kam über eine angrenzende Wiese galoppiert. Als sich unsere Blicke trafen, stemmte er die Hufe in den weichen Boden, schlidderte ein wenig und warf den Kopf hoch. Wäre es nicht vollkommen unmöglich gewesen, hätte ich schwören können, dass er mich erkannte.
Was ist mit dir?
Seine Antwort war ein Schnauben und er starrte hochmütig herüber, als wolle er den Zweibeiner mit dem starren Blick hinter seinem Zaun erst einmal taxieren. Dann hatte er sich offenbar entschieden und kam mit langem Hals auf mich zu.
»Hallo, mein Schöner. Du hast sicher das hier gerochen?« Einladend streckte ich ihm auf der flachen Hand einen Apfel entgegen, den ich beim Frühstück vorsorglich eingesteckt hatte.
Behutsam nahm er den Leckerbissen zwischen seine großen Zähne. In diesem Augenblick schien die Zeit stehen zu bleiben. Wir kannten uns, waren Freunde, Verbündete. Ein Traum …
»Er mag dich.« Die Stimme neben mir klang überrascht. Ich war es bestimmt, als der Mann, den ich vorhin im Gespräch mit Iain gesehen hatte, so plötzlich an meiner Seite auftauchte. Das musste Angus sein. Schnell fasste ich mich. Dia dhuit. Grüß Gott.«
»Hallo.« Lachend zeigte er eine breite Zahnlücke. »Ich sehe, Caitlynn hat dich gewarnt«, sagte er mit dem typisch rollenden schottischen Akzent, aber in bestem Englisch. »Sie hat mir erzählt, dass du ihre Sprache gelernt hast, drüben auf der Insel. Aber Irisch ist anders als unser Gälisch. Wir sagen hier Latha math, guten Tag.« Er zeigte auf meinen neuen Freund. »Aber sag, was hältst du von Brandubh?«
Weil ich nicht wusste, wie ich ihm die eigenartige Vertrautheit erklären sollte, die mich mit dem Pferd zu verbinden schien, stieg ich wortlos durch den Holzzaun in die Koppel.
Angus sog scharf die Luft ein, doch ich achtete nicht auf ihn. Der Rappe hatte den Apfel inzwischen aufgefressen. Aufmerksam sah er mich an und bewegte sich nicht. Nach einer Weile senkte er den Kopf, streckte den Hals ganz lang und schnüffelte an meiner Hosentasche.
Ich strich über sein samtiges Ohr und flüsterte: »Verrat mir dein Geheimnis, du schwarzer Teufel.«
Er hob den Kopf wieder, sah mich mit intelligent blickenden Augen an, schnaubte und schien dabei zu nicken.
»Bemerkenswert«, murmelte Angus.
Als ich wieder auf seine Seite des Gatters zurückkehrte, wieherte das Pferd auffordernd, kam aber nicht näher. Angus´ Frage hing noch in der Luft, und so sagte ich schließlich:
»Erst habe ich gedacht, er könnte spanischer Abstammung sein, aber mit diesen kleinen, festen Hufen und seiner Nase ist es wahrscheinlicher, dass er eine Kreuzung aus Berber-Vollblut und einer einheimischen Rasse ist.«
»Sehr gut.« Angus klopfte mir auf die Schulter. »Du hast echten Pferdeverstand. Möchtest du gemeinsam mit mir an ihm arbeiten?«
Und ob ich Lust hatte. »Was fehlt ihm denn?«, fragte ich dennoch vorsichtig.
»Nichts.« Die Antwort kam blitzschnell.
Das allein sagte schon eine Menge aus. Die tiefen Linien, die sich um Angus’ Mund gebildet hatten, verrieten mir noch mehr. Ich schloss kurz die Augen und versuchte tief in mich hineinzufühlen, diese Ebene zu erreichen, die ich bereits vor vielen Jahren endgültig verschlossen hatte. »Er ist misshandelt worden.« Ich konnte die Schläge spüren, die das Tier hatte ertragen müssen, als hätten sie mir gegolten.
»Sir Iain hat ihn mitgebracht. Ich soll ihn wieder in Ordnung bringen, hat er gesagt.« Angus verstummte und schien seinen Gedanken nachzuhängen. Plötzlich blies er die Atemluft geräuschvoll aus und klang dabei nicht viel anders als eines der Pferde. »Er ist sonst wirklich in Ordnung.«
Ganz sicher war ich nicht, ob er das Pferd oder Sir Iain meinte. Doch das war mir auch gleich. Hier war sie, die Herausforderung, die sinnvolle Aufgabe, nach der sich ein Teil von mir schon so lange gesehnt hatte. Ohne weiter zu überlegen, sagte ich zu.
»Dann pass gut auf, Mädchen.« Angus wechselte ins Gälische, als wäre es selbstverständlich, dass ich ihn verstehen müsste, und stieg zwischen den Holzbalken hindurch in das Gatter. »Siehst du den Zirkel, den wir dort aufgebaut haben?« Er winkte mir zu. »Komm herein, komm herein. Ich möchte sehen, ob es dir gelingt, Brandubh dort hineinzubringen.«
Zuversichtlich, dass das Pferd mir vertrauen würde wie beim ersten Mal, lockte ich mit leiser Stimme: »Komm, mein Schöner. Lass uns spielen …«
Ob es an meiner Stimme lag oder an der selbstbewussteren Körperhaltung, konnte ich nicht sagen. Brandubh jedenfalls hob den Kopf und sah mich einen Augenblick lang zweifelnd an. Plötzlich wieherte er laut, machte auf der Hinterhand kehrt und galoppierte den Hügel hinab. Weiter unten warf er sich herum und sah zu uns hinauf. Wäre er ein Hund gewesen, ich hätte es als Spielaufforderung verstanden, doch bei einem Fluchttier bedeutete dieses Verhalten etwas anderes. Fragend sah ich zu Angus, der nur mit den Schultern zuckte, als wollte er sagen: »So ist er eben.«
»Und nun?«, fragte ich ein wenig hilflos.
»Wenn du ihn im Zirkel hast, machen wir weiter.«
Damit ließ auch er mich stehen, und ich kam mir ziemlich blöd vor.
Es kostete mich einen Monatsvorrat Äpfel und mehr Geduld, als ich jemals für möglich gehalten hatte, bis ich nach fünf Tagen endlich so weit war, dass Brandubh mir bis zum Trainingszirkel folgte. Gerade als ich vorweggehen wollte, um ihn hereinzulocken, gab es einen fürchterlichen Knall, und weg war er. »Verdammte Idioten!«, brüllte ich den beiden Militärjets hinterher, die grollend in den Wolken über dem Meer verschwanden.
Brandubh war nicht mehr zu sehen, aber ich hatte das Gefühl, dass er mich aus dem Wäldchen heraus beobachtete, an dessen Saum er häufig Zuflucht suchte. Gut sichtbar legte ich einen Apfel in den Kreis und ging fort, ohne mich noch einmal umzudrehen. Dabei wäre ich vor Neugier beinahe geplatzt: Würde er kommen und sich die Leckerei holen?
Am nächsten Tag war sie jedenfalls fort, und ich nahm dies als gutes Zeichen. Und tatsächlich gelang es mir heute, den Hengst hereinzulocken. Er fraß seine Belohnung und ließ sich sogar von mir an der Stirn streicheln. Damit sollte es für den Anfang genug sein. »Wir haben Zuschauer«, raunte ich ihm zu. Aus dem Augenwinkel hatte ich den dunklen Fremden gesehen, der sich, ebenso wie Brandubh, allnächtlich in meine Träume schlich.
Seit unserer Begegnung zur Geisterstunde hatte ich ihn nicht mehr getroffen. Allerdings konnte ich ihn einmal von Weitem dabei beobachten, wie er heftig gestikulierend mit Iain sprach. Nun schien er mich zu beobachten.
Erwartungsvoll drehte ich mich um und sah gerade noch, dass er den Weg zum Sithean Inn einschlug. Kurz darauf war er hinter einer Biegung verschwunden.
»Er ist neugierig.«
Vor Schreck machte ich einen Satz nach hinten, stolperte und landete direkt vor Brandubhs Hufen. Er schnaubte und stupste mich mit seinem weichen Maul an, als wollte er fragen, ob mit mir alles in Ordnung sei.
»Tha mi duilich. Tut mir leid.« Angus’ Lachen widersprach seinen Worten, aber immerhin reichte er mir die Hand. »Ich wollte dich nicht erschrecken.« Nachdem er mich auf die Beine gezogen hatte, was das Pferd übrigens interessiert zu beobachten schien, wurde er ernst. »Du hast sein Interesse geweckt. Sehr gut. Pass auf, jetzt werde ich dir zeigen, wie er lernt, dich zu respektieren.«
Bei Angus wusste ich nie so genau, wie er die Dinge meinte. Ich hätte schwören können, dass er von meinem fremden Retter gesprochen hatte. Aber das war natürlich pure Einbildung, ich war weit davon entfernt, sein schottisches Gälisch wirklich verstehen zu können. Außerdem konnte er nichts über meine merkwürdige Begegnung wissen, denn ich hatte überhaupt niemandem davon erzählt.
Und hätte er doch den Fremden gemeint – warum sollte mir daran gelegen sein, dass der mich respektierte? Eine kleine Stimme in meinem Inneren allerdings verlangte genau dies von mir. Bisher hatte ich mich während der kurzen Begegnungen von meiner schlechtesten Seite gezeigt, und ich hätte meinem unfreiwilligen Retter gern bewiesen, dass ich nicht immer ungeschickt und zickig war.
»Mädchen, träum nicht. Sieh her.« Angus stand nun in der Mitte des Zirkels, der Zugang war verschlossen, und Brandubh trat verunsichert von einem Huf auf den anderen, als ahnte er bereits, dass etwas Unangenehmes kommen würde.
Gespannt ging ich näher an den Zaun heran und hielt den Atem an, als der sonst so sanftmütige Schotte den Hengst plötzlich aggressiv mit einer Longe antrieb, bis er im Kreis galoppierte.
Was hatte Angus bloß vor? Wollte er etwa die Arbeit von Tagen zunichtemachen, indem er ihn wieder scheu machte? Das Pferd rollte mit den Augen und schlug nach hinten aus, als es mich passierte. Ehe ich etwas sagen konnte, winkte Angus mich zu sich heran. Nur widerwillig ging ich zu ihm, aber ich musste wissen, was er vorhatte.
Damit, dass er mir die Longe in die Hand drücken und mich auffordern würde, es ihm nachzumachen, hatte ich nicht gerechnet. »Vertrau mir«, sagte er leise, und ich folgte seinen Anweisungen. Bald wurde klar, dass Brandubh das Spiel satthatte, aber wieder und wieder trieb ich ihn auf Angus’ Anweisung hin an, bis die Flanken des Tiers feucht wurden und ich vor Mitleid beinahe zerschmolz. Anfangs hatte er noch unwillig die Mähne geschüttelt, nun senkte er den Kopf, drehte die Ohren in meine Richtung und kaute.
»Jetzt lass ihn machen, was er will.«
Erleichtert zog ich die Longe ein. Ich rechnete fest damit, dass das Pferd seinen Abstand zu mir beibehalten würde. Doch stattdessen kam es mit ruhigen Schritten direkt auf mich zu.
»Arme an den Körper, sieh ihn nicht an«, erinnerte mich Angus, der unauffällig zum Tor gegangen war, um es zu öffnen und sich nun oben auf den Zaun setzte.
Ich vermied den Blickkontakt mit dem Hengst, stellte mich ein wenig seitlich und hatte Mühe, meine Überraschung zu verbergen, als Brandubh den Kopf an meiner Schulter rieb. Behutsam streckte ich die Hand aus und streichelte ihn an der Stirn. Er dankte es mir mit einem liebevollen Stups.
Von diesem Augenblick an wich mir das Pferd kaum noch von der Seite. Egal, ob ich Schlangenlinien ging, lief oder gemütlich mit ihm über die Wiese spazierte, er blieb immer in meiner Nähe, spitzte die Ohren und beobachtete genau, was ich als Nächstes tun würde. Natürlich gab es Rückschläge. Er kannte Sattel und Zaumzeug, verband damit aber offenbar negative Erlebnisse. Wir mussten behutsam vorgehen, um ihn nicht erneut zu verunsichern.
Irgendwann fragte ich Angus, warum es so wichtig gewesen war, dass ich Brandubh in den Zirkel gelockt hatte.
»Du hast dabei gelernt, das Pferd zu beobachten und seine Körpersprache besser kennenzulernen.«
Das stimmte. Seit jenem Tag hockten wir oft stundenlang einfach nur auf dem Zaun und beobachteten die Tiere. Angus gab mir viele wichtige Hinweise, und bald hatte ich nicht nur das Gefühl, mit den Pferden sprechen zu können, mir gelang es auch immer besser, mich mit meinem schottischen Pferdemenschen in Gàidhlig, seiner gälischen Muttersprache, zu verständigen.
»Hast du gewusst, dass Johanna und Angus den Hengst trainieren?«, fragte Iain unvermittelt, als wir an einem Samstagabend zu dritt im Pub saßen.
Caitlynn nickte und lächelte.
Leider verbrachten wir zu wenig Zeit miteinander, denn es gab am Haus viel zu tun, und die Saison musste vorbereitet werden. Auch jetzt behielt sie das Geschehen an der Bar im Auge, um rechtzeitig eingreifen zu können, falls der Barkeeper ihre Hilfe benötigte.
Natürlich hatte ich ihr meine Unterstützung angeboten, aber davon wollte sie nichts hören. »Du bist hier, um dich zu erholen.«
Von meiner Beschäftigung mit Brandubh hatte ich ihr in einer der wenigen gemeinsam verbrachten Stunden erzählt. Schon allein, um den schnell schrumpfenden Vorrat an frischen Äpfeln zu erklären und ihren Koch zu entlasten, der mir freundlicherweise freien Zugang zu seiner Speisekammer gewährte. An manchen Tagen war sie auch vorbeigekommen und hatte uns kurz bei der Arbeit zugesehen.
»Kommt ihr voran?«, fragte sie nun.
»Ja, morgen werde ich versuchen, ihn zum ersten Mal zu reiten. Warum fragst du?«
»Wenn dir das gelingt, hast du gleich zwei Widerspenstige gezähmt«, lachte sie. »Der Highlander hat noch nie mit jemandem zusammengearbeitet, und dieses Pferd – es ist völlig verrückt. Im Winter hätte es den Stalljungen beinahe totgetrampelt.«
Iain berührte kurz meine Hand. »Johanna, du hast ein Wunder vollbracht.«
Die freundliche Art, mit der mir die Leute hier begegneten, tat unglaublich gut.
In Hamburg hatte mein Freund immer nur an mir herumgenörgelt. Exfreund, korrigierte ich mich rasch. Ich sei nicht elegant, hatte er behauptet, mir mangele es an Durchsetzungsvermögen und Talent, sonst wäre ich in meinem Job als Journalistin längst erfolgreicher. Und vielleicht war sogar etwas dran, denn viel mehr als Berichte über das jährliche Treffen des örtlichen Kanarienvogelzüchtervereins und langweilige Ratssitzungen traute mir mein Redaktionschef auch nach einem Jahr selten zu.
Im April, kurz bevor die Saison richtig begann, überredete ich Caitlynn, mit mir nach Glasgow zu fahren. Ich wollte mich dafür erkenntlich zeigen, dass sie und Iain mich so herzlich aufgenommen hatten, und außerdem musste ich ein paar geschäftliche Dinge mit meinem Anwalt regeln, dem ich nicht zumuten wollte, in die Highlands zu reisen. Nein, das stimmte nicht ganz. Er gehörte zwar zu den wenigen Menschen aus meinen alten Leben denen ich vertraute, dennoch hätte seine Anwesenheit das glückliche Leben, das ich im Sithean Inn führte, mit schlechten Erinnerungen besudelt. In Glasgow besaß seine Sozietät eine Niederlassung. Näher wollte ich die Vergangenheit nicht an mich heranlassen.
Zuerst war die quirlige Stadt ein Schock. Zu viele Menschen, zu laut, und ein Dialekt, der mich daran zweifeln ließ, jemals Englisch gesprochen zu haben.
»Die Glaswegians sind sehr stolz darauf, ein bisschen anders zu sein als der Rest Schottlands«, erklärte Caitlynn lachend, die ebenso wie ich ihre Schwierigkeiten hatte, die Bewohner dieser Stadt zu verstehen.
In unserem Hotel am George Square, das ich als kleines Dankeschön für die Gastfreundschaft meiner Freunde ausgesucht hatte, gab man sich allerdings weltoffen und britisch, und wir genossen den Luxus einer eleganten Suite nebst höflicher Zuvorkommenheit des Personals.
Am ersten Tag kauften wir ein, bis meine Kreditkarte glühte. Neben London gilt Glasgow als die modischste Stadt in Großbritannien, und viele Designer unterhalten hier elegante Geschäfte. Es gelang mir, Caitlynn zu überreden, einige Dessous zu erstehen, die Iain rote Ohren bescheren würden, und im Gegenzug ließ ich mich von ihr überzeugen, Kleidung zu kaufen, die besser für die Herausforderungen des schottischen Wetters geeignet waren als alles, was ich eingepackt hatte. »Du bleibst noch eine Weile«, ordnete sie an, und ich widersprach nicht. Die Wunden in meiner Seele schlossen sich allmählich, aber ich hatte längst noch keine Lust, die Highlands zu verlassen. Im Gegenteil – mit meinem Anwalt hatte ich sogar über die Möglichkeit gesprochen, in der Nähe meiner Freunde ein Haus zu kaufen, und er hatte versprochen, sich dezent umzuhören.
»Very british, my dear«, kommentierte Caitlynn meine eher konservative Wahl an Alltagskleidung irgendwo zwischen Landadel und hanseatischem Understatement. Ich konnte halt doch nicht völlig aus meiner Haut.
Am ersten Abend gingen wir ins Kino, am zweiten besuchten wir das Konzert einer berühmten Band, die sich, wie die meisten bekannten Musiker, darum zu reißen schien, in dieser lebensfrohen Stadt aufzutreten. Anschließend gingen wir in einem Restaurant essen, das die Sekretärin meines Anwalts empfohlen hatte. Nachdem ich die Vorspeise gekostet hatte, beschloss ich spontan, ihr zum Dank für diesen Tipp am nächsten Tag einen Blumenstrauß zu schicken.
Wir aßen gerade den wahrscheinlich köstlichsten Lachs, den ich je probiert hatte, da betraten einige Männer das Restaurant, die dieses gewisse Flair von Reichtum und Erfolg umgab. Sie sahen sich um und musterten die Gäste, als wollten sie sichergehen, sich in angemessener Gesellschaft zu befinden, bis sie von jemandem, der wie der Restaurantbesitzer aussah, höflich begrüßt und an ihren Tisch begleitet wurden. Unangenehm an meine Vergangenheit erinnert, vermied ich jeden Blickkontakt und aß weiter.
Caitlynn dagegen musterte die Neuankömmlinge interessiert und pfiff dabei leise durch die Zähne. »Allein für diesen Anblick hat sich die Fahrt nach Glasgow schon gelohnt«, flüsterte sie mir zu.
Meine Neugier gewann die Oberhand. Ich schaute noch einmal auf und sah gerade noch einen Nachzügler auf den Durchgang zu einem Nebenraum zusteuern, in dem seine Freunde verschwunden waren. Ganz kurz trafen sich unsere Blicke, und für einen Augenblick hätte ich schwören können, meinen geheimnisvollen Retter zu erkennen. Er verlangsamte seine Schritte, als hätte er mich ebenfalls erkannt. Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt gewesen, um meine Vermutung zu überprüfen. Doch ich sah schnell beiseite. Nur das Klopfen meines Herzens, das ich bin in den Hals hinauf zu spüren glaubte, verriet meine Aufregung.
»Sag mal«, fragte ich Caitlynn, nachdem ein großer Schluck Wein meine Nerven wieder beruhigt hatte. »Wer ist eigentlich dieser dunkelhaarige Typ?«
»Bitte?« Verwirrt sah sie mich an.
Ihre Reaktion war verständlich, und mir tat es schon wieder leid, sie überhaupt darauf angesprochen zu haben.
Doch Caitlynn wäre nicht meine Freundin gewesen, wenn sie nicht eine Erklärung verlangt hätte. »Welcher Typ?«
»Er ist am gleichen Tag wie ich angereist, und ein paar Mal habe ich ihn in der Nähe der Pferde gesehen.« Als ich kein Erkennen in ihrer Miene sah, fügte ich lahm hinzu: »Mit Iain hat er auch gesprochen.«
Caitlynn schien etwas im Auge zu haben, denn sie rieb einige Male darüber, bevor ein freches Grinsen ihre Sommersprossen zum Leuchten zu bringen schien. »Ich habe keine Ahnung, von wem du sprichst. Warum fragst du ihn nicht selbst, wenn er dir das nächste Mal über den Weg läuft?«
Ich war bereits drauf und dran, ihr von den merkwürdigen Begegnungen mit meinem geheimnisvollen Retter zu erzählen, da kam der Kellner mit dem Hauptgang. Caitlynn schwor nach dem ersten Bissen, ihren Koch hierher in die Schule schicken zu wollen. Sie aß, trank und plauderte, und schließlich gab ich mein Vorhaben auf. In den letzten Wochen hatte ich den Mann ohnehin nicht mehr gesehen, und die Götter hätten bezeugen können, dass ich mir beinahe den Hals ausgerenkt hatte, um noch einmal einen Blick von ihm zu erhaschen. Wahrscheinlich hatte ich mir auch sein Auftauchen hier im Restaurant nur eingebildet. Lächerlich. Das musste ein Ende haben.
Unser Stadtbesuch war eine wunderbare Abwechslung, aber nach zwei Tagen sehnte ich mich bereits wieder zurück in meine Highlands. Caitlynn schien es ähnlich zu ergehen, denn als wir auf der Rückfahrt Fort William, die kleine Stadt am Fuß des höchsten Bergs von Schottland, hinter uns gelassen hatten, seufzte sie: »Endlich. Bald sind wir zu Hause.«
Nach einem langen Ausritt mit Brandubh hatte ich gerade noch Zeit zu duschen und eines der in Glasgow gekauften Kleider anzuziehen. Es war immer etwas Besonderes, wenn Alsdair zu uns kam, und ich hatte mir angewöhnt, mich zu solchen Gelegenheiten ein bisschen zurechtzumachen, wie es die einheimischen Frauen genannt hätten.
Alsdair stammte von der Insel Harris, und vermutlich jeder an der Westküste hätte bestätigt, dass er ein begnadeter Seanachaidh war. Es gab nur noch wenige dieser Geschichtenerzähler, die sich wie er auf die alte Tradition verstanden.
Heutzutage, erklärte er zu Beginn des Abends, könne man alles nachlesen, was von der ereignisreichen Geschichte Schottlands noch bekannt war, aber früher habe jeder Clan-Chief, der etwas auf sich hielt, einen eigenen Chronisten beschäftigt, der aus dem Stegreif die komplizierten Familienverhältnisse der Clans, ihre Schlachten und Siege bis in die Frühzeit der keltischen Besiedlung hätte wiedergeben können. Alsdair Mackenzie und seine Vorfahren blickten auf eine lange Tradition zurück. Sie stammten aus dieser Gegend und retteten nicht mehr als ihr nacktes Leben auf die Hebrideninsel Harris, als der Clan der MacCoinnaichs, der zu den Mackenzies gehörte, verfolgt und ausgelöscht worden war.
Jetzt, mitten in der Saison, war das Sithean Inn an den Wochenenden meist ausgebucht, und besonders die amerikanischen Touristen liebten es, dem alten Mann zuzuhören, wenn er vor dem knisternden Kamin von Clanstreitigkeiten, entschlossenen Kriegern und zauberhaften Feen erzählte.
Als ich die Tür zum Pub vorsichtig öffnete, hatte er gerade eine Geschichte beendet. Ich suchte mir einen freien Platz in seiner Nähe und wartete ebenso gespannt wie die anderen Gäste auf die nächste Story.
Alsdair nahm einen Schluck von dem frisch gezapften Ale, das die Kellnerin Minca, ein Mädchen aus dem Dorf, wie ich inzwischen wusste, lächelnd vor ihm abstellte. Er wischte sich mit dem Handrücken über seinen Mund und begann zu erzählen:
»Der junge Chief Alan Dubh MacCoinnaich, der Gleanngrianach selbst, trug seinen Beinamen der Dunkle nicht umsonst. Seinen jüngeren Geschwistern war die Familienähnlichkeit mit dem mächtigen Vater und vielen Clansleuten deutlich in die stolzen Gesichter geschrieben, ihm aber nicht. Wie die meisten MacCoinnaichs waren die Brüder von kräftiger Statur, und gewelltes, rotblondes Haar floss üppig über ihre breiten Schultern. Die Männer kannte man als prächtige Schwertkämpfer, und doch wirkten sie nahezu plump im Vergleich zu ihrem Bruder, der ihnen zwar in Körperhöhe und Ausdauer um nichts nachstand, aber eher einem Weidenzweig glich, wenn er im Kampf geschmeidig und siegreich das Schwert führte. Seine Augen leuchteten dabei kalt und erbarmungslos wie ein eisiger Wintersturm, und manch einer hielt ihn für ein Wechselbalg, ein Kind der Sìdhichean oder Sidhe. Diese Feen, das weiß man noch heute, kommen zuweilen aus ihren Hügeln in den Highlands und tauschen in dunklen Nächten ihre Nachkommen mit Menschenkindern aus, um die Art der Sterblichen zu lernen oder aus bloßem Schabernack und Freude am Leid der betrogenen Eltern.
Alans Mutter indes äußerte niemals einen Zweifel an der Abstammung ihres Sohns. Sie schwor, er wäre ihren Verwandten daheim in Irland wie aus dem Gesicht geschnitten, und irgendwo im Haus gab es wohl auch einige Miniaturen ihrer Familie, denn der Chief bekräftigte ihre Worte und gab an, die Iren auf seinen Reisen schon selbst getroffen zu haben.
Die Frau wusste seine Loyalität zu schätzen und war ihm stets dankbar dafür. Ihr Leben war recht turbulent gewesen. Nach dem Tod ihres ersten Ehemanns, einem leichtsinnigen Spekulanten mit wenig Geld, hatte die schöne Irin nämlich in einem holländischen Handelskontor festgesessen.
MacCoinnaich, der erfolgreich in die dort ansässige Ostasienflotte investierte und gelegentlich auf den Kontinent kam, wie manche hier das europäische Festland auch heute noch nennen, hatte nach den Geschäften sehen wollen und sich sofort in die zierliche Witwe verliebt. Ihre feengleichen Züge, die schräg gestellten Augen und das rabenschwarze Haar faszinierte auch andere Männer, und so konnte der hünenhafte Schotte sein Glück kaum fassen, als sie seinen Antrag annahm und ihm in die raue Heimat folgte, wo sie vor Ablauf eines Jahres Alan zur Welt brachte. Wenige Winter darauf starb sie, wie so viele Frauen ihrer Zeit, nach einer Fehlgeburt.
Trotz seiner Trauer heiratete der Chief erneut. Dieses Mal freite er ein kräftiges Mädchen aus einem befreundeten Clan. Nicht aus Liebe, sondern weil er weitere Nachkommen brauchte, um das Fortbestehen der Familie zu gewährleisten. Wie fragil ein menschliches Leben sein konnte, hatte sich nicht zuletzt durch den Tod seiner geliebten Irin wieder einmal gezeigt.
Der Erstgeborene Alan, der seiner Mutter so ähnlich sah und in den ersten Jahren ebenso zart wirkte, wurde von seinem Vater, dem Clanoberhaupt, mit eiserner Hand erzogen. Den kleinen Jungen behandelte man, im Gegensatz zu seinen Halbgeschwistern, nicht besser als die Kinder der einfachsten Pächter. Er litt sehr darunter und verstand auch nicht, warum die beiden Brüder, wie es damals üblich war, als Pflegekinder in die Familien anderer Clans geschickt wurden, während er daheimbleiben musste.«
Die Stimme des Seanachaidh wurde leiser und eindringlicher.
»Eines Tages, so erzählte man sich, schlich der junge Erbe heimlich in das Arbeitszimmer des Vaters, um die prächtigen bunten Bilder in einem der in Leder gebundenen Bücher zu betrachten, die kürzlich eingetroffen waren. Da öffnete sich die Tür, und das Kind versteckte sich blitzschnell hinter einer mächtigen Truhe. Seine Stiefmutter, die mit dem Vater hereintrat, beklagte sich nicht zum ersten Mal über ihn: Alan ist so feindselig und verschlossen. Er hat überhaupt keine Manieren, und unsere Kinder fürchten sein aufbrausendes Temperament. Wenn er mich mit diesen kalten Augen anschaut, dann bleibt mir fast das Herz stehen. Ihre Stimme wurde schrill. Die Leute haben Recht. Du beherbergst ein Wechselbalg unter deinem Dach.
Alans Vater, der es längst leid war, die ständigen Beschwerden seiner Frau anhören zu müssen, knurrte: Es ist mir egal, was die Dummköpfe reden. Und wenn er vom Teufel persönlich abstammt – Alan wird eines Tages der Chieftain sein. Gewöhnt euch besser rechtzeitig daran.
Mühsam unterdrückte der kleine Junge ein Schluchzen. Selbst der Vater schien sich nicht sicher über seine Herkunft zu sein, sonst hätte er doch bestimmt widersprochen. Alan wurde noch verschlossener. Seine Lehrer hingegen hatten wenig Mühe mit ihm, denn er begriff schnell. Und allmählich machte sich auch das tägliche Training bemerkbar, in dem der Capitane, der militärische Berater des Chiefs, ihn in die Geheimnisse des Schwertkampfs einweihte.
Die Mädchen kicherten nun verlegen, wenn Alan, nur mit dem gegürteten Kilt bekleidet, durchs Dorf ging. Auch die jungen Männer begannen, ihn mit anderen Augen zu sehen. Längst wagten sie es nicht mehr, den jungen Erben herauszufordern, seit er im Zweikampf einen von ihnen beinahe getötet hätte.
Sein Gegner Ross MacCoinnaich hatte schon von Kindesbeinen an seinem Vater in der Schmiede geholfen. Er war bärenstark, gewann jeden Zweikampf und warf den Fels am Eingang des Tals weiter als jeder andere der Jungen. Ross war zwar gutmütig, aber nicht gerade das, was man unter einem sensiblen Menschen verstand. Deshalb bemerkte er das gefährliche Glitzern in Alans Augen nicht, als er ihn wieder einmal als Feenbalg bezeichnete. Der Kampf war kurz und endete damit, dass Alan Ross einen Dolch an die Kehle drückte, bis die ersten Tropfen Blut hervorquollen. Nimm das sofort zurück.
Der mörderische Blick jagte dem Sohn des Schmieds einen entsetzlichen Schrecken ein, und er nickte vorsichtig.
Alan ließ von ihm ab, sprang auf und blickte drohend in die Runde: Ich bringe jeden um, der es wagt, mich noch einmal so zu nennen oder meine Mutter zu beleidigen.
Später sagten einige, Adhamh der teuflische Gehilfe der Feenkönigin hätte in diesem Augenblick aus dem Sohn des Chiefs gesprochen, und manch ein Dorfbewohner bekreuzigte sich fortan heimlich hinter Alans Rücken. Zwar wagte es niemand mehr, öffentlich über seine Herkunft zu spekulieren, doch viele schienen nun endgültig überzeugt, dass der Erstgeborene des Chiefs aus der Anderswelt stammte und womöglich sogar Adhamhs Bastard war. Denn der besonders gefürchtete männliche Vertreter der Feenwelt sei, so hieß es, schon manch einer jungen Frau zum Verhängnis geworden, die sich allein zu weit in die Berge gewagt hatte.
Während der Erzähler eine Pause machte, um sich mit frisch gezapftem Ale die Kehle zu kühlen, war plötzlich dieses eigenartige Kribbeln zwischen den Schulterblättern wieder da, das ich immer hatte, wenn eine unangenehme oder gar gefährliche Situation drohte. Noch bevor ich mich ganz umgedreht hatte, wusste ich, dass mein geheimnisvoller Retter den Raum betreten hatte. Und richtig: Mit verschränkten Armen lehnte er in der niedrigen Tür und sah gefährlich, aber auch zum Anbeißen attraktiv aus.
Wahrscheinlich genießt er jede Sekunde seines Auftritts, dachte ich verdrossen. Einen Moment lang schien ein Glitzern seine Augen zum Strahlen zu bringen, als sich unsere Blicke trafen. Dann blickte er jedoch gelangweilt in die Runde. Sicher war es nur das Flackern einer Kerze gewesen.
Der Erzähler selbst hatte den Neuankömmling bisher nicht bemerkt. Er leerte sein Glas, winkte Minca, damit sie ihm ein neues brachte, und fuhr mit seiner Geschichte fort: »Nach dem Tod des alten Chiefs kehrte Lachlan, der seinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten war, aus der Pflegefamilie zurück, und viele Gefolgsleute machten keinen Hehl daraus, dass sie lieber ihn als den dunklen Alan zum Chief gehabt hätten …«
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: