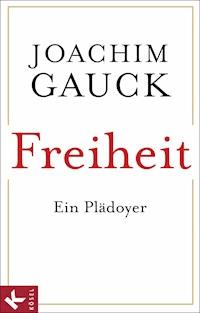12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siedler
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der Bestseller in aktualisierter Fassung - mit einer Bilanz des Autors fünfzehn Jahre danach
Eine der bedeutendsten Persönlichkeiten der jüngsten deutschen Geschichte erinnert sich: Joachim Gauck – engagierter Systemgegner in der friedlichen Revolution der DDR und herausragender Protagonist im Prozess der Wiedervereinigung als erster Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen. Ihm ist ein gleichermaßen politisches wie emotional berührendes Buch gelungen, in dem er in klaren Bildern die traumatisierende Erfahrung der Unfreiheit und das beglückende Erlebnis der Freiheit beschreibt.
Fünfzehn Jahre nach Erscheinen der Originalausgabe zieht der ehemalige Bundespräsident in einem aktualisierten Vorwort erneut Bilanz.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 480
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
»Wo ich her bin . . .«
Wenn ich den Sommer besuchen will, habe ich es nicht weit. Auf dem Fischland, östlich von Rostock an der mecklenburgischen Küste, kühlt er seine Hitze zwischen Ostsee und Bodden. Dort, wo das Land zwischen den beiden Wassern auf gerade einmal fünfhundert Meter zusammenschrumpft, liegt das Ostseedorf Wustrow.
Von hier stammen die ersten Erinnerungsbilder, die meine Seele aufbewahrt, denn hier verbrachte ich die ersten fünf Jahre meines Lebens: das Gesicht der Mutter über mir, das Haus, der Baum, der Himmel – hell. Das große Wasser, die Großmutter, der Himmel – dunkel. Die kleine Schwester, Kindertränen, Kinderglück. Alles war zum ersten Mal.
Aber immer, wenn ich mich erinnere, gibt es ein erstes Bild. Ich bin zwölf Jahre, besuche Tante Marianne, eine Freundin meiner Mutter. Sie wohnt mit ihren beiden Kindern in einem uralten Fachwerkhaus am Bodden. Im vorderen Bereich der dunklen Diele mit dem Lehmfußboden sind die Ställe, hinten liegen die Küche und die Zimmer. In der Diele streichen Katzen herum, Schwalben fliegen ein und aus, unter dem Gebälk haben sie ihre Nester gebaut.
Das Haus gehört Opa Konow, Tante Mariannes Vater, einem Mecklenburger Urgestein. Sein kleines Holzboot, eine Polt, liegt fünfzig Schritte entfernt im »Hafen«, einer kleinen Ausbuchtung im Schilfgürtel am Rande des Grundstücks. In diesem Boot lerne ich rudern und – da man es schnell in ein Segelboot verwandeln kann – auch segeln. Man holt damit Heu von einer Boddenwiese oder von der gegenüberliegenden Kreisstadt das Bindegarn, das für die Mähmaschine gebraucht wird. Opa spricht natürlich Plattdeutsch, mit Einheimischen und Fremden gleichermaßen, gelegentlich auch mit dem Wind, wenn der es »tau un tau dull« treibt mit dem kleinen Holzboot – nicht, dass man noch beidrehen und reffen muss!
Wenn sein Enkel Burckard und ich »anstellig« sind, kriegen wir ein gutes Wort und später in der Bauernküche Leckmilch, einen fast körnigen Quark. Wahrscheinlich buttert Tante Marianne gleich. Ich entwickle einen regelrechten Heißhunger auf die frische, mit winzigen Wasserteilchen behaftete sattgelbe Butter aus dem Fass, die Tante Marianne am Abend verschwenderisch auf ein Stück Schwarzbrot schmiert. Wir sind immer hungrig, denn wir sind immer draußen, bei Wind und Wetter, auf dem Hof, auf den Wiesen und auf dem Wasser.
An diesem Tag zieht ein Gewitter auf, was nicht allzu oft geschieht, denn meist, so die Alten, zögen die Gewitter am Fischland vorbei, wegen der Lage zwischen den Wassern. Aber wenn es kommt, dann mächtig. Mein Freund und ich rennen in die Laube gegenüber der Küche, wir erschauern, wenn die Blitze den Himmel zerreißen, und hören dem Regen zu, der laut auf das Laubendach trommelt und leise in den weichen Lagen des Rohrdachs gegenüber versickert.
Es ist so dunkel geworden, dass in Tante Mariannes Küche jetzt Licht brennt. Ich sehe sie dort hantieren, die Oberseite der Küchentür steht offen. Gern würde ich ihre Augen sehen – mir war immer, als würden ihre Augen ja sagen zum Leben. Sie haben das sicher immer und überall getan, aber in diesem Sommer bin ich es, der in den Blick dieser Augen gekommen ist. Ich spüre: Ich bin einer, der dazugehört. Tante Marianne hat mich geborgen. Jetzt blickt sie auf, sieht zu uns hinüber in die Laube, sie lächelt und winkt, wahrscheinlich gibt es gleich Abendbrot.
Morgen würde das Gewitterdunkel weitergezogen sein, Tante Marianne würde uns mitnehmen in die Wustrower Kirche. Jeden Mittwoch ist hier Sommerabendfeier, ein Abend bestimmt von der Musik durchreisender Künstler, vom Klang der Orgel und immer demselben Lied zum Schluss. Ich werde es schnell auswendig kennen:
Der Tag nimmt ab. Ach schönste Zier, Herr Jesu Christ, bleib du bei mir, es will nun Abend werden. Lass doch dein Licht auslöschen nicht bei uns allhier auf Erden.
Während wir mit unseren Fahrrädern am Bodden entlang zurückfahren unter unser Dach, summe ich die Melodie vor mich hin. Heute schlafen Burckard und ich im früheren Kälberstall neben der alten Scheune. Es gibt kein Licht und keine Betten, wir liegen auf Stroh bei Mäusen und Fledermäusen, wir sind mutige große Jungs. Die Tür zum Hof steht offen, der Himmel ist klar, wenn ich den Kopf wende, sehe ich die Sterne. »Der Tag nimmt ab . . . lass doch dein Licht auslöschen nicht . . .« – da bin ich eingeschlafen.
Heimat, so hörte ich den Rostocker Schriftsteller Walter Kempowski gut dreißig Jahre später im Westrundfunk sagen, Heimat sei für ihn der »Ort früher Leiden«. Ich weiß noch, wie ich mich dagegen auflehnte. Für mich war Heimat frühes Glück. Erst zwanzig Jahre später sollte ich begreifen, dass mein Glück im Sommer 1952 eng mit dem Unglück ein Jahr zuvor verbunden war. Tante Marianne hatte mich aufgenommen, nachdem mein Vater abgeholt worden war und spurlos verschwand. Wegen des dunklen Sommers ein Jahr zuvor hat der Sommer bei Tante Marianne alle früheren Bilder überstrahlt.
Als meine Familie nach Rostock zog, blieb Wustrow für mich ein Zufluchtsort, ein tröstlicher Bezugspunkt ein ganzes Leben lang: Als ich jung war und jetzt, da ich in die Jahre gekommen bin; als ich noch allein lebte und als ich verheiratet war; als ich ein Kind war und als ich Kinder hatte. Noch heute umfängt mich das Gefühl einer ganz besonderen Wärme und innere Freude, wenn ich, von Rostock kommend, auf das Fischland abbiege, parallel zur See nach Nordosten fahre, wenn dann in der Ferne der Kirchturm von Wustrow auftaucht und ich rechter Hand hinter Wiesen und Schilf den Bodden weiß. Auch wenn ich nur zu Besuch komme, fühle ich: Hier bin ich zu Hause.
Dabei waren wir doch Zugezogene, ansässig erst seit 1938, als meine Eltern Joachim und Olga Gauck nach ihrer Heirat eine Haushälfte gegenüber der Seefahrtschule in der heutigen Parkstraße mieteten, die damals Adolf-Hitler-Straße hieß. Wirklich fremd waren sie allerdings nicht, denn beide waren Mecklenburger, mein Vater zumindest ein halber, denn sein Vater stammte aus Sachsen. Mein Vater hat in Wustrow die Seefahrtschule besucht und sie zunächst mit dem Steuermanns-, 1940 mit dem Kapitänspatent A 6 beendet: Kapitän auf großer Fahrt. Als Kapitän ist er im Krieg allerdings nicht mehr gefahren; herumgekommen auf den Weltmeeren war er allerdings schon seit der Zeit, da er, gleich nach dem Abitur, als Schiffsjunge auf der Viermastbark »Gustav« angeheuert hatte. Im Familienalbum finden sich Bilder aus Australien, Afrika, Skandinavien und von Sumatra. Zuletzt arbeitete er in der Reederei Ferdinand Laeisz in Hamburg und holte auf Fruchtschiffen Bananen und andere Südfrüchte aus Afrika.
Meine Mutter scheint ihn bei einem seiner Landgänge regelrecht gekapert zu haben. In der Familie wurde jedenfalls kolportiert, dass die junge Olga Warremann den immerhin schon 31–Jährigen nach der Rückkehr aus Kamerun bei der Hamburger Reederei abgeholt und erwartungsvoll gefragt habe:
»Hast du meinen Brief bekommen?«
Mein Vater wusste von keinem Brief.
»Dann weißt du nicht, dass wir morgen in Blankenese heiraten?«
Offensichtlich musste mein Vater nicht lange überlegen.
So kam es, dass, als mein Vater zum Militär eingezogen wurde, meine Mutter nach Wustrow zog. Dort lebte ihre Schwiegermutter Antonie Gauck, die sich hier ein Haus an der Ostsee hatte bauen lassen. Als Tochter eines Ackerbürgers mit kleinem Viehhandel in der mecklenburgischen Kleinstadt Penzlin verfügte sie zwar über ein Erbe, aber über keine laufenden Einkünfte. So wollte sie Sommergäste beherbergen, um sich den Lebensunterhalt zu sichern. Die Leute im Dorf sagten: »De Fru iss woll nich klauk, will sick dor’n Huus hen bugen«, denn das Haus lag unmittelbar an der See, weit vor allen anderen Häusern des Ortes. Doch 1936 stand das Gebäude, groß genug, um nicht nur die eigene Wohnung, sondern auch Raum für einige Feriengäste zu bieten.
Bild 10
Sommer 1952 mit Burckard und Tante Marianne. Sie hat mir ein Zuhause im ersten Sommer gegeben, den meine Geschwister und ich ohne den Vater verbringen mussten.
Großmutter Antonie hatte sich scheiden lassen, als mein Vater ein kleiner Junge war. Niemand wusste, warum. Niemand, auch nicht der eigene Sohn, hatte je ein Bild ihres Mannes, seines Vaters, gesehen. Bekannt war allein, dass er aus Dresden stammte und Apotheker gewesen war. Weder Fragen noch gar Gerüchte konnten die stolze Mecklenburgerin zum Reden bringen. Sie verweigerte jede Auskunft, verbannte jede Erinnerung und entledigte sich schleunigst seines Namens. Wie sehr sie ihn abgelehnt haben muss, konnte mein Vater ahnen, als sie sich einmal bei einem Spaziergang zu dem inzwischen erwachsenen Sohn umdrehte und es ihr erschrocken entfuhr: »Mein Gott, du siehst ja aus wie dein Vater!« Antonie hat niemals wieder eine Beziehung zu einem Mann geknüpft, vielmehr meiner Schwester Marianne schon im Schulmädchenalter eingeimpft: »Lass dir nie von Männern imponieren!«
Auf letztlich ungeklärte Weise stellte diese herbe, sehr entschlossene und eigensinnige Frau auch ohne Mann etwas dar. Mit einigen repräsentativen Möbeln aus der Kaiserzeit und einem Schrank voller Bücher gab sie sich einen bürgerlichen Anstrich; meine Mutter mag sie gelegentlich als arrogant und dominant empfunden haben. Sie wisse sehr viel, und man könne einiges von ihr lernen, schrieb meine Mutter jedenfalls an ihre Schwester Gerda, aber wenn Oma Gauck nicht in ihre Schranken gewiesen werde, mische sie sich permanent ein. Sie hat zur Schwiegermutter eine gewisse Distanz gehalten.
Meine Mutter war selbst eine eigenständige Frau, eine gelernte Bürofachfrau, in praktischen Dingen außerordentlich beschlagen und nicht bereit, sich in Fragen des Haushalts und der Kindererziehung unterzuordnen. Ihre Eltern Franz und Luise Warremann stammten vom Land. Ihr Vater war in Kukuk geboren, wo auch immer das liegen mag, ihre Mutter in Kassebohm bei Rostock.
Oma Warremanns Eltern waren bettelarme Landarbeiter. Als sie klein war, mussten jeweils zwei Kinder in einem Bett schlafen; bei den gemeinsamen Mahlzeiten gab es Stühle nur für Vater und Mutter, die Kinder standen um den Tisch herum. Die Schule hat Oma Warremann gerade einmal bis zur siebten Klasse besucht, dann musste sie arbeiten gehen. Über die Armut hat sie aber nicht ein einziges Mal geklagt. Sie erzählte vielmehr, wie sie sich Weihnachten freute über die kleinen Geschenke oder welch großes Erlebnis es war, mit zehn oder zwanzig Pfennig zu Fuß zum Pfingstmarkt nach Rostock zu gehen, um dort eine Waffel zu erstehen oder einmal mit dem Karussell zu fahren.
Mit sechzehn Jahren heiratete meine Großmutter den Maurergesellen Franz Warremann und zog mit ihm in eine Mietwohnung nach Rostock. Tochter Olga, meine Mutter, wurde 1910 geboren, Sohn Walter einige Jahre früher, Tochter Gerda einige Jahre später. Die Armut dauerte in der Ehe zunächst an. Oma erzählte, dass Opa Ende der Weimarer Republik am Wochenende mit einen Rucksack voller Geld nach Hause gekommen sei, dieses Geld aber, wenn sie es nicht gleich in Ware umgesetzt habe, in der folgenden Woche schon wertlos gewesen wäre.
Glücklicherweise qualifizierte sich Großvater Warremann in den dreißiger Jahren zum Baumeister und begann, mit einem Betonmischer, ein paar Schubkarren und einigen Arbeitern ein Unternehmen zu betreiben: Franz Warremann, Baugeschäft. Auf alten Bildern sieht man ihn mit seinem Bierbauch stolz vor einem Opel stehen. Er hatte den Aufstieg geschafft. Ende der dreißiger Jahre errichtete er ein eigenes Haus im Rostocker Vorort Brinckmansdorf, ruhig gelegen, mit Garten und Blick über die Felder. Dieses Haus blieb für alle drei Warremann-Kinder, selbst als sie schon Familien hatten, ein Bezugspunkt und Zufluchtsort. Auch ich habe mehrfach in diesem Haus gelebt.
Mutters Familie hielt untereinander engen Kontakt. Besonders eng waren die Beziehungen meiner Mutter zu ihrer Schwester Gerda; es schien, als hätten sie sich in lebenswichtigen Fragen abgesprochen: Sie heirateten im Abstand von wenigen Wochen, in beiden Fällen waren die Auserkorenen keine Einheimischen. Außerdem gebaren sie ihre Kinder jeweils kurz hintereinander, mein Cousin Gerhard, der älteste Sohn meiner Tante Gerda, ist nur fünf Monate älter als ich.
In ihrem Wesen gab es allerdings Unterschiede. Die blonde, kurzhaarige Gerda, da waren sich alle einig, sei die hübschere der beiden Schwestern; die dunkelhaarige Olga, genannt Olly, die klügere. Gerda galt als die bessere Ehefrau, Olly als die bessere Mutter. Sollte irgendeine Rivalität zwischen den Frauen existiert haben, so blieb sie uns Kindern verborgen; vorherrschend waren ihre Vertrautheit und Solidarität, die auch andauerten, als sie – beide ihrer Männer wegen – in unterschiedliche Orte zogen: Gerda nach Saarbrücken, Rostock, Kiel und Memel, Olly nach Wustrow.
Wustrow war nicht irgendein Dorf. Es hatte Bedeutung gewonnen durch die 1846 errichtete »Großherzogliche Navigationsschule zu Wustrow«, die erste staatliche Seefahrtschule in Mecklenburg. Die Seeleute brachten große Muscheln von fernen Küsten mit, Porzellan aus Japan und China, Keramik aus England, und ihre Frauen schmückten die guten Stuben mit Bildern der Schiffe, auf denen ihre Männer als Kapitäne fuhren. Schüler und Lehrer am Ort wechselten, nicht wenige aber heirateten Frauen vom Fischland und blieben. So verwob sich Bodenständigkeit mit einem Hauch von Weltläufigkeit.
Kapitäne gab es seit alter Zeit reichlich in Wustrow. In der Segelschiffszeit besaß der Ort eine für damalige Verhältnisse beachtliche Flotte. Als Ende des 19. Jahrhunderts die Dampfschiffe die Segler verdrängten, entwickelte sich ein sehr bescheidener Tourismus, auch wenn die Anreise zunächst äußerst beschwerlich war. Bis 1929 die Fischlandchaussee gebaut wurde, gelangte man ausschließlich mit dem Schiff von Ribnitz aus über den Bodden nach Wustrow. Mit einem Segelboot oder einem Dampfer wurden Badegäste, Kühe, Schafe, Schweine und Post zwei Mal am Tag innerhalb einer Stunde übergesetzt. Noch nach dem Krieg standen die Jungen an der Anlegestelle, um das Gepäck der Feriengäste mit Schubkarren oder Ziehwagen in die Pensionen zu transportieren. Auch ich habe mir so gelegentlich in den Schulferien Taschengeld verdient.
Einer der Höhepunkte des Sommers war seit Generationen das Tonnenabschlagen, ein Volksfest in den Dörfern rund um den Bodden, das nicht zuletzt eine so große Bedeutung gewann, weil Schützenfeste und andere ländliche Traditionen von den Kommunisten aus den Dörfern verbannt worden waren. Wie aus der Zeit gefallen war dieses Volksfest – ohne FDJ- und Pionierumzüge, ohne sozialistische Lieder und Reden von Parteifunktionären. Stattdessen ein Umzug mit geschmückten Pferden und Reitern, mit Auszeichnungen aus der Vorkriegszeit, einem Ritual, das dauerhaft blieb, mochten sich die Zeiten und Flaggen auch wandeln. Ursprünglich hat man mit dem Fest die Ablieferung der letzten Heringstonne an die Schweden gefeiert, die Teile Mecklenburgs und Vorpommerns bis ins 19. Jahrhundert besetzt hielten. Im Laufe der Zeit ist daraus ein beliebtes Volksfest geworden, ein Wettkampf zu Pferde, bei dem im Galopp auf ein Heringsfass in drei bis vier Meter Höhe eingeschlagen werden muss, bis es zerbricht. Und der siegreiche Tonnenkönig stößt an: »Hoch Fischlands Art und Sitte / Und alter Väter Art!«
Es hatte etwas Tröstliches für die, die am Rande in bunten Sommerkleidern zuschauten, und für die, die mit schweren Holzknüppeln gegen das Fass schlugen. Es machte Spaß, es war schön, es war »unsers«, und alle wünschten sich: So soll es bleiben.
Für Touristen gewann Wustrow noch an Attraktivität durch das vier Kilometer entfernte Ahrenshoop. Wegen seiner Abgeschiedenheit und eigenwilligen Melancholie hatte dieses Küstendorf seit Ende des 19. Jahrhunderts Maler und Schriftsteller angezogen und sich wie Worpswede zu einer Künstlerkolonie entwickelt. Hier arbeiteten unter anderen die Maler Paul Müller-Kaempff und Erich Heckel. In der Nähe erwarb auch der Bildhauer Gerhard Marcks ein Haus; zunächst pendelte er zwischen Berlin und dem Fischland; nachdem die Nationalsozialisten ihn als Professor entlassen, große Teile seiner Arbeiten beschlagnahmt und zur entarteten Kunst erklärt hatten, zog er sich bis Kriegsende gänzlich hierher zurück. Nur wenig entfernt von ihm ließ sich der Maler Fritz Koch-Gotha nieder, der berühmte Autor der »Häschenschule«. Er fand seine letzte Ruhestätte auf dem Friedhof von Wustrow, ebenso Dora Menzler, die Gymnastiklehrerin aus Leipzig, die 1908 eine Schule für Bewegung und Musikerziehung gegründet hatte und den Unterricht in den Sommermonaten nach Wustrow verlegte. 1933 gab Dora Menzler die Leitung der Schule ab, weil sie als Halbjüdin deren Schließung fürchten musste. Doch ihre Arbeit blieb im Gedächtnis. Noch nach dem Krieg hörte ich immer wieder von den »Hüppers«, den jungen Frauen, die nackt am Wustrower Strand getanzt hatten. Sie hatten die Freikörperkultur für sich entdeckt, die in DDR-Zeiten am Ostseestrand trotz des phasenweisen Widerstands der prüden kommunistischen Herrschaft äußerst populär blieb.
In Wustrow selbst lebten die Maler Hedwig Holtz-Sommer und ihr Mann Erich Theodor, genannt ETH. Mein Schulfreund Christian Gätjen lernte von ihnen auf vielen gemeinsamen Wanderungen und blieb ihnen mit seinen Blumen- und Landschaftsbildern treu bis zu seinem frühen Tod 2008.
In dieser Welt bin ich aufgewachsen. Meine Mutter hatte mich am 24. Januar 1940 in einer Rostocker Klinik zur Welt gebracht. Auf der Heimfahrt blieb das Auto meines Großvaters etwa einen Kilometer von unserer Wohnung entfernt in einer Schneewehe stecken, ein Militärfahrzeug musste uns aus den Schneemassen befreien. Es war ein kalter Winter, Eisbrecher hielten nur mit Mühe die Fahrrinne über die Ostsee nach Dänemark frei, Südschweden meldete vier Meter hohe Schneewehen.
Besonders denen, die aus den Städten kamen, erschien das Dorfleben friedfertig, auch wenn Krieg war. Da waren die kleinen Häuser, die neugotische Kirche, von deren Turm aus der Ort von der Ostsee bis zum Bodden zu überblicken war, der ewige Wind, der durch die Pappeln und Linden fuhr, über die Felder und Dünen. Und wenn der Wind stärker wurde, war da die laute, bedrohliche Brandung, die manchmal so wütend tobte, dass sie Menschenopfer forderte oder Schiffe auf den Strand warf – wie 1965 die »Stinne«, einen dänischen Zwei-Mast-Schoner, der nicht mehr frei geschleppt werden konnte.
Mein Vater wurde bald zur Kriegsmarine eingezogen und war fast nie bei uns. Aber ich fühlte mich dennoch geborgen, unsere dreiköpfige Restfamilie war keineswegs allein. Oma Antonie wohnte nur wenige Minuten entfernt, außerdem traf sich meine Mutter trotz Krieg und Not regelmäßig mit anderen Kapitänsfrauen zu einem Kränzchen. Wir waren immer viele, denn Familien mit fünf Kindern waren keine Ausnahme. In meiner Erinnerung waren es heitere Treffen. Wenn die Frauen Angst um ihre abwesenden Männer gehabt haben, so haben wir Kinder nichts davon gespürt.
Ich sei, sagt meine anderthalb Jahre jüngere Schwester Marianne, Mutters Liebling gewesen. Dafür sprechen auch die kurzen Kommentare, die meine Mutter zu Fotos aus meinem ersten Lebensjahr verfasste. Nach den Erzählungen, die im Familienkreis weitergetragen wurden, dürfte der kleine Junge jedoch eine recht gespaltene Haltung zu dieser Frau gehabt haben. Er soll als Säugling und kleines Kind viel geschrien haben, weil er nicht genug zu trinken und zu essen bekam. Seine Mutter hatte wie Hunderttausende anderer deutscher Frauen wohl gelesen, was Johanna Haarer in ihrem Buch »Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind« für die Säuglingspflege empfahl: Wenn das Kind schreie und als Beruhigungsmittel auch der Schnuller versage, »dann, liebe Mutter, werde hart! Fange nur ja nicht an, das Kind aus dem Bett herauszunehmen, es zu tragen, zu wiegen, zu fahren oder es auf dem Schoß zu halten, es gar zu stillen.« Später fand ich dieses Buch in unserem Bücherschrank. »Auch das schreiende Kind muss tun, was die Mutter für nötig hält, und wird, falls es sich weiterhin ungezogen aufführt, gewissermaßen ›kaltgestellt‹, in einen Raum verbracht, wo es allein sein kann und so lange nicht beachtet, bis es sein Verhalten ändert. Man glaubt gar nicht, wie früh und wie rasch ein Kind solches Vorgehen begreift.«
Bild 11
Kriegssommer 1940 im Garten unserer Wustrower Wohnung in der damaligen Adolf-Hitler-Straße. Ich bin umgeben von den drei Frauen, die über die ersten Jahre meines Lebens wachten: Großmutter Antonie hält mich auf dem Schoß, flankiert von meiner Mutter (links) und Großmutter Warremann (rechts), ganz links unsere Nachbarin.
Meine Mutter muss die Anweisungen genau befolgt haben. Regelmäßig wurde der kleine Junge in seinem Kinderwagen hinausgeschoben auf die Wiese neben dem Haus. Entgegen Johanna Haarers Vorhersage aber scheint er sich keineswegs rasch und klaglos dem Mutterwillen unterworfen zu haben, denn er hat – so wurde kolportiert – weiterhin erbärmlich geschrien. Das Schreien stärke die Lungen, beruhigten sich damals die Mütter, es sorge dafür, dass das Kind gesund bleibe. So kam es, dass der unbeachtete und ungesättigte kleine Junge ständig Ausschau hielt, wo es etwas zu essen oder zu trinken gab. Als dann sehr schnell ein zweites Baby, meine Schwester Marianne, kam, griff der Kleine, wenn er sich unbeobachtet glaubte, gierig nach der Babyflasche, trank sie in einem Zug leer und strahlte – für kurze Zeit.
Obwohl Krieg war, es Lebensmittelkarten gab und Mangel herrschte, hat es uns in Wustrow dank der organisatorischen Fähigkeiten meiner Mutter selten an etwas gefehlt. Wir weckten ein, was im Garten heranreifte, außerdem konnte man Obst und Gemüse bei den Nachbarn erwerben. Unsere Versorgung wurde schlagartig schlechter, als Mutter mit meiner Schwester Marianne und mir für mehr als vier Monate, von Juli bis Dezember 1943, zu meinem Vater zog. Nach einem Einsatz in einer Minensuchflottille vor der dänischen Ostküste war er nach Adlershorst bei Gdingen, dem damaligen Gotenhafen, an die Navigationsschule versetzt worden, wo er Mathematik und Nautik unterrichtete. Offensichtlich versuchte Mutter, den Lebensstandard von Wustrow zu halten, versagte dabei aber unter den Bedingungen im besetzten Polen. In Briefen an ihre Schwester Gerda bat sie um die Nachsendung eines Kochers sowie von Röcken und Blusen, und sie ließ in Paketen und Kisten per Post und Bahn auch Eingewecktes nachkommen: Marmelade, Äpfel, Saft, Rübchen, Weintrauben (von der Hauswand unseres Großvaters Warremann in Brinckmansdorf), sogar Tomaten, die – so führte sie Klage in einem Brief – ihren Bestimmungsort leider zum Teil eingedrückt erreichten.
Bild 12
Ostern 1943 sind meine Mutter, meine Schwester Marianne und ich zu einem kurzen Besuch bei meinem Vater in Adlershorst bei Gdingen (damals Gotenhafen) im besetzten Polen. Im Herbst verbrachten wir sogar einige Monate in seiner kleinen Dienstwohnung. Der kleine Junge fühlte sich nicht wohl. Was taten wir hier? Es war wohl die Fremdheit, die ihn verunsicherte.
Nur einmal, am 10. Oktober 1943, berichtete Mutter ihrer Schwester von einem »ganz hübschen Tagsangriff« auf Gotenhafen, bei dem »das Krankenhaus vernichtet worden ist und ein Lazarettschiff. Außerdem hat ein Splittergraben mit vielen Kindern aus dem Krankenhaus einen Volltreffer bekommen«. Adlershorst blieb zwar verschont, »die Aufregung war allerdings auch hier groß, als wir die Unzahl von Flugzeugen sahen, es waren wohl mehr als zweihundert. So was habe ich noch nicht gesehen.« Kein Wort der Angst, kein Wort des Mitleids mit den Verwundeten und den Angehörigen der Toten, kein Wort der Besorgnis über die Kriegsereignisse. Dabei befand sich die Wehrmacht nach der schweren Niederlage bei Stalingrad und der misslungenen Offensive bei Kursk im Osten bereits in der Defensive. Die Front verschob sich seit Frühsommer 1943 unaufhaltsam nach Westen. Mein Vater dürfte darüber gut informiert gewesen sein. Außerdem bangte Tante Gerda um ihren Mann, der als Marinepfarrer nach Memel eingezogen worden war. Mit dem Wissen von heute erscheint befremdlich, wie weit meine Mutter in Sorge um das tägliche Wohlergehen der Familie das große Geschehen ausblendete und verdrängte, wie sie abwertende Worte fand über »die Polacken«, an die man sich erst gewöhnen müsse, und darüber, dass sie »so was von Stehlen wie hier« noch nicht erlebt habe, die bedrohliche Kriegslage hingegen hartnäckig ignorierte. Vermutlich suchte sie so ihren Glauben an den Endsieg der Deutschen aufrechtzuerhalten.
An den Fliegerangriff kann ich mich nicht erinnern, aber in meinem Gedächtnis hat sich ein Schatten über den ganzen Aufenthalt gelegt. Auch Adlershorst lag an der Ostsee, auch dort gab es einen breiten Strand und eine Steilküste wie in Wustrow. Doch ich empfand den Ort als fremd, unsicher, kalt. In der kleinen Dienstwohnung fühlte ich mich beengt, die kahlen, mehrstöckigen Häuser ängstigten mich, ich vermisste die großen Lindenbäume in Wustrows Straßen. Alles war zu unübersichtlich. Vor allem die Parade, zu der mich meine Mutter in Sonntagskleidung führte, um mich Stolz auf meinen Vater zu lehren. Die Marine marschierte, Mutter hob mich hoch, damit ich besser sehen konnte. Immer wieder wies sie vom Straßenrand mit dem Zeigefinger in den Zug: »Siehst du ihn nicht? Da ist er doch!« Der kleine Junge sah in die Reihen, sah uniformierte Männer im Gleichschritt paradieren: ein schönes, ein beeindruckendes, ein überwältigendes Bild. Aber ein Marinesoldat sah aus wie der andere. Wie hätte der Dreijährige in dem unüberschaubaren, schier endlosen Zug, der forschen Schritts unter lautem Trommelwirbel vorbeizog, ein einzelnes Gesicht fixieren sollen? Der Vater existierte nicht in der Masse.
Zurück in Wustrow hörte ich im Reichsrundfunk häufig die Sendung »Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt«, nicht gerade eine Kindersendung. Eine sehr markante Fanfarenmusik leitete die Meldungen über die Siege ein – und der kleine Junge wollte siegen mit seinen zwei Panzern aus Holz. Einer war grün-bräunlich mit Tarnfarben bemalt, der andere anthrazitgrau und glich den englischen Tanks aus dem Ersten Weltkrieg. Mit großer Ausdauer führte er sie um die Sessel in dem kleinen Wohnzimmer herum. Er sei fortwährend unterwegs gewesen, erzählte die Mutter später, um in El Alamein und sonst wo auf der Welt seinen Vater aus der Hand übermächtiger Feinde zu befreien. Offenbar glaubte der kleine Junge seinen Vater in Gdingen in Gefahr.
Weihnachten 1944 bestand ich meinen ersten öffentlichen Auftritt auf einer wahrscheinlich von der nationalsozialistischen Frauenschaft veranstalteten Weihnachtsfeier. Ich vermochte ein ganzes Weihnachtsgedicht aufzusagen, ohne mich zu verhaspeln und ohne zu stocken: »Von drauß, vom Walde komm ich her . . .« Der Weihnachtsmann war so gerührt, dass er versprach, nach der Feier noch bei mir zu Hause vorbeizukommen und mir ein spezielles Geschenk zu übergeben. Er hielt sein Versprechen: Ich bekam einen weiteren Panzer aus Holz.
Wustrow blieb vom Krieg verschont. Zwei Bomben fielen auf die Wiesen vor dem Ort, ohne irgendwelchen Schaden anzurichten. Rostock hingegen wurde bereits Ende April 1942 zu sechzig Prozent durch Bombenangriffe der Royal Air Force zerstört. In den vier Nächten zwischen dem 23. und dem 27. April legten jeweils über hundert Flugzeuge die historische Altstadt in Schutt und Asche, Brände fraßen Sankt Nikolai und die Petrikirche auf. Die Erwachsenen standen in Wustrow auf dem Deich und blickten bang über das Wasser nach Westen, wo der Rauch aufstieg; viele hatten Verwandte in Rostock, meine Mutter sorgte sich um ihre Eltern. Bei entsprechendem Westwind trieb es die Asche bis in die Gärten von Wustrow. Der Krieg hatte Mecklenburg gefunden.
Einmal, so meine einzige wirkliche Kriegserinnerung, waren wir bei den Großeltern Warremann in Rostock zu Besuch. Wir saßen miteinander im Keller des Hauses, von fern hörte ich Sirenen, die Bedrohung konnte ich nicht ermessen, aber ich spürte die Angst der Erwachsenen, die sich auf mich übertrug.
Insgesamt kamen die Großeltern im Krieg glimpflich davon. Bomben, die im Rostocker Vorort Brinckmansdorf nieder gingen, zerstörten zwei Häuser in der Nachbarschaft. Bei den Großeltern wurde nur die angebaute Garage neben dem Haus weggerissen und das Dach beschädigt. Oma Warremann und die Schwester meiner Mutter mit ihren beiden Kindern überstanden die Angriffe unversehrt im Keller. Die Möbel waren etwas lädiert, aber noch zu gebrauchen. Als in den letzten Apriltagen 1945 der Kanonendonner von der Front zu hören war, packte Großvater Warremann einen Leiterwagen mit Federbetten und etwas Hausrat, setzte meinen Cousin Gerhard und meine Cousine Dörthe darauf, dann schoben die Erwachsenen den Wagen Richtung Westen bis Bad Doberan, wo sie zum Dorf Retschow abbogen. Dort fanden sie bis Kriegsende im Pfarrhaus Unterschlupf.
In Rostock und Ribnitz zog die Sowjetarmee am 1. Mai 1945 ein. Über die Dorfstraße von Wustrow fuhren am 2. Mai einige sowjetische Panzer zum Hohen Ufer direkt an der Ostseeküste. Nachdem sie dort nur auf eine verlassene Stellung und zwei gesprengte Geschütze gestoßen waren, zogen sie sich wieder zurück.
Am Morgen des 3. Mai wurde schließlich auch Wustrow besetzt. Wir Kinder waren hinter den Erwachsenen her zu einer Anhöhe gelaufen. Von dort konnte man die einzige Straße überblicken, die sich auf das Fischland schlängelt. Sie kamen vom Westen, aus der Kreisstadt Ribnitz, Soldaten in abgerissenen Uniformen mit Panjewagen und strubbeligen, abgemagerten Pferden. Ohne einen einzigen Schuss abzugeben, zogen sie in das Dorf ein, wo sich fast alle Frauen versteckt hielten, viele hatten die Gesichter schwarz angemalt.
Kaum hatte sich die Schreckensnachricht vom Anmarsch der Russen verbreitet, eilte Oma Antonie auf den Hof. Sie hatte es auf meine Fahne abgesehen, die Fahne des Deutschen Reiches seit 1935, rot mit einem schwarzen Hakenkreuz in einem weißen Kreis. Oma Antonie versuchte den mit deutscher Gründlichkeit am fünfzig Zentimeter langen Fahnenstock befestigten Stoffteil abzureißen, brach, als ihr dies nicht gelang, den Stock einfach über ihrem Knie entzwei und steckte Stock und Fahne in das Feuer des Waschkessels, in dem gerade die große Wäsche kochte. Ich war entsetzt und verstand die Welt nicht mehr. Die müsse weg, erklärte Oma Antonie, weg, bevor die Russen kämen.
Meine Mutter verhielt sich erstaunlich ruhig. Sie hatte erst wenige Tage vor dem Einmarsch der Sowjettruppen ihr drittes Kind geboren, meinen Bruder Eckart. Als die Russen von der Landstraße abbogen, eine abenteuerliche Gestalt mit asiatischen Gesichtszügen und zwei weitere Soldaten in unser Haus traten, hörten wir als erstes, was schon Tausende vor uns gehört hatten und Tausende nach uns noch hören würden: »Uhri, Uhri.« Mutter reagierte geistesgegenwärtig und ließ blitzschnell ihre Armbanduhr vom Handgelenk in die Sesselritze rutschen, dann streckte sie die Arme hoch: Sie hatte keine Uhr.
Bald wurde requiriert und geklaut. Wer noch ein Auto hatte, der Arzt und einige wenige andere, musste es abliefern. Die Fahrzeuge wurden vor der Schule abgestellt. Wir Jungen kletterten heimlich in die unverschlossenen Gefährte, umfassten das Lenkrad – ein einzigartiges Vergnügen, besaß doch keiner unserer Väter ein Auto. Noch heute erinnere ich mich an den wunderbaren Geruch der Ledersitze und des Benzins. Ferner mussten Radios und Telefone abgeliefert werden; Fahrräder wurden nicht eingefordert, dafür aber in der Regel von den russischen Soldaten requiriert.
Die Seefahrtschule wurde okkupiert, die Tannen an ihrer Frontseite eine nach der anderen gefällt und zum Bau von Holzbaracken verwendet, die als Pferdeställe dienten. Nautische Geräte, Kreiselkompasse, mit denen die angehenden Steuerleute und Kapitäne ihr Handwerk erlernt hatten, fanden sich, achtlos weggeworfen, in unserem Garten wieder. Mehrere Häuser wurden für die Offiziere beschlagnahmt. Unsere Nachbarin Frau Fuchs, deren Wohnung nur durch den Eingangsflur von unserer getrennt war, musste zwei Zimmer und die Veranda an einen sowjetischen Major abtreten. Meine Mutter war darüber zunächst entsetzt. Doch der Major liebte uns Kinder von Herzen, nahm uns auf den Arm, das war zwar unangenehm, denn er roch nach Wodka, aber er lachte und schenkte uns Brot.
Die drei Gebäude, die unmittelbar an der Ostsee lagen – darunter das Haus meiner Großmutter Antonie –, wurden für militärische Zwecke genutzt. Den russischen Soldaten schien Großmutters Haus geeignet, um dort einen Ausguck zur See zu errichten. Sie stießen einfach das Rohrdach durch, warfen Kleidungsstücke und Möbel aus dem Fenster, einige Bücher wurden zerrissen, andere in russischer Schrift mit Losungen wie »Tod den deutschen Okkupanten!« versehen. Großmutter Antonie kam jedoch ungeschoren davon und durfte sich mit einem Teil ihrer Habe bei Bekannten im Dorf einmieten.
Mitte Juni 1945 teilte meine Mutter einem Bekannten in einem Brief mit, Flüchtlinge, Evakuierte und Ausländer müssten Wustrow innerhalb der nächsten Tage verlassen; es liefen sogar Gerüchte um, die ganze Küste werde aus militärischen Gründen geräumt. Dann reduzierte sich die Maßnahme offensichtlich auf die Sperrung des Strandes. Nicht einmal Kinder hatten Zugang zur Ostsee.
Mit fünf Jahren war ich zu klein, um auch nur annähernd zu erfassen, was um mich herum vorging. Mir erschien das Kriegsende vor allem interessant und abenteuerlich. Die Soldaten brachten Abwechslung in unsere kleine Dorfwelt, sie sahen anders aus, sprachen anders, benahmen sich anders – etwas Neues hatte begonnen.
Auch Jungen, die ein wenig älter waren als ich, nahmen das Geschehen zunächst eher von der sportlich-abenteuerlichen Seite. Sie fanden Koppel, Munitionstaschen und Munition, die haufenweise auf dem Hohen Ufer zwischen Wustrow und Ahrenshoop lagen, wo Küstengeschütze stationiert gewesen waren. Heute sind nicht nur die Militäranlagen aus der NS-Zeit, sondern auch aus der DDR-Zeit im Wasser verschwunden, denn die Ostseewellen tragen das Land am Hohen Ufer ab. Damals buddelten die Jungen die Kartuschen aus der Erde, klopften sie auf, schütteten das Schwarzpulver aus und veranstalteten Feuerwerke. Ein paar Jahre später war auch ich dabei. Wir häuften das Munitionspulver fast einen halben Meter hoch und schichteten Seetang, Steine und Sand darüber, nicht ohne zuvor eine kleine, ebenfalls mit Pulver aufgeschüttete Rinne dorthin geführt zu haben. Es war ein diebisches Vergnügen. Der Haufen flog in die Luft, und die Steine wirbelten durch die Gegend.
Wenn ich als Erwachsener zurückblicke, staune ich, welch harmlose Ereignisse im Gedächtnis des kleinen Jungen haften blieben. Erst viel später erfuhr ich, dass sich mehrere Wustrower unmittelbar vor dem Einmarsch der Sowjetarmee umgebracht hatten. Der Bildhauer Johann Jaenichen schnitt sich die Pulsadern auf; er war kein Nazi gewesen, die Gründe für seinen Freitod sind nicht bekannt. Unbekannt blieben auch die Motive des Selbstmords der Flüchtlingsfamilie Hennings; erst tötete das Ehepaar seine achtjährige Tochter, dann sich selbst. Der Dorfpolizist aus Wustrow erhängte sich mit seiner Frau auf dem Dachboden seines Hauses. In Ahrenshoop erschoss sich ein Ehepaar, das als fanatisches Nazi-Pärchen bekannt war. Offensichtlich fürchteten sie die Strafe der Sieger.
Die Verhaftungen von Männern zwischen fünfzehn und fünfzig blieben mir ebenfalls verborgen. Die wenigen, die sich im Dorf aufhielten, standen im Verdacht, Mitglied der NSDAP oder der SA gewesen zu sein; fast alle kamen ins Lager Fünfeichen bei Neubrandenburg, oder sie wurden in die Sowjetunion deportiert.
Auch von den Vergewaltigungen habe ich nichts bemerkt. Meine Mutter wurde zwar manchmal belästigt, dann stand ein Soldat grinsend auf der Türschwelle. Doch offensichtlich haben die Anwesenheit des Majors und das neugeborene Kind sie geschützt. Andere Frauen hingegen wurden abends um sieben zum Ausheben von Schützengräben auf den Deich befohlen. Sie hatten keine Chance zu entkommen. Vor ihnen die Ostsee, hinter ihnen Wiesen, in denen Flüchtende sofort auszumachen gewesen wären. Am Tag nach solchen Einsätzen erschienen dann einige in der Praxis unseres Arztes Dr. Meyer, der Scheidenspülungen vornahm, um Schwangerschaften zu verhindern. Im Frühjahr und Sommer 1945 suchten bis zu vierzig Menschen in seinem Haus Zuflucht, zwei Drittel von ihnen Frauen. Zur Abschreckung sowjetischer Soldaten hatte Familie Meyer das Bett der Großmutter gleich hinter der Eingangstür aufgestellt. Sie hatte Gelbsucht und war so quittegelb, dass ein Russe, wenn er sich tatsächlich über die Schwelle traute, gleich wieder kehrtmachte.
Die Soldaten hatten schreckliche Angst vor Typhus, Paratyphus und Infektionskrankheiten. Offiziere, bei denen man eine Geschlechtskrankheit feststellte, wurden zum einfachen Soldaten degradiert. Deswegen war Doktor Meyer auch bei den Besatzern gefragt. Einmal wurde er abends zum russischen Kommandanten gerufen, um dessen Tripper zu behandeln. Erst am nächsten Morgen kehrte der Arzt nach Hause zurück – sturzbetrunken, weil er die ganze Nacht hatte anstoßen müssen: »Sto gramm!« Die Familie war ihm trotzdem nicht gram, denn er brachte, eingewickelt in gestohlenes Leinen, ein Stück von einer requirierten Kuh mit: ein Dank des Kommandanten.
Bei uns sah es allerdings anders aus. Das Essen war knapp. Bald gab es keinen Zucker mehr, kein Brot, kein Mehl, nicht einmal Salz. Im Sommer liefen die Frauen zum Strand, schöpften Wasser aus der Ostsee und ließen es in großen Zinkwannen verdunsten. Die Methode war wenig ergiebig, gerade mal ein weißer Hauch setzte sich am Wannenboden ab, wenn das Wasser verdunstet war. Das Obst und Gemüse aus den Gärten und das wenige Vieh reichten nicht aus, um die Dorfbewohner zu ernähren, zumal die Einwohnerzahl durch den Zustrom der vielen Flüchtlinge aus Ostpreußen und Pommern bei Kriegsende wohl doppelt so hoch war wie vor dem Krieg. Einige Wustrower hatten etwas von dem Proviant retten können, den ein SS-Trupp zurückließ, als er sich im letzten Moment über die Ostsee nach Dänemark absetzte. Andere gingen auf Hamsterfahrt, setzten mit dem Dampfer über nach Ribnitz und zogen von Bauernhof zu Bauernhof, um Bettwäsche oder Tischdecken gegen Eier und Brot zu tauschen. Im Übrigen war es wichtig, dass es Fischer gab – Flüchtlinge aus Ostpreußen und Pommern, die Schollen aus der Ostsee holten, Sprotten und kleine Fische, die sie Tobis nannten.
Wo Jugendliche in den Familien waren, fiel das Organisieren leichter. Als beispielsweise eine der Kühe, die die Russen an der Küste von Wustrow nach Althagen trieben, am Hohen Ufer abstürzte, konnte, wer schnell genug zur Stelle war, mit einem Stück Fleisch nach Hause ziehen. Ein Sohn des Arztes stahl in sportlichem Ehrgeiz den russischen Soldaten sogar neun frei laufende Pferde. Sein Vater scheuchte sechs Tiere gleich wieder weg, eines aber spannte er vor das Gefährt, das ihm als Ersatz für sein eingezogenes Auto diente, ein weiteres tauschte er bei einem Bauern gegen eine Kuh. So trugen Jugendliche erheblich zum Überleben ihrer Familien bei.
Meine Mutter hatte es dagegen schwer, unsere Familie durchzubringen. Mein Vater, der kurz vor dem Einmarsch der Sowjettruppen von Ostpreußen in die Marine-Kriegsschule nach Flensburg-Mürwik versetzt worden war, war in englische Gefangenschaft geraten. Unter Aufsicht eines englischen und eines polnischen Verbindungsoffiziers hatte er ehemalige polnische Zwangsarbeiter auf Frachtschiffen in ihre Heimat zurückzubringen. Wir wussten zunächst nichts von seinem Verbleib, erst im Sommer 1946 kehrte er nach Hause zurück. Wir drei Kinder aber waren bei Kriegsende noch zu klein, um Mutter beistehen zu können. So zogen wir Ende 1945 von Wustrow zu den Großeltern Warremann nach Rostock, in die Räume, die Mutters Schwester gerade verlassen hatte, weil ihrem Mann eine Pfarrstelle in dem mecklenburgischen Dorf Sanitz zugewiesen worden war.
Großmutter Antonie blieb allein in Wustrow zurück. Sie hoffte auf die Rückgabe ihres Hauses an der See. Doch von den Russen ging das Haus an einen Großbetrieb über. Großmutter Antonie erhielt eine beleidigend niedrige Miete, das war ihre Rente. Als die ersten Pachtverträge ausliefen, musste sie weiter verpachten, zuletzt an einen großen Staatsbetrieb aus Magdeburg. Oma Antonie lebte in wechselnden Wohnungen, zuletzt im Pfarrhaus Wustrow. Sie starb 1964 bei dem Pastorenehepaar Hanns und Renate Wunderlich in dem Ort, den sie zu ihrer Wahlheimat gemacht hatte – aber nicht in dem Haus, das sie dort errichtet hatte. Wenn wir nach ihrem Tod den Ort besuchten, haben wir das Haus gemieden, der Anblick war zu trist.
Das Haus am Deich war für uns zum Zeichen von Willkür geworden. Es war unseres, aber gleichzeitig nicht unseres. Es verkam langsam, war mit seinem zerzausten Strohdach und einem angebauten Schuppen hässlich anzusehen – typisch für die DDR. Schließlich gingen wir vorbei wie an etwas Fremdem.
Das Haus war verloren – punktum. Jedenfalls war es kein großes Thema mehr. Seine weitere Geschichte ist eine von ungezählten DDR-Unrechtsgeschichten. Als mein Vater Mitte der achtziger Jahre nach Ablauf des letzten Pachtvertrages dem staatlichen Pächter mitteilte, er wolle das Haus künftig selber nutzen, er habe auch Kinder, Enkel und Urenkel, stieß er auf Ablehnung. Das Starkstromkombinat Magdeburg wollte Haus und Grundstück nicht räumen, zumal es dort inzwischen ohne Erlaubnis des Eigentümers eine große Klärgrube für seine benachbarten Ferienbungalows errichtet hatte.
Unser Vater klagte beim Kreisgericht auf Vertragserfüllung – und verlor. Er wandte sich an die nächste Instanz, das Bezirksgericht – und verlor. Die Nutzung seiner Immobilie durch einen sozialistischen Großbetrieb, so wurde ihm bedeutet, sei wichtiger als die private Nutzung. In zweiter Instanz wurde zudem der Paragraph des Pachtvertrages, der die Pachtzeit begrenzt hatte, aufgehoben. Nun war die Verpachtung unbefristet. Auf den Vorschlag seines Anwalts, er solle das offensichtlich rechtswidrige Urteil in Berlin durch das Oberste Gericht kassieren lassen, ging mein Vater nicht mehr ein. Erstens, sagte er, werde er in diesem Staat sowieso kein Recht erhalten, zweitens fehle ihm das Geld für das fragwürdige Unterfangen. Stattdessen eröffnete er uns Kindern: »Ich verschenk’ den Katen.«
In der DDR war das eine übliche Praxis. Wer beispielsweise ein Mietshaus in der Innenstadt besaß und mit den gesetzlich vorgeschriebenen Niedrigmieten nicht einmal die notwendigsten Reparaturen finanzieren konnte, musste sich zwangsläufig ruinieren. Viele alte Menschen haben daher die Städte gebeten, sie zu »retten« und sich die unrentablen Häuser schenken zu lassen.
Bild 13
Großmutter Antonies Haus – anders als heute noch einsam unmittelbar hinter dem Deich stehend. Wohnen konnte sie seit 1945 nicht mehr darin. Erst beschlagnahmte es die Sowjetarmee, später wurde es, zuletzt erzwungenermaßen, an große volkseigene Betriebe verpachtet. Nach 1989 kam es zurück in die Obhut der Familie und ist seither Feriendomizil für Enkel, Urenkel, Ururenkel und Feriengäste.
Mein Vater wäre ebenso verfahren, hätten seine erwachsenen Kinder ihn nicht daran gehindert. Wir machten ihm klar, dass man für ein großes Grundstück an der See immer Käufer finden könne. Um das übliche Vorkaufsrecht der Kommunen nicht fürchten zu müssen, sollte er unter staatlich anerkannten Persönlichkeiten nach einem Käufer suchen. Ein Verkauf an Partei- oder Staatsfunktionäre, an Militär-, Volkspolizei- oder Stasi-Personal schied für meinen Vater selbstverständlich aus. Am liebsten hätte er an unseren Bischof verkauft. Aber die Mecklenburger Bischöfe waren kritisch gegenüber dem Staat eingestellt, ihnen wäre kein Hauskauf erlaubt worden. Allerdings gab es Kirchenväter, die auf besserem Fuß mit der Staatsmacht standen. So wurde ein Anwalt beauftragt – er hieß Wolfgang Schnur –, in Berlin, Greifswald oder Thüringen nach einem Käufer zu suchen.
Zunächst zeigte der Anwalt selbst Interesse. Er hätte das Grundstück gern zum Einheitswert von 1934 erworben – zu einem Bruchteil des tatsächlichen Wertes also –, mehr Geld habe er nicht. Wir wollten zwar nicht reich werden, uns aber auch nicht für dumm verkaufen lassen und lehnten ab.
Anfang April 1987 schien die Suche doch noch zum Erfolg zu führen: Rechtsanwalt Wolfgang Schnur, alias IMB Torsten, ein langjähriger Mitarbeiter der Stasi, berichtete seinem Führungsoffizier Major Fiedler, dass ihm von Oberlandeskirchenrat Martin Kirchner, alias IM Küster, ebenfalls ein langjähriger Spitzel der Stasi, mitgeteilt worden sei, die Thüringer Landeskirche habe einen Beschluss zum Kauf des Hauses gefasst. Die Kirche konnte sowohl die Unterstützung vom Rat des Bezirks Erfurt als auch des Bezirks Rostock für ihr Anliegen gewinnen.
Von diesen Vorgängen hatte ich keinerlei Kenntnis. Völlig unvermittelt wurde ich als Leiter der Kirchentagsarbeit der Mecklenburgischen Landeskirche während eines Dienstgesprächs zur Vorbereitung des Kirchentags 1988 informiert, der Rat des Bezirks habe nichts dagegen einzuwenden, wenn ich mein Haus an der Ostsee verkaufen würde. Man wollte mir einen »Gefallen« tun, um mich gefügig zu machen. Ich verstand das Angebot sofort und sagte kühl: »Ich habe kein Haus. Meinen Sie meinen Vater?«
Überraschenderweise scheiterten die Verhandlungen mit der Thüringischen Landeskirche im Oktober 1988, von weiteren Interessenten hat Rechtsanwalt Schnur uns nichts mehr mitgeteilt. Offensichtlich war er völlig ausgelastet als gesuchter Strafverteidiger von Oppositionellen, als einer der effektivsten Informanten der Stasi und als aktiver Christ in Ehrenämtern der evangelischen Kirche. Die zivilrechtlichen Dinge mussten warten.
Sie blieben liegen, bis das Volk der DDR die Regierenden verjagte. Plötzlich war nichts mehr, wie es vorher war. Aus dem angesehenen Anwalt und angehenden Regierungschef der DDR von 1990 wurde eine Persona non grata, aus »Recht« wurde wieder Recht, arrogante Kombinatsleiter und Juristen verwandelten sich in entgegenkommende Vertragspartner.
Das Haus – inzwischen völlig verwahrlost – kam zurück zur Familie. Wir haben es mit Krediten instand setzen lassen und wie Oma Antonie Ferienwohnungen eingerichtet. Und wenn es irgend geht, kommen wir selbst zu Besuch: vier alt gewordene Enkelkinder, zehn Urenkel und sechzehn Ururenkel. In jeder Wohnung des Hauses hängen einige alte Fotos, die Gästen, die es interessiert, ein klein wenig über die Geschichte des Hauses erzählen. Und über Oma Antonie, »de Fru, de woll nich ganz klauk wier«.
Winter im Sommer
Es war der 27. Juni. Dieser Tag spielte in unserer Familie eine besondere Rolle. Er war nicht nur der Siebenschläfer, an dem sich entscheiden würde, wie der Sommer sein sollte. Der 27. Juni war Oma Antonies Geburtstag. 1951 wurde sie 71 Jahre alt. Meine Eltern fuhren mit der jüngsten Schwester, der damals vierjährigen Sabine, zur Geburtstagsfeier in die Lindenstraße nach Wustrow. Am nächsten Morgen kehrte unsere Mutter allein zurück, aufgelöst, mit dem Kind auf dem Arm.
»Sie haben Vater abgeholt.«
Tags zuvor waren kurz vor 19 Uhr zwei Männer in Zivil bei Oma Antonie aufgetaucht: Ob sie Joachim Gauck hier finden könnten? Sie hatten ihn bereits in unserer Rostocker Wohnung gesucht, dort aber von meiner Schwester Marianne erfahren, dass er sich in Wustrow aufhalte. Auf der Neptun–Werft sei ein Unfall geschehen, behaupteten die Männer, mein Vater – damals Arbeitsschutzinspektor für Schifffahrt in Rostock – müsse mitkommen, um die Sache zu untersuchen.
Die beiden warteten eine Stunde, bis Vater von einem Besuch bei einem Freund zurückkehrte, dann zogen sie sich mit ihm in die Gartenlaube zurück. Ihm sei das Ganze gleich suspekt erschienen, hat Vater später erzählt. Kurz hätte er überlegt: Ich könnte durch den Garten weglaufen Richtung Seefahrtschule, könnte mich verbergen. Aber er fürchtete, dann würde seiner Familie etwas geschehen, und so erklärte er sich bereit mitzufahren. Meine Mutter griff hastig nach Tasche und Jacke, um ihn zu begleiten, aber sie wurde zurückgewiesen. Vater folgte den beiden Männern und stieg mit ihnen in einen blauen Opel. Seitdem war er verschwunden.
Eben: abgeholt.
Selbst uns Kindern war dieses Wort vertraut, es signalisierte Unheil und Gefahr. Dass schon in der Ära der braunen Diktatur »abholen« eine böse Bedeutung hatte, würde ich erst später erfahren. Aber alle wussten damals: Wer in der Kneipe zu tief ins Glas schaute und ungeschützt redete, wer bei Familienfeiern zu laut politische Witze erzählte oder Lieder von gestern sang, wurde schnell gewarnt: »Halt den Mund – oder willst du abgeholt werden?« Wir hatten schon gehört von solchen Menschen, in der Regel kannten wir sie aber nicht.
Später, als ich Uwe Johnsons »Jahrestage« las, erhielten diese mecklenburgischen Menschen für mich Namen: Prof. Dr. jur. Tartarin-Tarnheyden aus Rostock, 1945 verurteilt zu zehn Jahren Zwangsarbeit; Prof. Ernst Lübcke, 1946 verhaftet, in der Sowjetunion verschwunden; Erich-Otto Paepke, Gerd-Manfred Ahrenholz, Hans Lücht, Hermann Jansen, Studentenpfarrer Joachim Reincke – jeweils 25 Jahre Zwangsarbeit usw. usw.
Später hörte ich auch von den vielen Jugendlichen, die unter der aberwitzigen Beschuldigung, »Werwölfe« zu sein, als angebliche nationalsozialistische Untergrundkämpfer in Speziallagern wie Buchenwald, Sachsenhausen und Fünfeichen in Mecklenburg verschwanden, die die Sowjets von den Nationalsozialisten übernommen hatten.
Nach dem Krieg war es zweifellos gerechtfertigt, führende Nationalsozialisten oder Funktionsträger von SS, SA, Gestapo, des Sicherheitsdienstes (SD) und des politischen Führungskorps zu verhaften und zu verurteilen. Die meisten Verhafteten wurden aber willkürlich Opfer des Regimes, waren verleumdet, aus unterschiedlichen Gründen denunziert worden. Oft handelte es sich um relativ untergeordnete NS-Mitläufer und natürlich um Gegner des stalinistischen Systems. Es traf auch völlig Unschuldige wie den Nazi-Gegner und evangelischen Theologen Ernst Lohmeyer. Anfang der dreißiger Jahre war er Professor und Rektor an der Universität Breslau gewesen, 1935 wegen seines demonstrativen Eintretens für jüdische Kollegen – unter anderem für Martin Buber – an die Universität Greifswald strafversetzt worden. Unmittelbar nach Kriegsende war ihm das Amt des Universitätsrektors angetragen worden, doch im Februar 1946 wurde er aus unbekannten Gründen vom NKWD verhaftet, wenige Tage später seines Amtes enthoben und am 19. September 1946 erschossen. Fünfzig Jahre später – 1996 – wurde das Todesurteil gegen ihn in Moskau formell aufgehoben.
Uns waren derartige Fälle damals nicht bekannt. Wir wussten nur: Vater war weder ein Funktionsträger in der NSDAP gewesen, noch hatte er der Gestapo, der SS oder SA angehört. Er hatte in der DDR keine Sabotage und keine antisowjetische Propaganda betrieben, er hatte keinen Fluchtversuch unternommen, und er besaß keine Waffen. Warum also hatte man ihn abgeholt?
Mutter und Oma Antonie riefen an jenem Tag sofort auf der Neptun-Werft an; dort war von einem Unfall nichts bekannt. Sie liefen zur Staatssicherheit und zur Kriminalpolizei. Sie gaben eine Vermisstenanzeige auf und fragten täglich auf den Revieren der Volkspolizei nach. Überall zuckte man die Schultern. Manchmal hörten sie: »Wenn die Russen Ihren Mann geholt haben, können wir nichts machen.«
Oma Antonie wollte sich mit dieser Auskunft nicht zufriedengeben. Anfang Juli schrieb sie eine Eingabe an den Staatspräsidenten Wilhelm Pieck und schickte, als sie keine Antwort erhielt, im September eine zweite hinterher: »Voller Verzweiflung und voller Vertrauen bitte ich Sie, mir zu helfen, meinen Sohn zu finden. Meine Schwiegertochter ist gesundheitlich völlig zusammengebrochen, und ich suche meinen einzigen Sohn.« Sie schrieb an den Staatssicherheitsdienst in Schwerin, den »Ersten Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft« in Rostock, an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz/Delegation in Deutschland. Sie schickte meine Mutter zum Sohn des Ministerpräsidenten Otto Grotewohl, der in Wustrow Urlaub machte, und suchte selbst den Kontakt zu Gerhart Eisler, dem Verantwortlichen der DDR-Regierung für Rundfunk und Presse, als dieser sich in Ahrenshoop aufhielt.
Wochenlang fuhr sie von Gefängnis zu Gefängnis, von Mecklenburg bis Sachsen, von Rostock bis Bautzen. Doch nirgends war
Dreizehnte Auflage
Copyright © 2009 by Siedler Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: Rothfos + Gabler, Hamburg, unter Verwendung einer Fotografie von Jonas Maron Lektorat und Satz: Ditta Ahmadi, Berlin
eISBN: 978-3-641-03901-1
www.siedler-verlag.de
www.randomhouse.de
Leseprobe