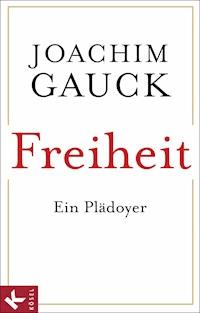10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 20,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siedler Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was unsere Demokratie bedroht: Joachim Gauck über die Gefahren von außen und innen - der Bestseller in aktualisierter Fassung
Die Erfolge der Rechts- und Linkspopulisten nicht nur in Deutschland und die russische Aggression gegen die Ukraine zeigen, wie sehr unsere liberale Demokratie von innen und außen bedroht ist. Wie kam es dazu? Joachim Gauck geht der Frage nach, weshalb das Vertrauen vieler Bürgerinnen und Bürger in die liberalen Prinzipien unserer Demokratie erschüttert ist.
Zugleich lotet er aus, warum wir heute vor den Scherben einer Ostpolitik stehen, die im Verhältnis zu Russland allzu lange nur auf die Prinzipien »Frieden vor Freiheit« und »Wandel durch Handel« gesetzt hat. Sehr eindrücklich und zum Teil auf persönliche Weise zeigt er, wie in den letzten Jahren so manche Gewissheit über die Stabilität unserer Demokratie verloren ging – und wie es uns gelingen kann, auch in Zukunft unsere liberalen Freiheiten zu verteidigen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 289
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Unsere Demokratie wird von außen und innen erschüttert: Der Weckruf des Altbundespräsidenten
Der russische Überfall auf die Ukraine bedroht unsere liberale Demokratie in einem Moment, in dem sie zugleich auch von innen unter Druck steht. Wie ist es dazu gekommen? Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck geht gemeinsam mit seiner Co-Autorin Helga Hirsch der Frage nach, weshalb das Vertrauen vieler Bürgerinnen und Bürger in unsere liberale Demokratie erschüttert ist. Was bedroht unsere Demokratie von innen heraus? Welche Rolle spielen autoritäre und libertäre Dispositionen in Krisenzeiten? Wie viel Einwanderung verträgt eine Demokratie?
Zugleich lotet er aus, warum wir heute vor den Scherben einer Ostpolitik stehen, die im Verhältnis zu Russland allzu lange nur auf die Prinzipien »Frieden vor Freiheit« und »Wandel durch Handel« gesetzt hat. Sehr eindrücklich und zum Teil auf persönliche Weise zeigt Joachim Gauck, wie in den letzten Jahren so manche Gewissheit über die Stabilität unserer Demokratie verloren ging – und wie es uns gelingen kann, auch in Zukunft unsere Freiheiten zu verteidigen und tatsächlich eine wehrhafte Demokratie zu werden.
Joachim Gauck, geboren 1940 in Rostock, arbeitete dort bis 1989 als Pastor. Er war Mitinitiator des kirchlichen und öffentlichen Widerstandes gegen die SED-Diktatur, politisch aktiv als Sprecher des Neuen Forums in seiner Heimatstadt und sodann als Abgeordneter der ersten freien Volkskammer. Von 1990 bis 2000 war er Bundesbeauftragter für die Stasiunterlagen, von 2012 bis 2017 elfter Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland. Er erhielt zahlreiche Ehrungen und Auszeichnungen, u. a. den Hannah-Arendt-Preis, den Geschwister-Scholl-Preis, den Europäischen Menschenrechtspreis und den Ludwig-Börne-Preis. Seine Autobiographie »Winter im Sommer – Frühling im Herbst« erschien 2009 im Siedler Verlag.
Helga Hirsch, geboren 1948, freiberufliche Publizistin, war unter anderem Korrespondentin der Wochenzeitung DIEZEIT in Warschau. Für ihre Arbeit erhielt Helga Hirsch mehrere Auszeichnungen, etwa den deutsch-polnischen Journalistenpreis. Sie veröffentlichte zahlreiche Bücher, darunter »Gehen oder bleiben? Eine Geschichte der Juden in Schlesien und Pommern 1945–1957« (2011) und »Endlich wieder leben. Die fünfziger Jahre im Rückblick von Frauen« (Siedler 2012). In Zusammenarbeit mit Joachim Gauck entstand dessen Autobiographie »Winter im Sommer – Frühling im Herbst«.
Besuchen Sie uns auf www.siedler-verlag.de
Joachim Gauck
Helga Hirsch
Erschütterungen
Was unsere Demokratie von außen und innen bedroht
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © dieser Ausgabe 2025 Pantheon Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 MünchenCopyright © 2023 by Siedler Verlag
Lektorat: Ludger Ikas
Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Coverabbildung: © Jens Gyarmaty/laif
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-31193-3V005
www.siedler-verlag.de
Inhalt
Ein paar Worte zur Einleitung
Teil I
Die Zeitenwende kam schon 2014
Die zwei Phasen der Entspannungspolitik
Der ungehörte Weckruf
Die neue Ostpolitik
Frieden um jeden Preis?
Was wir nicht gesehen haben
Russlands besonderer Weg
Putin: postkommunistisch und nationalistisch
Der Mythos der Einkreisung
Russland und die Ukraine
Die Gründe für unsere Realitätsblindheit
Die Wahrnehmungslücke
Woher kommt die Rücksichtnahme gegenüber Russland?
Regierung: Den Feind nicht denken wollen
Gesellschaft: Den Feind »verstehen« wollen
Für eine wehrhafte Demokratie
Wehrbereit oder pazifistisch?
Kämpfen – aber wofür? (»We shall never surrender«)
Noch einmal: Frieden um jeden Preis?
Teil II
Demokratie – ein System der ungesicherten Gewissheiten
Die Drift zum Autoritären
Die »einfachen« Beschädigungen der Demokratie
Auf der Suche nach Teilhabe
Die Subjektivierung des Politischen
Die autoritäre Disposition
Die libertäre Überdehnung des Liberalen
Wie viel Einwanderung verträgt eine Demokratie?
Wir und die anderen
Fremdeln ist (noch) kein Rassismus
Multikulturalismus als Problem
Postkoloniale Studien und Critical Race Theory – eine problematische Weichenstellung
Über die Weißen in der Geschichte
Die antirassistische Instrumentalisierung der Geschichte
Gegen die Konkurrenz der Opfer
Gegen selektive Solidarität – die Menschenrechte sind universell
Ein paar Worte zum Schluss
Anmerkungen
Ein paar Worte zur Einleitung
Dreimal stand sie mir vor Augen, auf je eigene Weise, unsere Demokratie.
Dreimal auch gab es eine je eigene Beziehung zu ihr:
Als ich jung war und in der Diktatur lebte, war sie das ferne, leuchtende Sehnsuchtsziel.
Als ich die Mitte meines Lebens überschritten hatte, eine friedliche Revolution erlebt und mitgestaltet hatte, da war sie der endlich erreichte Ankunftsort – festgegründet und sicher, gut, dort zu wohnen.
Nun, am Abend meines Lebens, hat sich meine Sicht auf sie noch einmal verändert. Wovon ich einst träumte und was mich danach beheimatete, ist nicht die ewig festgefügte Ordnung, das unumstößlich Gute, wo die Gerechten in stabiler Sicherheit leben. Speziell das Gefühl der Sicherheit hat sich reduziert. Die Demokratie zeigt jetzt deutlich ihre Schwächen. Sie erscheint mir manchmal wie ein Gelände, in dem die Bürger zu lange sorglos in den Tag lebten und dabei ignorierten, dass ihnen von außen und innen tatsächlich ernstzunehmende Gefahren drohten.
Ebendarum soll es in diesem Buch gehen – um die doppelte Bedrohung, der unsere liberale Demokratie ausgesetzt ist: um die Bedrohung von außen seitens des imperialen russischen Nachbarn, der das völkerrechtliche Gewaltverbot missachtet, und um die Bedrohung von innen seitens autoritärer, populistischer Kräfte, die den Pluralismus und die Rechtsstaatlichkeit infrage stellen. Offensichtlich bedurfte es erst tiefgreifender Erschütterungen, damit wir uns diesen Gefahren stellten, die beide letztlich demselben Motiv entspringen: einer Ablehnung der Moderne, einer Gegnerschaft zur liberalen Demokratie.
Inzwischen haben viele erkannt, dass dringender Handlungsbedarf besteht. Nur wenn wir die Außenmauern festigen, die Risse im Fundament ausbessern und die Demokratie den neuen Gegebenheiten anpassen, kann sie zukunftsfest werden. Doch um aus den Versäumnissen und Fehlern zu lernen, ist es erforderlich, sich einigen unbequemen Fragen zu stellen: Warum haben wir die Verletzung des völkerrechtlichen Gewaltverbots durch Russland und die territoriale Unterwerfung eines demokratischen Staates in Europa nicht kommen sehen? Warum haben wir zu lange und zu naiv allein auf Diplomatie und »Wandel durch Handel« gesetzt? Und wäre unsere Gesellschaft überhaupt bereit, die liberale Demokratie notfalls mit Entschlossenheit zu verteidigen?
Entsprechend selbstkritisch gilt es den Zustand unserer Demokratie im Innern zu betrachten: Sind wir uns ausreichend bewusst, wie schnell etwa demokratische Institutionen – ganz legal – um ihre Unabhängigkeit gebracht und für illiberale Ziele missbraucht werden können? Warum kommt es zu Polarisierung und Radikalisierung? Haben die liberalen Kräfte genügend Widerstandskraft, um den Illiberalen den Wind aus den Segeln zu nehmen? Wissen wir Bürger überhaupt zu schätzen, was uns Freiheit und Wohlstand sichert?
Dieses Buch ist kein Lehrbuch und hat nicht den Anspruch, solche großen politischen Problemfelder zu analysieren wie den Klimawandel, die Verteidigungsfähigkeit oder die Digitalisierung. Es ist vielmehr die Selbstvergewisserung eines Bürgers, der in diesen sich rasant verändernden Zeiten nach den Ursachen aktueller Erschütterungen sucht und sich fragt: Warum haben so viele Menschen nur ein geringes politisches Selbstvertrauen und ein schwaches Bewusstsein von der Kraft unserer Werte? Betrachten zu viele den Westen gar als ein Auslaufmodell? Scheitert er eventuell an sich selbst? Insofern fragt dieses Buch nach den Denkweisen, die die letzten Regierungen zu fehlerhaften Entscheidungen geführt haben und von der Mehrheit der Gesellschaft getragen wurden. Und es schildert dabei auch meinen eigenen Lernprozess.
Nicht zuletzt soll dabei deutlich werden: Wenn sich die Welt um uns herum verändert, muss sich die Demokratie mit ihr verändern. Wenn unser demokratisches und liberales Land von außen bedroht wird, muss es sich entschiedener wehrhaft machen. Wirklicher Frieden ist nur in Freiheit zu sichern. Wenn unser Land von innen angegriffen wird, muss es resistent werden gegen illiberale, fundamentalistische und populistische Kräfte aller Art. Die gegenwärtigen Erschütterungen und Veränderungen können unsere Demokratie am Ende nur dann wirklich bedrohen, wenn wir, die Bürgerinnen und Bürger, allein mit Angst oder Ignoranz reagieren. Wenn wir uns der Wahrnehmung der Wirklichkeit entziehen und es an ernst zu nehmender Bereitschaft fehlen lassen, das zu verteidigen, was unsere Väter und Mütter zusammen mit uns an Bewahrenswertem geschaffen haben.
Es gibt keinen Stillstand. Nicht einmal für Menschen, die am Abend ihres Lebens stehen. Die Erfahrung eines langen Lebens ist allerdings auch ein Gut, das mich zu sagen berechtigt: Ich weiß, wie viel Kraft dem Menschen innewohnt, wie viel er zu gestalten und wie er tatsächlich Dinge zum Guten zu wenden vermag.
P. S.
Noch ein paar Worte zu einigen Schreibweisen. Ich habe mich entschieden, in diesem Buch für ukrainische Städte und Flüsse die ukrainischen Namen zu benutzen. Bei den bisher üblichen Kennzeichnungen handelte es sich in der Regel um Transkriptionen aus der russischen Sprache. Doch wenn wir lernen wollen, die Geschichte der Ukraine aus der russischen Dominanz herauszulösen, dann hat dies auch bei den Namen zu geschehen. Deswegen rede ich von Kyjiw, von Charkiw und vom Dnipro.
Im Übrigen gelten eingeführte deutsche Schreibweisen weiter – für Galizien, für Wolhynien, und Lwiw darf auch Lemberg heißen.
Teil I
Die Zeitenwende kam schon 2014
Der 1. September 2014 war ein kühler und windiger Tag, die Sonne drang nur spärlich durch einen grauen, wolkenverhangenen Himmel. Anlässlich des 75. Jahrestages des Überfalls der Wehrmacht auf Polen fand auf der Westerplatte, einer Halbinsel direkt vor der Hafenstadt Danzig, Polens zentrale Gedenkfeier statt; der polnische Staatspräsident hatte den deutschen Bundespräsidenten eingeladen. Eine bewegende Einladung war das. Ein deutsches Staatsoberhaupt, im Krieg geboren, Sohn eines Mannes, der im besetzten Polen nur wenige Kilometer entfernt als Marineoffizier eingesetzt war, sollte an diesem für die polnische Nation so wichtigen Gedenktag sprechen. Die Schüsse des Schlachtschiffes Schleswig-Holstein auf ein Munitionslager der polnischen Armee auf der Westerplatte am 1. September 1939 um 4.47 Uhr gelten als Beginn des Zweiten Weltkriegs.
Sieben Tage lang hielten die polnischen Verteidiger damals mehreren Großangriffen, heftigem Artilleriebeschuss und zwei Luftangriffen der deutschen Übermacht stand. Ihre Kampfbereitschaft nötigte sogar den deutschen Militärs Respekt ab. Als die polnischen Soldaten schließlich kapitulierten, salutierten deutsche Offiziere vor ihnen; der polnische Kommandant durfte seinen Offizierssäbel mit in die Gefangenschaft nehmen.
Die Westerplatte ist für Polen mehr als ein historischer Ort; sie ist auch ein Symbol für Widerstand und Opferbereitschaft geworden. Die Westerplatte, so erklärte Papst Johannes Paul II. auf einer Großversammlung von Jugendlichen 1987 im noch kommunistischen Polen, sei »eine Pflicht, eine Verpflichtung, vor der man sich nicht drücken kann. Man kann nicht ›desertieren‹. Schließlich gilt es eine gewisse Ordnung von Wahrheiten und Werten aufrechtzuerhalten und zu verteidigen, in sich und in seiner Umgebung – so wie auf der Westerplatte.«[1]
Den Anlass für die Gedenkfeier 2014 lieferte zwar die Geschichte. Doch die Sorge galt der Gegenwart. Knapp 2000 Kilometer entfernt, im ukrainischen Donbas, herrschte seit einigen Monaten Krieg. Nach der Krim-Annexion mithilfe seiner »grünen Männchen« hatte der Kreml den Konflikt in die Region von Donezk und Luhansk ausgeweitet, prorussische Separatisten bewaffnet und die Einheit des ukrainischen Staates zerstört. Täglich kamen Menschen ums Leben, Soldaten und Zivilisten. Der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen berichtete von Freiheitsberaubungen, Entführungen, Folterungen und Exekutionen, selbst OSZE-Beobachter wurden verhaftet. Mitte Juli war eine malaysische Passagiermaschine über dem umkämpften Territorium abgeschossen worden. Alle 298 Menschen an Bord kamen ums Leben. Wie wir später erfuhren, war die Maschine von einer Buk-Rakete aus den Beständen der russischen Armee getroffen worden. Moskau jedoch bestritt jede Verwicklung – es sei »nicht Teil des Konflikts« –, obwohl es die besetzten Gebiete erkennbar steuerte. Die der Ukraine in der Charta von Paris 1990 allgemein und im Budapester Memorandum von 1994 speziell zugesicherte Unverletzlichkeit ihrer Grenzen hatte keinen Bestand mehr. Es war eine für Europa schockierende Erfahrung. Pacta sunt servanda galt offenkundig nicht mehr. Russland demonstrierte unverhohlen seine neoimperialen Pläne.
»Weil wir am Recht festhalten, weil wir es stärken und nicht dulden, dass es durch das Recht des Stärkeren ersetzt wird, stellen wir uns jenen entgegen, die internationales Recht brechen, fremdes Territorium annektieren und Abspaltung in fremden Ländern militärisch unterstützen«, sagte ich daher in meiner Rede auf der windigen Halbinsel. Und fügte hinzu: »Die Geschichte lehrt uns, dass territoriale Zugeständnisse den Appetit von Aggressoren oft nur vergrößern.«[2]
Die Reaktionen auf die Rede in Deutschland und Polen hätten unterschiedlicher nicht sein können. Zwar begrüßten in Deutschland einige Kommentatoren, dass die aggressive Politik Russlands verurteilt worden sei. »Wann hat ein Bundespräsident je so offen gesprochen? Wann waren sich Deutschland und Polen so einig in der Beurteilung Russlands?«[3] Der Westen dürfe nicht mehr jeden Regelbruch hinnehmen und nicht mehr länger zurückweichen, wenn Putin weiter ausprobiere, wie weit er zu weit gehen könne.[4] Bei linken und linksliberalen Publizisten und Historikern hingegen war von einem »präsidialen Fehlgriff ersten Ranges« die Rede, von einer »Eskalation der Worte«, sogar von einem »Säbelrasseln«. Die Rede sei einseitig: Müsste nicht auch Russlands Sicherheitsbedürfnis gegenüber der NATO berücksichtigt werden? Die Rede sei »unbesonnen«: Sei nicht gerade gegenüber Russland als einem Opfer deutscher Aggression mehr Bescheidenheit und Zurückhaltung angezeigt?[5] Der Gesprächsfaden mit Moskau dürfe nicht abreißen, Russland werde immer Deutschlands Nachbar bleiben. Und vor allem: Ein Bundespräsident habe ein Versöhner zu sein und die biblische Botschaft zu beherzigen, die die Völker lehre, ihre Schwerter zu Pflugscharen zu formen, sodass sie es verlernten, Krieg zu führen.[6]
Dann gab es die andere, die polnische Seite. Am Tag der Gedenkfeier erschien in Polen ein Aufruf polnischer Intellektueller und Künstler. Der ehemalige Außenminister Władysław Bartoszewski, die spätere Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk und andere dürften ausgedrückt haben, was wohl fast alle Polen dachten. Auch für sie galt, dass Russland immer der Nachbar ihres Landes bleiben würde. Doch sie zogen daraus völlig andere Schlüsse. Denn was Appeasement-Politik gebracht habe, hätten sie bitter erfahren. Engländer und Franzosen seien einst Hitler nicht in den Arm gefallen, als er sich das Sudetenland einverleibte, als er die Tschechoslowakei zerschlug, als er den »Anschluss« von Österreich erzwang und schließlich Polen überfiel. »Sie dachten, um den Preis des Sterbens der Stadt Danzig könnten sie ihr eigenes Leben retten.«[7] Aber sie hatten sich verrechnet. Hitler besetzte auch Paris und warf Bomben auf London.
Nun, 2014, warnte die polnische Seite Deutschland: dass es sich nicht weiter abhängig machen dürfe von russischem Gas, dass es nicht erpressbar werden dürfe. »Wer heute Putin nicht ›No pasarán‹ entgegenruft, macht die Europäische Union lächerlich und willigt ein, dass die Weltordnung umgestürzt wird […]. Gestern Danzig, heute Donezk: Wir dürfen nicht zulassen, dass Europa auf viele Jahre mit einer offenen, blutenden Wunde lebt.«[8]
Sie sahen es. Wir wollten es nicht sehen.
Im Rückblick ist es überdeutlich. Die Zeitenwende trat bereits 2014 ein. Spätestens, jedenfalls für die, die sehen konnten. Ich selbst sah die Gefährlichkeit Russlands. Aber hätte mich damals jemand gefragt, ob ich mir vorstellen könne, dass Russland seine Aggression noch ausweitet, so hätte ich geantwortet: Eher nein.
Die zwei Phasen der Entspannungspolitik
Der ungehörte Weckruf
Es gibt etwas, was für viele Menschen den 24. Februar 2022 mit dem 11. September 2001 verbindet. Viele dürften sich erinnern, wo sie sich befanden, als die von Islamisten gesteuerten Flugzeuge in das World Trade Center flogen; und fast jeder dürfte wissen, wo ihn die Nachricht vom russischen Einmarsch in die Ukraine erreichte. Beide Male brach eine Gegenwelt mörderischer Gewalt in den Alltag von Menschen ein, die Tausende das Leben kostete und bei Millionen Gefühle elementarer Bedrohung erzeugte. Sie fanden sich plötzlich in einer ganz anderen Lebenswelt wieder – erschreckt, verunsichert, verstört und vor allem: überrascht. Wir im Westen haben noch immer daran glauben wollen, dass die Welt nach dem Ende des Kalten Krieges berechenbarer, demokratischer, friedlicher würde. Die wenigsten haben den Islamisten einen solchen Anschlag wie auf das World Trade Center zugetraut; und die wenigsten dürften Putin für so »wahnsinnig« gehalten haben, dass er die ganze Ukraine angreift.
Doch er tat, was den USA, den europäischen Gesellschaften und auch vielen Russen und Ukrainern nicht rational erschien. Er handelte nach einer anderen Logik und drängte auf bestürzende Weise auf eine Revision von Grenzen und geopolitischen Einflusszonen. Erst verleibte er sich gewaltsam die Krim ein und besetzte die Ostukraine; acht Jahre später startete er einen Generalangriff auf die Ukraine und suchte die ukrainische Nation auszulöschen.
Im Jahr 2014 entwarfen die meisten Politiker und viele Intellektuelle in Deutschland und Europa noch eine geschönte Realität. Viele, die ansonsten jeden Verstoß der USA gegen das Völkerrecht brandmarkten, erwiesen sich gegenüber russischen Verstößen als äußerst nachsichtig und gutgläubig. Bekannte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens – von Alice Schwarzer bis Margot Käßmann, auch führende Sozialdemokraten wie Helmut Schmidt und Egon Bahr – spielten den russischen Überfall auf die Krim herunter und äußerten teilweise sogar Verständnis für Putin. Besonders engagiert zeigte sich Erhard Eppler, einst ein Schwergewicht in der Sozialdemokratie, Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Mitglied der Grundwertekommission der SPD, ein Linker, jahrzehntelang engagiert im Kampf für den Frieden. Von jemandem wie ihm hätte man ein Gespür für imperiales Verhalten und zumindest ein gewisses Mitgefühl mit einer angegriffenen Nation erwarten können. Doch Eppler schlug sich auf die Seite des Aggressors. Er könne sich nicht vorstellen, so Eppler nur wenige Tage nach der Annexion der Krim, dass ein russischer Präsident geduldig zusehen werde, wie eine »eindeutig antirussische Regierung« die Ukraine in Richtung NATO zu führen versuche. Immerhin sei der Kern der Ukraine seit mehr als 300 Jahren Teil des russischen Zarenreiches. Und bei einem Beitritt der Ukraine zur NATO würde das westliche Verteidigungsbündnis »ins Herz Russlands« vorstoßen.[1]
Natürlich hätten die Russen dabei mitgewirkt, dass sich die Krim der Russischen Föderation angeschlossen habe, gab Eppler zu. »Aber immerhin hat kein einziger Mensch dafür sterben müssen.« Im Übrigen sei die Weltgeschichte kein Amtsgericht. Was nütze es, auf das Völkerrecht zu verweisen, wenn sich die Betroffenen dadurch nicht gut aufgehoben fühlten? Eppler jedenfalls gab vor zu wissen, dass sich »die meisten Krimbewohner in Russland ganz wohl, vielleicht sogar zuhause« fühlten.[2] Dabei hatte die Mehrheit der Krimbewohner 1991 keineswegs für Russland optiert, sondern für die Unabhängigkeit der Ukraine gestimmt. Aber wer wusste das schon in Deutschland?
Über den Gebieten zwischen Berlin und Moskau schien ein Grauschleier zu liegen, der das ukrainische Terrain noch stärker als das über Polen und dem Baltikum verhüllte. Es gebe viele Dinge, erklärte der für seine offenen Worte bekannte ukrainische Schriftsteller Juri Andruchowytsch nach der Krim-Annexion 2014, von denen die Deutschen kaum etwas wüssten, weil sie von Medien und Politikern nach ein und denselben Schemata und Schablonen informiert würden. Die Ukraine sei aber »mehr als ein Territorium für den Gastransit zwischen Russland und Europa. Sie ist ein Land mit einer eigenen, extrem schwierigen und tragischen Geschichte und einer neu gefundenen Identität. [...] In der Ukraine wird heute ein Re-Make des historischen Dramas aufgeführt, in dem Zentraleuropa als Territorium fungiert, wo die autokratischen Werte zum wiederholten Male einen Angriff gegen die liberalen starten.«[3]
Ich gestehe, dass auch ich nicht viel von dem Land wusste, bevor sich Freiheitsbewegungen 2004 und 2014 auf dem Maidan gegen russischen Druck und eigene korrupte Regierungen zu wehren begannen. Bevor Dutzende von Demonstranten erschossen wurden und der korrupte, moskautreue ukrainische Staatspräsident Wiktor Janukowytsch nach Russland floh. Doch im Unterschied zu jenen, die noch nach der Annexion der Krim Verständnis für Putin äußerten, hielt ich es als deutscher Bundespräsident für angezeigter, nach Kyjiw zu reisen, um am 22. Februar 2015 zusammen mit dem polnischen Präsidenten Bronisław Komorowski, dem EU-Ratspräsidenten Donald Tusk und der litauischen Präsidentin Dalia Grybauskaitė an der Seite des damaligen ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko am »Marsch der Würde« teilzunehmen. Etwa 10 000 Menschen gedachten an jenem grauen Februartag der über hundert Demonstranten, die umgekommen waren, als sie ein Jahr zuvor auf dem Maidan, dem zentralen Platz der ukrainischen Hauptstadt, gegen eine Annäherung ihres Landes an Russland protestiert und eine proeuropäische Orientierung gefordert hatten. Und wir gedachten der mehr als 5000 Menschen, die bereits damals im Kampf gegen die moskautreuen Separatisten im Donbas umgekommen waren.
Doch es mussten acht weitere Jahre vergehen, ein zweites Mal mussten russische Soldaten in die Ukraine eindringen, bevor sich auch in der westlichen Welt eine Sichtweise durchsetzte, wie sie Präsident Joe Biden dann in seiner Rede in Warschau am 26. März 2022 als »Kampf zwischen Demokratie und Autokratie« umriss, als Kampf zwischen Freiheit und Unterdrückung, zwischen einer regelbasierten Ordnung und einer Ordnung, die von der Macht des Stärkeren beherrscht wird.
Und so sehen wir heute deutlich die Fehler einer Ostpolitik, die unbeirrt daran glauben wollte, dass die ganze Menschheit mit ihrer Friedenssehnsucht das alle Systemdifferenzen überwölbende Ziel eines allgemein akzeptierten Friedens anstreben würde. Dass Diplomatie imstande sei, die ganz ordinäre Machtpolitik zu zähmen, und dass Deutschland eine Vermittlerrolle zwischen »dem Westen« und Russland spielen könne. Wir untersagten uns, eine Welt zu denken, in der Putins Russland kein Partner und Verbündeter mehr sein würde, sondern ein Gegner, der seine Ziele sogar mit militärischer Gewalt durchsetzen könnte.
Inzwischen allerdings versteht ein aufgeschrecktes und aufgewachtes Deutschland: Es ist nicht nur ein moralisches Gebot, sondern ein Gebot der politischen Vernunft, sich neu aufzustellen, politisch, militärisch und mental. Und wir haben zurückzuschauen, um das einst für rational und alternativlos Gehaltene neu zu betrachten und Irrtümer zu benennen, die eine realistische Politik zukünftig zu vermeiden hat. Wir beginnen zu begreifen – spät, aber immerhin.
Die neue Ostpolitik
Offensichtlich brauchen Gesellschaften einschneidende, schmerzhafte Ereignisse, bevor sie Strategien und Maßnahmen zu überdenken beginnen, die einmal sinnvoll und nützlich waren, neuen Realitäten aber nicht mehr gerecht werden. Die Lösungen von gestern werden daher nicht selten zu den Problemen von morgen. So war die Welt bis Ende der 1950er-Jahre geprägt durch die Konfrontation zwischen den beiden Großmächten, die als Sieger aus dem Zweiten Weltkrieg hervorgegangen waren. Hier die Westmächte unter der Führung der Vereinigten Staaten von Amerika, dort der Ostblock unter dem Diktat der Sowjetunion. Hier Demokratie und Kapitalismus, dort Diktatur und Planwirtschaft. Der eine war der ideologische Feind des anderen, der Kalte Krieg die Inszenierung der Unversöhnlichkeit der Unversöhnlichen.
Ende der 1950er-Jahre kam jedoch Bewegung in die Konstellation der Unversöhnlichen. Chruschtschow, bemüht, die Flucht von Hunderttausenden Bürgern aus der DDR zu unterbinden, wollte Westberlin in eine neutrale, selbstständige Einheit umwandeln. Sollten sich die Westmächte dem verweigern, drohte er, die Kontrolle der Zugangswege der DDR zu überlassen. Als der Westen auf den Vorschlag nicht reagierte, geschah am 13. August 1961 das, was SED-Chef Walter Ulbricht angeblich nie geplant hatte. Mit dem Bau der Mauer wurden Deutschland-Ost von Deutschland-West und der europäische Osten vom europäischen Westen noch radikaler als zuvor getrennt.
Die Bevölkerung in beiden Teilen Deutschlands war schockiert und empört, doch aufseiten der westlichen Alliierten geschah – nichts. Oder fast nichts. Während verzweifelte Menschen aus Häusern direkt an der Grenze sprangen, um sich in die Freiheit zu retten, und unzählige Menschen in Ost und West erwarteten, dass der Westen »irgendetwas« tun werde, zeigten sich Amerika, England und Frankreich gelassen. Der britische Premier Harold Macmillan hielt den Mauerbau zwar für »unglücklich«, aber »nichts Illegales«. US-Präsident John F. Kennedy ließ sich angeblich nicht einmal bei einem Ausflug auf seiner Yacht stören. Er hatte bereits früher drei Punkte genannt, die für ihn in Berlin unverzichtbar waren: Präsenz der Westmächte, freier Zugang nach Berlin, Freiheit für das westliche Berlin. Solange diese nicht infrage gestellt wurden, sah er keinen Handlungsbedarf. Amerika akzeptierte den sowjetischen Einflussbereich bis in den Ostteil Berlins. Außerdem konnte sich keiner der Westalliierten vorstellen, seine Soldaten »für Berlin sterben« zu lassen. »Die Mauer kann nur weggebracht werden durch Krieg. Und Krieg will niemand, auch Sie nicht«, schrieb Kennedy an den damaligen Berliner Bürgermeister Willy Brandt. Doch Brandt nahm die Ereignisse anders wahr. »Es wurde Ulbricht erlaubt, der Hauptmacht des Westens einen bösen Tritt vors Schienbein zu setzen«, schrieb er später in seinen Erinnerungen, »und die Vereinigten Staaten verzogen nur verstimmt das Gesicht.«[4]
Dann kam die Kubakrise 1962. Die Sowjetunion begann auf Kuba mit der Stationierung von nuklear bestückbaren Mittelstreckenraketen, die auch die amerikanische Hauptstadt Washington hätten erreichen können. Dieses Mal blieb Kennedy nicht tatenlos.
Atomraketen vor den Küsten Floridas hätten die Sicherheit der USA unmittelbar bedroht. Kennedy verhängte eine Seeblockade, verlangte in direkten Verhandlungen mit dem sowjetischen Partei- und Staatschef Chruschtschow den Abzug bereits aufgestellter Raketen und drohte für den Angriffsfall mit einem atomaren Gegenschlag. Nach fünf Tagen, in denen die Welt am Rande eines Atomkriegs stand, lenkte Chruschtschow ein und erklärte sich bereit, die Raketen wieder abzuziehen. Die USA verzichteten ihrerseits auf eine Invasion auf Kuba und zogen – was der Öffentlichkeit vorenthalten wurde – ihre Raketen in der Türkei ab.
Für den Politikwissenschaftler Richard Löwenthal wurde die Machtbalance zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion durch die Doppelkrise um Berlin und Kuba neu justiert. »Die Konsequenz der Mauer war die Festigung des sowjetischen Status quo in Mitteleuropa; die Konsequenz der Raketenkrise war die Festigung der weltpolitischen Position des Westens – einschließlich seiner Position in Westberlin. Die Wendung zur weltpolitischen Entspannung, noch von Kennedy und Chruschtschow eingeleitet, erfolgte auf dieser Grundlage. Mit ihr veränderten sich endgültig die Rahmenbedingungen für die Ostpolitik der Bundesrepublik.«[5]
Der Schock der Kubakrise saß tief, war die Gefahr einer atomaren Katastrophe doch sehr real gewesen. John F. Kennedy sah sich daher zu einem Wechsel hin zu einer Politik der Détente veranlasst – einer »Strategie des Friedens«. Neben Abschreckung und Konfrontation sollten Kooperation und Verständigung treten. Die Chance dafür sah er in gemeinsamen Interessen der Großmächte: Auf beiden Seiten herrschte die Angst vor einem Atomkrieg, beide Seiten müssten an einer Begrenzung des Wettrüstens interessiert sein. Tatsächlich kam es bereits 1963 zur Unterzeichnung eines Abkommens zwischen den USA, Großbritannien und der Sowjetunion über einen begrenzten Atomteststopp. Es folgten 1968 der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie ab 1969 Verhandlungen zwischen den USA und der Sowjetunion über die Begrenzung strategischer Rüstung (SALT).
Kennedys Richtungsentscheidung bedeutete Rückenwind für neue Formen der Kooperation, wie sie auch Willy Brandt angedacht hatte. Auch er sann nach Möglichkeiten, trotz ideologischer Fronten konkrete Handlungsoptionen mit der anderen Seite zu schaffen: kurzfristig, um weiter Begegnungen zwischen Deutschen in Ost und West zu ermöglichen und die Lebensbedingungen der Menschen in der DDR zu verbessern. Längerfristig, um die beiden Systeme einander anzunähern und die Teilung Deutschlands irgendwann zu überwinden. Zumindest erhoffte sich Brandt, dass sich durch Zusammenarbeit die Verhältnisse im anderen Teil Europas rascher verändern würden, als wenn sie abgetrennt blieben.[6]
Das Problem war allerdings: Wie konnte Einfluss ausgeübt werden, ohne dass die DDR-Regierung und die Regierungen anderer ostmitteleuropäischer Staaten darin eine »Aufweichung« ihres Systems sahen und mit Abwehr oder gar Abschottung reagierten? Als Antwort darauf entwickelten Brandt und sein enger Mitarbeiter und damaliger Senatssprecher Egon Bahr eine scheinbar paradoxe Strategie, die Bahr in die griffige Formel vom »Wandel durch Annäherung« kleidete. Sie beinhaltete die »Überwindung des Status quo, indem der Status quo zunächst nicht verändert werden soll«. Der Parteistaat der DDR sollte gestärkt werden, damit er geschwächt würde. Die Machthabenden sollten sich sicher fühlen, um aus einem Gefühl der Stärke heraus liberale Zugeständnisse an die eigene Gesellschaft zu machen. »Ich sehe nur den schmalen Weg der Erleichterung für die Menschen in so homöopathischen Dosen«, schränkte Bahr die Erfolgsaussichten der Taktik ein, dass »sich daraus nicht die Gefahr eines revolutionären Umschlags ergibt, die das sowjetische Eingreifen aus sowjetischem Interesse zwangsläufig auslösen würde.«[7] Denkbar hingegen wären Maßnahmen, die einerseits zwar zu einer Auflockerung der Grenzen führten, das Risiko einer westlichen Unterwanderung aber erträglich erscheinen ließen.
Der Journalist Peter Bender, ein leidenschaftlicher publizistischer Parteigänger der Entspannungspolitik, sprach von Liberalisierung durch Stabilisierung: Die SED-Führung müsse sich eine Entspannung »leisten können«. Sie müsse deshalb »gestärkt werden, weil ›Liberalisierung‹ im Inneren und allmähliche Öffnung nach außen eine gewisse Stabilisierung der DDR voraussetzen«, erläuterte er im April 1967 in der ZEIT. »Was wir brauchen, ist demnach eine Politik, die vorsichtig zur Konsolidierung der DDR beiträgt.«[8] Es war diese besondere Dialektik, die Erfolg zu versprechen schien: Evolution durch den Verzicht auf Revolution, Systemwechsel durch die Träger des Systems.
Ein weiterer zentraler Punkt der Entspannungspolitik auf deutschem Boden war die Annahme, für ihr Gelingen sei die Billigung durch die Sowjetunion entscheidend. Oder in der Formulierung Bahrs: »Der Schlüssel liegt in Moskau.« Letztlich würde immer Moskau darüber entscheiden, was in seinen »Bruderstaaten« machbar sei und was nicht. »Nur mit der Sowjetunion, nicht gegen sie« (Brandt) könnten Veränderungen daher gelingen. Und so strengte Brandt, nachdem er 1969 Bundeskanzler geworden war, als Erstes eine Übereinkunft mit Moskau an, obwohl ihm klar war, dass dies alte Befürchtungen in Polen wachrufen würde, die beiden übermächtigen Nachbarn könnten erneut über sein Schicksal verhandeln. Allerdings reiste Brandt bereits im Dezember 1970, vier Monate nach der Unterzeichnung des Vertrags in Moskau, in dem sich die beiden Staaten verpflichteten, ihre Konflikte ohne Gewalt zu lösen und die Grenzen als unverletzlich anzuerkennen, zur Unterzeichnung eines entsprechenden Vertrags in die polnische Hauptstadt.[9] Im Jahr 1973 folgte der Vertrag mit Prag, nachdem in der Zwischenzeit (1972) mit der DDR der Grundlagenvertrag vereinbart worden war.
Die »neue Ostpolitik« veränderte die Ost-West-Beziehungen zweifellos zum Positiven. Politisch und wirtschaftlich gewann die Bundesregierung an Handlungsspielraum. An die Stelle des Neben- und Gegeneinanders trat ein partielles Miteinander. Die Gesprächsblockade zwischen Bonn und Moskau, Warschau, Prag und Ostberlin wurde durchbrochen. Mit dem deutsch-sowjetischen Röhren-Erdgas-Geschäft Anfang der 1970er-Jahre gelang zudem die bis dahin größte Handelsaktion zwischen Ost und West. Die Sowjetunion lieferte Gas gegen 1,2 Millionen Tonnen Großröhren und einen Milliardenkredit. Damals begann die Energiepartnerschaft, die unhinterfragt bis zur russischen Invasion in der Ukraine 2022 weitergeführt und ausgebaut wurde.
Der Grundlagenvertrag mit der DDR machte den Eisernen Vorhang zudem etwas durchlässiger. Die SED-Führung ließ Rentner nach Westdeutschland reisen und politische Gefangene sowie einige andere Ausreisewillige von der Bundesrepublik freikaufen. An die Stelle des Alles-oder-nichts traten pragmatische Lösungen. Auf dem Weg zu einer Anerkennung der DDR als Staat sprach Bundeskanzler Brandt im Herbst 1969 von »zwei Staaten einer Nation in Deutschland«. Geändert wurde auch das Verhältnis zur Oder-Neiße-Linie. Die sozialliberale Regierung verabschiedete sich von dem lange gültigen »Dreigeteilt – niemals!« und hielt im Warschauer Vertrag fest, dass die Oder-Neiße-Linie »die westliche Staatsgrenze der Volksrepublik Polen bildet«. Die endgültige völkerrechtliche Anerkennung der deutsch-polnischen Grenze erfolgte zwar erst nach der Wiedervereinigung 1990, doch de facto bedeutete der Warschauer Vertrag einen Verzicht auf mehr als ein Viertel des deutschen Staatsgebiets von vor dem Zweiten Weltkrieg, auf die Heimat von Millionen Menschen in Ost- und Westpreußen, Schlesien, Pommern und der brandenburgischen Neumark. Brandt suchte zu erklären, der Vertrag gebe »nichts preis, was nicht längst verspielt worden ist«. Doch er billigte auch zu: »Uns schmerzt das Verlorene.«
Die Reaktion auf die Ostverträge war ambivalent. Die CDU/CSU-Opposition hielt sie für den Ausverkauf deutscher Interessen: Die Regierung opfere die Einheit Deutschlands und bereite die endgültige Anerkennung der Oder-Neiße-Linie als Westgrenze Polens vor. Auch in der DDR hörte ich unter einigen Vertriebenen die Enttäuschung darüber, dass – nach der DDR-Regierung im Jahr 1950 – nun auch Westdeutschland das Land östlich der Oder verloren gebe. Andere stießen sich daran, dass Westdeutschland mit denen verhandelte, die erst anderthalb Jahre zuvor den Prager Frühling gewaltsam niedergeschlagen hatten. Für die meisten hingegen stand die Hoffnung auf Kontakte und Reiseerleichterungen im Vordergrund.
Wir im Osten hatten schon mehrere Jahre hinter dem Eisernen Vorhang gelebt, sodass uns schon kleine Schritte aufatmen ließen. Ich erinnere mich noch an den Jubel, mit dem Willy Brandt im März 1970 von der Bevölkerung in Erfurt begrüßt wurde: Es war die erste Reise eines Bundeskanzlers in die DDR. Wir sahen es im Westfernsehen, denn im DDR-Fernsehen wurde von dem Besuch nichts übertragen. Tausende Erfurter waren zum Bahnhof geströmt, obwohl die Behörden einen Teil der Stadt abgeriegelt hatten. Mit so viel Begeisterung hatten Volkspolizei und Staatssicherheit nicht gerechnet. Dann zogen die Menschen zu dem Hotel, in dem der Bundeskanzler abgestiegen war. Und als sich Brandt am Fenster zeigte, begannen die Menschen einfach nur noch begeistert zu skandieren: »Wil-ly Brandt! Wil-ly Brandt!« Selbst vor dem Fernseher stiegen mir die Tränen in die Augen. Brandt selbst sagte nichts, er winkte nicht. Er lächelte bloß und hob leicht die Hand, ein kleiner Gruß, den alle verstanden. Für uns im Osten: Hoffnung über das Westfernsehen.
Frieden um jeden Preis?
Die Entspannungspolitik erwies sich für Andersdenkende im kommunistischen Lager als eine große Unterstützung. Mit der Schlussakte der Konferenz für Sicherheit und Entspannung (KSZE) 1975 in Helsinki wurden zum ersten Mal in einer gesamteuropäischen Friedens- und Sicherheitsordnung die Menschenrechte und Grundfreiheiten verankert. Der Korb 3 ließ sich fortan als politische Waffe aller Oppositionellen gegen die Herrschenden einsetzen. Nun konnten sie von ihren Regierungen einfordern, was jene auf dem Papier versprochen hatten. In Moskau entstand 1976 in der Wohnung des Atomphysikers und Nobelpreisträgers Andrei Dmitrijewitsch Sacharow die Moskauer Helsinki-Gruppe, die älteste Menschenrechtsorganisation Russlands. Weitere Helsinki-Gruppen bildeten sich in der Ukraine, in Estland, Lettland, Litauen und Georgien. In Polen wurden das Komitee zur Verteidigung der Arbeiter (KOR) und andere unabhängige Gruppen gegründet, später die freie Gewerkschaft Solidarność; in der Tschechoslowakei entstand die Charta 77, und mit etwas Verzögerung bildeten sich auch erste systemkritische Gruppen in der DDR.
Plötzlich tauchten neue Akteure in den Ost-West-Beziehungen auf. Sozusagen von »unten«. Und sie hatten andere Vorstellungen zur Überwindung der Blockkonfrontation als die Entspannungspolitiker. Während westdeutsche Politiker nur die kommunistischen Führungen als die Träger von Veränderungen ansahen, verabschiedeten sich viele Oppositionelle gerade von dieser Illusion. Es hatte schließlich nicht geklappt, mit Reformkommunisten einen Sozialismus »mit menschlichem Antlitz« einzuführen: weder in Ungarn 1956 mit Imre Nagy noch mit Alexander Dubček 1968 in der Tschechoslowakei. Auch der zunächst gefeierte polnische Parteichef Władysław Gomułka, der am Ende des Stalinismus in Polen an die Macht zurückgekehrt war, hatte innerparteiliche Reformbemühungen unterdrückt. Von oben, aus der Partei heraus, so die übereinstimmende Meinung von enttäuschten Kommunisten und demokratischen Antikommunisten, sei eine Reform des Staates ebenso wenig denkbar wie eine Aufweichung des Eisernen Vorhangs. Eine neue Taktik war mithin zwingend erforderlich.
Während eines Aufenthalts in Paris 1976 stellte der polnische Oppositionelle Adam Michnik sein Konzept des »Neuen Evolutionismus« vor.[10] Es sollte zur Leitlinie für die neuen Oppositionsbewegungen nicht nur in Polen werden. Wie die westdeutschen Entspannungspolitiker ging auch Michnik davon aus, dass nur ein evolutionärer Weg und eine Politik der kleinen Schritte erfolgreich und verantwortbar seien. Die Angst vor einer sowjetischen Intervention sei wohl begründet, in der ersten Phase hätte sich die evolutionäre Systemumgestaltung daher unter Respektierung der Breschnew-Doktrin zu vollziehen, das heißt unter einer eingeschränkten Souveränität der Staaten im sowjetischen Machtbereich. Doch dann wichen Michniks Überlegungen tiefgreifend von der westdeutschen Entspannungspolitik ab. Nicht der Parteiapparat war für ihn Träger und Garant einer Liberalisierung, sondern die Zivilgesellschaft. Nicht aus der Partei heraus sollte der Druck zur Liberalisierung erfolgen, sondern von unten, aus der Gesellschaft.
Folgerichtig zielte das Konzept auf ein breites demokratisches, antitotalitäres Bündnis. Auf ein Bündnis von Linken, Liberalen und demokratischen Konservativen, ein Bündnis auch zwischen Arbeitern und Intellektuellen und – neu und überraschend und für den Westen befremdlich – ein Bündnis von reformorientierten Linken und der katholischen Kirche. Alle diese Kräfte einte der Wunsch nach mehr Freiheit, nach mehr demokratischen Rechten, nach mehr gesellschaftlicher Teilhabe. Tatsächlich konnten sich im Polen der 1970er-Jahre freie Gewerkschaften, unabhängige Bauern-, Studenten- und Künstlergruppen einen begrenzten Handlungsspielraum erkämpfen. Im Untergrund entstand eine Vielzahl illegaler Publikationen, im Sommer 1980 wurde die unabhängige Gewerkschaft Solidarność mit über neun Millionen Mitgliedern ertrotzt. Ein zuvor unvorstellbares Ereignis: eine unabhängige Organisation in einem totalitären Staat. Als sich Jahre später durch die Schwäche der Sowjetunion eine Chance zum Systemwechsel ergab, existierte in Polen somit bereits ein breites Netzwerk von Bürgerinnen und Bürgern, die zum Kampf für eine demokratische Gesellschaft entschlossen waren.