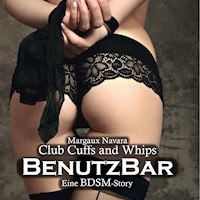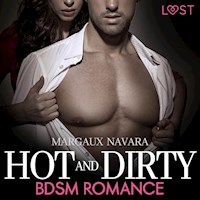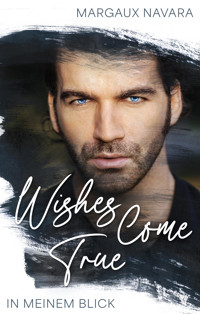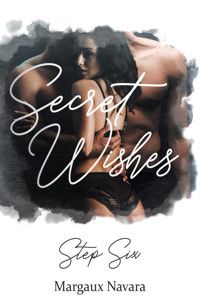3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Deutsch
Polizist Cooper legt Wert auf Regeln, sowohl in seinem Job als auch im WishesComeTrue. Doch die Tierärztin Taylor beugt sich diesen nicht gedankenlos, sondern hat einen eigenen Kopf, was ihn zu ihr hinzieht. Die Anziehung zwischen ihnen vertieft sich im Tierheim, in dem beide sich um einen Streuner kümmern. Taylor, die für Tiere eine Menge riskiert und dafür Grenzen überschreitet, ist fasziniert von dem Mann, der in allem eine klare Linie zieht. Aber kann er verzeihen, dass sie in ihrer Freizeit misshandelte und vernachlässigte Kreaturen befreit? Mit ihrem Verhalten stellt sie Cooper nämlich vor die härteste Entscheidung seines Lebens: Beharrt er weiter auf Recht und Gesetz und verliert die Frau, die er liebt? Oder riskiert er seinen Job und gewinnt dafür Taylor? Unabhängig lesbar. Spicy Szenen, ein süßer Hund und ein Happy End!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Impressum:
Margaux Navara
c/o easy-shop K. Mothes
Schloßstraße 20
06869 Coswig Anhalt
©2024 Margaux Navara
Coverdesign: www.cover-and-art.de
Lektorat und Korrektorat: J. Buhl
Wishes Come True
In meinen Händen
Polizist Cooper legt Wert auf Regeln, sowohl in seinem Job als auch in der Rolle eines Doms im WishesComeTrue. Doch die Tierärztin Taylor unterwirft sich nicht gedankenlos, sondern hat einen eigenen Kopf, was ihn zu ihr hinzieht. Die Anziehung zwischen ihnen vertieft sich im Tierheim, in dem beide sich um einen Streuner kümmern.
Taylor, die für Tiere eine Menge riskiert und dafür Grenzen überschreitet, ist fasziniert von dem Mann, der in allem eine klare Linie zieht. Aber kann er verzeihen, dass sie in ihrer Freizeit misshandelte und vernachlässigte Kreaturen befreit?
Mit ihrem Verhalten stellt sie Cooper nämlich vor die härteste Entscheidung seines Lebens: Beharrt er weiter auf Recht und Gesetz und verliert die Frau, die er liebt? Oder riskiert er seinen Job und gewinnt dafür Taylor?
Zum Glück gibt es Menschen, die sich in bestimmten Bereichen sehr viel besser auskennen als ich. Eine davon ist meine liebe Freundin und Hundetrainerin Patricia, die mir mit ihrem Fachwissen geholfen hat, das Verhalten der Hunde so darzustellen, wie es auch in Wirklichkeit sein könnte. Danke von Herzen!
Für Ringo. Meinen Hund, den ich auch nach all den Jahren nicht vergessen habe und nie vergessen werde. Du hast für kurze Zeit all meine Geheimnisse mitgenommen und mich getröstet, als ich es am meisten brauchte, wofür ich dir ewig dankbar sein werde.
Inhaltsverzeichnis
Wishes Come True_In meinen Händen
Impressum
Wishes Come True
In meinen Händen
Danksagung
Cooper
Taylor
Taylor
Cooper
Taylor
Cooper
Taylor
Cooper
Taylor
Cooper
Taylor
Cooper
Taylor
Cooper
Taylor
Cooper
Epilog
Danke
Meine bisher veröffentlichten Romane und Kurzromane
Leseprobe aus:
Cooper
»Cooper!«, brüllt Captain Westford durch das ganze Revier.
Ich stehe auf, stecke das Hemd ein Stück tiefer in den Hosenbund, sodass es keine Falten schlägt, richte die Manschetten aus und gehe zum Büro des Captains, das eigentlich nur ein Glaskasten innerhalb des Raums ist. Er hat wie immer die Jalousien heruntergelassen, um ein wenig Privatsphäre vorzutäuschen. Wobei jeder weiß, dass das eine Illusion ist. Captain Westford hat eine so laute Stimme, dass man draußen jedes Wort versteht.
Was Absicht ist, wie ich vermute. Es ist sehr viel demütigender, vor der gesamten Mannschaft heruntergemacht zu werden, als den Anschiss alleine ausbaden zu müssen.
Dass es ein Anschiss wird, habe ich schon aus seinem Tonfall entnommen. Das flaue Gefühl im Magen atme ich bewusst weg. Mein Rücken bleibt gerade, der Kopf erhoben. Ich werde nie kuschen.
»Cooper«, beginnt er trügerisch sanft, sobald ich die Tür geschlossen habe. Er wartet nicht einmal, bis ich in Habachtstellung vor seinem Tisch stehe.
»Was haben Sie sich dabei gedacht?«
»Bei was, Sir?«
»Ach, hören Sie auf damit. Sie wissen sehr genau, was ich meine. Ihr Kollege ist außer sich.«
»Tut mir leid, Sir. Die Vorschriften …«
Er spricht sehr viel lauter. »Schluss damit! Er hat sich einen Hotdog geholt. Wie Sie sehr wohl wissen, ist das erlaubt im Dienst, sofern er dabei nicht seine Pflichten vernachlässigt. Und das hat er nicht, er hat sich offiziell abgemeldet und wäre bei einem Einsatz sofort eingesprungen.«
»Aber sein Fahrzeug …«
Westford läuft rot an. »…stand genau so, wie jeder im Revier es macht, wenn er oder sie nur paar Minuten Zeit für einen Imbiss hat, Cooper! Sie wissen, wie ich dazu stehe. Solange es keine … Ach, scheiß drauf. Sie wissen genau, was ich sagen will, ich habe es Ihnen schließlich schon ungefähr hundert Mal vorgebetet. Cooper«, er steht auf, stützt dabei die Fäuste auf seinem Schreibtisch ab und steht da wie ein Weißrückengorilla in Drohhaltung. Dass er leicht die Zähne fletscht, die sich perfekt weiß von seiner dunklen Haut abheben, sorgt für noch mehr Ähnlichkeit. »Sie werden das in Zukunft unterlassen oder ich sorge dafür, dass sie erstens versetzt werden und zweitens zurückgestuft auf Police Officer 1st Grade. Ich schätze, Sie wissen, was das bedeutet. Dann können Sie gerne so viele Tickets ausstellen, wie Sie wollen.« Seine Augen zu Schlitzen zusammengezogen, die Nase in Falten fährt er mit leiserer Stimme, die keineswegs weniger bedrohlich klingt, fort. »Ich warne Sie jetzt schon. Sollten Sie dann wieder ihre Kollegen anschwärzen, stehen Sie für den Rest ihres Lebens vor der USS Midway und helfen alten Leuten über die Straße. Und ich warne Sie jetzt schon vor, dass ich einen Vermerk in Ihre Akte machen werde, dass man sie nie«, er holt tief Luft und brüllt dann: »Nie. Mehr. Da. Weglässt.« Er richtet sich auf, verschränkt die Arme. »Haben Sie das verstanden, 3rd grade Officer Cooper?«
Es gibt nur eine Antwort. Ich stehe stramm, salutiere und brülle ähnlich laut zurück. »Sir, jawoll, Sir.«
Ich drehe um neunzig Grad.
»Halt, Cooper!«
Eine Vierteldrehung zurück. Genau nach Vorschrift. Dann wieder in Habachtstellung, die Hacken zusammen, die Augen geradeaus, den Körper gerade und angespannt, die Zeigefinger genau an der Seitennaht der Hose.
»Ich habe eine neue Aufgabe für Sie, Cooper. Eine, der Sie sich in nächster Zeit ausschließlich widmen werden.«
In meinem Augenwinkel zuckt es, weil ich versucht bin, ihn anzuschauen, doch ich habe mich unter Kontrolle.
»Sie werden sich um diese Tierbefreier kümmern. Die haben neben mehreren Diebstählen bei Privatpersonen und einem Überfall auf einen Schlachtbetrieb nun auch den Zoo in ihr Visier genommen. Wir müssen alles tun, um zu verhindern, dass eines Tages Elefanten und Löwen durch Americas Finest City stromern. Das ist Ihr Job. Ausschließlich. Keine falschparkenden Dienstwagen mehr, keine Kollegen verleumden. Sie werden nur noch dann an anderen Einsätzen teilnehmen, wenn Sie ausdrücklich dazu angefordert werden.«
Als er nicht mehr weiterspricht, salutiere ich erneut, drehe mich um hundertachtzig Grad und stakse zurück zu meinem Schreibtisch, wo ich mich äußerst kontrolliert hinsetze und mich daran mache, das Ticket, das ich Kollege Stenzel ausgeschrieben habe, löschen zu lassen.
Eine äußerst demütigende und noch dazu aufwendige Prozedur.
Vor allem, wenn einem die Hand dabei zittert und der Puls so hoch ist, dass man Angst hat, dass die Adern in den Schläfen gleich platzen könnten.
Wobei sich in meinem Kopf eine Ansprache abspult.
Officer Stenzel parkte während seiner Dienstzeit mit seinem Dienstwagen in zweiter Reihe und behinderte sehr wohl den fließenden Verkehr. Ein Müllauto musste stehen bleiben und ungefähr drei Minuten warten, bis es den Dienstwagen umfahren konnte. Das bedeutet drei Minuten verlorene Arbeitszeit für drei Arbeiter der Stadt San Diego.
Officer Stenzel hatte auch die Räder nicht eingeschlagen, und das, obwohl das Gefälle der Straße mehr als 4 % aufwies. Das weiß ich deshalb so genau, weil ich schon vor einem halben Jahr an dieser Stelle ein Ticket ausgestellt habe, das von dem Fahrer angezweifelt wurde. Den Beweis habe ich selbst mittels Fotos erbracht, die zeigen, dass die Höhendifferenz auf einer Strecke von vierzig Zentimetern, der Länge meiner Wasserwaage, genau 1,8 Zentimeter beträgt, was nach der Berechnung einem Gefälle von 4,5% entspricht.
Leider werde ich diese Ansprache nie laut vor Captain Westford wiederholen.
Sie verklingt nur langsam in meinem Kopf. Vielleicht nur, weil sie abgelöst wird von Rückenschmerzen. Kein Wunder, alle Muskeln um mein Rückgrat sind hart und sorgen dafür, dass meine Haltung sich in der Senkrechten befindet. Keine Abweichung.
Schon gar kein Gefälle.
Ich richte den Kragen meines schwarzen Hemdes und schließe den Knopf am Ärmel, der nur halb im Knopfloch steckt, während ich auf die Dusche der Frauen zugehe. Ob Vicky schon fertig ist? Zeit genug hatte sie, aber ich weiß, dass kaum eine der Frauen sich in zwei Minuten duscht, wie es für mich Standard ist. Dann werde ich eben auf sie warten.
Dabei versuche ich, das Gefühl von Unzufriedenheit zu unterdrücken. Was nicht deshalb aufkommt, weil ich nicht gekommen bin. Eher, weil diese Session wieder einmal anders verlaufen ist, als ich es gehofft hatte. Vicky hat sich bemüht, aber sie war nicht mit dem Herzen dabei. Und sie entspricht einfach nicht dem, was ich mir so vorstelle. Wobei ich zugeben muss, dass meine Vorstellungen vage sind. Eine ehrliche Frau. Eine, die offen sagt, was sie will und was nicht.
Und eine, die verdammt noch mal das tut, was ich ihr sage.
»Hey, Vicky, wie war dein Cop?«, höre ich eine Frauenstimme hinter der Tür.
Natürlich horche ich, ich bin kein Heiliger. Es ist immer wichtig, Informationen zu beschaffen. Diese könnte helfen, mich zu verbessern und vielleicht – endlich! – das zu finden, was ich suche.
»Na ja. Wenn du ein Bootcamp magst und auf den Drill Sergeant stehst, ist er der Richtige für dich. Für den Spaß geht er vermutlich in den Keller. Also Tiefgarage zehntes Level, würde ich sagen.«
Das war Vickys Stimme. Die ich nur erkenne, weil ich auf so etwas trainiert bin. Sie spricht nämlich erheblich tiefer als vorhin, nicht das hohe Piepsen, das sie im Dungeon draufhatte.
Die andere lacht. »Okay, superschade, weil er verdammt heiß aussieht. Aber dass er streng ist, dachte ich mir schon.«
»Streng? Das ist mehr als streng. Eisern passt. Oder verbohrt, dogmatisch und dickköpfig.«
»Oh, du Arme! Dabei wolltest du doch entspannen. Warum hast du nicht dein Safeword gesagt?«
An dieser Stelle trete ich näher an die Tür und mir ist es völlig gleichgültig, ob jemand mich dabei beobachtet.
»Na hör mal. Er ist der Dom. Wenn ich wissen will, wie er so drauf ist, kann ich nicht abbrechen, sondern muss das durchziehen. Außerdem …«
Mein Ohr berührt die Tür.
»Außerdem bin ich halt so gepolt. Wenn einer was von mir will, sage ich ja oder genauer: ›Ja, Sir!‹ und mache mit. Ich meine, das ist doch ein Teil des Kicks. Auch das zu machen, was man eigentlich gar nicht will, weil man dazu gezwungen wird.«
»Schon. Aber ich ziehe da eher Grenzen. Du musst auch an dich denken. Nicht nur jedem Arsch erlauben, dich rumzukommandieren.«
Ich löse mein Ohr von der Tür und trete fünf Schritte zurück, bis ich mit dem Rücken an der gegenüberliegenden Wand anstoße. Meine Lippen sind so fest aufeinandergepresst, dass mir der Kiefer wehtut. Meine Rippen fühlen sich an, als müsse ich sie mit jedem Atemzug erst zwingen, Platz zu machen.
Ist ja nicht so, als hätte ich es nicht geahnt. Oder gespürt während der Session. Vicky ist wie alle. Sie hat mitgemacht, aber nicht, weil es das ist, was sie will. Ich bin also der Sergeant in einem Bootcamp? Dann hätte ich sie vielleicht eine Reihe von Liegestützen machen lassen sollen. Dann wäre sie jetzt so außer Puste, dass sie nicht mehr über mich herziehen könnte.
»Oh, du bist noch da?« Vicky ist noch in der Tür stehen geblieben und wird jetzt von ihrer Freundin nach vorne geschoben. Die schaut mich mit großen Augen an, ihr Blick gleitet über mich und bleibt an meiner Mitte hängen, ihr Mund zuckt und sie grinst Vicky über ihre Schulter an, ehe sie abzieht. Erst jetzt wird mir bewusst, dass ich die Hände hinter dem Rücken verschränkt habe, die Beine gespreizt und fest in den Boden gestemmt. Parade Rest. Nicht entspannt, nur einen Hauch gelockert.
Mist.
Nur zögernd löse ich die Hände voneinander, lasse die Arme locker hängen. »Ich bringe dich nach Hause, Vicky.«
»Brauchst du nicht. Ich fahre mit Antonia. Danke … ähm, für das Angebot.«
Ein Nicken, mehr bringe ich nicht zustande. Was auch immer ich jetzt als höflicher Dom sagen könnte, wäre gelogen, also schweige ich lieber.
Schon ist sie weg.
Ginge es um die Subs in diesem Club, wäre ich schon längst zu einem anderen gewechselt. Aber zum Glück ist es das nicht alleine. Die Männer sind es, die seinen Charme ausmachen. Hier habe ich Freunde gefunden, noch dazu welche, die wissen, wie ich ticke. Ich werde also bleiben, aber mich in Zukunft lieber auf die Bar beschränken.
Meine Hoffnung, dass ich hier irgendwann die Richtige finden werde, schrumpft immer weiter, doch diesen letzten kleinen Funken kann ich nicht unterdrücken.
Ich schaue über die wenigen Gäste, die noch an der Bar hängen. Tanner winkt mir zu, doch ich schüttle den Kopf. Nach dem Urteil von eben, oder sollte ich sagen: dieser Verurteilung? – ist mir nicht nach einem Plausch. Ich verabschiede mich und setze mich in meinen schwarzen RAM Pick-up, der allen zeigt, dass ich Polizist bin.
Wie immer beobachte ich die Umgebung und kann trotzdem über mein Problem nachdenken. Ich suche eine Sub, die mir gehorcht. Aber nicht, weil sie denkt, sie müsse tun, was ich sage, sondern die es auch will. Ich schlage meine Handfläche aufs Lenkrad. Mist, ich kann nicht mal selbst beschreiben, was ich will. Wie kann ich dann verlangen, dass eine Sub es versteht?
Mir geht einfach diese Lügerei auf den Geist. Denn das ist es doch letztendlich. Sie machen mir etwas vor. Tun so, als fänden sie meinen Stil in Ordnung und denken dabei nur darüber nach, was für eine Fehlentscheidung sie getroffen haben.
Ich schnaube, als ich in die Richmond Street abbiege. Seit vier Tagen ist das hier nun mein Revier. Dabei komme ich normalerweise vom Cabrillo Parkway, biege ostwärts ab auf die Richmond bis zur Upas Street, dann den Zoo Drive und entlang des Parkplatzes über den Park Boulevard zurück zum Parkway.
Kein Wunder, dass sie mich Drill Sergeant genannt hat.
Immerhin habe ich frei und hätte jede beliebige Route nehmen können, um vom Club zu meinem Apartment in der G Street zu kommen. Aber nein, ich fahre an dem verdammten Zoo vorbei. Dabei höre ich die Stimme des Captains erneut in meinem Kopf. Und spüre erneut alles, was ich in diesem Moment gespürt, aber unterdrückt habe. Die Wut. Die Machtlosigkeit. Die Angst um mein Gehalt. Bei einer Rückstufung würde ich über zehntausend Dollar im Jahr verlieren, was einer Kürzung von fast einem Viertel entspräche. Damit könnte ich mir die Wohnung in der Stadt nicht mehr leisten. Und das WishesComeTrue nur noch als Barmann betreten.
Entspann dich, Cooper!
Aber es hilft nichts.
Ich bin Cop durch und durch.
Und ich will verdammt noch mal meinen Rang behalten.
So sehe ich sofort den Wagen, der neben einer Verkehrsinsel hält und das nicht, weil er auf andere warten müsste. Die Warnlampen hat er nicht eingeschaltet. Die Straße ist ziemlich leer nachts um zwei, selbst oder gerade in diesem Teil der Stadt. Ohne Gas lasse ich meinen Ram ausrollen, bis ich direkt hinter dem anderen Wagen zu stehen komme, allerdings nach Vorschrift mit Warnblinkanlage.
Das Kennzeichen habe ich mir schon längst gemerkt.
Wie alle Cops bin ich äußerst vorsichtig, wenn ich aussteige und jemanden anspreche. Gut, dass ich eine Glock im Handschuhfach habe, die ich mir jetzt hinten in den Hosenbund schiebe.
Ein Mann ist ausgestiegen und beugt sich vor. Ist ihm schlecht? Hebt er etwas auf? »Sir, ich bin Polizist. Was tun Sie da?«
Er richtet sich auf. »Ah, gut. Dann können Sie mir bestimmt helfen.«
»Sir, sie halten widerrechtlich auf einer öffentlichen Straße, haben kein Warnblinklicht eingeschaltet und behindern den Verkehr. Bitte legen Sie die Hände aufs Autodach und erklären mir, was sie hier tun.«
»Behindern? Sie Arsch, hier ist überhaupt niemand, den ich behindern könnte!« Widerwillig dreht er sich zu seinem Wagen um und tut, was ich verlangt habe.
»Ich bin hier, Sir.« Noch bin ich großzügig und übergehe seine Beleidigung, doch wehe, er macht so weiter.
»Ja schon, aber schauen Sie doch, die Straße ist leer. Wie kann ich da jemanden behindern? Außerdem wollte ich nur helfen. Ich gehöre nicht zu denen, die vor Leid die Augen verschließen.«
Erst jetzt sehe ich eine Bewegung auf dem Boden. Die Form ist zu klein für einen Menschen. »Was ist das?«
»Ein Hund. Ausgesetzt, würde ich sagen. Ich wollte ihm nur helfen.«
»Das können und sollten Sie tun, Sir, aber beim nächsten Mal bitte mit Warnblinklicht. Noch besser wäre es, wenn Sie das Fahrzeug regelkonform abstellen würden und zu Fuß zurückkehrten.«
»Hier? Sie spinnen doch, Officer. Ich laufe doch nachts in dieser Gegend nicht zu Fuß rum. Am Ende kommt noch einer wie Sie vorbei und verhaftet mich.«
»Reden Sie sich nicht tiefer rein. Wofür sollte ich Sie denn verhaften? Haben Sie getrunken? Drogen?«
»Nein!« Jetzt hört er sich richtig empört an. »Habe ich nicht. Ich komme von einer Party, aber ich fahre nicht mit Alkohol. Ich brauche meinen Führerschein, ich bin nämlich Busfahrer.«
»Gut. Dann sind Sie nur wegen Verkehrsbehinderung dran und …«
»What?« Er dreht sich zu mir um und sein Gesicht ist ein einziges Fragezeichen. »Sie sind doch nicht ganz dicht! Ich wollte dem Viech da helfen! Wissen Sie was? Ich fahre jetzt nach Hause. Sie können mich mal.« Er steigt ins Auto.
»Ich habe Ihr Kennzeichen, Sir«, bemerke ich ruhig, doch er fährt bereits davon. Wozu er jedes Recht hat, denn ich konnte wirklich keine Zeichen eines Ausfalls an ihm feststellen. Und da liegt ein Hund auf dem Boden. Er hat sich ganz flach gemacht, nur seine Augen sind zwei dunkle Punkte, die mich jetzt fixieren.
»Und was tust du hier?« Ich mache zwei Schritte zurück zu meinem Fahrzeug und werde von einem kläglichen Fiepen abgebremst. Aber ich brauche eine Taschenlampe, wenn ich sehen will, was mit ihm los ist. Das Fiepen endet erst, als ich wieder in seiner Nähe bin. Ich lasse den Strahl der Lampe rund um ihn herum gleiten. Tatsächlich, er ist mit einem Seil angebunden an dem Richtungsweiser, der den Verkehr um die Insel lenkt. Keine Leine. Auch kein richtiges Halsband, nur das Seil mit ein paar Knoten. Noch dazu welche, die sich zusammenziehen können, wenn er versuchen würde, sich zu befreien.
Ich drehe um, hole mir aus dem Auto die Tüte Hundekekse, die ich immer dabei habe und zur Vorsicht Einmalhandschuhe. Wahrscheinlich voller Flöhe, der Arme. Er dürfte einem Obdachlosen gehören oder gehört haben. Aber hier ist niemand in der Nähe. Es ist still, soweit es in einer Stadt dieser Größe still sein kann.
Zwei Fuß von ihm entfernt, damit er mich nicht mit einem Sprung erreicht, gehe ich in die Hocke, wende ihm dabei meine Seite zu. Von hier aus werfe ich ihm ein paar der Kekse hin. Es dauert nicht lange, bis ich aus dem Augenwinkel sehe, wie er den Kopf zur Seite dreht, die Nase nach unten richtet und am Boden schnüffelt. Beschwichtigungssignale, wie ich weiß. Langsam bewegt er sich nach vorne und saugt die Leckerlis auf. Hat wohl Hunger, der Arme. Danach lässt seine Anspannung nach und als ich ihm die Hand entgegenstrecke, schnuppert er daran.
»Hat dich dein Herrchen hier zurückgelassen? Bist du alleine?« Wenn Tiere doch nur sprechen könnten. Ich möchte keinem Wohnsitzlosen seinen Hund wegnehmen, aber ich werde ihn auch nicht hier zurücklassen. Er hat Angst, ist eingeschüchtert. Wer weiß, wie lange er schon hier liegt. Was mich auf eine Idee bringt. Ich gehe zurück zum Auto, erneut begleitet von dem kläglichen Fiepen und hole eine Wasserflasche aus dem Fußraum. Wieder beruhigt er sich, sobald ich ihm nah bin.
Das Wasser, das ich auf meine Handfläche schütte, schleckt er so gierig auf, dass zumindest eine Frage beantwortet wird. Er ist schon länger hier angebunden.
Ob sein Besitzer oder seine Besitzerin hier irgendwo liegt? Möchte derjenige den Hund loswerden oder ist ihm oder ihr etwas passiert? Aber er ist hier angeknotet. Hm.
Eines steht fest, ich werde ihn mitnehmen. Und ihn gleich bei einem Tierheim vorbeibringen, das hier in der Nähe ist und die auch um diese Uhrzeit einen Hund aufnehmen. Dort verbringe ich an meinen freien Tagen viele Stunden damit, Hunde auszuführen. Er muss entlaust und entwurmt werden, nicht nur gefüttert. Das kann ich nicht leisten. Außerdem kann ich keinen Hund halten, nicht nur, weil ich zur Miete wohne. Auch meine Arbeitszeiten erlauben das nicht.
Ich bereite den Kofferraum vor, räume die Trekkingschuhe und die Allwetterjacke auf den Rücksitz. Dann hole ich den Hund. Sobald ich die Leine in der Hand halte, steht er auf, wedelt mit dem Schwanz, und versucht, an mir hochzuspringen. Ich drehe mich seitwärts, ein Zeichen, das er versteht. Doch nach zwei Schritten ist er vor mir, drängt sich zwischen meine Beine. »Nein, Buddy!« Ich nehme die Leine kürzer, bis er an meiner Seite ist. Er schaut mich von unten an. »So ist gut. Braver Hund.« Wir gehen die nächsten Schritte einträchtig nebeneinander her, er hält an, als ich anhalte. Sehr gut.
Außer dass er nicht in den Kofferraum springen will. »Na komm, Buddy. Anders geht es nicht. Du willst nicht, dass ich die Tierrettung rufe. Die sperren dich in einen Käfig. Hier hast du viel Platz.« Doch leider hilft das nichts. Ich betrachte ihn. Sein Fell ist verkrustet, besonders am Hintern scheinen eingetrocknete Kotreste zu kleben. Nein, so möchte ich ihn nicht anfassen. Aber ich habe noch das Hemd auf dem Rücksitz, das ich an der Bar des WishesComeTrue trage. Das muss eh in die Wäsche.
Ich schließe die Knöpfe, stecke es in die Hose. Kein Grund, nachlässig zu werden.
Der Hund liegt mir zu Füßen, vor allem, weil ich auf der Leine stehe, damit er mir nicht davonläuft. Als alles an seinem Platz ist, bücke ich mich und hebe ihn hoch.
Ich fahre zum Tierheim in der Sweetwater Road, etwa eine Viertelstunde Weg. Dazwischen gebe ich die Daten des anderen Fahrzeugs durch und das Vergehen. Der Mann wird eine Strafe von etwa sechzig Dollar zahlen müssen. So ist das nun mal mit den Regeln.
Und Captain Westford hat mir keineswegs verboten, einem Zivilisten eine Strafe aufzubrummen, wenn er sie verdient hat.
Taylor
Sadie zieht mich am Arm zu einem der Hundegehege. Ich gehe ungern mit, weil ich noch die getigerte Katze anschauen müsste, die vorhin hereingebracht wurde, aber gegen Sadie komme ich einfach nicht an.
»Du musst ihn dir anschauen. Der Arme! Auch so ein Opfer.« Sadie zeigt mit einem Arm auf das Gehege und weist mich auf einen extrem dicken Hund hin.
Ich kenne das Tier, er blieb zurück, als seine Besitzerin verstarb. Und er ist ausnehmend hässlich. Mit einem Seitenblick zu Sadie, die sich gerade die laufende Nase mit dem Ärmel ihres sehr bunten und zerschlissenen Shirts abwischt, weise ich sie auf das Offensichtliche hin. »Er muss abnehmen, aber ansonsten ist er gesund. Er wurde geliebt, wenn auch falsch.« Das ist doch das Problem. Manche Menschen können ihre Liebe nicht dosieren, gerade wenn es um Tiere geht.
In einem übertrieben sarkastischen Tonfall meint Sadie: »Ja, und wie!« Wieder gestikuliert sie wild, ich muss einem Arm ausweichen, sonst hätte ich den Ellbogen im Gesicht gehabt. »Angeblich lieben sie die Tiere. Angeblich! Das ist doch keine Liebe! Noch dazu, wenn niemand sich Gedanken darüber macht, was mit dem armen Süßen passieren soll, wenn die Leute ins Gras beißen.«
Nun ja, ich bezweifle, dass viele Menschen sich Gedanken darum machen. Und sie beißen garantiert nicht freiwillig ins Gras. »Das Tierheim wird ihn beim nächsten Meet & Greet vorstellen. Vielleicht findet sich ja jemand.« Mit schräg gelegtem Kopf füge ich an: »Oder möchtest du dich um ihn kümmern?«
»Du weißt genau, dass ich mich unmöglich nur um ein Tier kümmern kann, solange es Hunderte und Tausende gibt, die meine Hilfe brauchen!«
Ich schüttle sanft den Kopf und höre nicht weiter zu. Diesen Sermon kenne ich. Zum anderen bin ich ganz froh, dass Sadie nicht beginnt, Tiere aufzunehmen. Am Ende würde sie einen ganzen Haufen zusammenbringen und wir hätten den nächsten Fall von Tierhortung, die wir dann irgendwann aus einer total versifften Wohnung hierher bringen müssten.
Ich gehe zügig zurück in den Behandlungsraum, wasche mir die Hände ausgiebig. Ich mag Sadie wirklich sehr, aber es ist eine Sache, Kleidung nachhaltig zu nutzen und lange zu tragen, wie sie es behauptet, eine andere, sie nicht zu waschen oder defekte Stellen zu reparieren. Leider habe ich nach Kontakt mit Sadie immer das Bedürfnis, mich zu waschen oder gleich umzuziehen. Aber gut, ich bin Schmutz und Exkremente gewohnt, weshalb ich einfache und vor allem waschbare Kleidung trage wie die Jeans und das schwarze T-Shirt. Es muss nur eng anliegen, dann können die Tiere sich nicht so gut in den Stoff verbeißen. Auf die üblichen Tuniken mit Taschen habe ich schnell verzichtet, die Taschen reißen viel zu schnell aus.
Die getigerte Katze hockt noch in ihrem Kennel, allerdings ist sie extrem wild, wie sich herausstellt. Die war eindeutig schon lange auf der Straße. Dementsprechend fehlt ihr ein Teil eines Ohrs, wobei diese Verletzung längst verheilt ist. Was ich aber behandeln muss, ist das Bein, das gebrochen ist. Zusammen mit zwei Helferinnen und eingepackt in große, dicke Handschuhe holen wir sie aus dem Plastikcontainer, befördern sie auf die Liege, wo ich ihr erst einmal ein Betäubungsmittel gebe.
Danach lassen mich die Helferinnen alleine. Ich richte die Knochen, verbinde alles fest, gebe ihr noch ein Antibiotikum und lege sie zurück in den Kennel. Das nächste Tier wartet.
Man sollte meinen, dass die Arbeit im Tierheim genauso abläuft wie die in der Praxis, in der ich arbeite, aber das ist leider nicht so. In die SouthPawVet-Praxis kommen Tierhalter, die sich um ihre Tiere kümmern. Mal zu viel, so ähnlich wie bei dem kleinen dicken Mischling, aber das ist eher eine Ausnahme.
Hier jedoch … Hier sammeln sich die herrenlosen Tiere, die entlaufenen, die vernachlässigten, die irgendwann in einem Karton vor der Tür stehen. Gänzlich andere Fälle. Verletzungen, Krankheiten. Läuse, Würmer und Augenentzündungen sind an der Tagesordnung.
Sadie kommt in den Raum gehuscht. »Da ist ein Kerl mit einem Hund. Hast du ihn schon gesehen? Die Tussis sind im Hennenmodus. Gackern und plustern sich auf.«
Das macht mich neugierig. Wer könnte denn so eine Reaktion bei den Helferinnen auslösen? Der Hund oder der Mann?
Sadie hat die Tür einen Spalt offengelassen und ich sehe vor der Empfangstheke einen Mann stehen. Groß, schwarze Hose, schwarzes Hemd, dessen Stoff im Licht leicht schimmert. Ich ziehe eine Augenbraue hoch. Edel, hm? Aber Sadie hat recht, die drei Helferinnen umringen ihn und ich erkenne sehr genau, dass sie zwar vorgeben, sich um den Hund zu bemühen, aber letztlich der Kerl im Fokus steht. Kein Wunder. Er sieht gut aus, wenn man so harte Gesichtszüge mag.
»Sieht aus wie so ein autoritäres Arschloch«, flüstert Sadie mir ins Ohr.
Stimmt, wobei ich kurz überlege, woran es liegt. An seiner Haltung auf jeden Fall. Sehr aufrecht, fast schon steif. Die Schultern zurückgenommen, Brust raus. Kein bisschen entspannt. Ich mag genau das, die Spannung, die Muskeln, die ich unter der Kleidung erahne. Nichts Schlaffes an ihm. Ein ganz leichter Schauer läuft über meine Haut. Eigentlich überhaupt nichts Negatives an ihm zu sehen. »Hm. Er sieht doch heiß aus.«
»Mag ja sein, aber auf das Aussehen schaue ich nicht. Ich hasse solche Typen, das sind die, die einer Frau immer vorschreiben wollen, was sie zu tun und zu lassen hat. So ein Macho, der am Ende noch seine Frau schlägt und sie ständig rumkommandiert.«
Mir wird warm. Für eine Sekunde flittern Bilder vor meinen Augen. Wie er mir sagt, was ich tun soll. Wie ich ihm gehorche …
Ich wünschte, er wäre genau dieser Typ. Nur leider ist das ein Wunschtraum. Solche Männer trifft man nicht in einem Tierheim nachts um zwei. Und wenn, dann interessieren sie sich nicht für Frauen wie mich, mit Kratzern an den Armen und Sabber von der kleinen Bulldogge am Schienbein. Und überhaupt ist das nur eine Fantasie von mir, die muss ich nicht wahr machen. Ich richte mich auf, trete zur Seite, sodass ich ihn nicht mehr im Blick habe. »Ich werde sehen, wie er mit dem Hund umgeht, das sagt mehr über Menschen aus als der Blick von außen.«
»Fuck, er kommt her. Ich muss dann los. Ich geh hinten raus. Wir treffen uns Donnerstag. Bei dir, wie immer?«
Ehe ich dazu etwas sagen kann, huscht Sadie durch die zweite Tür, die nach hinten führt. Von dort gelangt man auf den Parkplatz, allerdings weiß ich, dass Sadie kein Auto hat. »Umweltsünder« nennt sie alle Autofahrer, freut sich allerdings, wenn jemand sie mitnimmt nach unseren Treffen. Die ich eigentlich nicht mehr bei mir abhalten wollte, aber das muss ich wohl mit allen besprechen.
Es klopft an der Tür.
Erstaunt hebe ich den Blick. Hier klopft keiner, man tritt einfach ein. »Ja?«
»Entschuldigen Sie, Ma’am.« Der Schwarzgekleidete tritt ein.
Die Ansprache finde ich witzig. So alt bin ich doch gar nicht! Aber ich sage nichts dazu, ich bin viel zu sehr abgelenkt von dem Kerl und den Bildern, die er in mir hervorruft.
Nur mit Mühe gelingt es mir, meinen Blick auf den Hund zu richten, den er neben sich führt, aber meine Augen springen immer wieder zu ihm zurück. Als er sich bückt, um dem Hund in das Halsband zu greifen, weil es den zum Katzenkennel zieht, bewundere ich seinen Rücken, die Arme, seine Hände. Hm. Ich kann ihn mir sehr gut als Mann in genau der Stellung vorstellen, die Sadie so verabscheut. Ein Kerl, der alles in der Hand hat.
Ich wünschte, er hätte mich in der Hand.
Oh Mann, ich muss aufhören, von so etwas zu träumen. Warum sollte ich ausgerechnet im Tierheim einen Mann finden, der mir gibt, was ich suche?
Ich richte mich auf, stemme beide Hände auf die Liege. »Sir? Berichten Sie mir bitte, warum Sie hier sind.«
»Cooper, Ma’am. Ich fand diesen Hund am Straßenrand, an einem Verkehrsschild festgebunden.«
»Ah. Dann sollte ich ihn wohl untersuchen. Können Sie ihn hochheben?«
Er packt den Hund und hievt ihn auf die Liege. Ich mag die Art, wie er sich bewegt. Sehr sicher, ohne Zögern. Was sich auch auf den Hund überträgt, der ihm zu vertrauen scheint, aber mir gegenüber misstrauisch ist. Außerdem bin ich beeindruckt, dass er sich nicht von dem Dreck abschrecken lässt. Da habe ich schon andere gesehen, die so ein Tier auf Armlänge von sich fernhalten und es sofort an der Tür an eine der Helferinnen übergeben.
Der Mann streichelt ihm einmal über den Rücken. »So, Buddy, hier bist du gut aufgehoben. Ich werde dieser Tage mal vorbeikommen und mit dir spazieren gehen, sofern du nicht vorher abgeholt wirst.«
Damit dreht er sich um.
Ich bin so überrascht, dass ich erst reagiere, als er schon an der Tür ist. »Moment!«
»Ja?«
»Bleiben Sie noch!«
»Warum?«
So eine einfache Frage, aber mir fällt keine vernünftige Antwort ein. Weil ich dich noch ein bisschen anschauen will? Dich näher kennenlernen will? Weil ich mir wünschte, jemand würde mir versprechen, mit mir spazieren zu gehen? Ach, was ein Blödsinn!
»Weil … er vertraut Ihnen. Es wäre für mich … für ihn besser, wenn Sie noch blieben, bis ich ihn untersucht habe, Mr. … äh, Cooper.«
Oh Mann, so viel habe ich seit dem Kindergarten nicht mehr gestottert.
Er zögert, schaut von mir zum Hund und zurück. Kehrt um und schließt die Tür hinter sich. »Na gut.«
»Ich weiß, es ist spät«, beginne ich.
»Ich muss erst um neun antreten.«
»Oh. Gut.« Die Uhr zeigt Viertel vor drei. »Nicht sehr viel Zeit übrig zum Schlafen.« Ich meine damit vor allem mich, weil ich um sieben in der Praxis auf der Matte stehen muss. Aber es ist wie es ist. So viele Kreaturen, die Hilfe brauchen an einem Wochenende. Dagegen wird mir die Montagsschicht in der Praxis wie ein Spaziergang erscheinen.
»Nein, aber das ist nichts, verglichen mit einer Nachtschicht.« Er verzieht das Gesicht, doch er konzentriert sich schnell wieder auf den Hund.
Ich würde zwar gerne fragen, was er arbeitet, weil er den Schichtdienst erwähnt, aber jetzt geht es um das Tier.
»Er war angebunden? Gehört er jemandem?«
»Niemand in der Nähe. Ich werde mich morgen dort umsehen und nachfragen. Ich komme regelmäßig dort vorbei.« Den letzten Satz sagt er mit einem Grollen in der Stimme. Oh, oh. Da ist jemand nicht glücklich mit der Situation.
Vielleicht kann ich ihn ablenken? Ich hebe einen Finger. »Sitz!«
Er zögert kurz, dann legt er sich ab. Na gut. Nicht ganz, was er tun sollte, aber immerhin hört er auf mich.
Doch Cooper zieht ihn hoch und wiederholt dann meinen Befehl.
Der Hund setzt sich.
Mir klappt der Unterkiefer runter. Wieso macht er das? Und warum gehorcht der Hund ihm besser als mir? »Haben Sie schon länger mit ihm zu tun?«
»Nein, ich habe ihn vor einer halben Stunde aufgesammelt.«
»Dann haben Sie selbst einen Hund?«
Ein Schatten fliegt über sein Gesicht. »Nein. Früher mal, aber das ist lange her.«
»Es tut mir leid.« Ich kenne diesen Ausdruck. Es ist nun mal so, dass ein Hund eine viel kürzere Lebensspanne hat. Alle, die Haustiere haben, kennen das. Na ja, außer Besitzer von Papageien und Schildkröten.
»Danke, Ma’am.«
»Bitte nenn mich Taylor. Ich komme mir gerade sehr alt vor.«
Er zieht erst einen Mundwinkel nach oben, die Augen zu Schlitzen geformt, dann entspannt er sich. Seine Schultern sinken ein paar Millimeter nach unten, er macht einen Schritt zur Seite und wirkt auf einmal nahbarer, lockerer. »Sehr gerne. Nenn mich Cooper.«
Hm. Ich bin versucht, ihn Cop zu nennen statt Cooper. Er wirkt ein bisschen wie ein Polizist. Streng. Oder autoritär, wie Sadie schon feststellte.
»Dann lass uns mal schauen, was er hat, ja? Es wäre mir eine große Hilfe, wenn du bleiben würdest. Er scheint dir zu gehorchen und mag dich, so wie er sich verhält.« Ist ja wohl offensichtlich, da der Kleine nah an Coopers Seite liegt, und alles versucht, Körperkontakt herzustellen.
»Ja, gerne. Was soll ich tun?«
Ich mag das, keine Diskussion, einfach eine Frage.
Und genauso verhält er sich bei der ganzen Untersuchung.
Der Hund ist nicht wirklich krank. Unterernährt, verwurmt, durstig. Dazu die Spuren am Hals von diesem grässlichen verknoteten Seil als Halsband. Vor allem ist er friedlich, nicht aggressiv. Er wirkt dankbar, besonders Cooper gegenüber. »Mir scheint, er sieht dich als seinen Retter.« Und weil ich weiß, wie wichtig ein festes Zuhause ist, spreche ich ihn gleich darauf an. »Könntest du ihn nicht zu dir nehmen? Du magst doch Hunde, das sehe ich sofort.«
»Klar mag ich Hunde. Aber ich kann keinen halten. Ich müsste ihn alleine lassen, während ich arbeite. Unmöglich. Ich bin oft zehn Stunden weg.«
Da ich überlege, was wohl sein Job sein könnte, schaue ich mir das Emblem auf seinem Hemd genauer an. Eine kniende Frau und Sterne, die vom Himmel fallen. Was das wohl bedeutet? Etwas steht darüber, ist aber nicht leicht zu entziffern.
Cooper schaut von dem Hund zu mir, scheint meinen Blick zu bemerken. Doch anstatt den Schriftzug zu erklären oder ihn abzudecken, stellt er sich aufrecht hin, streicht mit beiden Händen über seine Brust und steckt das Hemd in den Hosenbund, bis es straff und faltenfrei über seinem Körper liegt.
Was mich ein wenig ablenkt.
Okay, mehr als es sollte. Ich vergesse sogar, die Schrift zu entziffern.
Der Hund stößt ein helles Fiepen aus.
»Ich glaube, er ist auch der Ansicht, dass du hierbleiben solltest, Cooper.«
»Mag sein, aber mehr als ein paar Mal ausführen ist nicht drin.« Er streichelt den Hund automatisch, seinen Blick auf mich gerichtet, den Kopf schräg gelegt, die Brauen zusammengezogen. »Ich komme schon länger her. Dich habe ich hier noch nie gesehen.«
Ich gehe einen Schritt zurück, weil ich ahne, dass ich nach Tieren rieche, nach Medikamenten und Desinfektionsmittel. Dazu mein Aussehen – die Haare sind garantiert noch mehr durcheinander als sonst und ich weiß, dass meine helle Haut in diesem Licht eher kränklich wirkt. »Äh, ich komme auch schon länger her.« Schnell drehe ich mich weg und überlege krampfhaft, was ich holen könnte, damit es wie Absicht aussieht. Dabei verziehe ich mein Gesicht und fluche lautlos.
Ah, einen Cookie für den Hund!
Als ich mich umdrehe, grinst Cooper mich breit an.
Ich hebe eine Augenbraue.
»Sorry.« Er gestikuliert zu dem Schrank hinter mir. »Das Glas spiegelt.«
Dummerweise drehe ich mich um, als müsse ich das erst selbst kontrollieren. Für eine Sekunde schließe ich die Augen. Geht es noch peinlicher? Mit einem Ruck reiße ich mich zusammen. »Ich meinte damit, dass ich schon seit ein paar Monaten hier arbeite, zumindest stundenweise, so wie es mein richtiger Job zulässt.« Ein feuchter Stupser an meiner Hand erinnert mich an den Keks, den ich jetzt dem Hund überlasse. »Er ist gut erzogen. Zumindest, soweit ich das beurteilen kann.«
»Das dachte ich auch. Er hört, wenn man ihm klarmacht, was man von ihm möchte.«
In diesem Moment steht der Hund auf und stupst mich erneut, nur ist jetzt seine Schnauze auf Höhe meines Gesichts. Ich kann mich gerade noch wegdrehen und der feuchte Kuss landet auf meiner Wange. Verdammt, das ist so unprofessionell! Ich weiß doch, wie man mit Tieren umgehen muss. Hätte er mich beißen wollen, wäre ich jetzt für immer entstellt. »Nun ja …« Ich umfasse seinen Hals, um ihn von mir wegzuschieben, doch dort liegen schon Coopers Hände. Es funkt zwischen uns und der Hund japst überrascht auf.
»Sorry!«, sagen wir beide gleichzeitig. Unsere Blicke begegnen sich über dem Hund, blitzend, offen. »Meine Schuhe sind schuld«, sage ich. »Trockene Luft«, bietet er an.
Ich muss lachen und schaue ihn dabei an. Sein Gesicht hat sich ganz verändert. War er eben noch ganz fokussiert, ernst und damit unnahbar, wirkt er jetzt locker und entspannt.
Noch attraktiver, stelle ich für mich fest. War er eben die Sorte Mann, die ich mir für den Sex vorstellen könnte, den ich gerne hätte und nie haben werde, so wirkt er jetzt wie einer, mit dem man Pferde stehlen könnte.
Ich atme tief durch. Zeit, die Unterhaltung auf ein etwas höheres Niveau zu heben, knapp über der Wassermelonen-Ebene.
»Du gehst gerne mit Hunden spazieren?«
»Ja, sehr gerne. Ich komme so oft her, wie möglich. Leider ist das nicht sehr oft. Du bist Tierärztin?«
Ich nicke. »Leider habe ich auch nicht so viel Zeit, wie ich es gerne hätte. Aber hier wird auch für die Spätschicht immer jemand gebraucht.«
»Dabei musst du morgen wieder arbeiten.«
»Wie du auch.« Ich nicke zu dem Emblem auf seinem Hemd. Eindeutig ein Arbeitshemd, wenn auch kein Schnellimbiss. Ich vermute, ein nettes Lokal, in dem er bedient oder ein Maitre d'irgendwas ist. Mit so etwas kenne ich mich nicht aus, ich bin in einem durchschnittlichen Elternhaus aufgewachsen, fernab von Haute Cuisine.
Er schaut an sich herab, als hätte er vergessen, was er da trägt. »Oh, das. Ähm, ein Nebenjob. Das Hemd kommt eh in die Wäsche, deshalb habe ich es übergezogen.« Er schaut zu dem Hund, der uns von der Liege aus abwechselnd betrachtet.
»Ah«, sage ich. Und verdrehe zumindest innerlich die Augen. Sehr kompetent. Eindeutig unter der Wassermelonen-Linie.
Cooper tätschelt dem Hund den Kopf. »Ich muss dann mal los. Vielleicht …« Er schaut zu mir hoch. »Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Wenn ich ihn ausführe.« Damit hebt er eine Hand, es wirkt, als wolle er sich an eine Mütze greifen, die er nicht trägt. Stattdessen fährt er sich mit der Hand durch seine vollen Haare, die noch lockiger sind als meine, wenn auch von einer ähnlich dunklen Farbe.
»Moment noch!«
Schon wieder stehe ich da und weiß nicht, was ich sagen soll. Warum will ich ihn aufhalten? Na ja, ich gestehe es mir ein. Ich finde ihn cool. Endlich habe ich einen Geistesblitz. »Du hast vermutlich keine Ahnung, wie er heißt? Dann such doch einen Namen aus. Wir müssen ihn ja irgendwie nennen.«
»Oh. Hm.« Er kratzt sich im Nacken und ich starre auf seinen Oberarm. Genau genommen auf den Triceps, der sich deutlich herausdrückt. Oh Mann. Der macht Sport. Oder Bodybuilding. Wobei er nicht aufgepumpt wirkt, sondern so, als verwende er diese Muskeln aktiv.
»Buddy?« Er schaut mich mit hochgezogenen Brauen und großen Augen an.
Ich schüttle den Kopf. »Keine Chance. So nennen wir sie alle. Es sollte schon ein einzigartiger Name sein.«
Er kratzt sich erneut und diesmal höre ich deutlich das Geräusch. Es verursacht Gänsehaut bei mir.
»Peanuts?«
»Erstens haben wir schon einen Peanut, zweitens: Sieht er aus wie eine Erdnuss?«
»Er sieht ein wenig … rostig aus. Rusty?«
Ich lächle den Hund an. »Super, der passt gut. Sein Fell wirkt tatsächlich ein wenig rostig.« Rusty wedelt mit dem Schwanz, er scheint einverstanden zu sein.
»Sorry, ich muss los. Taylor, es war nett, dich kennengelernt zu haben. Wir sehen uns.« Damit dreht er sich um, hebt erneut einen Finger, als wollte er ihn an eine Mütze legen und verlässt den Raum.
Schade, ich habe keinen Grund, ihn erneut aufzuhalten.
Aber sobald Rusty in seinem vorläufigen Gehege untergebracht ist, beginne ich mit der Suche. Zum Glück wird Google dank AI-Unterstützung fündig.
Mein Unterkiefer fällt diesmal noch tiefer als vorhin. Ein Club. Die Sterne stehen für Wünsche, die wahr werden. Die kniende Frau für eine Sub. Die Sterne über dem Bild bilden drei Worte, die zu einem zusammengefügt sind.
WishesComeTrue.
Alles, was ich jemals gesucht habe.
Taylor
Ich lasse drei Tage verstreichen. Zum Teil in der Hoffnung, Cooper käme vorbei, während ich im Tierheim bin. Zum Teil, weil es in mir rumort.
Durch das Gitter betrachte ich Rusty, der inzwischen gar nicht mehr so rostig aussieht, weil er endlich sauber ist und sich erholt. Das vormals stumpfe Fell glänzt wieder in zartem Mahagoniton, noch nicht perfekt, aber doch erheblich mehr als in der Nacht seiner Einlieferung. Das Entwurmen hat geholfen, er nimmt viel mehr Nährstoffe auf und er trinkt ausreichend.
Wie schon in den letzten Tagen streckt er mir seine Nase entgegen und ich kann mich dieser Einladung nicht entziehen. Ich öffne das mit Maschendraht bespannte Tor und gehe zu ihm in den Zwinger. Noch muss er alleine bleiben, wir halten bei allen Neuankömmlingen eine Quarantäne ein. Sobald ich mich hingesetzt habe, legt Rusty sich neben mir ab mit seinem Kopf auf meinem Schoß und genießt das Streicheln.
Genauso wie ich den Kontakt mit ihm genieße. Dabei kann ich ganz in Ruhe nachdenken.
Noch nie dachte ich über einen Clubbesuch nach. Für mich bedeutet das Wort ›Club‹ das, was man früher mit Diskothek beschrieb, einen Ort, an dem man tanzen kann zu Musik, die ein DJ auflegt, an dem man trinkt und Menschen trifft. Genau das, was ich nie mache. Weder tanzen noch trinken und ja, leider auch keine Menschen treffen. Also einfach nur so, ohne Grund.
Natürlich treffe ich Menschen, die Animal Rights-Gruppe zum Beispiel. Meine Kollegen in der Praxis und hier. Zwei Freundinnen aus dem Studium, mit denen ich einmal im Monat etwas unternehme oder dann, wenn es einen Notfall gibt.
Wäre das hier ein Notfall? Soll ich sie fragen, was ich tun soll?
Rusty stupst mich an, ich habe sein Streicheln vernachlässigt.
Ich richte mich auf, lehne mich gerader an. Nein, auf keinen Fall werde ich Nadja und Aisha erzählen, dass es mich nach dieser Art Sex gelüstet.