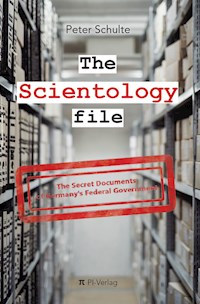Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ostwestfalen in den siebziger Jahren. Eine Kleinstadt im Wandel. Die Industrialisierung verändert das Handwerker- und Bauernleben. Zugereiste Arbeitsmigrannten und Ureinwohner müssen sich miteinander arrangieren. Statt Eis vom Lebensmittelhändler gibt es jetzt Gelati bei Pedro und Pizza zum Mitnehmen, sehr zur Freude von Kindern und Jugendlichen. Kirche und Schützen dominieren das Bild der Stadt, doch die Jugend steht auf progressive Musik, Mädchen und alternative Lebensentwürfe. Ein Rückblick aus Sicht eines Jugendlichen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 187
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Prolog
In der ostwestfälischen Provinz
Alltag im Dunstkreis des Spökenkiekers
Untaugliche Väter und überforderte Mütter
Ohne Fleiß kein Preis – die Schulzeit
Sommerfreuden im Freibad
Kirche und Glaube
Hopp hopp rin in Kopp – Feste und Gebräuche
Kulturarbeit auf Ostwestfälisch
Muss Arbeit First Claas – Wirtschaftsleben in der Pampa
Ich habe fertig – Lebenswirklichkeiten meiner Jugend
1. Prolog
Die schrecklichsten Erinnerungen an meine Jugend sind Mireille Mathieu, Michael Holm und Bata Illic. In den siebziger Jahren waren sie bekannter als der damalige Bundespräsident, aber im Gegensatz zu ihm sind sie heute noch bekannt. Wer um 1962 geboren ist, weiß, wovon ich spreche. Zu dieser Zeit waren Schlager ganz groß angesagt – je seichter, desto besser. Meine Tante stand auf Michael Holm. Auf ihrem Polterabend tanzte sie zu Barfuß im Regen (und wir tanzen und tanzen und tanzen). Da war ich um die neun Jahre alt.
Die Jungs hießen Klaus, Reinhold, Peter, Markus, Harald, Stefan oder Heinz und trugen häufig eine Art Jürgen-Marcus-Frisur – ja, genau der mit dem Song Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben (nananananana). Manchmal tat es auch der Poposcheitel oder der alltagstaugliche Fassonschnitt.
Die Mädchen hießen Christiane, Hildegard, Annette, Monika, Birgit, Elisabeth oder Kordula und hatten oft lange, dicke Zöpfe, an denen wir gerne zogen. Meist aber trugen sie ihr Haar offen und ließen es wachsen, wie es die Natur eben zuließ. Agnetha von ABBA trug manchmal Zöpfe und konnte uns Jungs ziemlich verwirren. Anni-Frid, die zweite Sängerin von ABBA, war aber auch nicht ohne.
Meine erste Langspielplatte war von Neil Young und hieß Harvest. Auf diesem Album ist auch sein wohl bekanntester Song Heart of Gold. Clemens brachte ihn mir auf der Gitarre bei. Mit einer Gitarre kam man damals bei den Mädchen besser an als mit einer dicken Brieftasche (besser wäre natürlich beides gewesen). Leider wurde mir die Platte nach mehrmaligem Verleihen irgendwann nicht mehr zurückgegeben (danke, Oliver, ich hoffe, du hattest deine Freude damit!).
Letztes Jahr, 42 Jahre nach der Veröffentlichung von Harvest, erfüllte ich mir meinen Jugendtraum und fuhr zum Neil-Young-Konzert nach Mönchengladbach. Da stand er, der Godfather of Grunge, wie er heute genannt wird, etwas gealtert, aber immer noch mit der gleichen Power und dem unverwechselbaren Sound, der mich bis heute inspiriert.
Meine erste Freundin war sehr hübsch, mit einem strahlenden Gesicht und enormem Selbstbewusstsein. Da war ich so zwölf Jahre alt. Sie hatte blonde, mittellange Haare und riesige, silberne Ohrringe, und bei unserem ersten Kuss sah sie mich an wie Ingrid Bergman ihren Rick alias Humphrey Bogart in Casablanca. Leider habe ich ihren Namen vergessen und sie bestimmt auch meinen. Interessant, wie manche Menschen in deinem Leben immer noch präsent sind, obwohl das schon eine Ewigkeit her ist! Der Zauber der Kindheit und Jugend ist schön und aufregend. Ich kenne Menschen, die so tun, als wäre so etwas völlig unbedeutend – vielleicht haben sie andere Erfahrungen gemacht…
In meiner Jugend war Literatur nicht wirklich angesagt. Man sah sich höchstens die Bilder in Zeitungen und Illustrierten an, las die Überschrift oder gelegentlich den Text (meist auf dem Klo). Die Bild am Sonntag war immer gegenwärtig. Mein erstes Buch, das ich von Anfang bis Ende las, war Pippi in Taka-Tuka-Land von Astrid Lindgren. Oder Fünf Freunde von Enid Blyton. Worum es da genau ging, habe ich vergessen – aber das ist auch egal, irgendwie war es spannend.
Die Geschichte, die ich erzählen möchte, ist wahrscheinlich eine Geschichte unter vielen. Vielleicht ist sie zu trivial, als dass sie in die literarische Welt Einzug finden würde. Mir ist das egal, denn darum geht es nicht. Bei mir war es wie eine Art Vorsehung, Prophezeiung oder Vision: Sie sagt einem, was zu tun oder auch nicht zu tun ist. Nicht, dass ich an so etwas glaube, aber manchmal ist es eine innere Stimme, die einen ruft und einem sagt, dass die Zeit für etwas Außergewöhnliches gekommen ist. So war es auch in meinem Fall. Hier ist meine Geschichte.
Der Ort, über den ich schreibe, ist ein kleiner Punkt auf der Landkarte irgendwo in Ostwestfalen, ein kleiner, möglicherweise unbedeutender Mikrokosmos, von dem die Welt kaum Notiz nimmt. Und doch ist er für die Einwohner das Zentrum der Welt. Hier spielt sich das Leben ab, mit all seinen Höhen und Tiefen, Irrungen und Verwirrungen, kleinen und großen Tragödien. Man kennt sich, aber irgendwie auch nicht, und wie überall auf der Welt gibt es auch in diesem Mikrokosmos nicht Schöneres als den Austausch von Mythen und Halbwahrheiten über andere Einwohner der Stadt.
Das Wahrzeichen der Stadt ist der Spökenkieker, ein in die Ferne blickender Schäfer. Der Legende nach konnte er in die Zukunft schauen und Unheil vorhersagen. Er wusste, wann Krieg, Krankheit und Tod kommt. Vielleicht konnte er auch Positives sehen. Wenn er das konnte, hat er es wohl für sich behalten, denn es gibt keine Überlieferung von seinen Prophezeiungen, die glücklich enden. Wie meine Geschichte endet, weiß weder der Spökenkieker noch ich.
Die Stadt und die darin lebenden Menschen, von denen ich erzählen möchte, besitzt eben so einen Spökenkieker. Seit 1962, dem Jahr meiner Geburt, steht er als Beobachter der Zukunft vor dem Rathaus der Stadt. Vermutlich ist er ein greiser Schäfer gewesen. Zu seinen Füßen weiden Schafe, bewacht von einem Hund, der das Treiben des Viehes beobachtet. Mit einem Schäferstab ausgerüstet, auf den er sich mit dem linken Arm stützt, versucht der Spökenkieker, die andere Hand über seine Augen haltend, weit in die Ferne zu schauen, um das Unheil zu erkennen.
Und so wie der Spökenkieker, so sind auch die Menschen dieser Stadt: Sie beobachten gern das Geschehen und sehen aus sicherem Abstand dem Treiben der Menschen zu. Was kann schöner sein, als das Schicksal der anderen zu sehen oder zumindest zu vermuten, um dem eigenen eine Zeit lang zu entfliehen? Neuigkeiten von besonderer Tragweite erfahren sie aus der regionalen Tageszeitung, die täglich auf einer Seite über das Leben der Menschen in dieser Stadt berichtet. Erst letztens ist wieder ein Einwohner ihrer Stadt „plötzlich und unerwartet“ verstorben, noch nicht einmal fünfzig Jahre alt.
Natürlich sind die Menschen dort nicht nur so; es wäre unfair, ihnen nur diese Eigenschaft zu unterstellen. Wie in jeder anderen Kleinstadt in Westfalen sind die Menschen so unterschiedlich wie auf der ganzen Welt: Es gibt Bauern und Handwerker, Arbeiter und Angestellte, Geschäftsleute und Versicherungsvertreter, Beamte und Lehrer, Hausfrauen mit und ohne Kinder genauso wie diejenigen, die abseits des bunten Treibens nie eine wirkliche Chance auf ein selbstbestimmtes und befriedigendes Leben hatten. Auch sie sind ein Teil dieser Stadt und gehören zu ihr, so wie es der Spökenkieker schon immer war.
Von all jenen möchte ich erzählen, von den Menschen in dieser westfälischen Provinz, von der manche meinen, dass sie völlig unbedeutend sei und den Verlauf des Lebens und das Schicksal der Welt in keiner Weise beeinflusse. Es mag sein, dass dieser winzige Punkt auf der Weltkarte für die Menschen außerhalb der Stadt nicht von Belang ist. Aber darauf kommt es nicht an. Es sind die Bilder und Eindrücke, der Duft und die Farben, das Licht und das Dunkel, Erlebnisse und Ereignisse, die Gesichter der Stadt und die unterschiedlichen Lebensgeschichten, die mich interessieren und von denen ich ein Teil war und manchmal auch noch bin.
Seit meiner Kindheit bin ich mit dieser Stadt verbunden, und obwohl ich schon seit vielen Jahren nicht mehr dort lebe, zieht es mich immer wieder an diesen Ort zurück. Warum das so ist, kann ich nur vermuten. Seitdem ich im Ausland lebe, wird mir mit den Jahren immer mehr bewusst, was Heimat bedeutet: Es ist der Ort, den du in deinem Herzen trägst und der dich überallhin begleitet, egal wo du bist. Hier, in dieser Stadt habe ich meine Kindheit und Jugend verbracht, bin ich zur Schule gegangen, habe die Wälder und die Stadt mit Freunden erkundet und habe meine erste Liebe erlebt und meinen ersten Frust bewältigt.
Immer wenn ich dort bin, besuche ich den heimischen Friedhof, um zu sehen, wer wieder einmal zu Grabe getragen wurde. Manchmal verbindet mich mit dem oder der Verstorbenen etwas, was nur wir zwei wissen können und sonst niemand. Vielleicht war es ein gemeinsames Bier oder ein interessantes Gespräch, das gemeinsame Sitzen auf der Schulbank in der Grundschule oder die Bewunderung wegen des tollen Motorrades (was ihm allerdings wenig Glück brachte, weil er damit tödlich verunglückt ist). Manchmal ist es auch nur so, dass man den Verstorbenen kennt, sich an sein Gesicht erinnert oder mit ihm etwas verbindet, was man nicht genau beschreiben kann: vielleicht eine Solidarität mit seiner Person und seinem Tun – oder auch nur, dass er immer freundlich grüßte.
Der Friedhof ist wie ein großes Lesebuch und hält für jeden Menschen, der ihn besucht, eine besondere Geschichte bereit. Es ist nur eine Frage der Zeit und dann liegst du selbst hier unter der Erde und dein Grabstein erzählt vielleicht anderen Menschen etwas von dir.
Jerry Williams ist so ein Mensch, auf dessen Grabstein nur das Jahr seiner Geburt und seines Todes steht. Wie und warum er hierherkam, entzieht sich meiner Kenntnis. Aber mein zwei Jahre älterer Bruder nahm bei ihm Nachhilfe in Englisch. Jerry muss ziemlich nett gewesen sein, denn mein Bruder hat sich nur positiv über ihn geäußert. Er war ein schwarzer Engländer oder Amerikaner und starb Mitte der siebziger Jahre mit gerade einmal 36 Jahren. Die Umstände seines Todes sind mir nicht bekannt. Entweder war er krank oder er hat sich umgebracht. Er liegt einsam auf dem Friedhof. Noch nie habe ich frische Blumen auf seinem Grab gesehen. Obwohl ich ihn nicht persönlich kenne (ich habe ihn nie gesehen oder gar mit ihm gesprochen), fühle ich mit ihm solidarisch verbunden, wenn ich vor seinem kleinen Grab stehe – vermutlich weil er fernab von seiner Heimat sein Glück in der ostwestfälischen Provinz gesucht hat und aus welchen Gründen auch immer fernab seiner Heimat sein Schicksal erfuhr.
In meiner Jugend begegnete ich dem Tod wie einem Fremden, er war etwas Unaussprechliches, Gewaltsames und Grausames. Der Macht, mit der er mir begegnete, konnte ich nur Traurigkeit und Unverständnis entgegensetzen. Mittlerweile habe ich akzeptiert, dass er ein Bestandteil unseres Lebens ist. Letztendlich erinnert uns der Tod ja auch an das Leben, das vor ihm lag, und von daher ist es mir heute wichtiger denn je, mich ständig nach dem Wert des Lebens heute, jetzt und in dieser Stunde zu fragen.
Doch zurück zum besagten Friedhof in der kleinen westfälischen Provinz mit ihrem Spökenkieker auf dem Rathausplatz. Hier wird vermutlich jeder einmal zur letzten Ruhe gebettet, wer ein Teil dieser Stadt war und sie in gewissem Maße durch sein Wirken mitgestaltet hat, egal wie groß der Beitrag war, den er oder sie geleistet hat. Überhaupt – was heißt es schon, einen Beitrag geleistet zu haben? Mir sind am meisten die Menschen in Erinnerung geblieben, die für mich etwas Besonderes darstellten und mich in meiner Persönlichkeit gefördert haben, also Menschen, die mich auf irgendeine Art beeinflusst und mir Wege aufgezeigt haben, die ich bis dahin noch nicht kannte. Aber auch solche Menschen sind mir in Erinnerung geblieben, die der Ansicht waren, dass ich möglicherweise keinen Wert für sie hätte und sie deswegen etwas Besseres wären. Auch diese Seite des Lebens gehört zu den Bildern, die in mir aufkommen, wenn ich an diese Stadt denke.
2. In der ostwestfälischen Provinz
Wir waren keine Einheimischen, als wir Mitte der sechziger Jahre unsere neue Wohnung in besagter westfälischer Provinz bezogen. Vorher hatten wir im ostwestfälischen Paderborn gewohnt. Von dort aus war mein Vater jeden Tag mit dem Bus in unseren neuen Wohnort gefahren, wo er in der dortigen Fabrik Brot und Arbeit fand. Das Unternehmen war so groß, dass es nicht nur Einheimische beschäftigte, sondern auch Personen aus einem Umkreis von fünfzig Kilometern und mehr, die mit dem Werksbus abgeholt wurden. Morgens um 5:30 Uhr kam der Bus, und pünktlich um 6:30 Uhr ließ die Sirene der Fabrik das bunte Treiben vor dem Werkstor verstummen und lautes Maschinengedröhne und Gestanze trat an dessen Stelle.
Wie dem auch sei – das waren meine ersten Eindrücke vom Berufsleben. Mir kam es so vor, als wenn die Fabrik die Menschen frühmorgens verschlingt, den ganzen Tag über verdaut und abends wieder ausspuckt. Wenn mein Vater morgens aus dem Haus ging, war er frisch und munter, und wenn er nachmittags wieder nach Hause kam, legte er sich zuerst zum Schlafen auf das Wohnzimmersofa.
So wie wir kamen auch die ersten Gastarbeiter in die Stadt: hauptsächlich aus Spanien, manche aus Italien und einige vermutlich aus Portugal. Für die Spanier wurden eigens gebaute Werkswohnungen bereitgestellt, wo sie in Zwei- und Mehrbettzimmern untergebracht waren. Die Männer kamen allein, ohne ihre Familien und verdienten das Geld in der Fremde für ihre Liebsten daheim. Sie hießen Felix, Gonzales, Rafael oder Adolfo und unterschieden sich schon im Aussehen von den Einheimischen. Meist hatten sie schwarze Haare, die sie mit Unterstützung von reichlich Frisiergel nach hinten kämmten. Auch ihre Kleidung suggerierte einen gewissen Wohlstand, wenn sie mit Sakko oder Weste und in schwarzen Lederschuhen morgens durch die Werkstore gingen. Inwieweit ihr südländisches Temperament mit dem wilhelminisch-preußischen Arbeitsethos korrelierte, bleibt ein Geheimnis; fest steht nur, dass für sie sicher alles anders war als in ihrer Heimat.
Der Austausch mit den Einheimischen beschränkte sich fast ausschließlich auf berufliche Kontakte oder auf ein kurzes Gespräch beim Lebensmittelhändler, der einen Edeka-Markt betrieb. Für diesen stellten die Zuwanderer eine zahlungskräftige Zielgruppe da und er ließ es sich nicht nehmen, zusätzlich zu den Samstagsbrötchen große Weißbrote zu produzieren, die sogenannten Spanierbrote. Zehn Brötchen kosteten ca. 60 Pfennig und ein Spanierbrot 35, wobei Letzteres etwa der Größe von fünf bis sechs Brötchen entsprach.
Später kauften auch die Deutschen dieses Weißbrot. Es galt als Geheimtipp, obwohl es sich im Geschmack nicht vom Brötchen unterschied – es war nur ein großes Brötchen. Vermutlich galt der Kauf eines Spanierbrotes eher als ein Zeichen der Solidarität mit den Spaniern. Und es waren wohl auch die deutschen Arbeitskollegen, die in der Nähe wohnten, die sich für die Essgewohnheiten derjenigen interessierten, mit denen sie die ganze Woche in der Fabrik zusammenarbeiteten und von denen sie so gut wie nichts außer ihrem Namen wussten.
Privat spielte sich zwischen den Deutschen und den Spaniern nicht viel ab, teilweise bedingt durch Sprachschwierigkeiten, vor allem aber wohl durch die kulturellen Unterschiede und die wahrgenommene Andersartigkeit. Man blieb vorerst unter sich. Die Spanier hatten ihr eigenes Kulturzentrum, wo sie sich nach Feierabend trafen, und die Deutschen gingen in ihre eigenen Stammlokale.
Der immer gleiche Wochenrhythmus und vermutlich auch die berufliche Eintönigkeit, die mit dem Aufkommen der Massenproduktion verbunden war, führten dazu, dass es für meinen Vater keine großen handwerklichen Herausforderungen gab. Vielmehr galt es, pünktlich zu kommen, pünktlich zu gehen und schön brav ein wichtiges Rad im Getriebe zu sein oder zumindest so zu tun, als ob man es sei, um sich möglichen Ärger zu ersparen.
Als Leiter eines großen Familienunternehmens ließ es sich der Chef nicht nehmen, jeden Morgen mit dem Fahrrad durch die Werkshallen zu fahren, um nach dem Rechten zu sehen. Manchmal soll er sogar angehalten und sich mit seinen Mitarbeitern unterhalten haben. Ob er meinem Vater jemals ein Wort gewechselt hat, kann ich nicht sagen. Ich gehe eher davon aus, dass sie sich vom Sehen her kannten und sich auf distanziert-höfliche Art grüßten.
Mitte der sechziger Jahre zogen wir also von der Stadt in die Provinz, von Paderborn nach Harsewinkel, in das ostwestfälische Städtchen mit dem Spökenkieker, der vor dem Rathaus steht und jeden Besucher schon aus der Ferne sehen kann.
Woher der Name Harsewinkel stammt, ist nicht eindeutig geklärt. Es gibt zwei Thesen. Erstere besagt, dass „Harse“ in „Harsewinkel“ eine Ableitung des englischen Begriffs „Horse“ (Pferd) ist. Jedoch ist schwer nachvollziehbar, wie ein englischer Begriff in einen deutschen Städtenamen kommt. In der Praxis ist „Horse“ schon von Bedeutung, denn in und um Harsewinkel gab und gibt es viele Pferde. Auch auf dem Wappen der Stadt ist ein Pferdekopf abgebildet. Der Stadtchronik zufolge handelt es sich, etymologisch gesehen, bei dem Namen Harsewinkel also um „Horsewinkel“, also Pferdewinkel.
Eine andere These, die ich einmal gehört habe (wobei ich nicht weiß, ob uns das in der Schule oder sonst wo erzählt wurde), ist, dass „Harse“ ein Fluss in dieser Stadt war, der früher einmal irgendwo entlanggeflossen ist. Ob das stimmt? Wer weiß das schon! Überhaupt stellt sich die Frage, inwieweit das irgendjemanden interessiert.
Wenn mich heute jemand fragt, woher ich komme, und ich antworte, dass ich aus Harsewinkel stamme, dann ist immer Gelächter im Raum. Für viele Menschen klingt der Name lustig und verspielt, und nicht wenige vermuten, dass Harsewinkel etwas mit Hasen zu tun hat. Die Einheimischen, die schon ewig in der Stadt wohnen und sich nicht mit dem zufrieden geben, was in dieser Stadt passiert, meinen allerdings – und das ist auch nachvollziehbar –, dass Harsewinkel eine Stadt ist, in der sich Fuchs und Hase noch frohe Ostern wünschen. – So viel zu den Ableitungen und Bedeutungen des Namens.
Wer aus südöstlicher Richtung nach Harsewinkel fährt, dem fallen schon von weitem zwei Objekte auf: Zum einen sticht die Domspitze der Stadt sofort ins Auge. Wie auf einem Thron wacht die Kirche über die Geschicke ihrer Schäfchen. Zum anderen empfängt dich an der Ortseinfahrt eine Schutzengelmadonna mit offenen Armen und signalisiert dir, dass du herzlich willkommen bist.
Die Bedeutung dieser Objekte hat einen geschichtlichen Hintergrund. Diesen möchte ich hier nicht weiter ausbreiten, sondern nur darauf hinweisen, dass der Katholizismus und die damit verbundenen Einflüsse ein wichtiger Teil der Stadt und seiner Einwohner sind. Doch davon später mehr.
Der Bahnhof von Harsewinkel liegt versteckt zwischen hohen Birken- und Ahornbäumen am östlichen Ende der Stadt. Kein Schild zeigt Orts-fremden, wo man ihn findet, und wenn man ihn gefunden hat, steht man vor einem alten Haus, das wie im Winterschlaf liegt. Aber es gibt eine Straße, die „Am Bahnhof“ heißt, und am Ende dieser Straße steht das Hotel Haus Bergmann. Die Besitzer dieses Hauses erbauten das Haus etwa zeitgleich mit der Eröffnung der Bahnlinie; das muss in den sechziger Jahren gewesen sein, vielleicht auch früher. Jeder in Harsewinkel ankommende Gast fand dort Essen und Quartier.
Erst neulich stattete ich dem Bahnhof in Harsewinkel wieder einen Besuch ab. Er wirkt verlassen und einsam, wenn man sich ihm nähert. Die Wände sind mit Graffiti bemalt und hier und da liegen Bierflaschen und sonstiger Müll herum, Zeichen nächtlicher Treffen an einem ruhigen Ort.
Und noch etwas anderes erinnert an früheres Leben und Betriebsamkeit: Die Fahrradständer stehen immer noch da, wo sie immer standen. Wenn man vor dem Bahnhof steht, sieht man sie links unter einer Blechüberdachung, die von einem großen Baum geschützt wird. Das Bahnhofsschild hängt noch über den zweistöckigen Gebäude, und auch die Laterne, die abends das Schild beleuchtet, wirkt so, als sei sie gerade erst erloschen.
Den hinteren Teil des Bahnhofs bildet eine Zufahrt, die zum größten Teil noch aus Kopfsteinpflaster besteht, Baumaterial, das an die Zeiten der Pferdekutschen und Reiter zu Pferd erinnert. Vom Bahnhofsgebäude bis zu dem Abfahrtsgleis sind es gerade einmal zehn Meter; alles wirkt einfach und unkompliziert, ein kleiner ostwestfälischer Provinzbahnhof. Ein weiteres Gleis führt zu einer kleinen Lagerhalle direkt neben dem Bahnhofsgebäude; hier wurden Güter mit der Bahn angeliefert oder abgeholt. Etwa hundert Meter weiter stehen die Lagerhallen der Genossenschaft; sie bunkerten landwirtschaftliche Produkte aus der Region für den Weitertransport an irgendeinen Ort der Welt.
Im Sommer trat Öl aus den hölzernen Gleisbohlen und erzeugte einen eigenartigen Geruch, den ich heute noch bei heißem Wetter wahrnehme. Als wir Kinder draußen spielten, konnten wir oft das Tuten der Diesel- oder Elektrolok hören, wenn sie einen Bahnübergang querte. Auch heute noch höre ich denselben Klang in einer Art und Weise, so als ob die Zeit stehen geblieben ist.
Uns Kindern wurde gesagt, dass wir keine Steine oder sonstige Gegenstände auf die Gleise legen durften, weil sonst die Eisenbahn entgleisen könnte. Manchmal legten wir Ein-, Fünf- oder Zehn-Pfennig-Stücke auf die Gleise, legten uns auf die Lauer und warteten, bis die Eisenbahn laut tutend immer näher kam, bis sie schließlich schnaufend über unsere Münzen fuhr und sie plattwalzte. Es war ein herrliches Gefühl, als wir dann aus unserem Versteck kamen und uns den Gleisen näherten, um das Resultat unserer kreativen Aktion zu betrachten.
In den sechziger und siebziger Jahren fuhr hier noch die Teutoburger-Wald-Eisenbahn Richtung Gütersloh und in entgegengesetzter Richtung nach Halle in Westfalen. Heute hält kein Zug hält mehr am Bahnsteig, die Zeiten des dörflichen Personenverkehrs mit der Eisenbahn sind längst Vergangenheit. Heute donnern nur noch Waggons mit Mähdreschern des einheimischen Landmaschinenherstellers auf dem Weg zu ihrem Bestimmungsort über die Gleise, ansonsten ist tote Hose. Es gab viele Versuche, den Personenverkehr wieder aufleben zu lassen, aber bis heute ist, aus welchen Gründen auch immer, nichts passiert.
Die Werkshallen des Landmaschinenherstellers wurden entlang der Bundesstraße 513 gebaut. Er gibt den meisten Einwohnern der Stadt Brot und Arbeit und sichert den Wohlstand der Region. Vor dem Zweiten Weltkrieg entwickelte das Unternehmen nützliche Dinge für die Heuernte, zum Beispiel ein technisches Gerät, das Heuballen zusammenknoten kann. Es wurde in eine eigens dafür konstruierte Maschine integriert. Das Ergebnis ist ein tadellos aussehendes, viereckiges Heubündel, das man nach der Heuernte in Ostwestfalen auf vielen Feldern bestaunen kann.
Später entwickelten und bauten die findigen Ingenieure große, komplexe Erntemaschinen, die sie bis heute weltweit vertreiben. Die Stadt zeigte ihre Dankbarkeit auf vielfältige Weise: So tragen Straßen und Schulen den Namen der Firmengründer, mittlerweile erinnern auch die Ortseingangstafeln daran, dass hier nicht nur „Harse“, also „Horse“ (Pferde) zu Hause sind, sondern auch Mähdrescher und Landmaschinen das Bild der Stadt mitgeprägt haben. Kurzum, vieles hier im Ort erinnert an die Geschichte des Konzerns. Auch die Stadtchronik betont die herausragenden Leistungen der Firmengründer, die viele Arbeitsplätze geschaffen und der Stadt zu Wohlstand verholfen haben.