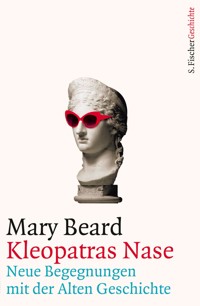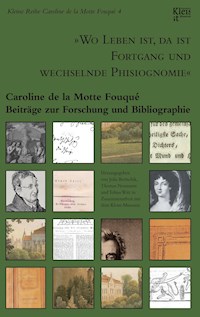
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Der vierte Band der »Kleinen Reihe Caroline de la Motte Fouqué« beinhaltet verschiedene, verstreut publizierte Beiträge aus der Caroline de la Motte Fouqué-Forschung. Die teilweise an unzugänglichen Orten veröffentlichten Aufsätze sollen hier den interessierten Lesern zugänglich gemacht werden und gleichzeitig einen Überblick zum Stand der Forschung zu der Schriftstellerin Caroline de la Motte Fouqué geben. Außerdem enthält der Band einen bisher unveröffentlichten Beitrag, gehalten auf dem Caroline de la Motte Fouqué-Symposion im Herbst 2014 im Kleist-Museum. Die Caroline de la Motte Fouqué-Bibliographie gibt einen Überblick über die von und über Caroline de la Motte Fouqué erschienenen Werke und Schriften.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 331
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Don’t make me sad, Don’t make me cry. Sometimes love is not enough And the road gets tough, I don’t know why.
Abb. 1: Porträt Caroline de la Motte Fouqué (1775–1831)
INHALTSVERZEICHNIS
Caroline de la Motte Fouqué und einige ihrer modernen Bewunderer. Beiträge zur Forschung. Eine Einleitung
von Tobias Witt
Beiträge zur Forschung
Petra Kabus: Caroline Fouqué – geschlechtsspezifisch motivierte Ausgrenzungsmechanismen der literarischen Kritik am Beispiel von Arno Schmidts Fouqué-Biographie
Petra Kabus: Caroline de la Motte Fouqué: »Resignation«. Ein Roman zwischen den »Wahlverwandtschaften« und »Effi Briest«
Birgit Wägenbaur: Romantik für Jedermann. Caroline de la Motte Fouqués Erzählungen
Elisa Müller-Adams: »Wie das Leben so in lauter kleine Welten zerfällt.« Caroline de la Motte Fouqués »Fragmente aus dem Leben der heutigen Welt«
Julia Bertschik: »Sinnliche Zeichen« – Dichtungssymbolik bei Goethe und Caroline de la Motte Fouqué
Julia Bertschik: Maskeraden. Zum Topos der Verkleidung in der Spätromantik, besonders bei Caroline de la Motte Fouqué
Thomas Neumann: Erzählen als Lebensentwurf? Caroline de la Motte Fouqué geb. von Briest
Thomas Neumann: Weibliche Bildung und emanzipatorisches Leben bei Caroline de la Motte Fouqué
Thomas Neumann: Reflexion und Rezeption. Caroline de la Motte Fouqué in der Gemäldegalerie in Dresden
Anhang
Zu dieser Ausgabe
Verzeichnis der Abbildungen
Drucknachweise
Thomas Neumann: Bibliographie Caroline de la Motte Fouqué
A. Selbständige Publikationen
B. Unselbständige Publikationen
C. Sekundärliteratur
CAROLINE DE LA MOTTE FOUQUÉ UND EINIGE IHRER MODERNEN BEWUNDERER. BEITRÄGE ZUR FORSCHUNG
Eine Einleitung von Tobias Witt
Trotz einiger bemerkenswerter Einzelleistungen1 konnte bis zur Mitte der 1990er Jahre von einer kontinuierlichen Forschung über Leben und Schreiben Caroline de la Motte Fouqués keine Rede sein. Zwanzig Jahre später hat sich die Situation grundlegend gewandelt. Als wichtige Impulsgeber für die Vernetzung und Ausdifferenzierung der Fouqué- Forschung seien die 1997 an der FH Brandenburg veranstaltete Tagung Friedrich und Caroline de la Motte Fouqué, die von 1998 bis 2003 durchgeführten wissenschaftlichen Kolloquien der Fouqué-Gesellschaft Berlin-Brandenburg sowie die Tagung Caroline de la Motte Fouqué und Sophie Tieck- Bernhardi-von Knorring. Schriftstellerinnen in Preußen genannt, die 2010 im Kleist-Museum Frankfurt (Oder) stattfand. Der vorliegende Band will diese Entwicklung anhand ausgewählter Forschungsbeiträge aus den vergangenen zwei Jahrzehnten Revue passieren lassen. Jeder von ihnen hat auf seine Weise neue Erkenntnisse zur Diskussion gestellt, auf Vergessenes aufmerksam gemacht und scheinbar Bekanntes aus moderner Perspektive neu beleuchtet.
PETRA KABUS widmet sich zunächst der Biographie Caroline de la Motte Fouqués. Sie befreit die Lebensgeschichte der Autorin aus dem Bannkreis des durchweg unter negativen Vorzeichen stehenden Porträts in Arno Schmidts einflussreicher Monumentalstudie Fouqué und einige seiner Zeitgenossen (1958) und schreibt sie auf der Basis eigener Quellenforschungen neu.2 Daneben gilt Kabus’ Interesse den auf die gesellschaftskritischen Eheromane Theodor Fontanes vorausweisenden Zügen des Spätwerks Caroline Fouqués. In ihrem Briefroman Resignation (1829) ist es eine Wiederaufnahme der maßgeblich durch das Vorbild von Goethes Wahlverwandtschaften (1809) geprägten Ehe-Thematik, mit der die Autorin spätromantische Strukturmuster hinter sich lässt. Ihr gelingt damit die frührealistische Darstellung einer schuldlos schuldigen Ehebrecherin, die als geschiedene Frau mit ihrer geschlechtsspezifischen Chancenlosigkeit konfrontiert ist, trotz gesellschaftlicher Ächtung und Isolation aber nicht in den Tod geht, sondern eine Haltung von Entsagung als Selbstbehauptung wählt.
BIRGIT WÄGENBAUR wendet sich den romantischen Strukturmustern in der Regel weitaus stärker verpflichteten Erzählungen zu, die Caroline Fouqué für diverse Almanache und Zeitschriften verfasste. Die Diagnose, dass diese Texte in thematisch-motivischer Hinsicht als genuin ›romantisch‹ gelten können, in Punkto Mehrdeutigkeit, Ironie und Selbstreflexivität aber hinter den für die moderne Romantik-Forschung zentralen Erzählungen der kanonisierten männlichen Autoren Arnim, Brentano oder Tieck zurückbleiben, ist grundsätzlich sicher zutreffend, obwohl sich in den besten Erzählungen Fouqués durchaus auch selbstreflexive Momente und subversive ironische Brechungen aufspüren lassen.3
Die Modernität ihres Schreibens zeigt sich deutlicher in ihren oft dialogartig angelegten zeitkritischen Journalveröffentlichungen, etwa in den Fragmenten aus dem Leben der heutigen Welt (1820), auf die ELISA MÜLLER-ADAMS nachdrücklich aufmerksam macht. Der Einsatz der dialogischen Textform als Mittel polyphoner, ergebnisoffener Zeitreflexion kann als eine der interessantesten Schreibstrategien Caroline Fouqués gelten, die Müller-Adams auf das literarische Konzept einer Poesie der Geselligkeit aus dem Geist der Salon-Konversation zurückführt.4
JULIA BERTSCHIK verfolgt die Spuren, die der Wandel der Kleiderordnung um 1800 und der damit einhergehende vestimentäre Diskurs der beginnenden Moderne – auch über Fouqués mittlerweile relativ bekannte Geschichte der Moden (1829) hinaus – in ihren Texten hinterlassen haben.5 ›Sprechende‹ Kleidungsrequisiten finden sich hier ebenso wie eine in der Nachfolge Goethes poetologisch gewendete Textilmetaphorik. Verweist diese vor allem auf die zeitgenössischen Aporien weiblicher Autorschaftskonzepte, so gelingt Fouqué mit ihren die wechselnden Mode- und Gesellschaftsphänomene kommentierenden Journaltexten ein Vorgriff auf die dynamische Kulturpoetik des sich herausbildenden modernen Feuilletons. Gleichzeitig setzt Fouqué den beliebten goethezeitlichen Topos der Verkleidung nicht nur auf der Figurenebene ihrer Erzähltexte, sondern auch als eigene Schreibstrategie ein, indem sie in ganz ›unweiblicher‹ Manier die Maske der Fiktion gezielt ausnutzt, um autobiographische Momente ebenso wie reale Personen ihrer Lebenswelt verdeckt gestalten und bei Bedarf karikieren zu können.
Einen gerafften Überblick über Caroline Fouqués Werkbiographie legt THOMAS NEUMANN vor und präsentiert hierbei nicht zuletzt reichliches Quellenmaterial zur Veranschaulichung der Rezeption ihrer Texte durch die zeitgenössische Literaturkritik. Einen weiteren thematischen Schwerpunkt stellen die drei Bildungsschriften dar, mit denen Fouqué zwischen 1810 und 1820 in die zeitgenössische Diskussion über die angemessene intellektuelle Bildung von Frauen und Mädchen eingriff. Neumann erläutert die Briefe über Zweck und Richtung weiblicher Bildung (1811), die Briefe über die griechische Mythologie, für Frauen (1812) und Die früheste Geschichte der Welt. Ein Geschenk für Kinder (1818) als eine konsequent entwickelte pädagogische Trilogie, die sich bei der Wissensvermittlung auf der Höhe der medialen Möglichkeiten ihrer Zeit bewegt.6 Schließlich weist Neumann auf die bemerkenswert deutliche Verabschiedung romantischer Kunstverehrung zugunsten der Beobachtung und Reflexion zeitgenössischer Gesellschaftsphänomene hin, die Caroline Fouqué in einem 1823 veröffentlichten Reisebericht aus der Dresdner Gemäldegalerie vornimmt. Indem sie hierin das komplexe Tableau der Museumsbesucher als eine Bildergalerie zweiter Ordnung den eigentlichen Kunstwerken vorzieht, definiert sie einen kunstauratisch aufgeladenen Erinnerungsort der Frühromantik als sozialen Raum neu.
»Wo Leben ist, da ist Fortgang und wechselnde Phisiognomie«: Ganz im Sinne des Caroline Fouqués Fragmenten aus dem Leben der heutigen Welt entnommenen Titelzitats zeigen die in diesem Band versammelten Beiträge die Lebendigkeit der neueren Fouqué-Forschung in ihrer konsequenten Weiterentwicklung und Anreicherung von Fragestellungen und ihrem zugleich vielstimmigen, individuell unterschiedlichen Erkenntnisinteressen verpflichteten Erscheinungsbild. An noch unbearbeitetem Untersuchungsmaterial und weiteren lohnenden Forschungsfragen – etwa zum politischen Diskurs im Werk Caroline Fouqués, zu ihren literarischen Konzepten von Adeligkeit oder ihrer Position in den zeitgenössischen Verlegernetzwerken7 – wird auch in Zukunft kein Mangel herrschen.
ANMERKUNGEN
1 Vgl. vor allem die nach wie vor unverzichtbare Monographie von Wilde, The Romantic Realist. Die vollständigen Titel der in den Anmerkungen abgekürzt erwähnten Forschungsbeiträge finden sich im bibliographischen Teil dieses Bandes.
2 Zum letzten Stand der biographischen Forschung vgl. Gribnitz, Caroline de la Motte Fouqué.
3 Etwa in ›Der Delphin‹, vgl. Witt, Gottwalt der Zelotes-Mensch.
4 Vgl. ausführlich: Müller-Adams, »daß die Frau zur Frau redete«; zur Dialogform: Gribnitz, Über Literatur sprechen und schreiben.
5 Vgl. ausführlich: Bertschik, Mode und Moderne.
6 Zum Aspekt der Wissenspopularisierung vgl. Bertschik, Im Zeichen des Schleiers.
7 Vgl. hierzu bislang: Baumgartner, Public Voices; Witt, »Er hatte den Bogen gespannt. Der Pfeil nahm seine eigene Richtung«; Neumann/Witt (Hrsg.), »Kein menschliches Bemühn...«.
Abb. 2: Schloß Nennhausen (um 1860)
BEITRÄGE ZUR FOSCHUNG
Abb. 3: Resignation (1829), Titelblatt
PETRA KABUS
CAROLINE FOUQUÉ – GESCHLECHTSSPEZIfiSCH MOTIVIERTE AUSGRENZUNGSMECHANISMEN DER LITERARISCHEN KRITIK AM BEISPIEL VON ARNO SCHMIDTS FOUQUÉ-BIOGRAPHIE
1818 spricht Caroline de la Motte Fouqué in einem Brief an Prinzessin Marianne von ihren Phantasien, der König könne ihr ein Haus in Berlin schenken: »Wären wir in Frankreich, Berlin Paris und ich eine französische Schriftstellerin so etwas wäre denkbar! Doch die Feder in einer deutschen Frauenhand bleibt den Meisten, und ist auch vielleicht wirklich nur eine andre Art von Spielwerk, wie die Nadel, vergängliche Bilder zu schaffen, die das Auge wohl einmal sieht aber auch übersieht.«1
Ihr Anspruch mag damals frappiert haben, und er tut es auch heute, wenn auch die Gründe unterschiedliche zu sein scheinen. Caroline Fouqué hat in drei Jahrzehnten über einhundert Prosatexte unterschiedlicher Länge und Qualität sowie Gedichte veröffentlicht und vor allem der Frauenbildung mehrere theoretische Schriften gewidmet. 1818 war sie bereits eine gestandene Schriftstellerin, doch sie selbst empfand das in ihrer Geschlechtszugehörigkeit begründete Absurde ihres Wunsches: Eine Frau konnte nie in dem Maße wie ein Mann öffentliche Anerkennung erfahren; auch wenn sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts immer mehr Frauen öffentlich zu Wort meldeten, waren sie mehr geduldete Außenseiterinnen als ernstzunehmende Berufsgenossinnen.
Auch uns heute überrascht ihr Ansinnen. Zwar sind wir eher bereit, Frauen künstlerische und intellektuelle Fähigkeiten und Erfolge zuzubilligen. Doch Caroline Fouqué ist in unserem Bewußtsein trotz einiger größerer Arbeiten über sie aus der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts und trotz mehrerer Jahrzehnte Frauenforschung noch immer kaum mehr als die Frau Friedrich Fouqués.
In ihrer Testamentsergänzung, die sie im selben Jahr vornahm, aus dem der Brief an Marianne stammt, hatte sie mit einer Gesamtausgabe ihrer Werke bei Cotta gerechnet und den daraus zu erzielenden Erlös ihren Hinterlassenschaften bereits zugerechnet. Als sie 1831 starb, widmete ihr der Neue Nekrolog der Deutschen einen Nachruf – von insgesamt 38 bedeutenden Persönlichkeiten, deren Ableben für den Juli 1831 angezeigt wurde, war sie die einzige Frau. Ein Roman erschien posthum. Die Bemühungen der Tochter Marie um eine Gesamtausgabe hatten jedoch keinen Erfolg mehr: Wie über Nacht war Caroline Fouqué dem Vergessen anheimgefallen.
Dieses Schicksal teilt sie mit vielen anderen Autoren. Gegen die Behauptung, ihre Texte seien von minderer Qualität und keiner weiteren Beachtung wert, ist schwer anzugehen: »Denn es ist nicht schwierig, den ästhetischen Wert von Texten zu behaupten, die durch ihre Aufnahme in den Kanon als ›Werk‹ gesetzt worden sind, aber es erscheint fast aussichtslos, die Werkhaftigkeit von etwas nachzuweisen, dem die Institution die Anerkennung verweigert hat.«2 Trotzdem ist dieser Versuch in den letzten Jahrzehnten bei den verschiedensten Autoren unternommen worden. Daß das Interesse an Caroline Fouqué so bemerkenswert gering blieb, ist mehreren Umständen geschuldet. Caroline Fouqué war eine weder formal noch inhaltlich innovative Autorin. Sie schrieb solide Unterhaltungsliteratur, manchmal weniger, manchmal aber auch mehr, und besonders ihre frauenerzieherischen Schriften müßten für die Forschung von Interesse sein. In einer Zeit aber, in der ein solches Interesse an vergessenen Autoren langsam aufkeimte, entstand ein Text, der den Blick auf Caroline Fouqué von vorneherein verstellte: Arno Schmidts Friedrich-Fouqué-Biographie.3 Jeder, der etwas über Caroline erfahren will, schlägt zuerst bei Schmidt nach und ist anschließend der Meinung, daß es da nichts Besonderes zu erfahren gebe. Das ist nicht nur ein Trugschluß, sondern ein Urteil, das auf einer Reihe von Fehlinterpretationen und der definitiv falschen Wiedergabe von Fakten beruht.
Nachdem mir Diskrepanzen zwischen Schmidts Bemerkungen zur Fouqué und den Aussagen, die die authentischen Materialien selbst beinhalten, aufgefallen waren, bin ich anhand seiner Unterlagen zur Fouqué-Biographie im Bargfelder Arno-Schmidt-Archiv der Frage nachgegangen, inwieweit Schmidt etwa weiterführendes und mir unbekanntes Material, das seine Darstellungen absicherte, in Händen gehabt haben könnte bzw. ob von einer Funktionalisierung oder gar bewußten Verdrehung der ihm bekannten Fakten gesprochen werden muß.
Wenn ich im folgenden einen Vergleich der wichtigsten Caroline Fouqué tangierenden Bemerkungen Schmidts mit den originalen Materialien geben will, möchte ich vorher ausdrücklich betonen, daß es mir dabei nicht um anmaßende und kleingeistige Fehlersuche geht, sondern um eine Objektivierung des Bildes der Fouqué und gleichzeitig um die Darstellung von Mechanismen der Ausgrenzung aus der Kanonbildung und Literaturgeschichtsschreibung aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit einer Autorin.
Doch zunächst einige biobibliographischen Bemerkungen zu Caroline Fouqué.
Sie wurde am 7. Oktober 1775 als Caroline Philippine von Briest in Berlin geboren. Nach dem Tod seines Bruders übernahm ihr Vater 1780 den Familienbesitz in Nennhausen, pflegte aber weiter die alten gesellschaftlichen Kontakte und zog Berliner Bekannte nach Nennhausen. Als einzige Tochter des Hauses erfuhr Caroline eine umfassende Bildung. 1791 heiratete sie den Sohn einer benachbarten Adelsfamilie, Friedrich Ehrenreich Adolf Ludwig Rochus von Rochow, der als Offizier in Potsdam stationiert war. Rochow war Lehnsvetter des Pädagogen Friedrich Eberhard von Rochow, so daß bei dessen Ableben Carolines Söhne die Besitzungen erbten. Persönliche Beziehungen Carolines zu Friedrich Eberhard von Rochow, die sie zu ihren eigenen pädagogischen Schriften angeregt haben könnten, sind denkbar, aber nicht nachzuweisen.
Nach einem knappen Jahrzehnt sollte die Ehe wieder geschieden werden. Das Gerücht sagt, die 1796 geborene Tochter sei das Ergebnis einer Wette zwischen Rochow und einem Kameraden gewesen: ›Du verführst meine Frau nicht.‹ Ob dies den Tatsachen entspricht und Jahre später der Scheidungsgrund war, steht dahin. Bevor die Scheidung vollzogen werden konnte, hat sich Rochow, der Spielschulden nicht mehr begleichen konnte, erschossen.4
Spätestens ab dem Herbst 1802 wurde eine engere Beziehung Carolines zu Friedrich de la Motte Fouqué, den sie längst kannte, wie sich der Adel in der Mark eben kannte, offenbar. Gemeinsam besuchten sie z. B. August Wilhelm Schlegel, Friedrich Fouqués späteren Förderer. Schon Ende 1802 zog Friedrich nach Nennhausen. Im Januar 1803 fand dort die Hochzeit statt, im September kam die gemeinsame Tochter Marie zur Welt. Das eheliche Klima muß wenigstens dem Schreiben günstig gewesen sein: Zwei Monate nach der Geburt der Tochter war sein erstes ernstzunehmendes Werk fertig, ein Jahr später wurden ihre ersten Gedichte veröffentlicht.
In jenen Jahren, etwa bis zu den Befreiungskriegen oder genauer der anschließenden Zeit der Restauration waren die Fouqués Teil der romantischen Strömung, Friedrich Mitglied des »Nordsternbundes«, der gemeinsam den Roman Versuche und Hindernisse Karls verfaßte. Die ursprünglich geplante Teilnahme Carolines an diesem Roman kam nicht zustande, doch hat sie die Arbeiten begleitet. Damals schrieb Rahel, spätere Varnhagen: »Warum kann ich nicht sprechen, wie Frau v. F. z. Exempel!«5 Ganz offenbar aber kam es gegen Ende der zehner Jahre zu einer Verschiebung der gesellschaftlichen Interessen. Das dürfte vor allem politische Ursachen gehabt haben. Schon 1813 schrieb Caroline im Zuge der Befreiungskriege einen Ruf an die deutschen Frauen, über den Rahel urteilte: »Gott im Himmel! wie durchaus erbärmlich!«6
Mit dem Eintritt ihrer Söhne in den Dienst beim preußischen Hofe ging auch eine engere Bindung beider Fouqués an die höfischen Kreise vonstatten. Freundschaftliche Beziehungen zu den Geschwistern der Königin Luise, der Prinzessin Marianne und dem Kronprinzen, dem späteren Friedrich Wilhelm IV., kristallisierten sich heraus, bei deren genauerer Untersuchung jedoch ein widersprüchliches Bild entsteht. Die Hofberichterstattung dokumentiert eher seltene offizielle Einladungen anläßlich größerer Festivitäten an die Fouqués.7 Hingegen scheinen beide auf einer familiäreren Ebene regelmäßig mit den verschiedenen Angehörigen des Hofes verkehrt zu haben. Sie sandten Exemplare ihrer neuesten Werke und lasen im privaten – mit Hofdamen und -herren aufgefüllten – Kreis. Es liegen umfangreiche Briefwechsel Caroline Fouqués mit Großherzog Georg von Mecklenburg-Strelitz, Herzog Karl von Mecklenburg-Strelitz, Prinzessin Marianne von Hessen-Homburg und dem Kronprinzen Friedrich Wilhelm vor. In den Briefen sprach man recht intim über familiäre Sorgen, die Frauen tauschten Modetips aus, und selbstbewußt gab Caroline dem Kronprinzen Hinweise zu seiner geistigen Fortbildung.8 Nach Texten der Fouqués wurden Hoffeste ausgeführt, und gemeinsam mit Karl verfaßte Caroline 1822 einen Briefroman.9 Eigenartigerweise erwähnt das Tagebuch von Georg von Mecklenburg-Strelitz, der in seinen Briefen an Caroline sehr vertraut scheint und sie nach dem Tod ihres Vaters bei Bemühungen um ein Darlehen vom König unterstützt,10 beide Fouqués, auch ihre Besuche in Strelitz, mit keinem Wort.11 Dagegen schreibt Marianne in ihrem Tagebuch von Friedrichs schwärmerischer Aufdringlichkeit und Carolines frappierend offenen Worten, ihm doch entgegenzukommen.12 Es geht sicherlich entschieden zu weit, die Fouqués etwa als Hofdichter bezeichnen zu wollen. Allerdings gab es dauerhafte und teilweise auch recht enge Beziehungen, die für beide Fouqués von großem Wert waren, und auch ihre Texte dürften nicht ganz ohne Einfluß gewesen sein.13
Spätestens seit dem Tod ihres Vaters im Jahre 1822 führte Caroline die Wirtschaft auf den Gütern. Zwar hatte sie schon 1818 darum gebeten, daß ihr Sohn Theodor diese vom Großvater erben sollte.14 Ganz offenbar aber liefen die Geschäfte weiter über sie. Friedrich Fouqué blieb davon weitgehend unbehelligt. Aber auch Caroline war schriftstellerisch weiterhin außerordentlich produktiv: Die Hälfte ihrer über zwanzig Romane entstand in ihrem letzten Lebensjahrzehnt.
Ihre Texte sind in verschiedener Hinsicht recht unterschiedlich. Der Großteil ihrer Erzählungen scheint mit schneller Feder zum Zwecke des Gelderwerbs geschrieben zu sein. Die Romane, die z. T. beträchtlichen Umfang haben, verraten im allgemeinen mehr Sorgfalt und haben z. T. – wie die Erzählungen nur ganz ausnahmsweise – auch heute noch einen über das historische Interesse hinausgehenden Reiz.
Die bedeutendste Gruppe ihrer theoretischen Schriften bilden die Abhandlungen zur Mädchenerziehung. Ihren allgemeineren Betrachtungen zu Geschlechtsspezifika von Notwendigkeit und Inhalt der Erziehung und Bildung von Mädchen hat sie zwei Geschichtswerke hinzugefügt, deren Schwerpunkt die griechische und die christliche Mythologie bilden. Anliegen dieser Arbeiten war es, diese Wissensgebiete speziell für Frauen aufzubereiten. Sie sind jedoch keineswegs simplifizierend, sondern verraten ein umfängliches Wissen.
Aus einer Handvoll von Rezensionen ragt die Schrift Ueber deutsche Geselligkeit in Antwort auf das Urtheil der Frau von Stael (Berlin 1814) heraus.
Eine ganz eigene Stellung in der Fülle ihrer Texte nimmt der Titel Blick auf Gesinnung und Streben in den Jahren 1774–7815 ein: Es sind dies keine eigenen fiktiven, beschreibenden oder kommentierenden Texte, sondern Briefe Potsdamer Offiziere aus der Korrespondenz ihres Onkels, veröffentlicht mit dem Bestreben, Geschichte zu dokumentieren.
Ein ähnliches Anliegen ist auch ihrer Geschichte der Moden zuzuschreiben. Zwar scheint der hier gewählte Gegenstand auf den ersten Blick eher unbedeutend, aber die Fouqué war in Bezug auf das Vorhaben, ›Zeitgeist‹ einzufangen, der Überzeugung: »Es gibt in diesem Sinne nichts absolut Unwichtiges.«16
Fouqués Briefe über Berlin (Berlin 1822) haben Heinrich Heine zu seinen Briefen aus Berlin17 angeregt.
Einige Werke sind in Wien neuaufgelegt, andere sogar sind ins Französische und Englische übertragen worden.18
Schmidts Äußerungen zu Caroline Fouqué schriftstellerischer Tätigkeit sind spärlich. Abschätzig bemerkt er: »Als sie die Technik erlernt hat, verfaßt sie auch selbst Romane und Erzählungen, zierliche Mythologien ›Für die Töchter gebildeter Stände‹ und Ratgeber ›zum Eintritt in die große Welt‹.« Er habe zehn ihrer Bücher gelesen und nur den Roman Rodrich (Berlin 1806/7) und die Erzählung Der Delphin (In: Frauentaschenbuch. Nürnberg 1817) für halbwegs gut befunden.19
Schmidt führt weiter aus, daß manches in Caroline Fouqués Werken, zum Beispiel die Gedichte in ihrem Roman Die Frau des Falkensteins (Berlin 1810), von Fouqué sei.20 Hier wird zum ersten Mal deutlich, wie Schmidt mit den Caroline Fouqué betreffenden Materialien verfährt. Der Fakt an sich ist folgender: Friedrich Fouqué hat die Gedichte dieses einen Romans verfaßt. Sein Wissen hat Schmidt aus einem Brief Friedrichs an die Prinzessin Marianne,21 in welchem dieser davon spricht, daß neben den jetzt übersandten Reise-Errinnerungen (Dresden 1823) eine literarische Zusammenarbeit mit seiner Frau nur stattgefunden habe, als er eben diese Gedichte für den Falkenstein-Roman lieferte. Schmidt dehnt dies zu »manchem«, was Fouqué für die Frau habe arbeiten müssen, und unterstellt damit quasi, daß es ihre Fähigkeiten überschritten habe, die Texte allein fertigzustellen. Was er unterschlägt, ist, daß Caroline Fouqué, wie es dem Zeitgeschmack entsprach, viele ihrer Romane und längeren Erzählungen mit lyrischen Einschüben versehen hat, die Friedrichs Brief zufolge also von ihr selbst stammten, und daß sie mehrmals eigenständige Gedichte vorgelegt hat.22 So läßt er aus einem eher zufälligen Umstand einen wesentlichen Zug eines – verfälschten – Charakter- und Persönlichkeitsbildes entstehen.
In seinen Biographischen Portraits stellt Karl August Varnhagen von Ense dar, wie Caroline Fouqué sich in ihrem Schreiben immer mehr an Friedrich orientiert habe. »Als nun aber Fouqué selbst in schneller Folge sank, [...] da war die Schriftstellerei der Frau doppelt verloren«, und »als Frau veraltet, und als Schriftstellerin vergessen« sei sie schließlich gestorben, unbemerkt von Hofwelt und Publikum.23
Es steht dahin, inwiefern seine Äußerungen über Carolines gesellschaftlichen Wandel die Tatsachen widerspiegeln. Nachweislich falsch sind hingegen seine Bemerkungen über das Ende ihrer schriftstellerischen Karriere: Tatsächlich stieß Friedrich Fouqué ab 1820 mit seinen Werken auf immer größere Absatzschwierigkeiten. Regelmäßig mußte Caroline nun nicht nur – wie sie es mindestens ab 1813 tat24 – bei den Verlegern um die Zahlung seiner Honorare nachsuchen, sondern sie bat jetzt immer wieder auch um Hilfe für ihren Mann, den aus der Mode gekommenen Autor. Gleichzeitig riß der Strom ihrer eigenen Veröffentlichungen nicht ab. Es verging auch jetzt kein Jahr ohne mindestens zwei Veröffentlichungen; gemessen an den Veröffentlichungszahlen lag zwischen 1818 und 1823 das eigentliche Hoch ihres schriftstellerischen Schaffens, aber noch 1829 waren es fünf neue Texte, die gedruckt wurden, und sie arbeitete für die bedeutendsten Verleger der Zeit. Im § 47 (391ff.) seines Buches schildert Schmidt Friedrich Fouqués Beziehungen zu seinen Verlegern und die wachsenden Schwierigkeiten, denen er dabei gegenüberstand. In Kenntnis der wahren Verhältnisse ist es nur allzu leichtfertig, Varnhagens Bemerkungen unbesehen zu übernehmen. Aber während Varnhagen für Schmidt, geht es um Friedrich, nur ein »altes Klatschmaul« ist, übernimmt er dankbar alles, was seinem negativen Caroline-Bild entspricht.
Wenn Schmidt Friedrich Fouqués mehr erträumtes als reales Verhältnis zu Goethe schildert, zitiert er Friedrich aus Goethe und einer seiner Bewunderer, Goethe habe »für mich, und auch für meine Gattin [...] Caroline« anerkennende Worte gehabt.25 Wenn Schmidt dann fortfährt: »schon dieses ›und‹ genügt für den Wissenden«,26 ist das der Gipfel des Sagens und Urteilens durch Nichts-Sagen: Wo schon Friedrich von Goethe im wesentlichen nur Desinteresse erfahren habe, sei völlig klar, daß Goethes Gruß an Caroline nur gesellschaftliche Konvention gewesen sein konnte. Tatsächlich aber liegen die Dinge etwas anders. Friedrich Fouqué hat sich immer wieder um die Gunst des Dichterfürsten bemüht, ihn besucht, ihm Exemplare seiner neuesten Werke und Briefe gesandt. Goethes mit den Jahren immer geschäftsmäßiger organisiertes Tagebuch verzeichnet gleichwohl nur zwei dieser Briefe – beantwortet wird keiner. Was Fouqué als »fortgesetzte [...] Zeichen Ihres mir unschätzbaren Wohlwollens«27 auffassen möchte, sind wohl die Briefe von Goethes Schwiegertochter, die sie zum Teil wahrscheinlich in Goethes Auftrag verfaßt haben mag. So schreibt Goethe an Ottilie: »Antwortest Du dem Herrn von Fouqué etwas Freundliches, so füge auch ein gutes Wort von mir hinzu.«28 1825 erhält Friedrich Fouqué ein Exemplar des neuaufgelegten Werther. Der Vorsatz aus dem Jahre 1819, ein Gedicht für eine der Fouquéschen Zeitschriften herauszusuchen,29 wird offenbar nicht erfüllt. Eckermann überliefert das Urteil Goethes über Friedrich Fouqués Schriften, das nur die Undine gelten läßt, wie es sich auch in verschiedenen Briefen Goethes ausdrückt.30
Hingegen schreibt Caroline, nachdem sie von Friedrich die Grüße aus Weimar erhalten hat, ihrerseits an Goethe31 und erhält auf ihren »schönen Brief« umgehend Antwort – eine Antwort, die persönliche Züge trägt und von offensichtlichem Wohlwollen gegenüber der Schreiberin zeugt: Nicht nur, daß sie die Aufforderung erhält, von ihren Werken zu schicken;32 Goethe fügt dem von Caroline Ulrich niedergeschriebenen Brief einen handschriftlichen Nachsatz über – körperlich wie künstlerisch – arbeitende Frauen hinzu. Auf diesen überaus freundlichen und zu weiteren Kontakten einladenden Brief antwortet Caroline – nicht. Erst 1819 schreibt sie zu Goethes Geburtstag einen herzlichen Glückwunschbrief,33 und wieder wird sie mit einer, wenn auch diesmal dürftigeren, Antwort bedacht: Auch sie erhält den Gedenkdruck Die Feier des achtundzwanzigsten Augusts dankbar zu erwiedern [sic] mit einem kurzen handschriftlichen Vermerk.34
Das Verhältnis zwischen Goethe und den Fouqués, wenn es denn überhaupt als ein solches bezeichnet werden kann, ist von deutlich mehr Sympathie Goethes gegenüber Carolines als Friedrichs Persönlichkeit und Schreiben geprägt, und wenn es Schmidt schon um Carolines Charakter ging: die von ihm als vor allem geltungssüchtig beschriebene Frau unterließ es – wenigstens aus der Schmidtschen Charakterisierung heraus – völlig unverständlicherweise, ein sich anbietendes engeres Verhältnis zum großen Dichter zu entwickeln.
Den kurzen Seitenblicken Schmidts auf Caroline Fouqués literarisches Schaffen und Wirken steht eine Fülle von Bemerkungen über ihren angeblich herrschsüchtigen und egoistischen Charakter gegenüber. Es gibt so kleinlich-unsachliche Bemerkungen wie die, daß Caroline, von Ehrgeiz zerfressen, ihre viel zu jungen Knaben bereits einem Hauslehrer anvertraute: Schmidt übersieht geflissentlich, daß es, konnte man es sich leisten, durchaus üblich war, für Knaben mit vier, fünf Jahren einen Hauslehrer zu bestellen, ja daß er selbst uns berichtet hat, für Friedrich Fouqué wurde, als er »noch [...] im Kinderröckchen« steckte, ein solcher angeschafft.35
Auch in späteren Jahren habe Caroline immer wieder versucht, für ihre, wie Schmidt meint, im Grunde beschränkten Söhne – einer dieser unbegabten Männer wurde später immerhin preußischer Minister des Inneren36 – bei Hofe zu intervenieren. Auch hier wird er ungenau und berichtet, Sohn Gustav von Rochow sei 1823 offenbar beim König in Ungnade gefallen, aber dann hätten Carolines Bemühungen Erfolg gehabt, und so wurde Rochow 1822 Protokollführer bei den Beratungen über die Provinziallandstände.37
Gerüchte über Carolines lockere Moralauffassungen kommen Schmidt nur zupaß. Die Geschichte, die Varnhagen in seinen Biographischen Portraits angedeutet und in den Vorarbeiten für diese ausführlicher dargestellt hat, der zufolge ihr drittes Kind nicht vom ersten Ehemann, sondern von einem Militärkameraden stammen sollte, ist für ihn ein Faktum. Er spricht von einem Brief Carolines an den angeblichen Kindsvater, Graf Lehndorff, der im Varnhagen-Archiv im Original liege. Der Brief, den man heute dort einsehen kann, ist jedoch eindeutig eine Kopie.38
In einem Brief aus der Zeit der Befreiungskriege an Varnhagen spricht Caroline von dem in ihrer Nähe einquartierten Fürsten Czernitscheff.39 Bei Schmidt wird in der für ihn typischen tendenziösen Verdrehung der ihm bekannten tatsächlichen Umstände der bei ihr einquartierte Czernitscheff. Selbstverständlich übernimmt er die Andeutungen der Zeitschrift Salon, daß die Achtunddreißigjährige mit dem elf Jahre jüngeren Mann eine Liaison gehabt habe.40
Immer wieder betont Schmidt, ohne genauere Indizien dafür zu liefern, daß vor allem negative Frauenfiguren Friedrichs als Zeichnungen der Caroline Fouqué zu lesen seien.41 Letztlich ist es freilich müßig, darüber zu spekulieren, ob und mit wem die Fouqués einander in der zweifelsohne nicht übermäßig glücklichen und harmonischen Ehe betrogen haben. Interessant ist jedoch die unterschiedliche moralische Bewertung und vor allem die Funktionalisierung des von Schmidt Postulierten: Während von Friedrichs »Verfehlungen« leichthin und fast nebenbei die Rede ist, werden die von Caroline berichteten Dinge gnadenlos herangezogen, um am schwarzen Bild dieser Frau zu malen.
Sein Hauptaugenmerk richtet Schmidt auf die finanziellen Beziehungen des Ehepaares. Hier besonders wird er bedauerlich unkorrekt.
Das beginnt, wenn er berichtet, Fouqué habe sein gesamtes Erbe bei der Scheidung seiner ersten Frau vermacht, sei also mittellos in die Ehe mit Caroline gekommen. Letzteres muß wohl stimmen: Zur Eheschließung schenkte ihm sein Schwiegervater 10.000 Taler, die noch nach Jahren Grundlage seiner finanziellen Berechnungen waren.42 Mit seinem Erbe allerdings muß es sich nicht unbedingt und zweifelsfrei so wie geschildert verhalten haben. Wiederum liegen Schmidt verschiedene Informationen vor, die er nur bruchstückhaft und funktional für die Aussage, die er machen will, benutzt: Der Hinweis auf das verschenkte Erbe stammt aus einem Brief Friedrichs an Prinzessin Marianne.43 Der Charakter dieses Briefes kann u. U. ein Licht auf die Zuverlässigkeit seiner Aussagen werfen: Es ist einer von vielen Bittbriefen um finanzielle Unterstützung. Gut möglich, daß Friedrich hier nicht ganz bei der Wahrheit geblieben ist. Schmidt selbst war sich dieser nicht unbedingt gegebenen Zuverlässigkeit wohl bewußt, als er sich an verschiedene Archive wandte, um detailliertere Auskunft über die Besitzverhältnisse des Fouquéschen Erbes zu erlangen. Alles, was er erhielt, war die Auskunft, daß man ihm Genaueres nicht sagen könne.44 Trotzdem schreibt er ohne Wenn und Aber: Fouqué hat sein Erbe verschenkt.
Die finanziellen Verhältnisse auf dem Gut der Familie Carolines, wo man lebte, sind weniger günstig gewesen, als Schmidt beschrieben hat. Briest, Carolines Vater, »versteht etwas von Landwirtschaft; die Anwesen gedeihen«, lesen wir bei ihm.45 In Wirklichkeit findet Caroline beim Tode ihres Vaters Schulden vor, muß den König um ein Darlehen angehen und ist bis zu ihrem Tode nicht in der Lage, es zurückzuzahlen. Immer wieder spricht sie von den für Gutsbesitzer problematischen Zeiten. So nimmt sie die 1818 gemachten testamentarischen Bestimmungen, die das ursprüngliche Testament von 1806 ergänzten, wieder zurück und muß befinden, daß die 10.000 Taler, die sie Friedrich zugedacht hatte, mit dem Geschenk ihres Vaters abgetan sind.
Carolines Testament ist Schmidt ein besonders großes Ärgernis. Schon die äußeren Umstände, die er so poetisch beschreibt, sind schlicht falsch. Im Herbst 1830, als sie ihren Tod kommen fühlt, ordnet Caroline laut Schmidt »kalt und klar ihre Verhältnisse, überprüft noch einmal mit einem geringschätzigen und wütenden Blick auf den Gatten [...] ihr Testament«.46 Den wütenden Blick können wir nicht mehr sehen; das Testament allerdings ist 1828 zum letzten Mal ergänzt worden. »Im Park von Nennhausen wird Caroline [...] begraben [...] und Fouqué [...] steht mit gefalteten Händen als Letzter an dem umbüschten und umbäumten Hügel; dann geht auch er langsam ins Haus zur Testamentseröffnung.«47 – Caroline ist am 21. Juli gestorben, erst am 7. August erfolgte die Testamentseröffnung. Wir wollen nicht annehmen, daß man so lange mit der Beisetzung gewartet hat.
Laut Schmidt regelt das Testament für Friedrich ein Taschengeld von 40 Talern monatlich sowie freie Kost und Logis in Nennhausen – freilich unter der Bedingung, daß er unverheiratet bleibe. Im Testament selbst jedoch wird nur Friedrichs weiterer Aufenthalt – mit detaillierten Angaben über seine Versorgung auch mit Diener und Pferd – geregelt, und zwar »solange er solches hier zu genießen wünscht«.48 Weder von einem Taschengeld von 40 Talern ist die Rede – die müssen wohl doch von den angeblich so lieblosen Kindern gekommen sein – noch von einer Bedingung für seinen weiteren Aufenthalt. Freilich ist anzunehmen, daß Friedrich selbst genug Ehrgefühl besessen hat, um mit seiner dritten Frau nicht auf dem Gut der zweiten bei deren Sohn aus erster Ehe zu leben. Und noch etwas: Noch 1838 spricht er in einem Brief von 280 Talern, die er jährlich aus dem Erbe Carolines bezieht – diese Quelle liegt Schmidt vor, aber er benutzt sie nicht.49
Zu all den Unstimmigkeiten, die sich zwischen Schmidts Ausführungen und dem eigentlichen Testament hinsichtlich der genauen testamentarischen Regelungen ergeben, kommt, daß Caroline das Gut ihrem Mann gar nicht vererben konnte: Es hat ihr nie gehört, sondern ist, wie oben bereits erwähnt, nach dem Tod ihres Vaters auf ihren Sohn Theodor übergegangen. Zusammenfassend kommt man zu dem Eindruck, daß es Schmidt in Hinsicht auf Caroline Fouqué ganz offensichtlich weniger um eine nüchterne und korrekte Wiedergabe des verwendeten Materials, welche die Grundlage für eine objektive Bewertung liefern würde, zu tun war als vielmehr darum, sein bereits feststehendes Urteil zu belegen. Schmidt hat für nahezu alle wesentlichen Äußerungen über Caroline auf Quellen zurückgegriffen. Allerdings ist sein Einsatz dieses Materials selektiv und gewissermaßen tendenziös zu nennen. Indem er darauf verzichtet, seine Quellen genau anzugeben und zu beschreiben, macht er es erstens schwer, den Stand seiner Nachforschungen nachzuvollziehen: Er suggeriert, alle Arbeit geleistet zu haben und ein letztgültiges Bild zu liefern. Und zweitens kann der Leser die sich aus ihrem jeweiligen Charakter ergebende Aussagekraft der Materialien nicht bewerten. Inwieweit dies bewußt oder unbewußt geschah, kann nur vermutet werden. Mochte die Ehe zwischen Caroline und Friedrich Fouqué mit der Übereinkunft, das zukünftige Leben der beschaulichen Zweisamkeit und künstlerischen Arbeit zu widmen, geschlossen worden sein, ist die Harmonie offenbar bald an den unterschiedlichen Charakteren, aber auch den verschiedenen Anforderungen, die die Umwelt an sie stellte, zerbrochen: Ganz offenbar ist Carolines Ungeduld über den unpraktischen Mann, der die Organisation des vielköpfigen Haushaltes und der Gutsarbeit völlig ihr überließ, in Unduldsamkeit und – wenigstens zeitweise – schließlich Abwendung umgeschlagen. So tragisch dies für die Beteiligten gewesen sein mochte und so sehr es Schmidt möglicherweise als Phänomen bei der Beurteilung des Werks von Friedrich Fouqué bedeutsam erschien, kann es doch seine tendenziöse Darstellungsweise nicht rechtfertigen.
Wirft man einen Blick auf die Traditionen, in denen Schmidt steht, wird die Geschlechterspezifik seines Vorgehens noch deutlicher: Schon den zeitgenössischen Rezensenten war die Geschlechtszugehörigkeit der Fouqué ein wichtiger Umstand, der in fast allen Rezensionen zum Maßstab der Beurteilung der Texte erhoben wurde. Die Frage, die immer wieder gestellt wurde, war nicht: Wie ist die Qualität der Texte? sondern: Sind Thema und Schreibweise einer Frau angemessen? Die Fouqué scheint sich durchaus nicht immer im Rahmen des Erlaubten bewegt zu haben.
Den zeitgenössischen Rezensenten und Schmidt ist eines gemeinsam: Sie vermengen die Geschlechtszugehörigkeit der Autorin und ihre Vorstellungen von Geschlechterrollen mit der Bewertung des Werks. Während die Zeitgenossen die Frage nach dem einer Frau Angemessenen des Schreibens stellten, rückt Schmidt die Angemessenheit ihres Verhaltens in den Mittelpunkt. Jedesmal ist kein vorurteilsfreies Urteil über das Werk der Fouqué möglich. Im übrigen ist Schmidt ein Autor, der für sich selbst nie in Anspruch nahm, bis ins Letzte wissenschaftlich korrekt und erschöpfend zu arbeiten. Aber seine Arbeit hat in bezug auf Caroline Fouqué verheerende Folgen. Nicht nur populärwissenschaftliche Autoren, auch Literaturwissenschaftler können sich der Suggestivkraft Schmidts nur schwer entziehen und folgen – wenn sie sich denn überhaupt Caroline Fouqué zuwenden – zum Teil noch immer seinem Urteil.
Ich habe die Hintergründe und die Herausbildung dieses Urteils so detailliert beschrieben, um seine Absolutheit aufzubrechen und damit den Blick auf Caroline Fouqué und ihre Texte freizumachen.
ANMERKUNGEN
1 Brief Carolines an Marianne, [vor dem 9.]12.[1818]: Hessisches Staatsarchiv Darmstadt D 22. – Caroline bezieht sich offensichtlich auf das erst von seinem Nachfolger erfüllte Versprechen des preußischen Königs Friedrich II., der Dichterin Anna Louisa Karsch ein Haus in Berlin zu schenken (vgl. Anna Louisa Karsch: Gedichte. Nachdruck der Ausgabe Berlin 1792, mit einem Vorwort von Barbara Becker-Cantarino. Karben 1996, S. *11f.).
2 Christa Bürger: Leben Schreiben. Stuttgart 1990, S. 31.
3 Arno Schmidt: Fouqué und einige seiner Zeitgenossen, erstmals Darmstadt 1958, im folgenden zitiert nach der Ausgabe Bargfeld 1993.
4 Vgl. Adolph Friedrich August von Rochow: Nachrichten zur Geschichte des Geschlechts derer von Rochow und ihrer Besitzungen. Berlin 1861 und das im Brandenburger Domstiftsarchiv befindliche Kirchenbuch von Neuhaus bei Jeserig. Das letztere dokumentiert den Selbstmord Rochows und Neuhaus als den Ort, wo dieser – im Gegensatz zu der Angabe bei Schmidt, Fouqué, S. 168 – stattfand.
5 Rahel Varnhagen. Gesammelte Werke. Hrsg. von Konrad Feilchenfeldt, Uwe Schweikert, Rahel E. Steiner. München 1983, Bd. 4: Briefwechsel zwischen Varnhagen und Rahel. Leipzig 1874 (Bd. 1), S. 182.
6 Ebd., Bd. 5 (Bd. 3), S. 32 zu Caroline de la Motte Fouqué: Ruf an die deutschen Frauen. Berlin 1813.
7 Einzusehen sind die Hofakten im Geheimen Preußischen Staatsarchiv in Berlin/ Dahlem.
8 Hierzu ein Auszug aus ihrem Brief vom 7.10.1827: »Ihr Königl. Hoheit Haben Schlegel gesehen und nicht gelesen. Da nun an dem bemalten und beklebten Kopf nicht eben viel Erfreuliches zu sehen war, so denke ich mir, sei es doch eine Art von Gerechtigkeit gegen den Mann ihn Ihr Kgl.e Hoheit in seiner wirklichen Jugendblüthe vorzustellen. Deßhalb erlaube ich mir die beifolgenden Vorlesungen meinem gnädigsten Herrn zur Durchsicht zu übersenden. Man darf es doch nicht vergessen was sein wässriger Geist für sein Zeitalter gethan hat, u. wenn auch nunmehr die dort entwickelte Weisheit jedem Schüler vom Munde fließt, so war doch der Meister nun einmal der Erste der sie aussprach. Jetzt ist der Weise ein Thor geworden, – das schadet der Weisheit nichts! Kein Mensch weniger als Ihr Hoheit darf den Zustand der gegenwärtigen Bildung so auf halbem Wege übersehen. Der geistreichste deutsche Fürst muß alle Fäden kennen die hier ineinander greifen, u. sicher dürfte man diesen als den rothen bezeichnen der durch das Gewebe geht.« (Dahlem BPH Rep 50 J No 391) Die Briefkonvolute sind einzusehen in: Geheimes Preußisches Staatsarchiv Dahlem unter der angeg. Signatur, Mecklenburgisches Landeshauptarchiv Schwerin Hausarchiv Mecklenburg-Strelitz lfd. Nr. 615, Hessisches Staatsarchiv Darmstadt D 22 sowie Brandenburgisches Landeshauptarchiv Potsdam Rep 37 Nennhausen.
9 1827 war ein Maskenball ursprünglich nach Carolines Roman ›Die Herzogin von Montmorenci‹ geplant. Nachdem Friedrich Wilhelm III. Bedenken kamen, in Kostümen aus der Bartholomäusnacht zu erscheinen, wurde eine Verschiebung der zeitlichen Ereignisse vorgenommen. Vgl. Hofunterlagen Dahlem BPH Rep 113 No 1499/2. 1829 ›Fest der weißen Rose‹ mit Figuren aus Friedrichs ›Zauberring‹. Caroline de la Motte Fouqué [mit Karl von Mecklenburg-Strelitz]: Vergangenheit und Gegenwart. Berlin 1822.
10 Vgl. Briefe im Nachlaß Caroline Fouqué im Brandenburgischen Landeshauptarchiv Potsdam Rep 37 Nennhausen.
11 Vgl. Landeshauptarchiv Schwerin Hausarchiv Mecklenburg-Strelitz lfd. Nr. 172, 173, 177.
12 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt.
13 Vgl. Schmidt, Fouqué, S. 428ff., wo er den geradezu verhängnisvollen Einfluß der Texte Friedrichs auf Seelenhaltung und Politik Friedrich Wilhelm IV. umreißt.
14 Vgl. ihr Testament im Brandenburgischen Landeshauptarchiv Potsdam Rep 37 Nennhausen und Rochow, Nachrichten zur Geschichte, wo berichtet wird, die Stände des Kreises hätten in Anhänglichkeit an den alten Briest diesen Vorschlag unterstützt.
15 Stuttgart 1830; Teilabdruck in: Morgenblatt für gebildete Stände, März – April 1830.
16 Caroline de la Motte Fouqué: Geschichte der Moden 1785–1829. Als Beitrag zur Geschichte der Zeit, nach dem Original von 1829–30 hrsg. von Dorothea Böck. Berlin, Hanau 1988, S. 7.
17 Erstmals in: Rheinisch-Westfälischer Anzeiger. Beilage: Kunst- und Wissenschaftsblatt, 1822.
18 Jean T. Wilde: The Romantic Realist. New York 1955, S. 451, nennt: Claire. Paris 1821; The Outcasts. London 1824; The Curse. Edinburgh 1825; The Castle of Scharffenstein. Edinburgh 1826; The Castle on the Beach. Glasgow 1830; In: Burns’ Fireside Library (London 1845) Bd. II: Christmas Eve, III. The Revolutionists, IV. Valerie. Der ›Neue Nekrolog‹ nennt zusätzlich: Vingt et un ans. Paris 1822. Der Catalogue General des livres imprimes de la Bibliotheque nationale (Paris 1929, Bd. 53) führt weiter auf: Ida. Paris 1821. Der ›British Library General Catalogue of Printed Books to 1975‹ (London u. a. 1983, Bd. 183) ergänzt: The Turn Coat, in: An Essay of three Tales. Ghent 1820.
19 Schmidt, Fouqué, S. 167
20 Ebd., S. 167
21 Brief Nennhausen, 11.11.1822: Fischbacher Archiv Hessisches Staatsarchiv Darmstadt: D 22 Nr. 24/4; in Bargfeld liegt ein Regest zu diesem Brief.
22 1806 gibt sie ihr literarisches Debüt mit Beiträgen zum ›Musenalmanach auf die Jahre 1806‹. Leipzig, Berlin 1806. Gedichte aus ihrem Roman ›Die Frau des Falkensteins‹ erscheinen in: Pantheon. Eine Zeitschrift für Wissenschaft und Kunst. Leipzig 1809/10. Darüber hinaus schreibt ihr Ludwig Geiger die Autorschaft an Gedichten im ›Berliner Musen-Almanach auf die Jahre 1830/31‹ zu, leider ohne seine Gründe für diese Entscheidung genauer darzulegen. Vgl. Ludwig Geiger: Berlin 1688–1840. Geschichte des geistigen Lebens der preußischen Hauptstadt. Berlin 1895, Bd. II, S. 442.
23 Karl August Varnhagen von Ense: Biographische Portraits. Leipzig 1871, S. 124 und 125.
24 Der erste mir bekannte Brief ist Nennhausen, 20.6.1813 an Campe: Staats- und Universitätsbibliothek. Hamburg CS 2, Fouqué, und er lag Schmidt vor.
25 Friedrich de la Motte Fouqué: Goethe und einer seiner Bewunderer. Berlin 1840, S. 22. So in: Schmidt, Fouqué, 288
26 Schmidt, Fouqué, S. 288
27 Friedrich Fouqué an Goethe, Nennhausen, 9.9.1827. So in: Goethe und die Romantik. Hrsg. von Carl Schüddekopf und Oskar Walzel. Weimar 1899, S. 247.
28 Brief vom 18.7.1828, in: Goethes Werke (Sophien-Ausgabe), Weimar, 4. Abt., Bd. 44, S. 214.
29 Goethe an August von Goethe am 6.10.1819, in: Goethes Werke, 4. Abt., Bd. 32, S. 49.
30 Johann Peter Eckermann: Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens. Berlin, Weimar 1987, S. 241f. Briefe Goethes an Knebel, Zelter, Seidler vgl, in: Goethes Werke, 4. Abt., Bd. 23, Nr. 6480, 6484, 6521.
31 Brief Nennhausen, 24.11.1813, abgedruckt in: Goethe und die Romantik. Hrsg. von Carl Schüddekopf und Oskar Walzel. Weimar 1899, Bd. 2, S. 233ff.
32 Goethes Werke (Sophien-Ausgabe) weisen nur seine Lektüre ihrer ›Magie der Natur‹im Jahre 1812 nach. Weitere Texte finden sich nach Auskunft der Stiftung Weimarer Klassik weder in Goethes Bibliothek noch werden sie im Tagebuch erwähnt.
33 Brief Nennhausen, 28.8.1819, abgedruckt in: Goethe und die Romantik, Bd. 2, S. 238–240.
34 Als Brief Carlsbad, 15.9.1819: Brandenburgisches Landeshauptarchiv Rep 37 Jahnsfelde 141, als Gedicht abgedruckt in: Goethes Werke (Sophien-Ausgabe). Weimar 1891, I. Abt., 4. Bd., S. 42. Kommentar mit Verzeichnung verschiedener Adressaten (nicht der Fouqué) in Bd. 6, S. 27 (Weimar 1910).
35 Schmidt, Fouqué, S. 38.
36 Vgl. zu Gustav von Rochow die sicher als Ehrenrettung unternommene, aber doch einen weiteren Blick bietende Schrift: Vom Leben am preußischen Hofe. Aufzeichnungen von Caroline von Rochow und Marie de la Motte-Fouqué, bearbeitet von Luise von der Marwitz. Berlin 1908.
37 Schmidt, Fouqué, S. 490f.
38 Bereits Wilde, Romantic Realist, S. 35, weist darauf hin, daß die Schriftzüge des Briefes weit eher Varnhagen als Caroline Fouqué zugeordnet werden müssen. Leider kann nicht festgestellt werden, wann Schmidt Einsicht in das Varnhagen- Archiv genommen hat; Unterlagen finden sich dazu in Bargfeld nicht. Allerdings ist die Möglichkeit, daß früher zu der Kopie tatsächlich noch ein Original existiert hat, recht unwahrscheinlich.
39