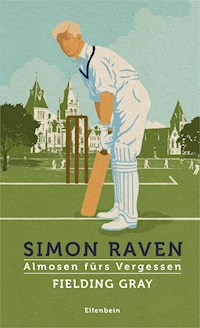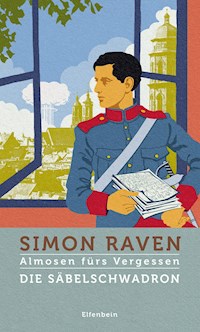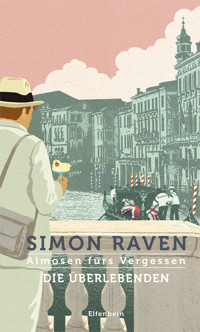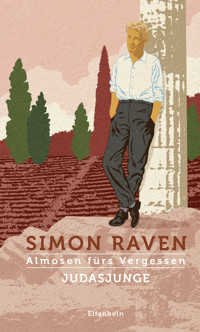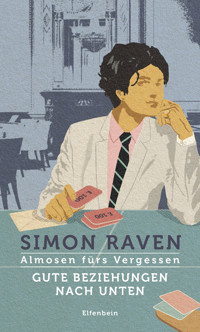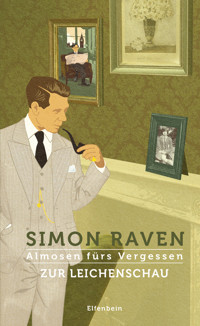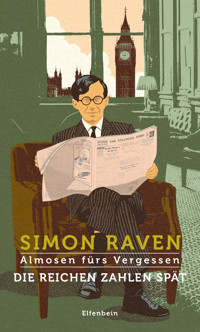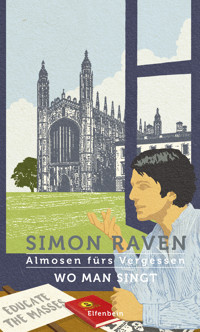
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Elfenbein Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Almosen fürs Vergessen
- Sprache: Deutsch
Man schreibt das Jahr 1967 am altehrwürdigen Lancaster College der Universität Cambridge, und die Zeichen stehen auf Sturm. Zu den üblichen Grabenkämpfen zwischen den Professoren kommen die Forderungen einer politisierten Studentenschaft. Angeführt wird die Rebellion von Hugh Balliston, einem begabten jungen Intellektuellen, der auch die attraktive Hetta für seine Sache eingespannt hat. Doch Hugh gerät zunehmend unter den Einfluss eines externen Agitators, der ihn zu immer drastischeren Aktionen treibt. Als anlässlich eines Madrigalkonzertes der Kapelle des Colleges, einem der bedeutendsten Sakralbauten des Landes, eine rabiate Entweihung und ein moderner Bildersturm droht, geht es mit einem Mal nicht mehr nur um die Überwindung oder Bewahrung alter Traditionen und Glaubenssätze, sondern um Leben und Tod. Im siebten Band seiner Romanreihe »Almosen fürs Vergessen« widmet sich Simon Raven mit unverkennbarer Verehrung für den historischen Schauplatz auf gewohnt unterhaltsame und bissige Weise einem weiteren Meilenstein der britischen Nachkriegsgeschichte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Simon Raven
Wo man singt
Roman
Aus dem Englischen übersetzt
von Sabine Franke
Elfenbein
Die Originalausgabe erschien 1970unter dem Titel
»Places Where They Sing« bei Anthony Blond, London.
Band 7 des Romanzyklus »Almosen fürs Vergessen«
Copyright ©Simon Raven, 1998
First published as part of »Alms for Oblivion«:
Volume 2 by Vintage, an imprint of Vintage.
Vintage is part of the Penguin Random House
group of companies.
© 2023 Elfenbein Verlag, Berlin
Einbandgestaltung: Oda Ruthe
Alle Rechte vorbehalten
ISBN 978-3-96160-045-8 (E-Book)
ISBN 978-3-96160-015-1 (Druckausgabe)
Teil I
scholars’ meadow
»Das war’s«, dachte Ivor Winstanley. »Der Gnadenstoß.« Drüben zu seiner Rechten läutete zur Bestätigung eine böse kleine Glocke.
»Winning gallery!«, schrie der Junge am Netzpfosten. »Spiel, Satz und Sieg: Doktor Helmut.«
Ivor trottete in die Galerie, die das Tennisfeld seitlich begrenzte, während Jacquiz Helmut gönnerhaft hinter ihm herschritt.
»Du schlägst dich wirklich recht gut, Ivor«, sagte er, »du musst bloß mehr darauf achten, den Ball nicht auf die Vorhand deines Gegners zu spielen, wenn du am Hazard End bist.«
Die Vorhaut deines Gegners, dachte Ivor sauertöpfisch – diese Juden konnten einem vielleicht auf den Keks gehen, selbst die kultivierten unter ihnen. Er verkniff sich die Bemerkung, schon Tennis gespielt zu haben, als Jacquiz noch in seine koscheren Krabbelhöschen gemacht hatte (was für einen Anblick er da abgegeben haben musste, bei diesen Beinen, wie Weinglasstiele!), und sagte in Anbetracht der allgemein herrschenden Toleranz, die in diesen modernen Zeiten und in seinem Beruf von ihm gefordert war, lediglich einigermaßen betrübt: »Das wird wohl bis zum Herbst unser letztes Spiel gewesen sein.«
»Ich habe nie begriffen, warum sie die Anlage während des Sommer-Trimesters schließen.«
»Schließen kann man so nicht sagen«, sagte Ivor. »Es ist einfach unüblich, im Sommer Royal Tennis zu spielen.«
Jacquiz wickelte sich einen vielfarbigen Schal um den Hals und warf sich dann in einen noch unmöglicheren Blazer.
»Warum eigentlich nicht?«, sagte er in leicht anklagendem Ton. »Der Platzmeister bleibt schließlich hier, und sein Balljunge ebenso, und beide bekommen nicht gerade wenig Geld dafür.«
»Dennoch«, sagte Ivor, während er sich seinen zerbeulten Sportblazer überzog, »ist es schlicht und einfach so Usus: Kein Tennis vom ersten Tag des Sommer-Trimesters bis zum letzten Tag der langen Ferien.«
»Warum einen Brauch pflegen, der einen nur einschränkt und zudem Geld vergeudet?«
»Du bist Historiker«, sagte Ivor, »warum solltest du so was also nicht verstehen, wo es alle anderen doch auch begreifen? Der wesentliche Punkt ist, dass die Gepflogenheit für alle außer dem Universitätsteam gilt, das im Juli im Lord’s für uns gegen Oxford antritt. Ursprünglich steckte also eindeutig der Gedanke dahinter, unseren einzigen Platz freizuhalten, damit die Topauswahl trainieren konnte, wann sie wollte. Aber statt eine Regel einzuführen, was den Leuten nicht gefallen hätte, haben sie einen Brauch daraus gemacht, was an einem Ort wie diesem jedermann höchst erfreut zur Kenntnis genommen hat.«
Mittlerweile hatten sie die Universitätsbibliothek hinter sich gelassen und durchquerten den New Court von Clare College – zwei Figuren in weißen Flanellhosen, der eine einen Kopf größer als der andere, in geradezu bizarr anmutendem Gleichschritt – denn Ivor Winstanley war ein entgegenkommender Mensch, mehr noch, er besaß einen sorgfältigen Sinn für das, was sich gehörte, und es hätte für ihn etwas Skandalöses gehabt, sich nicht im Gleichschritt mit seinem Begleiter zu bewe-gen.
»Wann?«, blaffte Jacquiz. »Wann hat man diesen Brauch eingeführt?«
»Weiß ich nicht«, sagte Ivor matt. »Als ich Ende der zwanziger Jahre hier angefangen habe, hat man sich jedenfalls schon daran gehalten.«
»Und du hast nichts dagegen unternommen?«
»Ich war nie jemand, der sich gerne einmischt.«
»Dann ist es aber höchste Zeit, dass das mal wer tut!«, sagte Jacquiz. »Ich bin selbst nicht gerade von der radikalen Sorte, wie du weißt, aber ich hasse es, wenn man mich um mein Tennis bringt.«
»Na schön: Dann unternimm etwas.«
»Na schön. Das werd’ ich auch.«
Ivor und Jacquiz hatten genau dieses Gespräch, fast Wort für Wort, bisher jeden April geführt, seit sie damals begonnen hatten, miteinander Royal Tennis zu spielen, zu einer Zeit, die jetzt schon weit zurücklag. In Wahrheit war Tennis für Jacquiz jedoch nur eine Nebenvergnügung, so dass er gar nicht vorhatte, diesbezüglich irgendetwas zu unternehmen. Und obwohl sie beide das ganz genau wussten, wäre es ihnen nicht im Traum in den Sinn gekommen, auf diese Diskussion zu verzichten, die für sie im Jahresablauf eine genauso bedeutsame Wegmarke war wie die Rückkehr des Kuckucks. Sumer is icumen in, und dies war ihr Begrüßungsritus.
»Ich weiß noch«, sagte Ivor fröhlich, »wann du das zum ersten Mal gesagt hast. Das war im April 1953 – ein paar Tage nachdem du zum Fellow ernannt worden warst, und einige Wochen vor der Krönungsfeier. Damals hat dir der vollkommen irrsinnige Gedanke vorgeschwebt, dass man zu Beginn einer neuen Regentschaft am besten lauter alte Bräuche abschafft. Und jetzt haben wir 1967, morgen ist der erste Tag des Sommer-Trimesters, und wie eh und je wird der Tennisplatz für alle außer den Angehörigen des Universitätsteams geschlossen, und eher würdest du drüben vom Dach der Kapelle segeln, als irgendetwas dagegen zu unternehmen.«
Sie nickten beide höchst zufrieden und wandten sich kurz um, um den Torbogen zum New Court von Clare College zu betrachten, den sie soeben durchschritten hatten.
SUI MEMORES, stand dort geschrieben, ALIOS FECERE MERENDO.
»›Es durch ihre Verdienste dazu brachten‹«, übersetzte Ivor, »›dass andere noch an sie denken.‹ Bedenklich, meinst du nicht? Als Altsprachler bin ich ganz und gar nicht glücklich damit, wie alios in diesem Zusammenhang verwendet wird.«
»Wieso?«
»Der Plural von alius wird sonst eigentlich zweiteilig verwendet … die einen taten dies, die anderen das. Dass alios hier alleine steht, ist ominös. Das Einzige, was sonst hätte gemeint sein können, wäre aliquos, und wenn man davon ausginge, würde die Stelle bedeuten: ›Es durch ihre Verdienste dazu brachten, dass manche – das heißt nur manche – noch an sie denken‹.«
»Dagegen hätte ich kaum was einzuwenden.«
»Ist zynisch.«
»Seit wann«, sagte Jacquiz, während sie nun die Queen’s Road überquerten und unter den Bäumen nach rechts abbogen, »störst du dich an Zynismus?«
»So was gehört nicht an ein Gedenkportal wie dieses.«
»Das ist ja eben der Punkt. Auf dem Gedenkportal steht alios, und das ist nicht zynisch.«
»Wohl aber zweifelhaftes Latein. Zweifelhaftes Latein sollte noch weniger auf einem Gedenkportal erscheinen als etwas Zynisches.«
»Was ist also dein Fazit?«
»Dass sie ein anderes Zitat hätten nehmen sollen.«
»Dulce et decorum est pro patria mori?«
»Nein. Zu verlogen. Vielleicht Aspicit et moriens dulces reminiscitur Argos. ›Blickt auf, und sterbend gedenkt er des lieblichen Argos.‹«
»Das findest du hier angebracht?«
»Vielleicht haben sich manche, derer wir hier gedenken, als sie im Sterben lagen, an ihr College erinnert. Ich denke … ich denke, ich hätte das an ihrer Stelle vielleicht getan. Wenn du aber wissen willst, was ich wirklich für passend halte, dann ist das ganz schlicht und auf Englisch ›Tot ist tot.‹ … Noch einen kurzen Abstecher in den Fellows’ Garden vor dem Tee?«
»Aber sehr gern!«
Sie gingen noch einmal über die Straße zurück, zu einem verschnörkelten Eisentor. Ivor wühlte in seiner Tasche und zog einen Schlüssel hervor, Jacquiz lächelte und öffnete das Tor einfach so.
»Seit wann wird das Tor nicht mehr abgeschlossen?«, fragte Ivor.
»Seit der Verwaltungsrat im März zusammengetreten ist. Da warst du in Griechenland. Die Ratsversammlung hat auf die eindringende Bitte von Provost Constable und anderen hin beschlossen, dem Ersuchen der Studenten stattzugeben und ihnen jederzeit freien Zugang zum Fellows’ Garden zu gewähren.«
»Oh!«, sagte Ivor, als hätte er mit einem Mal Mühe, Luft zu kriegen. »Das wusste ich noch gar nicht.« Er schlappte langsam über den Rasen, am Judasbaum vorbei zum Sommerhaus hin. »Wer waren die anderen?«, fragte er schließlich. »Außer dem Provost?«
»Tony Beck – der hat es ganz lautstark gefordert. Wenn wir, sagte er, an aus der Zeit gefallenen Privilegien festhalten, dann wird etwas, das er ›das neue Bewusstsein‹ nannte, dafür sorgen, dass man sie uns mit Gewalt wegnehmen wird. Daniel Mond und Tom Llewyllyn haben in etwa dasselbe gesagt.«
»Oh … oh«, schnaufte Ivor jammervoll. »Das heißt … der Fellows’ Garden von Lancaster College … steht jetzt jedem offen, der mal eben des Weges kommt?«
Jacquiz zuckte mit den Schultern. »Macht das noch einen Unterschied?«, sagte er. »Sie haben den Garten doch ohnehin schon ruiniert, als sie direkt daneben das neue Wohnheim gebaut haben.«
Die beiden Männer wandten die Köpfe zu einem auffälligen roten Backsteingebäude, das da stand, wo sich einst ein Birkenhain befunden hatte, und nun finster dem noch übrigen Rest des Gartens entgegenstarrte, wie zur Drohung, dass es auch diesen noch beanspruchen und sich einverleiben könnte, im Namen des allgemeinen Nutzens und Fortschritts.
»Der Garten war ohnehin schon ein verlorener Fall«, sagte Jacquiz, ebenso finster zum Wohnheim zurückstarrend, »aber es ist wichtig, dass wir nicht noch mehr aufgeben. Ich hoffe doch, dass du es morgen als eine deiner vordringlichsten Aufgaben ansiehst, bei der Ratsversammlung zu erscheinen. Ich mache gerade all unseren Leuten Dampf.«
»Worum geht’s denn morgen?«
»Um das College geht es … wegen einer sehr großen Menge Geld aus dem Verkauf dieses Farmlandes in Lincolnshire. Die Frage ist: Wofür soll man es verwenden? Es gibt Leute, die gerne mehr hiervon sehen würden« – er zeigte, mit einer fast schon wüsten Geste, zum neuen Wohnheimgebäude.
»Wo? Hier?«
»Schlimmer. Auf der Scholars’ Meadow.«
»Aber das können sie doch nicht machen!«, jammerte Ivor. »Die Scholars’ Meadow darf per Statut nicht angerührt werden, da sie … qua currant et ludant pupillares … für körperliche Ertüchtigungen und Freizeitvergnügen der Scholaren, also unserer Studenten vorgesehen ist.«
»Die haben sich da schon seit über einem Jahrhundert nicht mehr ertüchtigt und vergnügt. Seit die neuen Sportfelder von der Universität erworben wurden.«
»Trotzdem. Das Gelände ist durch die Statuten geschützt. Und außerdem«, fuhr Ivor missmutig fort, »macht sich die Wiese doch so hübsch dort, und darauf zu bauen würde den Blick auf das Sitwell’s-Gebäude von jenseits des Flusses vollkommen verhunzen.«
»Für ästhetische Erwägungen«, sagte Jacquiz, »haben Reformer nichts übrig. Und radikale Reformer wie die, mit denen wir es hier zu tun haben, pfeifen auch auf Statuten.«
»Das heißt aber nicht, dass sie sie einfach brechen kön-nen.«
»Es gibt Wege, sie zu umgehen, Ivor. Vermächtnisse, Treuhandschaften, Statuten – all das lässt sich heutzutage unterlaufen. Man muss bloß behaupten, dass es im besten Interesse des Colleges als Ausbildungsstätte ist, und niemand wird es wagen, auch nur einen leisen Mucks dagegen zu machen.«
»Und weshalb sollte es im besten Interesse des Colleges als Ausbildungsstätte sein, die Scholars’ Meadow zu bebauen?«
»Weil wir dann mehr Studenten aufnehmen könnten.«
»Und wer, der einigermaßen bei Sinnen ist, würde das wollen?«
»Herrgott, Ivor! Du musst doch wenigstens ein klein bisschen was mitbekommen haben von dem, was in den letzten zehn Jahren so passiert ist.«
»Natürlich. Mir ist durchaus zu Ohren gekommen, dass es sinnvolle Veränderungen geben soll. Sinnvolle Veränderungen, die Schritt für Schritt hier und da angebracht werden sollen, um alles besser und fairer zu gestalten. Weniger streng reglementierte Stipendien, so was in der Art – und da bin ich ganz dafür. Wovon ich bisher nichts gehört habe, ist, dass wir einen der herrlichsten Anblicke Europas verschandeln wollen, bloß um unsere Zahlen hochzudrücken.«
»Aber genau darum geht’s bei alledem, Ivor. Höhere Studentenzahlen ist gleich angewandte Demokratie ist gleich das absolut Gute. Ein herrlicher Anblick ist gleich Privilegien ist gleich das absolut Böse. Wie verfügen über ein großes Areal namens Scholars’ Meadow, das hübsch anzuschauen ist, aber keinerlei praktischen Nutzen hat. Seine Schönheit ruft ebenso Missfallen hervor wir die fehlende Zweckgerichtetheit, und gewisse Personen werden keine Ruhe geben, bis nicht von der Queen’s Road bis zum Fluss rüber alles mit lauter grauen Blöcken zugebaut ist, mit schäbigen, grauenvollen Einzelunterkünften drin …«
»… mit lauter schäbigen, grauenvollen Studenten drin, die alle Soziologie studieren. Hör mir auf! Also, das muss verhindert werden.« Ivor Winstanley schnaufte heftig durch die Nase, und in seinen Mundwinkeln hatte sich ein wenig Schaum gesammelt. »Ein Wohnheim im Fellows’ Garden mag vielleicht noch angehen; als wohlweisliches Zugeständnis an die neuen Zeiten, könnte man sagen. Aber die Scholars’ Meadow zum Baugrund zu machen – bei einem Fall von Vandalismus diesen Ausmaßes hört sich wirklich alles auf.«
»Also kommst du morgen?«, sagte Jacquiz.
»Mit Schwert und Buckler! Wir sind in der Überzahl. Wir stellen immer noch die Mehrheit im Verwaltungsrat, und wenn der guten Mannen, der getreuen, alle sich zeigen, dann haben wir nichts zu befürchten.«
»Allerdings«, sagte Jacquiz, »ist es nicht mehr der Verwaltungsrat, der das entscheidet. Oder nicht mehr allein.«
»Du meinst, die von der Regierung könnten sich einmischen?«
»Möglich. Aber mit denen würden wir schon fertigwerden, weil die wenigstens dieselbe Sprache sprechen wie wir und auch größtenteils nach denselben Regeln spielen. Ich fürchte aber, dass es viel unheilvollere Gegner gibt als Regierungen – ja, selbst als sozialistische Regierungen.«
»Ich finde dich höchst rätselhaft, Jacquiz.«
Ivor fuhr sich mit dem Ärmel seines Mantels über den Mund und ging, für seine Verhältnisse ziemlich schnellen Schritts, voran, zum Tor zurück. In seinem Ärger gierte er jetzt nach dem Tee.
»Bei dieser Angelegenheit«, sagte Jacquiz, »gibt es eine ganz neue Komponente. Eine Komponente, die dir in deinem oder mir in meinem Weltbild nicht im Traum eingefallen wäre. Bis jetzt.«
Ivor zog seinen Schlüssel hervor, wie er es schon lange gewohnt war, um das Tor auf- und wieder zuzuschließen.
»Nein«, sagte Jacquiz, seine Kardinalsnase kräuselnd, »lass mal den Schlüssel. Die Studenten fänden das nicht gut – du erinnerst dich?«
»Die meisten von denen sind noch gar nicht wieder da«, sagte Ivor beleidigt und störrisch.
»Aber morgen ist der erste Tag des neuen Trimesters«, sagte Jacquiz. »Morgen werden sie alle zurück sein.«
Zu denen, die bereits eingetroffen waren, gehörte ein junger Student namens Hugh Balliston, der ein Zimmer im Wohnheim am Fellows’ Garden bewohnte. Hughs Zimmer ging zur Gartenanlage hinaus, so dass er Ivor Winstanley und Jacquiz Helmut sicher gesehen hätte, wäre er denn in der Nähe seines Fensters gewesen. Nun verhielt es sich aber gerade so, dass er mit Blick nach unten auf seinem Bett lag, unter sich Hetta Frith.
»Castro«, brach es aus Hetta hervor, »du hast’s wirklich raus! Castro, Lenin, Engels. Mao … Jesus!«
»Jesus?«
»’tschuldigung – Marx …«
»Jetzt dann?«
»Jetzt!«
Sie schnaubte wie ein Rennpferd beim Zieleinlauf und rang tief nach Luft.
»Mao«, wimmerte sie, stöhnte, mächtig erzitternd, »Mar-cuse«, japste »Fidel, o Fidel!« und sank schließlich mit »Che … Che … Cheeee …« bebend in sich zusammen.
Hugh, der den Höhepunkt zur selben Zeit erreicht, dabei aber (typischerweise) keinen Laut von sich gegeben hatte, löste sich vorsichtig von Hetta, erhob sich vom Bett und ging zum Waschbecken hinüber. Hetta betrachtete ihn beglückt: die schlanken, drahtigen Beine; den hellen schmalen Rücken mit den drei großen Pickeln auf dem linken Schulterblatt; die wie aus Alabaster konturierten Oberarme, und die mit kurzen, schwarzen Härchen schwach bewachsenen Unterarme, die jetzt hinter dem Körper verschwanden, um sich der Säuberung zu widmen. Castro, ihr Hugh hatte es vielleicht drauf! Und jetzt würde er möglicherweise noch mal zurück ins Bett kommen, ihr erst ein bisschen davon erzählen, was er in den Ferien alles erlebt hatte und im kommenden Trimester zu tun gedachte, und dann, mit ein bisschen Glück (Marx, Castro, Che), würden sie gleich noch mal loslegen.
Aber Hughs Pläne sahen anders aus.
»Zieh dich an, Häschen«, sagte er. »Du musst gehen.«
»Ach Hugh … Und was ist mit Tee?«
»Was soll damit sein?«
»Willst du nicht auch welchen?«
Hugh drehte sich zu ihr um. Genau in der Mitte seiner Brust verliefen bei ihm die Haare in einer feinen Linie, an einer Stelle, überlegte Hetta, an der die meisten Menschen keine hatten. Unter dem Nabel war sein Bauch flach und zart, Hetta wollte ihn dort küssen. Sie sprang aus dem Bett, ließ sich auf die Knie sinken, schlang ihre Arme um seine Oberschenkel und schmiegte ihre Wange an die weiche Stelle. Sanft und bestimmt schob Hugh sie von sich, nahm dann ein Handtuch und begann sich ausführlich und mit großer Sorgfalt abzutrocknen.
»Ich muss noch was arbeiten«, sagte er.
»Bloß eine einzige Tasse. Ist schließlich Teezeit.«
»Nein, ist es nicht«, sagte er. »Zeit für den Tee ist es erst um halb sieben. Du sollst nicht immer in alte Gewohnheiten zurückverfallen, Hetta. Ich weiß, das fällt einem schwer, wenn man wie du einen Papa hat, der Pastor in Godalming ist und all das, aber wenn man erst mal die Seiten gewechselt hat, gibt’s kein Zurück zu den alten Pfarrhaussitten – auch nicht für eine kleine Tasse Tee zwischendurch.«
Er sagte es mit ruhiger Stimme, überzeugt und ohne jede Aggression, beiläufig, aber auf den Punkt – so, wie ein Gentleman redet, hätte man denken können, wäre nicht seinen »a«s ein leichtes Schnarren anzuhören gewesen, das noch nicht einmal wirklich auffällig war, man merkte erst einige Augenblicke später, dass es da war. Mit Hughs Stimme war es wie mit manchen Arten Weißburgunder, die beim Schlucken angenehm überzeugen, im Abgang aber zäh am Gaumen bleiben. Oder, wie Hetta sich manchmal schon gesagt hatte, wie mit dem Duftspray, das ihre Mutter in der Küche benutzte: das Frische und Leichte verwandelte sich innerhalb kürzester Zeit in einen Geruch nach warmem Metall. Weil sie nun diesen Geruch wahrnahm (sozusagen) und um ihren Tee gebracht worden war, fühlte sich Hetta zu einer kleinen Gegen-Revolte provo-ziert.
»Diejenigen Leute, die ihren Tee um halb sieben abends einnehmen«, sagte sie, »würden von Sex am Nachmittag aber gar nichts halten.«
»Weiß ich. Das werden wir alles ändern. Wir werden sie dahingehend bilden, dass sie verstehen, dass gar nichts dabei ist, wenn man Sex am Nachmittag hat.«
»Und sie werden dann ebenso begreifen, dass gar nichts dabei ist, wenn man um vier Uhr am Nachmittag Tee trinkt.«
Hugh lachte und nickte – er musste ihr zugestehen, dass er dagegen nichts sagen konnte. Von dieser großzügigen Geste überrumpelt, fühlte Hetta sogleich Reue in sich aufsteigen, darüber, dass sie »zimperlich« gewesen war, und hüpfte schnell in ihr Höschen.
»Ich will nicht stören!«, sagte sie und meinte es auch.
»Lieb von dir. Ich würde dich nicht so behandeln, aber ich muss mich auf ein Tutorium heute Abend vorbereiten.«
»Ein Tutorium? Aber das Trimester ist doch noch gar nicht richtig losgegangen!«
»Tony Beck möchte was mit mir besprechen. Irgendwas Spezielles.«
»Weil du sein spezieller Lieblingsstudent bist, deswegen. Bei der Eins in der Prüfung letzten Sommer und diesem Preis von der Universität im Herbst … dem ›Preis für den besten Essay im Fach Englisch, ausgelobt von allen Mitgliedern‹«, proklamierte sie stolz. »Für den Studenten, der von allen mit Gliedern das größte hat«, kicherte sie und zupfte zärtlich daran.
»Den Witz hatten wir schon mal«, sagte Hugh reserviert, weil er fand, dass sein akademischer Erfolg von solchen Schlüpfrigkeiten irgendwie besudelt wurde. »Und jetzt nimm um Himmels willen deine Hand da weg, bevor ich gleich wieder einen Ständer kriege.«
Er zog sich ein gestreiftes Flanellhemd (ohne Kragen) an und ein Paar Jeans und ging dann zu seinem Schreibtisch am Fenster.
»Was musst du denn für Mr. Beck machen?«
»Ist bloß ein kurzer Aufsatz. Ich muss ihn noch ins Reine schreiben, bevor ich zu ihm gehe.«
»Schon gut, ich gehe ja schon. Was ist mit heute Abend?«
»Geht nicht«, sagte er, ohne sich umzudrehen. »Ich hab ein Treffen. Die alten Herren haben mal wieder was vor.«
»Ach ja?«
»Sie haben ein bisschen Geld in die Finger bekommen, und wir wollen dafür sorgen, dass sie es für was Sinnvolles ausgeben. Obwohl Lancaster College stinkreich ist, braucht man gar nicht erst hoffen, dass sie es irgendwo anders hingeben, wo man es wirklich brauchen würde. Und wir können sie nicht dazu zwingen – noch nicht. Aber wenigstens zusehen, dass Sie hier im College was Anständiges damit anfangen, das können wir versuchen.«
»Wie zum Beispiel?«
»Wie zum Beispiel das, was wir heute Abend diskutieren.«
»Das ist ja interessant. Kann ich zu dem Treffen nicht mitkommen?«
»Tut mir leid, Süße. Ist nicht öffentlich. Jetzt aber los mit dir!«
»Bin schon an der Tür. Wink mir, Hugh!«
Hugh wandte kurz sein intelligentes, affenartiges Gesicht, das bereits von Konzentration gezeichnet war, Richtung Tür. Er fuhr sich mit den Händen durch das schwarze Haar (dickes, lockiges Haar, aber im Nacken akkurat auf Linie geschnitten) und winkte Hetta dann mit vier langen Fingern zu. Hetta winkte mit vier eher kurz geratenen Fingern zurück, ruckelte sich die Jeans über ihren herrlich runden Hintern und die breiten Hüften und schnippte eine lange blonde Haarsträhne vom Mund weg, um Hugh zuzulächeln. Es war zur Hälfte ein unschuldiges Lächeln, frech und niedlich und vertrauensselig, und zur Hälfte der lüstern lockende Blick einer Prostituierten (na, wie wär’s, ’ne schmutzige Nummer im Taxi?). Ein zärtlicher Schauer überkam Hugh, er gab ein leises Gurgeln von sich und wandte sich dann mit einem Schulterzucken wieder den Papieren auf seinem Schreibtisch zu.
»Na dann, Popöchen«, sagte er sanft. »Komm morgen um zwölf.«
Obwohl Hugh Hetta gesagt hatte, dass sie ruhig direkt durch den Fellows’ Garten gehen solle, wann immer sie wolle, kam Hetta das nicht richtig vor, wenn sie nicht in Begleitung von jemandem war, der dem College angehörte. Als sie das Wohnheim verließ, nahm sie daher für gut hundert Meter den geteerten Zufahrtsweg, bis der auf eine Seitenstraße traf, auf der sie nach links abbog, um wieder fast hundert Meter bis zur Queen’s Road zu gehen, hielt sich dort wieder links und gelangte so auf der Queen’s Road zum Hintereingang von Lancaster College, der sich genau gegenüber vom Tor zum Fellows’ Garden befand. Weil sie ihre bourgeoisen Skrupel noch nicht aufgegeben hatte, hatte Hetta sich also veranlasst gesehen, dreimal weiter zu gehen, als nötig gewesen wäre, und selbst jetzt waren diese Skrupel noch nicht verschwunden. Denn obwohl es jedem in der Welt freistand, das Gelände von Lancaster College zu durchqueren, kam es Hetta so vor, als sollte man, wenn man mit jemandem aus dem College eine Liebesbeziehung hatte, das nicht tun, es sei denn, man war in Begleitung der geliebten Person, damit es nicht eventuell so aussah, als ginge sie davon aus, Besitzansprüche zu haben; und gerade jetzt überlegte sie ernsthaft, lieber hinten herum über das Trinity College zu gehen, was einen weiteren Umweg von anderthalb Kilometern bedeutet hätte. Schließlich behielt aber doch die Vernunft die Oberhand, und sie betrat den Lancaster Walk, auf dem sie sich unter den Ulmen der Willow Bridge nä-herte.
Zu Hettas Linken lag, wo sie jetzt lief, die Scholars’ Meadow. Welche Art von Spielwiese dieses Weideland einst für die Studenten dargestellt hatte und welchen Zerstreuungen man dort nachgegangen war, fragte sich heute niemand mehr, denn die Scholars’ Meadow war genau genommen gar keine Wiese mehr. Was prominent ins Auge fiel, waren zwei prächtige Blutbuchen, die oben auf einem kleinen, steil zulaufenden Hügel standen. Der Hügel befand sich in der Mitte eines rechteckigen, über zweihundert Meter langen und vielleicht hundertvierzig Meter breiten Areals, das mit dichten Sträuchern und niedrigen, schmächtigen Bäumen bewachsen war; dazwischen Stellen mit Moos und gelben und weißen Narzissen, die für Abwechslung sorgten, und kleine Pfade, die verschlungene Verbindungen schufen, sich hierhin und dorthin wanden, hier plötzlich aufhörten und dort wieder anfingen, zielstrebig übereinander wegeilten und abrupt zurückkamen, um sich selbst den Weg abzuschneiden, jeden Anspruch auf Zielstrebigkeit oder Zweckdienlichkeit entbehrend. Das Erstaunliche war, dass es die Pfade überhaupt noch gab, da niemand je dort umherging und auch sonst nie jemand zu sehen war, der das Gelände betrat, das (so erzählte man sich) von einem unbekannten Gärtner gepflegt wurde, der in der Abenddämmerung kam und bei Tagesanbruch wieder verschwunden war.
Den Studenten von Lancaster College war oft ans Herz gelegt worden, die Scholars’ Meadow doch häufiger aufzusuchen, da sie per Statut zu ihrem Vergnügen gedacht war … ein Hinweis, der unlängst noch einmal betont worden war, als sie im vergangenen Winter begonnen hatten, für eine unbeschränkte Nutzung des Fellows’ Garden zu agitieren. Aber das studentische Komitee, das die ganze Sache betrieb, hatte erwidert, dass sie sich nicht mit etwas abspeisen lassen würden, das sie nicht wollten; und auf die Frage hin, warum sie die Meadow nicht wollten, hatten sie zur Antwort gegeben, dass das Gelände, da seit Menschengedenken niemand dort gewesen sei (eigentlich seit 1856 nicht, dem Jahr des Erwerbs der »neuen« Spielwiese), inzwischen etwas Abgeschiedenes, ja Feindseliges angenommen habe, das sie nicht einladend fänden. Das war natürlich eine vorgeschobene Begründung. Tatsächlich wollte das Komitee einzig und allein eines: die Fellows vorführen und ihren Unmut erregen, indem es deren exklusives Recht auf den eigenen Grund und Boden in Frage stellte. Allerdings war die Behauptung, dass die Scholars’ Meadow nicht einladend sei, nicht ganz von der Hand zu weisen. Denn trotz der bunten Blumen und hübschen Wege strahlte sie etwas Morbides aus, als wäre sie (einmal abgesehen vom ungewöhnlichen botanischen Umfeld) der letzte Rückzugsort eines dem Verfall geweihten Kaisers, der entmutigt darauf wartet, dass endlich die Barbaren auftauchen und Byzanz plündern.
Wie es zu diesem Eindruck kam, war schwer zu sagen. Obwohl die Scholars’ Meadow manchmal als »Wildnis« bezeichnet wurde, war das Wort stets in dem Sinn gemeint, wie es im Landschaftsgartenbau benutzt wurde, und das Areal war keineswegs verwahrlost oder zugewuchert; ganz im Gegenteil, wie auch immer es sich mit dem mysteriösen Gärtner verhalten mochte, sie war auf ihre zwanglos konzipierte Weise genauso gepflegt wie der Fellows’ Garden auch. Vielleicht lag ja darin die Erklärung: Denn schließlich hat ein gut gepflegtes Grundstück, nach dem offensichtlich nie ein Gärtner schaut, doch etwas ziemlich Unheimliches an sich. Wie auch immer, es hielt sich das allgemeine Gefühl, dass die Scholars’ Meadow auf eine nicht genauer bezeichnete, jedenfalls aber unerfreuliche Weise etwas leicht Numinoses an sich hatte, und die Leute einfach kein Interesse daran hatten, dort hinzugehen.
Und doch, so verrückt das war, liebten sie sie. Sie ließen schweigend die Blicke auf ihr ruhen, von allen Seiten her, zu jeder Tageszeit und jeden Tag. Wie Hetta jetzt auch. Wie hübsch, sagte sie sich im Stillen, als sie mit den Augen einem kleinen Pfad folgte, der durch ein Meer von gelben Narzissen verlief, auf einem winzigen Brückchen einen Bachlauf überwand, eine junge, grüne Buche umrundete und zwischen zwei Brombeerbüschen verschwand. Wie … wie erfüllend, dachte sie und blieb kurz auf Höhe des zentralen Hügels stehen; und dann, als sie an der vorderen Hälfte der Meadow entlangging: Warum wirkt hier alles so traurig? Ein Grund für die traurige Wirkung war das einsame und namenlose alte Pferd, das immer auf dem einzigen Stück echter Weide graste, das noch übrig war, einem schmalen Streifen, der sich zwischen dem vorderen Rand der »Wildnis« und dem Flussufer erstreckte. Und was für eine noch traurigere Wirkung sorgte, überlegte sie, war die lange Reihe von Weidenbäumen (zur Hälfte Trauerweiden) am Fluss selbst. Sie standen das gesamte Ufer entlang vom anderen Ende drüben bis fast zur Willow Bridge, wo die Reihe in einer Gruppe von vier Bäumen endete, die über das Wasser hinausragten und in es hineinhingen, ob trauernd oder in Demut, das konnte Hetta nicht sagen. Melancholisch, sagte sie sich, wusste aber, es war das falsche Wort. Hugh könnte mir das passende Wort sagen, dachte sie, sein Englisch ist so gut. Trübselig? Nein. Schwermütig? Nicht ganz. Düster? Sicher nicht. Das Wort, nach dem Hetta suchte und das sie nicht finden konnte, war vielleicht »elegisch«; doch wäre es fraglich, ob Hugh Balliston es ihr gesagt hätte, da dies kein Wort war, das er sehr schätzte.
Die Brücke war voll mit Leuten, die ihren Blick auf die Meadow gerichtet hielten, und anderen, die um die guten Plätze an der Balustrade konkurrierten. Die meisten der Männer wandten sich um, um Hetta betrachten zu können, aber sie ging in einer Haltung, die, wie sie meinte, Herablassung ausdrückte, stur weiter geradeaus, nicht ahnend, dass eine solche Haltung das doppelte Wippen ihrer hinreißenden Pobacken nur noch mehr betonte. Zu ihrer Linken lag nun eine riesengroße und sorgfältig gemähte Rasenfläche, und an deren anderem Ende, die gesamte Vorderfront ihr zukehrend, ein elegantes Gebäude aus dem 18. Jahrhundert (Sitwell’s), in dem, das wusste sie, die meisten der Professoren und einige wenige reiche Studenten (ein ganz heikler Punkt bei Hugh) große und opulent ausgestattete Räume bewohnten. Geradeaus vor ihr führte der Kiesweg, auf dem sie ging, durch eine Lücke zwischen dem südlichen Ende von Sitwell’s und dem Großen Saal des Colleges (einem bezaubernden Beispiel neogotischer Architektur) hindurch und dann weiter zum Großen Innenhof von Lancaster, während unmittelbar zu ihrer Rechten Stufen zum Haupteingang desjenigen Gebäudes hochführten, in dem der Provost logierte, einem Bau aus dem späten 19. Jahrhundert mit einer konventionellen und doch irgendwie imposanten Vorderfront. Hetta warf ihm einen Blick voll wütender Verachtung zu, weil sich darin der Leiter des Colleges und damit der schlimmste der ganzen »alten Herren« befand, und setzte dann zügig ihren Weg fort, durch den Durchlass zwischen Sitwell’s und dem Großen Saal, hinaus auf den Großen Innenhof.
Hier war es nun ihre vordringlichste Pflicht, den Großen Innenhof hinter sich zu bringen, ohne dabei von der Kapelle Notiz zu nehmen. Die stand keine zweihundert Meter von ihr entfernt zu ihrer Linken, bildete die nördliche Begrenzung des Karrees und gehörte zu den exquisitesten Zeugnissen englischer Spätgotik im ganzen Land – doch hatte Hugh sie bei einem der feierlichsten Momente ihrer »Umerziehung« diesbezüglich Obacht gelehrt. »Wir können aus der Geschichte etwas lernen«, hatte Hugh gesagt, »doch dürfen wir uns von ihr nicht ablenken oder moralisch korrumpieren lassen. Die Hauptsache, über die du dir bei dieser Kapelle klarwerden musst, ist, dass sie für ein Gedankensystem steht, das falsch, überholt und repressiv ist. Ihrem Charme solltest du nicht erliegen!« Dies beherzigend marschierte Hetta stur weiter geradeaus, schwingende Arme, wippender Busen, Augen und Nase resolut nach vorne gerichtet. Aber Hugh hin oder her, die Kapelle ließ sich nicht lange ignorieren, aus dem guten Grund, dass Hetta am Ende des Weges im Innenhof nach links abbiegen musste, um zum Tor zu kommen. Das bedeutete, dass sie nicht verhindern konnte, den Südostturm und mindestens zwei der Stützpfeiler auf der Südseite … es sei denn, sie würde stattdessen den Blick auf den Boden richten, was aber, wie ihre Mutter ihr beigebracht hatte, von einer verstohlenen und nachlässigen Haltung zeugte. Also wandte Hetta sich nun nach links und erhob ihre zögerlichen Augen zur Kapelle, und wie immer überwältigte sie der Anblick auch jetzt.
»Castro, ist das nicht scheißgroßartig!«, sagte sie.
Ihre Umerziehung erst einmal vergessend, wandte sie sich der Statue des Gründers zu, König Heinrich VI., der mitten auf dem Rasen auf einem steinernen Brunnen stand.
»Beate Henrice«, flüsterte sie, »ora pro nobis.«
Dann, nachdem sie sich diese Zügellosigkeit gegönnt hatte, aber mit schlechtem Gewissen, weil sie Hugh damit hinterging, stiefelte sie weiter zum Marktplatz, wo sie einen Bus in die Vorstadt, nach Cherry Hinton zur Schule für angehende Kinderkrankenschwestern nahm.
Robert Reculver Constable, der Provost von Lancaster College, hatte gesehen, wie Hetta im Vorübergehen voller Verachtung zu seiner Eingangstür geblickt hatte. Er hatte in seinem Studierzimmer am Schreibtisch gesessen, von seiner Arbeit aufgesehen, zum Fenster hinaus, um seinen Geist durch den Ausblick auf den Großen Rasen zu erfrischen, und dabei Hetta genau beobachten können, wie sie sich auf dem Kiesweg unter seinem Fensterkasten energisch ihr helles Haar aus dem Gesicht gewischt und den Mund zu einer selbstgefälligen Schnute verzogen hatte, die (so Robert Constables Schlussfolgerung) als Geste moralischer Geringschätzung intendiert war. Allerdings war es so, dass nicht nur die abschätzige Art, mit der Hetta hier entlangmarschierte, noch aufregender wirkte als ihr üblicher Gang, sie sah auch mit diesem abschätzigen Ausdruck im Gesicht noch hinreißender aus als mit unbewegtem Blick. Und zwar so, dass der Provost versucht war, das Fenster aufzustoßen und sie zum Tee hereinzubitten. Das wäre (überlegte er) gar nicht einmal so unstatthaft, da er tatsächlich schon einmal mit ihr zusammengetroffen war, in Begleitung eines jüngeren Studenten des Colleges, Hugh Balliston, der sie vor ein oder zwei Tagen im Fellows’ Garden herumgeführt hatte. Da der Provost Hugh kannte und mochte, hatte er ihn dazu gebracht, stehenzubleiben, um ein paar Worte mit ihm zu wechseln, und war Hetta, eher widerwillig, vorgestellt worden. Und dennoch, rief er sich zur Besinnung – allein umherziehende junge Damen zum Tee hereinzubitten war etwas, das der Provost von Lancaster üblicherweise nicht tat, und ganz gewiss war es etwas, das er, Robert Constable, nicht tun würde. Dazu kam, dass Hettas grimmiger Blick, wie hinreißend er auch sein mochte, trotz allem eine Geste der Geringschätzung war, und somit lag die Annahme nahe, dass sie die Einladung ausgeschlagen hätte.
Aber warum nur hatte die junge Frau so grimmig geschaut? Er vermutete, dass sie sich wahrscheinlich von Balliston etwas hatte erzählen lassen und der etwas gesagt hatte, was sie nun feindlich stimmte. Bloß: Warum sollte Balliston so etwas tun? Constable hatte immer sehr darauf geachtet, freundlich zu dem jungen Mann zu sein, den er für einen sehr begabten Studenten hielt und für jemanden, der dem College vielleicht einmal alle Ehre machen konnte. Gewiss, Balliston war ein Linker und Antiautoritärer der hartnäckigsten Sorte, was er mit seinem Engagement in verschiedenen Studentenausschüssen und in mehreren klugen Artikeln in Studentenzeitschriften bewiesen hatte; aber schließlich war der Provost selbst seit Ewigkeiten ein lupenreiner Sozialist und hatte während seiner Amtszeit in Lancaster wahre Seiltänze vollführt, um Reformen auf den Weg zu bringen und die Vorschriften so weit zu lockern, dass die Wahrung der allgemeinen Ordnung und ein friedliches Verfolgen der Wissensaneignung gerade noch so gewährleistet war. Das sollte doch eigentlich ausreichen, selbst einem Hugh Balliston.
Aber irgendwie war sich Robert Constable da nicht so ganz sicher. In letzter Zeit hatten sich die Zeichen gemehrt, dass einige Leute (wer genau, konnte er gar nicht sagen) noch viel mehr Veränderungen wollten und zudem viel schneller. Nicht nur eine generelle Veränderung, deren Notwendigkeit Constable ja sogar einsah, sondern eine neue Art von Veränderung – und wie genau die aussehen sollte, hatte ihm bisher noch niemand erklärt, abgesehen von vagen Andeutungen, dass die Forderungen, die demnächst gestellt würden, keine Frage für Debatten oder Verhandlungen nach klar definierten Richtlinien mehr seien, sondern dass sie irgendwie nicht nur unabweislich, sondern auch uferlos waren. Beyfus hatte vor einigen Wochen etwas in der Art von sich gegeben: »Es geht nicht mehr darum, die bestehenden Strukturen anzupassen«, hatte Beyfus gesagt. »Man muss sich auf das Prinzip der totalen Auflösung einlassen.« Was auch immer das heißen sollte. (Beyfus war immer für gleichermaßen provokative wie undurchsichtige Äußerungen gut.) Wenn es allerdings bedeutete, was er dachte, dass es bedeutete, gefiel das Constable überhaupt nicht, und er konnte nur hoffen, dass Hugh Balliston dem nicht auf den Leim gegangen war. Schließlich durfte man die großartigen Errungenschaften, die seit dem Krieg erkämpft und vollbracht worden waren, nicht einfach in Rauch aufgehen lassen (»totale Auflösung?«), bloß wegen einer neuen und radikalen modischen Schwärmerei. Balliston, wer, wenn nicht Balliston, musste doch das Zeug dazu haben, das zu verstehen.
Von welcher Seite er es auch betrachtete, Hettas grimmiger Blick bedeutete Ärger von Balliston und seinen Konsorten. Noch mal also: Warum? Es war kaum ein paar Wochen her, dass das Verwaltungsgremium der Universität den Fellows’ Garden als Zugeständnis freigegeben hatte – da konnte es doch nicht jetzt schon einen neuen Streitpunkt geben? »Totale Auflösung«, hörte er Beyfus mit schnarrender Stimme sagen. Schön und gut, aber trotzdem, wie uferlos und unabweislich die zu erwartenden Forderungen auch sein mochten, solche Forderungen mussten konkret benannt werden; man konnte sie einzeln vorbringen oder hundert auf einmal, aber sie mussten jede für sich erkennbar sein, nicht ununterscheidbar. Was also war es, was Balliston und seine Kumpanen jetzt wollten? Was war es, das die hübsche Hetta dazu veranlasst hatte, eine so ansehnliche Schnute zu ziehen, hinter der so offenkundig ein wilder Vorsatz steckte? Constable schüttelte seinen skulpturalen Kopf (den eines späten Herrschers, könnte man versucht sein zu sagen, aufgestiegen aus einem Geschlecht in Bithynien oder solch einer Gegend, aber nicht unkultiviert – vielleicht der Sohn eines lokalen Stammesführers?) und fuhr sich mit seiner großen, kräftigen Hand durch kurzgestutztes graues Haar. Es gab, dachte er, eine konkrete und klar benennbare Frage, die auf die Unzufriedenen genau jetzt und vor allen anderen denkbaren Themen Anziehung ausüben würde: die Verwendung von einer Viertelmillion Pfund Sterling.
Denn das College hatte Land nordwestlich der großen Bucht an der Ostküste verkauft, und zwar genau für das Doppelte des Wertes, der in den Büchern eingetragen war (da die Ermittlung der Grundstückswerte darin noch auf 1947 und weiter zurückging). Was die mit dem Verkauf erworbenen Gelder betraf, war in den Statuten festgelegt, dass die Hälfte davon, und somit das, was das Land theoretisch zuvor wert gewesen war, umgehend wieder fest angelegt werden musste; die andere Hälfte jedoch, die gesamten zweihundertfünfzigtausend Pfund (die nicht der Kapitalzuwachssteuer unterlagen), waren reiner Gewinn – Geld, das ausgegeben werden konnte. Das Geld war da, was für den Provost Probleme mit sich brachte. Denn naturgemäß war der Verkauf, als dieser bevorstand, praktisch überall bekannt geworden. Die eigentliche Abwicklung hatte sich nun so lange hingezogen (gut drei Jahre) und war eine so entsetzlich trockene Angelegenheit gewesen, dass die Öffentlichkeit weitgehend das Interesse verloren hatte; doch gab es im College selbst bestimmte Beobachter, die das Geschäft bis zuletzt mit scharfem Blick und großem Interesse verfolgt hatten und sehr wohl wussten, dass es nun endgültig zum Abschluss gebracht worden war. Solche Leute waren es, die sich jetzt rüsteten: voller Entschlossenheit, jeder mit einem eigenen Plan, mit fertig geschmiedeten, bis ins Letzte ausgefeilten Plänen, mit denen sie den Provost attackieren würden wie mit lauter gezückten Schwertern, sobald die Nachricht offiziell verkündet wurde – was am morgigen Tag beim Zusammentreten des Verwaltungsrates sein würde, am ersten Tag des Sommertrimesters in diesem Jahr, anno domini 1967.
Noch einmal hob der Provost seine wachsamen Augen, um sich an der Rasenfläche und der Scholars’ Meadow drüben zu erfreuen; noch einmal schaute er auf den Kiesweg unten und sah dieses Mal keine Hetta, die ihm das Bild verschönt hätte. Er schniefte kurz und heftig und beugte sich dann über das leere Blatt, das vor ihm lag. Morgen würden lauter schlaue Köpfe mit verschiedenen, lang gehegten Vorhaben für die Verwendung der zweihundertfünfzigtausend Pfund auf ihn einstürmen. Er würde sich Appelle, Drohungen, Vernünftiges, moralische Erpressungsversuche, politisch Feindseliges, schmeichlerischen Zuspruch und sinnlose Traumgespinste anhören müssen. Er musste auf all das vorbereitet sein. Wie also waren die Lager aufgestellt?
Zunächst mal bin da ich selbst, dachte er. Ich würde mir lediglich wünschen, dass das Geld in Form von Kapitalbeteiligungen (die von heute bis Ende 1968 beträchtlich an Wert zunehmen dürften) angelegt wird und erst einmal unangetastet bleibt und sich vermehren kann, bis jeder, der möchte, Zeit hatte, ausführlich ausgearbeitete Vorschläge vorzulegen, die daraufhin in Ruhe auf ihre praktischen wie auch alle anderen Verdienste hin geprüft werden können. Was ich nicht will, ist, dass irgendein theoretisch überzeugender Plan aus moralischem oder politischem Kalkül eilig verabschiedet wird und wir von da an dann nur noch diesen und nichts anderes mehr verfolgen. Aber genau das ist es, wozu uns die Aktivisten, alle auf ihre Weise, zu zwingen versuchen werden. Nun gut – wer werden die Vorreiter sein, und unter welchen Flaggen werden sie ihre Mannen jeweils anführen?
Rechtskonservatives Lager: …, schrieb er jetzt. Balbo Blakeney und Jacquiz Helmut.
Helmut hat etwas gegen Veränderung, aus snobistischen, ästhetischen und, um ihm nicht Unrecht zu tun, auch aus intellektuellen Gründen. Ideal fände er es, wenn mit dem Geld so lange wie nur irgend möglich überhaupt nichts geschehen würde. Es könnte daher sein, dass er mich dabei unterstützt, wenn ich auf ein Hinausschieben des Ganzen dringe. Andererseits kann es genauso gut sein, dass er will, dass es sofort aufgebraucht wird (zum Beispiel bevor die Summe durch Investieren noch anwachsen und dadurch noch bedrohlicher werden kann) – denn er weiß ja, dass das Geld irgendwann ausgegeben werden muss; und natürlich soll es dann für etwas Neutrales und Vertrautes sein.
So oder so sind konstruktive Vorschläge viel eher von Balbo Blakeney zu erwarten. Er hat Führungstalent, wie es jemand aus der Oberschicht automatisch mitbringt (wobei ihm sein übles Mundwerk sogar eher förderlich als hinderlich ist), und es lässt sich nicht leugnen, dass er über Einfallsreichtum verfügt, auch wenn seine wissenschaftlichen Errungenschaften eher überschaubar sind. Was wird Blakeney wollen? (Abgesehen von noch größeren Mengen Essen und Trinken.) Er kann kaum von uns verlangen, dass wir seine Forschungen zur chemischen Beschaffenheit des Blutes finanzieren, für die ja seine Fakultät bereits in großzügigem Maße aufkommt. Und auch sonst: Blakeney hat es eigentlich mit Bauwerken, gar nicht nur traditionellen, aber genau wie Helmut verabscheut er den Gedanken, steigende Zahlen von Studenten zuzulassen. Er könnte, denke ich mal, auf die Errichtung eines eigenen Labors hier im College dringen, wovon unsere Studenten aus den naturwissenschaftlichen Fächern auch profitieren würden – wäre nicht seine generelle Verachtung für Studenten so ausgeprägt, dass er sie auch gleich zum Teufel jagen könnte. Er könnte für mehr Wasch- und Toilettenräume plädieren – wären nicht die, die in seinen Verantwortungsbereich fallen, bereits ausreichend; und es würde ihm nicht im Traum einfallen, an die von jemand anderem auch nur einen Gedanken zu verschwenden. Alles in allem muss ich wohl leider eingestehen, nicht vorhersehen zu können, was Balbo anbringen wird: Ich muss mich damit abfinden, dass es eine Überraschung wird, und höchstwahrscheinlich keine schöne.
Und welche Gefolgschaft, dachte Constable, als er seinen Füller aus der Hand legte und über den Rasen zu der rötlichen Backsteinmauer am anderen Ende hinübersah, würde Blakeney hinter sich vereinen? Helmut würde dazugehören, das war sicher; die entscheidende Frage war aber, ob er auch diejenigen aus dem konservativen Lagers für sich gewinnen konnte, die eine moderatere Haltung vertraten. Da ging es vorrangig um drei: Ivor Winstanley, den Latinisten und hochgerühmten Horaz-Experten; den Ehrenwerten Grantchester FitzMargrave Pough, Senior Fellow und Professor emeritus für Geografie des Orients sowie seinerzeit ein beachteter Bergsteiger; und Reverend Andrew Ogden, Dekan der College-Kapelle. Dieses Trio war von so großer Liebenswürdigkeit und allgemein so angesehen, dass jedermann rechts von der Mitte, wie nah oder weit entfernt auch immer, ihnen überallhin folgen würde. Genau genommen war es sogar möglich, dass ein Teil der gemäßigten Linken, sollten Winstanley, Pough und Ogden einer Meinung sein, sich auf ihre Seite schlagen würde. Dass die drei einer Meinung waren, war recht wahrscheinlich, weil das oft der Fall war – aber würden sie sich hinter Blakeney stellen? Das hing eindeutig davon ab, wie Blakeney sich positionieren würde, und darüber ließen sich, wie der Provost sich bereits gesagt hatte, noch keine Schlüsse ziehen. Die einzig vernünftige Mutmaßung war, dass Blakeney sich bei seinem Antrag nach dem Geschmack von Winstanley und den anderen beiden richten würde, weil ihm klar war, dass er auf deren Unterstützung angewiesen war, wenn er genügend Stimmen auf sich vereinen wollte.
Diese Überlegungen brachte er nun ebenfalls zu Papier, genau ausgeführt und ohne nur eine Sekunde der damit verbundenen Mühe zu scheuen – denn die einzige Eitelkeit, die man ihm anlasten konnte, war sein Wunsch, einst eine Niederschrift und Rechtfertigung seines gesamten beruflichen Wirkens zu hinterlassen, und daher machte er sich Notizen, Tag für Tag und Stück für Stück, für eine Autobiografie, deren ungeheurer Umfang und minutiöse Herleitung jedes einzelnen Details alles übertreffen würde, was je in diesem Bereich geleistet wurde, selbst von den selbstquälerischsten alexandrinischen Autoren und den weitschweifigsten Viktorianern.
So weit zum konservativen Lager, dachte er nun, als er seinen letzten Satz zu diesem Thema geschrieben hatte: Vorgehen nicht vorhersagbar und zahlenmäßige Stärke bis dato nicht zu bestimmen. Wie sieht’s mit den Linken aus?
Die Führungsfigur im linken Lager, schrieb er nach einigem Nachdenken,