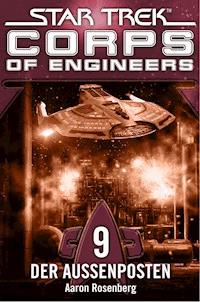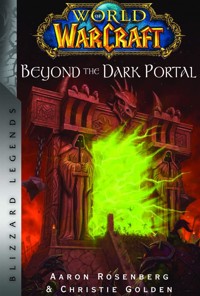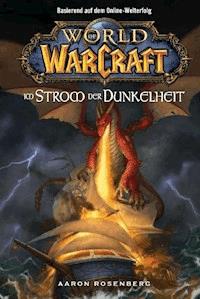
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Panini
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: World of Warcraft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2009
Ogrim Schicksalshammer hat den korrupten Kriegshäuptling Blackhand vernichtet und die Führung über die Horde der Orcs übernommen. Jetzt gilt es den Rest Azeroths niederzuwerfen, damit sein Volk wieder über ein eigenes Reich herrscht Anduin Lothar, ehemaliger Champion Sturmwinds, hat die Überreste seiner zerstörten Heimat hinter sich gelassen und ist nun an den Gestaden Lordaerons gelandet. Dort will er, unterstützt von dem edlen König Terenas, eine mächtige Allianz mit den anderen Nationen der Menschen schmieden. Doch selbst das mag nicht ausreichen, den wütenden Ansturm der Horde zu stoppen. Elfen, Zwerge und Trollen werfen sich in den Kampf, als die beiden Heere aufeinanderprallen. Wird die Allianz den Sieg davon tragen oder wird die Horde alles in einen Strom der Dunkelheit reißen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 442
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Amerikanische Originalausgabe: „World of Warcraft: Tides of Darkness“ by Aaron Rosenberg, published by Simon and Schuster, Inc., September 2007.
Deutsche Übersetzung © 2008 Panini Verlags GmbH, Rotebühlstraße 87, 70178 Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten.
Copyright © 2009 Blizzard Entertainment, Inc. All Rights Reserved. „WORLD OF WARCRAFT: Tides of Darkness“, WORLD OF WARCRAFT, Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.
No similarity between any of the names, characters, persons and/ or institutions in this publication and those of any pre-existing person or institution is intended and any similarity which may exist is purely coincidental. No portion of this publication may be reproduced, by any means, without the express written permission of the copyright holder(s).
Übersetzung: Mick Schnelle Lektorat: Manfred Weinland, Dr. Sabine Jansen Redaktion: Mathias Ulinski, Holger Wiest Chefredaktion: Jo Löffler Umschlaggestaltung: tab indivisuell, Stuttgart
Danksagung
Für meine Familie und Freunde und ganz besonders für meine großartige Frau, die mir geholfen hat, den Strom aufzuhalten.
Für David Honigsberg (1958 – 2007), Musiker, Autor, Computerspieler, Rabbi und ganz besonderer Freund. Zeig dem Himmel, wie man rockt, Amigo.
ERSTER PROLOG
Die Morgendämmerung kroch über das Land und nagte am dichten Nebel, der alles vereinnahmte. Im kleinen Dorf Süderstade erwachten die Menschen und gingen ihren Beschäftigungen nach. Das Licht der aufgehenden Sonne wärmte sie noch nicht, aber die Nacht neigte sich unaufhaltsam ihrem Ende zu.
Noch aber lag der dichte Dunst über den schlichten Holzhütten und bedeckte das Meer jenseits des Dorfes. Obwohl nicht zu sehen, war die Brandung, die ans Ufer rollte und sich am Kai brach, deutlich zu hören.
Doch etwas anderes klang darin mit, langsam und gleichmäßig, als würde etwas durch den Nebel gleiten. Das Geräusch hallte von allen Seiten wider, bis die Menschen von Süderstade nicht mehr sagen konnten, um was es sich dabei handelte und aus welcher Richtung es kam. Erklang es vom Land hinter ihnen – oder kam es von der See? Schlugen nur die Wellen etwas fester gegen die Gestade, oder war es der Regen, der den Nebel niederkämpfte?
Oder sollte es sich gar um den Wagen eines Händlers handeln, der einen der Feldwege hinunterfuhr?
Nachdem sie angespannt gelauscht hatten, erkannten sie, dass das merkwürdige neue Geräusch aus Richtung des Wassers kam. Sie liefen zum Strand und versuchten, in der Finsternis etwas zu erkennen.
Was war das für ein Geräusch, und wovon wurde es verursacht?
Langsam begann sich der Nebel zu verändern – als würde er von dem Geräusch vor sich her getrieben. Er wurde dichter und dunkler. Die Finsternis begann Form anzunehmen, bildete eine Art Welle, die auf die Dörfler zurollte.
Sie wichen zurück, einige schrien laut. Die Männer waren mit der See groß geworden, geborene Fischer, die schon alles gesehen zu haben meinten, was mit dem Wasser zu tun hatte.
Doch diese Welle bestand erkennbar nicht aus Wasser, sondern aus etwas gänzlich anderem. Und sie bewegte sich falsch …
Die Dunkelheit näherte sich immer mehr. Sie brachte den Nebel mit sich. Das begleitende Geräusch wurde lauter, dann durchbrach es den diesigen Schleier. Die riesige Welle teilte sich in viele kleinere und nahm dabei … Form an.
Es waren Boote. Die Dörfler entspannten sich, weil ihnen das zunächst einmal vertraut war. Dennoch blieben sie auf der Hut. Süderstade war ein winziges Fischerdorf, und seine Bewohner nannten gerade mal ein Dutzend kleiner Kähne ihr eigen. Über die Jahre hatten sie kaum mehr als ein Dutzend fremder Fahrzeuge gesehen.
Und nun, plötzlich, näherten sich ihnen auf einen Schlag Hunderte!
Was bedeutete das? Die Männer umfassten ihre kurzen Holzknüppel, Messer, Hakenstangen, sogar mit Gewichten versehene Netze. Sie warteten gespannt. Immer mehr Schiffe kamen aus dem Nebel, eine endlose Armada.
Mit jeder neuen Reihe Schiffe wuchs die Bestürzung der Fischer. Das waren nicht Hunderte, sondern Tausende!
Mehr Boote, als sie jemals zuvor gesehen hatten. Wo kamen die her? Was konnte ihre Insassen aufs Wasser getrieben haben … und was führte sie nach Lordaeron?
Die Dörfler packten ihre Waffen fester, Kinder und Frauen verbargen sich in den Hütten. Und noch immer erhöhte sich die Zahl der Boote.
Längst war klar geworden, dass das Geräusch von den Rudern stammte, die ungleichmäßig durch das Wasser gezogen wurden.
Das erste Boot legte am Kai an. Jetzt konnten die Einheimischen das erste Mal die Gestalten darauf erkennen. Sie entspannten sich, obwohl ihre Verwunderung wuchs. Es handelte sich um Menschen, darunter auch Frauen und Kinder. Hell- und dunkelhäutige, mit Haarfarben in sämtlichen Schattierungen.
Das waren keine Monster oder irgendeine andere Rasse, von denen die Dorfbewohner bisweilen zwar gehört, die sie aber nie mit eigenen Augen gesehen hatten. Diese Menschen wirkten auch nicht, als wären sie für den Krieg gerüstet. Denn offensichtlich waren die meisten der Ankömmlinge keine Krieger.
Nein, dies war keine Invasion. Es wirkte eher, als wären sie auf der Flucht vor einer schrecklichen Katastrophe. Die Fischer spürten, dass sich ihre Furcht in Sympathie verwandelte.
Was aber konnte eine solche Zahl von Flüchtlingen auf die See hinausgetrieben haben?
Weitere Boote erreichten die Küste, und ihre Besatzungen verließen wankend die unsicheren Planken. Einige brachen auf dem steinigen Strand zusammen und weinten. Andere beherrschten sich besser und atmeten tief durch, als wären sie einfach nur heilfroh, endlich der Wasserwüste entkommen zu sein.
Der Nebel lichtete sich allmählich. Die Morgensonne brach durch und löste die Schwaden mit ihren starken Strahlen mehr und mehr auf. Die Dorfbewohner konnten jetzt vieles klarer erkennen.
Diese Menschen gehörten zu keiner Invasionsarmee. Viele waren Frauen und Kinder, ärmlich gekleidet, die meisten abgemagert und schwach. Es handelte sich um einfache Leute, die eindeutig von großem Unglück betroffen waren. Manche waren so erschöpft, dass sie kaum noch stehen konnten oder wie trunken über den Strand stolperten.
Ein paar immerhin trugen auch Rüstungen. Einer, der sich auf dem vordersten Boot befunden hatte, kam auf die versammelten Dörfler zu. Er war von großer, kräftiger Statur, fast kahlköpfig, mit einem dichten Schnurrbart und einem harten, ernsten Gesicht. Seine Rüstung hatte sich erkennbar in mehreren Kämpfen bewährt, und der Griff seines großen Schwertes ragte über die Schulter hinaus. Seine Hände aber umfassten keine Waffen, sondern zwei kleine Kinder. Weitere liefen neben ihm her und klammerten sich an Rüstung, Gürtel oder Waffenscheide des Kriegers.
Neben ihm schritt ein merkwürdiger Mann daher. Er hatte breite Schultern, war ansonsten aber hager. Sein weißes Haar wehte in der leichten Brise. Er trug ein zerfleddertes violettes Gewand und einen abgewetzten Rucksack. Über einer Schulter lag ein Kind, ein weiteres, das noch aus eigener Kraft gehen konnte, hielt er an der Hand.
Und noch eine dritte erwachsene Gestalt gehörte zu dieser Vorhut: ein junger, braunhaariger Mann mit braunen Augen, der seine Umgebung kaum wahrzunehmen schien. Eine Hand hatte sich in den Umhang des großen Mannes gegraben, um Halt zu finden. Mehr noch als die tatsächlichen Kinder wirkte er wie ein kleiner Junge, der sich verzweifelt an ein Elternteil klammerte. Seine Kleidung war von edler Machart, aber von Wind und Wetter verblichen.
„Seid gegrüßt!“, rief der Krieger und kam mit einem breiten Lachen auf die Dörfler zu. „Wir sind Flüchtlinge, die einer schrecklichen Schlacht entkommen sind. Ich bitte euch um Nahrung und etwas zu trinken, so ihr es entbehren könnt. Und um Unterkunft für die Kinder.“
Die Einheimischen schauten einander an. Dann nickten sie und senkten ihre Waffen. Sie waren kein reiches Dorf, aber auch nicht verzweifelt arm. Und es hätte ihnen schon deutlich schlechter gehen müssen, um Kinder und deren Angehörige abzuweisen.
Ein paar Männer traten vor und nahmen dem Krieger die Kleinen ab, und der Mann mit der violetten Robe führte sie zur Kirche, dem größten und stabilsten Gebäude im Dorf. Die Frauenbereiteten derweil schon töpfeweise Haferbrei und Eintopf zu.
Schnell hatten die Flüchtlinge Unterkunft in der Kirche und unmittelbar davor bezogen. Sie aßen und tranken, teilten sich Stoffe und Mäntel. Es hätte fast ein Fest sein können, wäre da nicht der betrübliche Ausdruck auf den Gesichtern der Flüchtlinge gewesen.
„Unser Dank ist euch gewiss“, wandte sich der Krieger an den Dorfvorsteher, der sich ihm als Marcus Rotpfad vorgestellt hatte. „Ich weiß, dass ihr eigentlich nicht viel entbehren könnt. Deshalb wiegt das Wenige, das ihr mit uns teilt, umso schwerer.“
„Wir lassen Frauen und Kinder nicht hungern“, antwortete Marcus. Er schaute finster drein und musterte Schwert und Rüstung seines Gegenübers. „Aber erzählt mir doch, wer Ihr eigentlich seid – und warum Ihr hierher gekommen seid.“
„Ich bin Anduin Lothar“, erwiderte der Krieger mit Bedacht und strich sich über die Stirn. „Ich bin … ich war der Held von Sturmwind.“
„Sturmwind?“ Marcus hatte von dieser Nation gehört. „Aber das liegt jenseits des Meeres!“
„Ja“, nickte Lothar traurig. „Wir sind tagelang gesegelt, um hierher zu kommen. Wir befinden uns in Lordaeron, nicht wahr?“
„Ganz gewiss sind wir das“, sagte der violett gekleidete Mann, der damit zum ersten Mal das Wort ergriff. „Ich erkenne das Land wieder, obwohl mir das Dorf fremd ist.“ Seine Stimme war sehr fest für jemanden seines Alters. Obwohl nur seine Haarfarbe und die Falten in seinem Gesicht auf sein Alter hinwiesen, ansonsten wirkte er wie ein Jüngling.
„Ihr seid in Süderstade“, sagte Marcus. Er beäugte den weißbärtigen Mann misstrauisch und fragte schließlich: „Stammt Ihr aus Dalaran?“ Er bemühte sich um einen neutralen Tonfall.
„Aye“, gab der Fremde zu. „Und habt keine Furcht – ich werde dorthin zurückkehren, sobald meine Gefährten reisen können.“
Marcus versuchte, sich seine Erleichterung nicht anmerken zu lassen. Die Zauberer von Dalaran waren überaus mächtig, und er hatte gehört, dass der König sie als Verbündete und Berater schätzte. Er selbst aber wollte mit Magie und Zaubererei nichts zu tun haben.
„Wir müssen uns beeilen“, stimmte Lothar zu. „Ich muss so schnell wie möglich mit dem König sprechen. Wir dürfen der Horde keinen weiteren Vorsprung schenken.“
Marcus verstand diese Anmerkung nicht, doch er erkannte die Dringlichkeit im Tonfall des stämmigen Kriegers. „Die Frauen und Kinder können eine Weile bei uns bleiben“, versicherte er ihm. „Wir werden uns um sie kümmern.“
„Danke“, sagte Lothar aufrichtig. „Wir schicken Nahrung und Güter, sobald wir beim König waren.“
„Es wird Zeit kosten, die Hauptstadt zu erreichen“, erklärte Marcus. „Ich werde deshalb jemanden auf einem schnellen Pferd vorausschicken, damit man auf Eure Ankunft vorbereitet ist. Was soll er ausrichten?“
Lothar runzelte die Stirn. „Er soll dem König berichten, dass Sturmwind gefallen ist“, sagte er schließlich leise. „Der Prinz ist bei uns und mit ihm so viele Leute, wie ich retten konnte. Wir brauchen so rasch wie möglich Vorräte. Und wir bringen ihm schlechte Nachrichten von höchster Dringlichkeit.“
Marcus’ Augen waren angesichts des Gehörten immer größer geworden. Sein Blick war zu dem Jungen gewandert, der neben dem Krieger stand. Dann aber schaute er weg, bevor es unangenehm wurde. „Wird erledigt“, versicherte er ihnen und sprach mit einem der Dörfler.
Der nickte und sprang auf eines der bereitstehenden Pferde. Er galoppierte schon los, bevor der Dorfvorsteher zwei Schritte zurück in die Kirche gemacht hatte.
„Willem ist unser bester Reiter, und sein Pferd ist das schnellste des Dorfes“, versicherte Marcus den beiden Männern. „Er wird die Hauptstadt lange vor Euch erreichen und die Botschaft überbringen. Wir organisieren derweil Pferde und Nahrung für Euch und Eure Begleiter.“
Lothar nickte und dankte. Dann wandte er sich an den Mann im violetten Gewand. „Sammelt alle, die mit uns kommen, Khadgar, und haltet Euch bereit. Wir brechen so bald wie möglich auf.“
Der Zauberer nickte und begab sich zu den Flüchtlingen.
Ein paar Stunden später verließen Lothar und Khadgar Süderstade. Prinz Varian Wrynn begleitete sie zusammen mit sechzig Mann. Die meisten aber wollten lieber zurückbleiben. Entweder um ihre Wunden auszukurieren oder um sich von der Erschöpfung zu erholen. Manche waren auch einfach noch zu verängstigt und schockiert und wollten mit den wenigen Überlebenden aus ihrer Heimat zusammenbleiben.
Lothar nahm es ihnen nicht übel. Ein Teil von ihm wäre auch gern in dem Fischerdorf geblieben. Doch er hatte eine Aufgabe zu erfüllen. Wie so oft.
„Wie weit ist es bis zur Hauptstadt?“, fragte er Khadgar, der neben ihm ritt. Die Dörfler hatten ihnen an Reittieren und Wagen überlassen, was sie entbehren konnten. Lothar wollte den großzügigen Menschen nicht zu viel wegnehmen, aber schließlich hatte er die Hilfe doch akzeptiert, weil er wusste, dass sie auf diese Weise deutlich an Zeit gewannen. Und die war wertvoll.
„Ein paar Tage noch, vielleicht eine Woche“, antwortete der Zauberer. „Ich kenne mich in diesem Teil des Landes nicht so gut aus. Doch ich erinnere mich daran, wie es auf den Karten ausgesehen hat. Wir sollten die Turmspitzen der Stadt in spätestens fünf Tagen sehen können. Dann müssen wir noch durch den Silberwald, der zu den großen Wundern Lordaerons gehört. Er liegt am Rande des Lordameresees. Die Stadt erhebt sich am nördlichen Ufer.“
Khadgar verfiel wieder in Schweigen, und Lothar beobachtete seinen Begleiter verstohlen. Er sorgte sich um den jungen Mann. Als er ihn das erste Mal getroffen hatte, bewunderte er ihn für seine Gelassenheit und Selbstsicherheit. In so jugendlichem Alter war beides gepaart äußerst selten zu finden.
Khadgar war damals erst siebzehn Jahre alt gewesen und doch bereits ein vollwertiger Zauberer. Zudem war er der erste, den Medivh je als Lehrling akzeptiert hatte!
Spätere Treffen hatten Lothar gezeigt, dass Khadgar klug, strebsam und freundlich war. Er mochte den Jüngling. Es war das erste Mal, dass er wieder freundschaftlich mit einem Zauberer verkehrte, seit … nun, seit der Zeit von Medivh. Aber nach allem, was in Karazhan geschehen war …
Lothar erschauderte, als er sich den hässlichen, albtraumhaften Konflikt in Erinnerung rief. Er hatte gemeinsam mit Khadgar, der Halborcfrau Garona und einer Handvoll Männer gegen Medivh antreten müssen. Khadgar hatte einen tödlichen Angriff gegen seinen Meister geführt. Doch war es Lothar gewesen, der seinem ehemaligen Freund den Kopf abschlug. Den Kopf, den er in ihrer Jugendzeit so oft verteidigt hatte, damals, als er, Medivh und Llane noch Freunde und Gefährten gewesen waren.
Lothar schüttelte den Kopf, um die Tränen zurückzudrängen. Er hatte auf der langen Seereise oft getrauert. Aber immer noch schienen ihn die Qual, die Wut und das Bedauern zu überwältigen.
Llane! Sein bester Freund, sein Gefährte, sein König. Llane, mit dem breiten Grinsen, den lachenden Augen und der schnellen Auffassungsgabe. Llane, der Sturmwind in ein goldenes Zeitalter geführt hatte – nur, um miterleben zu müssen, wie die Orcs es zerstörten.
Die Horde fegte über das Land und verwüstete alles, was ihr dabei im Weg stand.
Und dann … hatten sie erkennen müssen, dass Medivh für all das verantwortlich war! Dass seine Magie den Orcs dabei geholfen hatte, diese Welt zu erreichen – dass sie nur dadurch Sturmwind überhaupt hatten erreichen können!
Und als Folge davon war nicht nur das Königreich vernichtet worden, sondern auch Llane gestorben …
Lothar schluckte beim Gedanken daran, was er alles verloren – was sein Volk verloren hatte. Doch dann riss er sich zusammen, wie schon so viele Male zuvor auf ihrer Reise. Er konnte sich diesen Gefühlen nicht ergeben. Sein Volk brauchte ihn, genauso wie die Bewohner dieses Landes, auch wenn sie es noch nicht ahnten.
Und Khadgar folgte seinem Beispiel. Lothar verstand immer noch nicht alles, was in Karazhan in jener Nacht passiert war. Doch irgendwie hatte sich Khadgar während des Kampfes mit Medivh verändert. Seine Jugend war verschwunden, sein Körper unnatürlich gealtert. Jetzt sah er wie ein uralter Mann aus, viel älter als Lothar, obwohl Khadgar fast vierzig Jahre weniger zählte.
Lothar fragte sich, was damals noch mit dem jungen Zauberer geschehen war. Khadgar wiederum war viel zu sehr in Gedanken versunken, um den besorgten Blick seines Gefährten zu bemerken. Der junge und doch so alt anmutende Zauberer war in sich gekehrt, obwohl er über dieselben Dinge nachgrübelte wie sein Begleiter. Er durchlebte noch einmal den Kampf von Karazhan. Dabei spürte er sogar erneut das schreckliche Zerren, als Medivh ihm seine Magie und Jugend entzog.
Die Magie war zurückgekehrt – sie war sogar auf vielerlei Weise stärker geworden als zuvor –, doch seine Jugend war ihm genommen, lange vor der eigentlichen Zeit. Er war ein alter Mann geworden, zumindest dem Aussehen nach, auch wenn er sich immer noch gesund und munter fühlte wie eh und je. Und tatsächlich war er genauso ausdauernd, stark und beweglich wie einst. Nur sein Gesicht war voller Falten, seine Augen lagen tiefer in den Höhlen, und sein Haar und der frisch sprießende Bart schimmerten weiß.
Obwohl er erst neunzehn war, sah Khadgar gut dreimal so alt aus. Damit ähnelte er dem Mann in seinen Visionen, jener älteren Ausgabe seiner selbst, die er während des Kampfes aufgrund der in Medivhs Turm freigesetzten Magie gesehen hatte – der ältere Mann, der eines Tages unter einer merkwürdigen roten Sonne sterben würde, weit weg von zu Hause …
Khadgar analysierte die Gefühle, die ihn seit Medivhs Tod bewegten. Der Mann war das personifizierte Böse gewesen, ganz allein verantwortlich dafür, dass die Horde auf diese Welt hatte gelangen können. Auch wenn er nicht er selbst gewesen war, denn Medivh war von Sargeras beherrscht worden, dem Titan, den Medivhs Mutter ein Jahrtausend zuvor besiegen konnte. Doch jener Sargeras war seinerzeit nicht vollständig gestorben, nur sein Körper war vergangen. Er hatte sich in Aegwynns Mutterleib eingenistet und dort ihren noch ungeborenen Sohn beeinflusst.
Nein, Medivh war für seine Taten nicht verantwortlich. Im Sterben hatte er Khadgar verraten, dass er gegen das Böse in sich bereits seit Jahren ankämpfte, vielleicht schon sein ganzes Leben lang. Khadgar war sogar einem merkwürdigen Trugbild seines toten Meisters begegnet, kurz nachdem dessen Körper begraben worden war. Es stammte laut Medivh aus der Zukunft, endlich befreit von Sargeras Geist – dank Khadgar.
Wie sollte ich mich also fühlen?, überlegte Khadgar. Sollte er trauern, weil sein Meister tot war?
Zeitweilig hatte er Medivh sehr gemocht. Und ganz sicher hatte die Welt durch seinen Tod einen herben Verlust erlitten.
Sollte er also stolz darauf sein, dass er seinen Teil dazu beigetragen hatte, den Mann zu befreien und Sargeras erneut aus dieser Welt zu vertreiben? Sollte er wütend auf Medivhs Taten sein – oder beeindruckt, weil der Magier der Einflussnahme durch den Titanen so lange widerstanden hatte?
Er war sich nicht sicher. Khadgar war sowohl im Geiste als auch im Herzen verwirrt. Dazu kamen noch andere Dinge. Denn hier war er zu Hause. Immerhin war er zurück in seinem Heimatland Lordaeron. Wenn auch anders, als er es erwartet hatte.
Als er auf Geheiß seines vorherigen Meisters in Dalaran ausgezogen war, um Medivhs Schüler zu werden, hatte Khadgar nicht damit gerechnet, dass er zurückkehren würde, bevor er nicht selbst ein Meistermagier geworden war. Er hatte sich vorgestellt, wie er auf einem Greifen zurückgeflogen kam, so wie Medivh es ihn gelehrt hatte. Er wäre auf dem Dach der Violetten Zitadelle gelandet, sodass alle seine ehemaligen Lehrer und Freunde sein Können hätten bestaunen können …
Stattdessen ritt er nun auf einem Ackergaul, Seite an Seite mit Sturmwinds ehemaligem Helden, um mit einer heruntergekommenen Truppe von Kriegern den König dazu zu überreden, die Welt zu retten.
Immerhin bot man ihnen gewiss einen dramatischen Empfang, was seine alten Lehrer und Freunde zu schätzen wissen würden.
„Was machen wir, wenn wir die Stadt erreicht haben?“, fragte er Lothar und riss den alternden Krieger aus seiner Tagträumerei.
Sein Kamerad war schnell wieder bei der Sache und musterte ihn mit diesen entwaffnenden, sturmblauen Augen, die die Gefühle des Kriegers verrieten, ohne zugleich den scharfen Verstand durchblicken zu lassen.
„Wir werden mit dem König reden“, antwortete Lothar. Er schaute zu dem Jüngling, der still neben ihnen ritt. Dann strich er über den Schaft seines Schwertes. Die Edelsteine und das Gold darauf glitzerten in der Nachmittagssonne. „Auch wenn Sturmwind verloren ist, ist Varian immer noch der Prinz, und ich bin nach wie vor sein Berater. Ich habe König Terenas nur einmal kurz getroffen, das war vor vielen Jahren. Doch vielleicht erkennt er mich ja. Varian wird er jedenfalls sicherlich kennen, und durch den Boten ist er von unserem Eintreffen unterrichtet. Er wird uns eine Audienz gewähren. Und dann erklären wir ihm, was passiert ist – und was getan werden muss.“
„Und was ist das?“, fragte Khadgar, obwohl er es wusste.
„Wir rufen die Könige dieser Länder zusammen“, antwortete Lothar, wie Khadgar es erwartet hatte. „Wir müssen sie dazu bringen, die Gefahr zu erkennen. Keine Nation kann der Horde allein widerstehen. Mein eigenes Land hat es versucht und ist deshalb vernichtet worden. Das darf hier nicht geschehen. Die Menschen müssen sich vereinen und als Verbündete kämpfen!“ Seine Hände umklammerten die Zügel, und nun erkannte Khadgar wieder den mächtigen Krieger in ihm, der Sturmwinds Armee angeführt und für so viele Jahre die Grenzen gesichert hatte.
„Dann sollten wir hoffen, dass sie uns zuhören“, sagte Khadgar leise.
„Das werden sie“, versicherte ihm Lothar. „Sie müssen einfach!“
Keiner von ihnen sprach aus, was beide dachten. Sie hatten die Macht der Horde erlebt. Und wenn die Nationen sich nicht vereinten, wenn ihre Könige die Gefahr nicht erkennen wollten, würden sie untergehen.
In diesem Falle würde die Horde dieses Land ebenso überrennen wie Sturmwind. Und nichts würde von ihr verschont bleiben.
ZWEITER PROLOG
Eine dunkle Gestalt stand auf dem hohen Turm und blickte auf die Welt darunter. Von diesem Aussichtspunkt aus konnte sie die Stadt und das Umland sehen. Beides war von einer sich bewegenden Dunkelheit bedeckt. Einer Flut, die sich über Umgebung und Gebäude ergoss … und nichts als Ruinen hinterließ.
Die Gestalt schaute zu. Groß, mächtig und muskelbepackt stand sie bewegungslos auf der steinernen Spitze. Ihre scharfen Augen analysierten die Szenerie in der Tiefe. Langes dunkles Haar hing zu Zöpfen geflochten über ein kantiges Gesicht. Die mit Quasten versehenen Enden strichen über die langen Hauer, die aus der Unterlippe sprossen.
Die Sonne brannte auf sie herab, und die Haut leuchtete grünlich. Das Licht wurde von zahlreichen Trophäen und Medaillons, die um den Hals hingen, reflektiert. Schwere Plattenpanzer bedeckten Brust, Schultern und Beine. Die verkratzte Oberfläche glühte schwarz. Auffällige Bronzeschnallen prangten darauf. Gold leuchtete an den Rändern und unterstrich die Wichtigkeit des Wesens.
Schließlich hatte die Gestalt genug gesehen. Sie hob ihren riesigen schwarzen Kriegshammer, auf den sie sich gestützt hatte und dessen Steinkopf das Sonnenlicht zu absorbieren schien. Dann brüllte sie los. Es war ein Kriegsschrei, der zur Zusammenkunft rief. Er drang in die Gebäude und selbst die Hügel ringsum ein und wurde zurückgeworfen.
Die schwarze Flut wurde langsamer. Dann kräuselte sie sich, als sich die Gesichter nach oben wandten. Jeder Orc in der Horde blieb stehen und schaute zu der einsamen Gestalt empor, die nun erneut aufbrüllte und den Hammer hochhielt. Und dieses Mal brach die Flut der Orcs in ohrenbetäubenden Jubel aus. Die Horde huldigte ihrem Anführer.
Befriedigt ließ Orgrim Schicksalshammer seine markante Waffe sinken – und die dunkle Flut nahm ihre Verderben bringende Bewegung wieder auf.
Unten, jenseits der Stadttore, lag ein Orc auf einem Feldbett. Sein kurzer, magerer Körper war in dicke Felle gehüllt, und edle Kleidung lag bereit. Aber die Gewänder waren seit Wochen nicht mehr angerührt worden.
Der Orc bewegte sich nicht, und es schien, als sei er tot. Sein hässliches Gesicht war vor Schmerz oder Konzentration verzerrt. Ein dichter Bart verdeckte den knurrenden Mund.
Plötzlich änderte sich alles. Keuchend setzte sich der Orc auf. Die Felle fielen von seinem schweißgetränkten Körper. Seine Augen öffneten sich. Zuerst waren sie glasig und ohne echte Wahrnehmung. Dann blinzelte er den langen Schlaf weg und blickte sich um.
„Wo …?“, wollte er wissen.
Eine größere Gestalt war schon unterwegs zu ihm. Ihre beiden Köpfe waren angenehm überrascht, und als der Blick des Orcs den Doppelhäuptigen traf, wurde die Welt wieder klar, enthüllte ihre Details.
Was auch immer ihn ausgeschaltet hatte, lag nun hinter ihm und war überwunden. Heimtücke und Wut erfüllten ihn. „Wo bin ich?“, wollte er wissen. „Was ist passiert?“
„Du bist eingeschlafen, Gul’dan“, antwortete die Kreatur, die neben dem Feldbett kniete und ihm einen Kelch anbot.
Der Orc nahm ihn, roch daran und trank den Inhalt grunzend. Dann wischte er sich mit der Hand über den Mund.
„Ein Schlaf wie ein Toter. Seit Wochen hast du dich nicht mehr bewegt, hast kaum geatmet. Wir dachten schon, dein Geist sei fort.“
„Tatsächlich?“ Gul’dan grinste. „Hattest du Angst, dass ich dich verlassen würde, Cho’gall, und dich damit Schwarzfausts Gnade ausliefere?“
Der zweiköpfige Ogermagier schaute ihn an. „Schwarzfaust ist tot, Gul’dan!“, sagte einer der Köpfe. Der andere nickte eifrig.
„Tot?“ Zuerst glaubte Gul’dan, sich verhört zu haben. Aber Cho’galls finsteres Mienenspiel überzeugte ihn vom Gegenteil, noch bevor beide Köpfe nickten. „Was? Wie?“ Er richtete sich auf und setzte sich hin. Die plötzliche Bewegung ließ ihn taumeln, und kalter Schweiß brach aus. „Was ist passiert, während ich schlief?“
Cho’gall begann zu antworten, aber seine Worte erstarben, als jemand die Eingangsflappe beiseite schob und in den engen Raum trat.
Zwei kräftige Orckrieger schoben Cho’gall aus dem Weg, packten Gul’dan fest an den Armen und stellten ihn auf die Füße.
Der Oger begann zu protestieren. Seine beiden Köpfe liefen dunkel an vor Wut, aber zwei weitere Orcs drängten in den Raum und verstellten ihm den Weg. Ihre Kriegsäxte waren bereit zuzuschlagen. Sie standen Wache, während die ersten beiden Gul’dan aus dem Zelt schleiften.
„Wohin bringt ihr mich?“, verlangte er zu wissen. Dabei versuchte er, seine Arme frei zu bekommen. Aber er hatte keine Chance. Selbst bei völliger Gesundheit wäre er kein ernstzunehmender Gegner für einen dieser Krieger gewesen. Und jetzt konnte er sich gerade auf den Füßen halten.
Sie schubsten ihn mehr, als dass sie ihn führten. Er bemerkte, dass er zu einem großen Zelt gebracht wurde.
Schwarzfausts Zelt.
„Schicksalshammer ist jetzt an der Macht, Gul’dan“, sagte Cho’gall leise. Er ging neben ihm, hielt sich aber außer Reichweite der Krieger. „Als du ohnmächtig warst, hat er den Schattenrat angegriffen und die meisten seiner Mitglieder getötet! Nur du, ich und ein paar der niederen Hexenmeister sind übrig geblieben!“
Gul’dan schüttelte den Kopf und versuchte, einen klaren Gedanken zu fassen. Er fühlte sich immer noch benommen.
Nach allem, was Cho’gall erzählt hatte, war dies ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt, um das Bewusstsein zu verlieren. Doch was der Oger ihm erzählt hatte, verwirrte ihn. Schwarzfaust getötet? Der Schattenrat zerstört?
Das war Wahnsinn!
„Wer war das?“, wollte er erneut wissen. Dabei wandte er sein Gesicht Cho’gall hinter den breiten Schultern der Krieger zu. „Wer hat das getan?“
Aber Cho’gall war zurückgefallen. Auf seinen beiden Gesichtern spiegelten sich Furcht und Bestürzung.
Gul’dan sah wieder nach vorne. Eine kräftige Gestalt trat vor. Und als er den imposanten Krieger in seiner schwarzen Plattenrüstung sah, der den gigantischen Kriegshammer mit spielerischer Leichtigkeit in Händen hielt, verstand Gul’dan endlich.
Schicksalshammer.
„Ah, du bist wach.“ Schicksalshammer spie die Worte förmlich aus.
Die Krieger ließen Gul’dan sofort los. Doch der Orc-Hexenmeister konnte sich nicht auf den Beinen halten und fiel hin. Er lag auf den Knien, schaute auf und schluckte angesichts der nackten Wut und des Hasses im Gesicht seines Gegenübers.
„Ich …“, begann Gul’dan.
Doch Schicksalshammer unterbrach ihn. Mit der Rückhand schlug er so fest zu, dass Gul’dan einige Meter durch die Luft geschleudert wurde und in einem Müllhaufen landete.
„Ruhe!“, knurrte der neue Anführer der Horde. „Ich hatte dir noch nicht erlaubt zu sprechen!“ Er kam näher und hob Gul’dans Kinn mit der Spitze seiner fürchterlichen Waffe an. „Ich weiß, was du getan hast, Gul’dan. Ich weiß, wie du Schwarzfaust kontrolliert hast. Du und dein Schattenrat.“ Er lachte heiser, erfüllt von Bitterkeit und Abscheu. „Oh ja, ich weiß davon. Aber deine Hexer werden dir jetzt nicht helfen. Die meisten sind tot. Und die wenigen, die es noch gibt, bleiben angekettet und unter Beobachtung.“ Er beugte sich vor. „ Ich befehlige die Horde jetzt, Gul’dan. Nicht du, nicht deine Hexenmeister – sondern ich, Orgrim Schicksalshammer! Es wird keine Ehrlosigkeit mehr geben! Keinen Verrat mehr! Keine Hinterlist und keine Lügen!“ Schicksalshammer erhob sich zu seiner vollen beeindruckenden Größe und überragte Gul’dan. „Durotan ist wegen dir gestorben, aber er ist der Letzte, der deinen Intrigen zum Opfer fiel. Und er wird gerächt werden! Du wirst dein Volk nie wieder aus den Schatten heraus regieren! Du wirst unser Schicksal nie mehr lenken und uns zu deinem alleinigen Vorteil missbrauchen. Unser Volk wird frei von dir sein!“
Gul’dan zitterte und dachte nach. Er hatte gewusst, dass Schicksalshammer zu einem Problem werden konnte. Der selbstbewusste Orckrieger war zu intelligent, zu ehrenhaft und nobel, um leicht beeinflusst oder gar kontrolliert zu werden. Er war Schwarzfausts Stellvertreter gewesen, die rechte Hand des einstmals mächtigen Anführers des Schwarzfelsklans, den Gul’dan zu seiner Marionette für die Herrschaft über die Horde auserkoren hatte.
Schwarzfaust war ein starker Krieger gewesen, hielt sich jedoch für cleverer, als er war – und konnte deshalb leicht kontrolliert werden. Gul’dan und der Schattenrat hatten die wahre Macht in Händen gehalten. Und Gul’dan seinerseits kontrollierte den Rat ebenso leicht wie den Kriegshäuptling.
Aber über Schicksalshammer hatte er keine Gewalt gehabt. Dieser hatte ihm die Gefolgschaft verweigert und seinen eigenen Weg beschritten, Schicksalshammer war nur von der Loyalität zu seinem Volk getrieben. Er wusste natürlich, was hinter den Kulissen geschah. Kannte die Korruption. Und als er schließlich genug gesehen hatte … als er es nicht mehr ertragen konnte … hatte er handeln müssen.
Schicksalshammer hatte den Augenblick klug gewählt. Nachdem Gul’dan nicht mehr im Weg stand, war Schwarzfaust verwundbar. Wie er dem Schattenrat auf die Schliche gekommen war, war unklar, aber offensichtlich war er erfolgreich gewesen und die meisten Mitglieder waren eliminiert worden. Es blieben nur Gul’dan, Cho’gall und ein paar andere übrig.
Und jetzt stand er mit erhobenem Hammer vor Gul’dan, bereit, ihn ebenfalls zu vernichten.
„Warte!“, schrie Gul’dan. Er hatte beide Hände instinktiv erhoben, um sein Gesicht zu schützen. „Bitte, ich flehe dich an!“
Schicksalshammer wartete. „Du, der mächtige Gul’dan, bettelst? Sehr gut, Hündchen, winsle! Bettle um dein Leben!“ Er hielt den Hammer immer noch erhoben.
„Ich …“ Gul’dan hasste ihn, hasste ihn mit einer Leidenschaft, die er niemals für etwas anderes als die pure Macht aufgebracht hatte. Aber er wusste, was er zu tun hatte. Schicksalshammer hasste ihn ebenso, weil er Schuld am Tod seines alten Freundes Durotan trug. Und weil er ihr Volk von friedfertigen Jägern in rasende Monster verwandelt hatte.
Wenn er jetzt auch nur die kleinste Entschuldigung vorbrachte, würde der Hammer seinen Schädel zerschmettern und danach mit Blut, Haar und Hirn überzogen sein!
Soweit durfte er es nicht kommen lassen.
„Ich beuge mich deiner Macht, Orgrim Schicksalshammer“, rang er sich schließlich ab. Jedes Wort erklang klar und deutlich. Alle Umstehenden konnten es hören. „Ich erkenne dich als Kriegshäuptling der Horde an, und ich unterwerfe mich dir. Ich werde dir in allen Belangen gehorchen.“
Schicksalshammer grunzte. „Du hast niemals zuvor Loyalität bewiesen“, erwiderte er scharf. „Warum sollte ich dir glauben?“
„Weil du mich brauchst“, antwortete Gul’dan. Dabei hob er den Kopf und hielt dem Blick des Kriegshäuptlings stand. „Du hast meinen Schattenrat getötet und deine Macht über die Horde gestärkt. Und so soll es sein. Schwarzfaust war nicht stark genug, um uns zu führen. Du bist es, und deshalb brauchst du den Rat nicht.“ Er schürzte die Lippen. „Aber du brauchst Hexenmeister. Du brauchst unsere Magie – weil die Menschen ihre eigenen Zauberer besitzen. Ohne uns hast du keine Chance gegen sie.“ Er schüttelte den Kopf „Und du hast nur noch wenige Hexenmeister übrig. Mich, Cho’gall und eine Handvoll Neophyten. Ich bin zu nützlich, um mich nur aus Rachegelüsten heraus zu töten.“
Schicksalshammer knurrte, aber er senkte den Hammer. Einen Moment lang sagte er gar nichts und blickte Gul’dan nur an. Seine grauen Augen füllten sich mit Hass.
Doch schließlich nickte er. „Du hast Recht“, räumte er ein, obwohl es ihn offensichtlich enorme Selbstüberwindung kostete. „Und ich werde die Bedürfnisse der Horde über meine eigenen stellen.“ Er entblößte seine Zähne. „Ich erlaube dir zu leben, Gul’dan. Dir und den übrigen Hexenmeistern. Doch nur solange ihr euch als nützlich erweist.“
„Oh, wir werden nützlich sein“, versicherte ihm Gul’dan und verbeugte sich tief. Sein Verstand lief bereits auf Hochtouren. „Ich werde dir Kreaturen erschaffen, die du niemals zuvor gesehen hast, mächtiger Schicksalshammer. Krieger, die nur dir allein gehören. Mit ihrer Macht und unserer Magie werden wir die Zauberer dieser Welt zermalmen, so wie die Horde die Krieger des Feindes zerstampfen wird.“
Schicksalshammer nickte. Seine gefletschten Zähne wichen einem nachdenklichen Stirnrunzeln. „Sehr gut“, sagte er schließlich. „Du hast mir Krieger versprochen, die den Magiern der Menschen Paroli bieten. An diesem Versprechen werde ich dich messen.“ Damit wandte er sich von ihm ab. Die Orckrieger folgten ihm. Der Hexenmeister meinte, sie lachen zu hören, als sie gingen.
Gul’dan blieb zurück. Cho’gall befand sich in seiner Nähe.
Verdammt sei Schicksalshammer! dachte Gul’dan, als er sah, wie der Kriegshäuptling zurück in sein Zelt ging. Und verdammt sei dieser menschliche Zauberer!
Gul’dan schüttelte den Kopf. Vielleicht hätte er auch sich selbst verfluchen müssen – wegen seiner Ungeduld. Denn die hatte ihn in Medivhs Geist getrieben, wo er nach den Informationen suchte, die der Magier ihm versprochen, jedoch bislang vorenthalten hatte.
Gul’dans Pech war gewesen, dass er sich in Medivhs Geist befunden hatte, als der Mensch gestorben war. Sein eigener Verstand war von diesem Eindruck überwältigt und gefangen gewesen, unfähig, in seinen Körper zurückzukehren. Er hatte die Welt um sich herum nicht wahrnehmen können. Und so hatte Schicksalshammer die Gelegenheit beim Schopf gepackt, die Macht zu ergreifen.
Doch jetzt war er wieder wach und handlungsfähig, konnte seine Pläne ausführen.
Immerhin war dieser Akt der Verzweiflung, mit dem er sich das Leben gerettet hatte, nicht umsonst gewesen. Gul’dan hatte die Information, die er brauchte. Und schon bald würde er Schicksalshammer oder die Horde nicht mehr länger brauchen. Schon bald würde er auch ganz ohne sie an die Macht gelangen und sich dort behaupten!
„Ruf die anderen zusammen“, befahl er Cho’gall, während er aufstand, sich streckte und in sich hineinlauschte. Er war schwach, aber er würde es schaffen. Er hatte keine Zeit zu verlieren. „Ich werde sie zu einem Klan zusammenschmieden, der mich vor Schicksalshammers Zorn beschützen wird. Sie werden Sturmrächer sein – und der Horde beweisen, was wir Hexenmeister zu erreichen imstande sind. Bis selbst Schicksalshammer unseren Wert nicht mehr bestreiten kann.“
Cho’gall führte den Schattenhammerklan an, der besessen war vom drohenden Ende der Welt – aber furchtlose Kämpfer vorzuweisen hatte.
„Es gibt viel zu tun!“
KAPITEL EINS
Gegen seinen Willen war Lothar beeindruckt.
Sturmwind war eine ebenso gewaltige wie beeindruckende Stadt gewesen, voller Türme und Terrassen, gebaut aus massivem Stein, der Wind und Wetter trotzte. Aber auf ihre ganz eigene Art war die Hauptstadt von Lordaeron vergleichbar schön.
Nicht, dass sie Sturmwind sonderlich ähnlich gesehen hätte. Sie war zum Beispiel nicht so groß. Doch was ihr an Größe mangelte, glich sie mit Eleganz aus. Sie lag am nördlichen Ufer des Lordameresees und leuchtete in Weiß und Silber. Sie funkelte nicht in der Art, wie Sturmwind es tat, vielmehr schien sie zu leuchten, als würde die Sonne aus den anmutigen Gebäuden heraus scheinen und nicht etwa vom Himmel herab. Sie war ruhig und friedlich, strahlte fast etwas Heiliges aus.
„Ein machtvoller Ort“, sagte Khadgar und bestärkte Lothar damit in seinem eigenen Empfinden. „Obwohl ich ein wenig Wärme bevorzuge.“ Er blickte hinter sich zum südlichen Rand des Sees, wo sich eine zweite Stadt erhob. Ihre Umrisse waren denen der Hauptstadt ähnlich, doch diese Spiegelstadt mutete um einiges exotischer an. Ihre Mauern und Türme leuchteten violett und in warmen Farben. „Das ist Dalaran“, erklärte er. „Dort befindet sich der Kirin Tor und seine Zauberer – meine Heimat, bevor ich zu Medivh geschickt wurde.“
„Vielleicht ist soviel Zeit, damit du nach Hause kannst, wenigstens kurz“, schlug Lothar vor. „Aber jetzt müssen wir uns auf die Hauptstadt konzentrieren.“ Er betrachtete erneut die leuchtende Stadt. „Lasst uns hoffen, dass sie so ehrenhaft in ihren Ansichten sind, wie ihre Gebäude es vermuten lassen.“
Er trieb sein Pferd in einen leichten Galopp und ritt aus dem majestätischen Silberwald. Varian und der Magier befanden sich direkt hinter ihm. Die anderen Männer folgten in den Wagen.
Zwei Stunden später erreichten sie das Haupttor. Wächter standen am Eingang, obwohl die Doppeltore offen waren. Genügend Platz für zwei oder gar drei Wagen nebeneinander.
Die Wachen hatten sie natürlich längst aus der Ferne bemerkt. Der Wächter, der vortrat, trug einen roten Umhang über seinem polierten Brustharnisch. Goldene Verzierungen befanden sich an Rüstung und Helm. Sein Benehmen war höflich, fast schon respektvoll. Aber Lothar fiel sofort auf, dass der Mann nur ein paar Schritte von ihnen entfernt stehen blieb, genau in Reichweite seines Schwertes.
Er zwang sich, entspannt zu bleiben. Hier war nicht Sturmwind. Diese Leute waren keine erfahrenen Soldaten, gestählt durch ständige Gefechte. Sie hatten noch nie um ihr Leben kämpfen müssen.
Bis jetzt jedenfalls.
„Tretet ein und seid willkommen“, sagte der Hauptmann der Wache und verneigte sich. „Marcus Rotpfad hat uns Euer Kommen angekündigt und von Eurer Notlage berichtet. Der König befindet sich im Thronsaal.“
„Seid bedankt“, antwortete Khadgar nickend. „Kommt, Lothar“, ergänzte er und trieb sein Pferd an. „Ich kenne den Weg.“
Sie ritten durch die Stadt und kamen in den breiten Straßen gut zurecht. Khadgar schien sich tatsächlich auszukennen und wurde nie langsamer, um nach dem Weg zu fragen.
Schließlich erreichten sie den Palast. Dort stiegen sie ab und gaben die Pferde in die Obhut einiger ihrer Begleiter, die sich darum kümmern würden.
Lothar und Prinz Varian stiegen bereits die breite Palasttreppe hinauf, doch Khadgar war dicht dahinter und holte schnell auf.
Sie schritten durch die äußeren Palasttüren und erreichten einen breiten Hof. Logen standen an den Seiten. Momentan waren sie leer, aber Lothar vermutete, dass sie während der hier stattfindenden Feste wahrscheinlich aus allen Nähten platzten.
Auf der anderen Seite der Halle endete eine kleine Treppenflucht vor einer weiteren Reihe von Türen, die in den Thronsaal führten – ein beeindruckender Raum.
Das Deckengewölbe war so hoch, dass es sich in den Schatten verlor. Der Raum selbst war rund und wurde getragen von Bögen und Säulen. Goldenes Sonnenlicht schien durch das Buntglasfenster, das in der Deckenmitte eingesetzt war. Dabei entstanden komplizierte Muster auf dem Boden, ineinander verschachtelte Kreise, jeder anders, wobei ein Dreieck in der Mitte den innersten Ring überlappte.
Und im Zentrum prangte das goldene Siegel von Lordaeron.
Es gab mehrere hohe Balkone, die, wie Lothar glaubte, den Adeligen vorbehalten waren. Aber sie hatten auch einen strategischen Wert. Ein paar Wachen reichten aus, um von dort mit Bögen jederzeit jeden Punkt unter Feuer nehmen zu können.
Unmittelbar darunter befand sich eine kreisrunde Empore, von der konzentrisch angeordnete Stufen bis zum Thron hinauf führten. Der Thron selbst war aus glitzernden Steinen erbaut. Darauf saß ein Mann, groß und kräftig, dessen blondes Haar von leichtem Grau durchwirkt war. Seine Rüstung strahlte, die Krone auf seinem Kopf hingegen wirkte mehr wie ein Stachelhelm.
Ein wahrer König, das wusste Lothar sofort. Jemand wie Llane, der nicht zögerte, für sein Volk zu kämpfen. Seine Hoffnung wuchs bei diesem Gedanken.
Es waren auch andere Leute anwesend, Stadtmenschen und Arbeiter, sogar Bauern. Alle hielten sich in gebührendem Abstand zur Empore. Viele hatten etwas dabei, Pergamente, sogar Nahrungsmittel, doch sie alle entfernten sich geräuschlos, als Lothar und Khadgar sich näherten.
„Ja?“, rief der Mann auf dem Thron. „Wer seid ihr und was wollt ihr von mir?“
Selbst von hier aus konnte Lothar die merkwürdig gefärbten Augen des Königs erkennen. In ihnen waren blau und grün vermischt. Sie blickten scharf, sodass Lothars Hoffnung weiter anstieg. Hier stand ein Mann, der klar sehen konnte.
„Euer Majestät“, antwortete Lothar, und seine tiefe Stimme war überall im Raum zu verstehen. Er blieb mehrere Schritte vor dem Podest stehen und verneigte sich. „Ich bin Anduin Lothar, ein Ritter aus Sturmwind. Dies ist mein Begleiter Khadgar von Dalaran.“ Er konnte Gemurmel aus der Menge hinter sich hören. „Und dies …“, dabei drehte er sich so, dass der König Varian sehen konnte, der hinter ihm gestanden hatte, entnervt von der Menschenmenge und den merkwürdigen Staatssymbolen, „ … ist Prinz Varian Wrynn, Erbe des Thrones von Sturmwind.“
Das Murmeln schwoll an zu lautem Raunen, als die Leute begriffen, dass der Jüngling ein echter Monarch war. Aber Lothar ignorierte sie und konzentrierte sich nur auf den König. „Wir müssen mit Euch sprechen, Majestät. Es ist äußerst wichtig und von großer Bedeutung.“
„Selbstverständlich.“ Terenas erhob sich bereits von seinem Thron und kam auf sie zu. „Lasst uns allein“, bat er die Umstehenden.
Obwohl ein Befehl, war er höflich formuliert. Die Leute gehorchten, und bald blieben nur eine Handvoll Adliger und Wachen zurück. Die Männer, die Lothar begleitet hatten, traten ebenso zur Seite, sodass Lothar, Khadgar und Varian allein waren, als Terenas die Distanz zwischen ihnen vollends überwand.
„Euer Majestät“, grüßte Terenas Varian und verneigte sich wie vor einem Ebenbürtigen.
„Euer Majestät“, antwortete Varian, dem es gelang, den ersten Schreck zu überwinden.
„Wir waren sehr betrübt, vom Tod Eures Vaters zu hören“, fuhr Terenas freundlich fort. „König Llane war ein guter Mann, und wir durften ihn einen Freund und Verbündeten nennen. Wisset, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun werden, um Euch Euren Thron zurückzuerobern.“
„Ich danke Euch“, sagte Varian, wobei seine Unterlippe ein wenig bebte.
„Nun kommt und setzt Euch und erzählt mir, was geschehen ist“, forderte Terenas ihn auf und wies auf die Stufen zur Empore. Er setzte sich auf die oberste und winkte Varian, neben ihm Platz zu nehmen. „Ich habe Sturmwind selbst gesehen und bewundere die Stärke und Schönheit dieser Stadt. Was konnte solch eine Bastion zerstören?“
„Die Horde“, sagte Khadgar und sprach zum ersten Mal, seit sie den Thronsaal betreten hatten.
Terenas wandte sich ihm zu. Lothar sah, wie sich die Brauen des Königs zusammenzogen. „Die Horde hat das angerichtet.“
„Und was ist diese Horde?“, wollte Terenas wissen und wandte sich zuerst an Varian, dann an Lothar.
„Es ist eine Armee, aber eigentlich mehr als das“, antwortete Lothar. „Es ist eine Vielzahl von Truppen, mehr, als man zählen kann. Genug, um das Land von Küste zu Küste zu überziehen.“
„Und wer kommandiert diese unglaubliche Zahl von Männern?“, fragte Terenas.
„Es handelt sich nicht um Männer oder überhaupt Menschen. Es sind Orcs“, korrigierte ihn Lothar.
Der König blickte verwirrt, deshalb erläuterte Lothar: „Es ist eine neue Rasse, eine, die nicht von dieser Welt stammt. Sie sind so groß wie wir, aber kräftiger gebaut. Sie haben grüne Haut, leuchtend rote Augen und riesige Hauer, die aus ihrer Unterlippe wachsen.“
Ein Adeliger schnaubte im Hintergrund. Lothar drehte sich um. „Zweifelt Ihr an meinen Worten?“, rief er. Er schaute jeden der Balkone an, um herauszufinden, wer gelacht hatte. „Ihr denkt, ich lüge?“ Er schlug mit seiner Faust auf die Rüstung, dort, wo eine der größeren Beulen sie zierte. „Das stammt vom Kriegshammer eines Orcs!“ Er schlug auf eine andere Stelle. „Und das von einem Orc mit einer Kriegsaxt!“ Er wies auf einen Einschnitt im Unterarm. „Hier hat ein Hauer gewütet, als mich eins der Monster ansprang und zu nahe kam, um es mit der Klinge zu bekämpfen! Diese üblen Kreaturen haben mein Land vernichtet, meine Heimat, mein Volk! Wenn Ihr an mir zweifelt, dann kommt herunter und sagt mir das ins Gesicht! Ich zeige Euch dann, was für eine Sorte Mann ich bin und was denen widerfährt, die mich der Lüge bezichtigen!“
„Genug!“ Terenas’ Ruf unterdrückte jede mögliche Antwort. Die Wut war aus seiner Stimme herauszuhören. Aber als er sich an Lothar wandte, erkannte der, dass die Wut des Königs sich nicht gegen ihn richtete. „Genug“, wiederholte der König noch einmal und versicherte dann leiser: „Niemand hier zweifelt an Eurem Wort.“ Ein ernster Blick bedeutete seinen Adeligen, dass er keinen Widerspruch duldete. „Ich kenne Eure Ehre und Eure Loyalität. Ich traue Eurem Wort, auch wenn diese Kreaturen uns merkwürdig erscheinen.“ Er drehte sich um und nickte Khadgar zu. „Mit einem Zauberer von Dalaran, der für Euch bürgt, können wir Eure Aussage gar nicht anzweifeln. Genauso wenig wie die Absichten einer Rasse, die uns bislang unbekannt war …“
„Ich danke Euch, König Terenas“, erwiderte Lothar förmlich und zügelte seinen Ärger. Er wusste nicht, was er als nächstes tun sollte.
Glücklicherweise wusste es Terenas. „Ich werde die Herrscher der Nachbarreiche zusammenrufen“, kündigte er an. „Diese Ereignisse gehen uns alle etwas an.“ Er wandte sich wieder an Varian. „Euer Majestät, ich biete Euch mein Heim und meinen Schutz an, solange Ihr beides benötigt“, sagte er so laut, dass jeder es hören konnte. „Wenn Ihr bereit seid, wisset, dass Lordaeron Euch dabei unterstützen wird, Euer Königreich zurückzufordern.“
Lothar nickte. „Euer Majestät, Ihr seid sehr großzügig“, sagte er im Namen Varians. „Und ich kann mir keinen sichereren oder besseren Ort vorstellen, an dem unser Prinz bis zu seiner Volljährigkeit leben kann, als hier, in Eurer Hauptstadt. Wir sind aber nicht nur gekommen, um Zuflucht zu finden. Wir wollen Euch auch warnen.“ Er stand hochaufgerichtet da, seine Stimme dröhnte durch den Raum und seine Augen fixierten den König von Lordaeron. „Denn die Horde wird sich nicht mit Sturmwind begnügen. Sie wollen die ganze Welt erobern! Und sie haben die Macht und die Zahl an Kriegern, um ihren Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Es fehlt ihnen auch nicht an magischer Unterstützung. Wenn sie erst mit meiner Heimat fertig sind …“ Seine Stimme klang jetzt noch tiefer und rauer, doch er zwang sich weiterzureden, „ … werden sie einen Weg finden, den Ozean zu überqueren. Und dann kommen sie hierher.“
„Ihr meint, wir sollen uns auf einen Krieg vorbereiten“, erwiderte Terenas ruhig.
Es war keine Frage, aber Lothar antwortete trotzdem. „Ja.“ Er sah sich unter den versammelten Männern um. „Ein Krieg, bei dem es um das nackte Überleben unserer gesamten Rasse geht.“
KAPITEL ZWEI
Orgrim Schicksalshammer, Anführer des Schwarzfelsklans und Kriegshäuptling der Horde, beobachtete die Geschehnisse um sich herum. Er stand fast in der Mitte von Sturmwind, während seine Krieger die einst großartige Stadt in Schutt und Asche legten. Wohin er auch blickte, herrschten Tod und Zerstörung. Obwohl aus Stein gemauert, brannten die Gebäude. Leichen und Schutt verschandelten die Straßen. Blut floss über das Pflaster und sammelte sich hier und da. Ständige Schreie verrieten, dass es noch Überlebende unter den einstigen Bewohnern gab, die nun gefoltert wurden.
Das war auch gut so. Schicksalshammer nickte. Sturmwind war eine imposante Stadt gewesen – und ein gewaltiges Hindernis. Eine Zeit lang war er nicht sicher gewesen, ob sie die mächtigen Mauern stürzen und ihre unerschütterlichen Verteidiger würden überwinden können. Obwohl ihnen die Horde zahlenmäßig weit überlegen war, hatten die Menschen mit unglaublicher Entschlossenheit und enormem Geschick gekämpft. Und dafür respektierte Schicksalshammer sie. Sie waren würdige Gegner gewesen.
Aber sie hatten verloren. Wie letztlich alle vor der Macht seines Volkes kapitulieren mussten.
Die Stadt war dem Erdboden gleich gemacht worden, ihre einstigen Verteidiger waren entweder tot oder geflohen. Das Land gehörte jetzt der Horde. Dieses reiche, fruchtbare Land, das so stark ihrer Heimat vor der Katastrophe glich.
Bevor Gul’dan sie zerstört hatte.
Schicksalshammer wurde zornig, und er umfasste seinen berühmten Hammer fester.
Gul’dan! Der verräterische Schamane, der zum Hexenmeister geworden war, hatte mehr Ärger verursacht, als er wert war. Und nur die Öffnung des Spalts in diese Welt hatte ihn davor bewahrt, von seinen zornigen Klanbrüdern zerrissen zu werden.
Aber irgendwie hatte es dieser Intrigant geschafft, selbst das zu seinem Vorteil zu nutzen. Schwarzfaust war unter seiner Kontrolle gewesen.
Schicksalshammer hatte seinen ehemaligen Häuptling über Jahre beobachtet und wusste, dass er schlauer gewesen war, als viele es dachten. Aber er war nicht schlau genug gewesen. Indem er Schwarzfausts Ego schmeichelte, hatte Gul’dan ihn beeinflusst und letztlich vollkommen kontrolliert. Von ihm stammte die Idee, die Klans zur Horde zu vereinen. Dessen war sich Schicksalshammer sicher.
Und Gul’dans Schattenrat hatte hinter den Kulissen die Fäden gezogen und Schwarzfaust derart manipuliert, dass er nicht einmal begriffen hatte, dass er lediglich Befehlen folgte.
Schicksalshammer grinste. Das zumindest war jetzt vorbei, auch wenn er Schwarzfaust nur ungern getötet hatte. Schwarzfaust war der Stellvertreter des Kriegshäuptlings gewesen. Er hatte geschworen, mit Schicksalshammer zu kämpfen, nicht gegen ihn. Aber die Tradition erlaubte es einem Krieger, seinen Häuptling herauszufordern. Schicksalshammer hatte sich schließlich gezwungen gesehen, diesen Weg zu gehen.
Er hatte gewonnen, weil er es musste. Mit einem Hieb hatte er Schwarzfausts Schädel zerschmettert und die Führung seines Klans und der Horde übernommen.
Danach hatte er sich noch um den Schattenrat kümmern müssen. Und das war ihm eine Freude gewesen.
Er grinste bei dem Gedanken daran. Wenige Orcs hatten überhaupt Kenntnis von der Existenz des Schattenrats gehabt. Und noch weniger hätten zu sagen vermocht, wer ihm angehörte und wo seine Mitglieder tagten.
Aber Schicksalshammer wusste, wen er fragen musste. Die Halborcfrau Garona war gefoltert worden, bis sie den Tagungsort des Schattenrats preisgab. Zweifellos machte sie der Anteil an fremdem Blut in ihren Adern zu schwach, um der Folter zu widerstehen.
Die Gesichter der Hexenmeister zu sehen, als er in ihre Versammlung platzte, wäre nicht mit Gold aufzuwiegen gewesen. Und erst das Gefühl, während er sie einen nach dem anderen erschlug … Schicksalshammer hatte die Macht des Schattenrats an jenem Tag gebrochen. Niemals würde er wie Schwarzfaust kontrolliert werden. Er würde sich seine eigenen Kämpfe aussuchen und seine eigenen Pläne schmieden, die nicht dazu dienten, irgendjemandes Macht zu vergrößern … sondern das Überleben seines Volkes zu sichern.
Als hätte er sie per Gedankenbefehl herbeizitiert, erblickte Schicksalshammer in diesem Moment zwei Gestalten, die auf ihn zukamen. Die eine war kleiner als ein Durchschnittsorc, die andere weitaus größer und hatte einen merkwürdigen Umriss.
Schicksalshammer erkannte die beiden sofort, und seine Lippen wölbten sich höhnisch um seine Hauer.
„Hast du deine Aufgabe erfüllt?“, fragte er, als Gul’dan und sein Lakai Cho’gall näher kamen. Er behielt den Hexenmeister im Auge, während er seinen massigen Untergebenen ignorierte.
Schicksalshammer hatte wie die meisten Orcs sein Leben lang gegen Oger gekämpft. Er war angewidert gewesen, als Schwarzfaust ein Bündnis mit diesen Monstern einging – obwohl er zugeben musste, dass sie sich im Kampf bewährt hatten. Aber er mochte sie immer noch nicht, geschweige denn, dass er ihnen traute.
Cho’gall war zudem noch übler als alle anderen. Er war einer der seltenen zweiköpfigen Oger und wesentlich intelligenter als seine brutalen Artgenossen.
Cho’gall war ein echter Magier. Der Gedanke an einen Oger mit derartiger Macht erfüllte Schicksalshammer mit Schrecken. Außerdem war Cho’gall auch noch der Anführer des Schattenhammerklans geworden und legte denselben Fanatismus an den Tag wie seine Gefolgsleute. Dadurch wurde der zweiköpfige Oger zur besonderen Gefahr.
Schicksalshammer ließ sich seine Vorbehalte nicht anmerken – außer vielleicht, dass er seinen Hammer fester umfasste, sobald der Ogermagier in der Nähe war.
„Nein, habe ich nicht, werter Schicksalshammer“, antwortete Gul’dan und blieb neben ihm stehen. Der Hexenmeister wirkte dürr, fast ausgezehrt, was angesichts seines monatelangen Schlafs jedoch kein Wunder war. „Aber ich habe die allerletzten Nachwirkungen meines langen Schlafs abgelegt. Und ich bringe dir wichtige Nachrichten, die ich aus dieser Ruhephase gezogen habe.“
„Oh? Der Schlaf hat dich weiser gemacht?“
„Er hat mir einen Weg zu großer Macht gewiesen“, erklärte Gul’dan mit gierigem Blick.
Schicksalshammer wusste, dass es keine normale Gier war, keine nach Frauen, gutem Essen oder Reichtum etwa. Nein, Gul’dan sann nur nach wahrer Macht und war bereit, alles zu tun, um sie zu erlangen. Seine Taten auf ihrer Heimatwelt hatten das allzu deutlich bewiesen.
„Macht für dich – oder für die Horde?“, fragte Schicksalshammer.
„Für beide“, antwortete der Hexenmeister. Seine Stimme wurde zu einem durchtriebenen Flüstern. „Ich habe einen Ort gesehen – alt, jenseits aller Vorstellungskraft. Älter selbst als der Heilige Berg auf unserer Welt. Er liegt tief im Ozean verborgen. Und in ihm wohnt eine Kraft, die diese Welt verändern kann. Wir sollten sie für uns gewinnen – und niemand wird sich uns je wieder entgegenstellen können!“
„Niemand kann sich uns derzeit entgegenstellen“, knurrte Schicksalshammer. „Und ich ziehe die ehrliche Macht eines Hammers und einer Axt der verderbten Zauberei vor, die du entdeckt hast. Schau doch nur, was deine Intrigen unserer Welt und unserem Volk angetan haben! Du wirst sie nicht wieder zerstören, kaum dass wir begonnen haben zu erobern!“
„Es geht um etwas viel Größeres als deine Wünsche“, blaffte der Hexenmeister. Sein Temperament ließ ihn jede Vortäuschung von Unterwerfung vergessen. „Mein Schicksal liegt unter dem Wasser, und du kannst nichts tun, um mich daran zu hindern! Diese Horde ist nur der erste Schritt auf dem Weg unseres Volks. Und ich werde es zum Ziel führen, nicht du!“
„Vorsicht, Hexenmeister“, antwortete Schicksalshammer. Er hob seine Waffe und stieß Gul’dan damit leicht gegen die Wange. „Denk daran, was dem letzten Schattenrat zugestoßen ist. Ich kann deinen Schädel wie eine überreife Frucht zerschmettern. Wo liegt deine Bestimmung dann?“ Er schaute den sich aufrichtenden Cho’gall finster an. „Und glaube ja nicht, dass dich diese Abnormität schützen wird“, zischte er, hob den Hammernoch höher und lachte, als der Ogermagier einen Schritt zurückwich. Angst zuckte über seine beiden Gesichter. „Ich habe schon Oger vor dir erschlagen, und auch ein paar Gronns. Ich kann und werde das wieder tun!“ Er beugte sich weit vor. „Deine Absichten sind nicht länger von Interesse. Nur die Horde zählt.“
Einen Moment lang sah er Wut in Gul’dans Blick aufflackern und hielt es für möglich, dass der Hexenmeister nicht nachgeben würde – und ein Teil von ihm freute sich darauf.
Schicksalshammer hatte stets die Schamanen seines Volkes geachtet. Aber diese Hexenmeister waren etwas ganz anderes. Ihre Kräfte stammten nicht von den Elementen oder den Geistern der Ahnen, sondern aus einer anderen, aus einer schrecklichen Quelle. Magie hatte sein Volk von braun nach grün gefärbt und seine Heimatwelt zerstört. Deshalb waren sie gezwungen gewesen, hierher zu kommen und ums Überleben zu kämpfen.
Und Gul’dan war ihr Anführer gewesen, ihr Anstifter – der mächtigste, durchtriebenste und selbstsüchtigste von allen.
Schicksalshammer kannte den Wert der Hexenmeister für die Horde. Dennoch war er sicher, dass sie ohne diese Kerle weit besser dran gewesen wären.