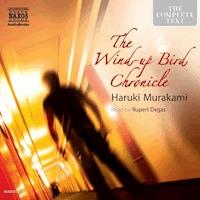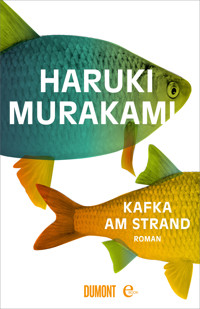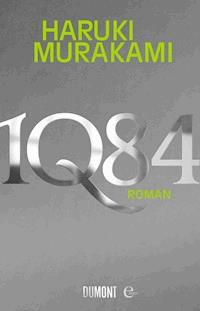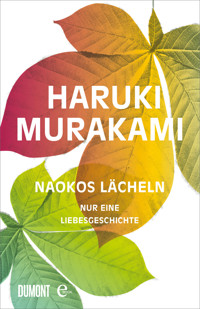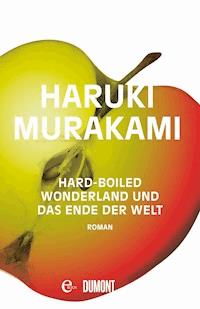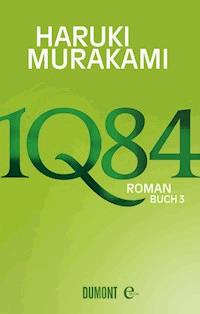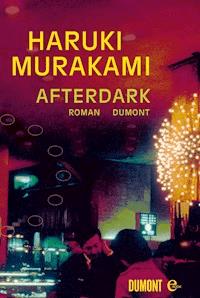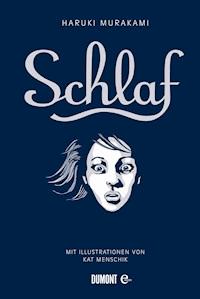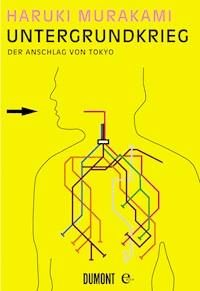7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
»Aufrichtig über das Laufen und aufrichtig über mich zu schreiben, ist nahezu das Gleiche« Haruki Murakami Zwei Leidenschaften bestimmen Haruki Murakamis Leben: das Schreiben und das Laufen. Eines verbindet beide Tätigkeiten – ihre Intensität. Für Haruki Murakami bedeutet das Laufen ein zweites Leben. Hier holt er sich Inspiration, sammelt Kraft und trainiert die Zähigkeit, die er zum Schreiben braucht. Der Entschluss, Romanautor zu werden, kam ihm beim Sport. Das Sitzen am Schreibtisch gleicht er durch Laufen aus. Nach langsamen ersten Schritten hat er sich in den vergangenen Jahrzehnten professionalisiert: Längst sind zu den jährlichen Marathons auch Triathlon und Ultralanglauf über 100 Kilometern hinzugekommen. Haruki Murakami erzählt eindringlich und komisch von seinen Frustrationen, vom Kampf gegen das stets lauernde Versagen und davon, wie er es überwindet. Denn für ihn bleibt das Laufen ein großes, wortloses Glück. Für seinen Grabstein wünscht er sich die Inschrift: »Haruki Murakami 1949-20**, Schriftsteller (und Läufer) – Wenigstens ist er nie gegangen.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 191
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
HARUKI MURAKAMI
WOVON ICH REDE, WENN ICH VOM LAUFEN REDE
AUS DEM JAPANISCHEN
DIE ORIGINALAUSGABE ERSCHIEN 2007 UNTER DEM TITEL HASHIRUKOTO NI TSUITE KATARUTOKI NI BOKU NO KATARUKOTO BEI BUNGEI SHUNJU, TOKYO. © 2007 HARUKI MURAKAMI E-BOOK 2011 © 2008 FÜR DIE DEUTSCHE AUSGABE: DUMONT BUCHVERLAG, KÖLN
Vorwort
LEIDEN IST EINE OPTION
Eine weise Redensart besagt: Ein echter Gentleman spricht niemals über die Frauen, von denen er sich getrennt hat, oder darüber, wie viel Steuern er zahlt. Nein, eine solche Redensart existiert nicht. Pardon, ich habe sie gerade erfunden. Gäbe es sie, müsste es ein weiteres Kriterium für einen Gentleman sein, über das zu schweigen, was er für seine Gesundheit tut, und sich nicht darüber zu verbreiten, wie er sich fit hält. Zumindest sehe ich das so.
Wie Sie alle wissen, bin ich kein Gentleman und müsste mir deshalb keine Gedanken machen, und doch habe ich gewisse Hemmungen, dieses Buch zu schreiben. Womöglich klingt es ein bisschen nach einer Ausrede, aber dies ist ein Buch über meine Erfahrungen als Läufer und ganz gewiss kein Fitness-Ratgeber, in dem ich meine Leser auffordere: »Tun Sie etwas für Ihre Gesundheit und laufen Sie täglich!« Stattdessen habe ich meine Gedanken darüber gesammelt, was Laufen für mich persönlich bedeutet. Es ist einfach ein Buch, in dem ich über verschiedenes nachdenke.
Somerset Maugham hat einmal geschrieben, in jeder Rasur liege eine Philosophie, und ich pflichte diesem Gedanken entschieden bei. Ganz gleich, wie banal und alltäglich eine Tätigkeit sein mag, wenn man sie nur lange genug ausübt, bekommt sie etwas Meditatives oder Kontemplatives. Als Schriftsteller und Läufer glaube ich nicht, dass es mich zu weit von meinem üblichen Pfad abführt, ein Buch über das Laufen zu veröffentlichen. Vielleicht hat es etwas mit Pedanterie zu tun, aber ich kann viele Dinge nur begreifen, indem ich meine Gedanken zu Papier bringe. Ich muss verfassen, um zu erfassen. Was Laufen für mich bedeutet, musste ich mir sozusagen durch meiner Hände Schreibarbeit verdeutlichen.
Als ich einmal in einem Hotelzimmer in Paris herumsaß und in der International Herald Tribune blätterte, stieß ich auf einen Sonderbericht über Marathonläufe. Unter anderem wurden mehrere berühmte Läufer nach dem Mantra befragt, das sie während ihres Laufs rezitierten, um sich anzuspornen. Eine interessante Frage. Die Gedanken der Läufer während der 42,195 Kilometer beeindruckten mich. Sie veranschaulichten, wie zermürbend ein Marathonlauf ist. Wer nicht einen bestimmten Gedanken gebetsmühlenartig wiederholt, kann niemals durchhalten.
Einer der Läufer berichtete von einem Spruch, den ihm sein älterer Bruder (ebenfalls ein Läufer) beigebracht hatte, und den er seither ständig im Kopf behält: Schmerz ist unvermeidlich, Leiden ist eine Option. Man stelle sich vor, man rennt und denkt plötzlich: »Boah, ist das eine Qual, ich kann nicht mehr.« Die Qual ist eine unvermeidliche Tatsache, sie zu ertragen oder nicht, bleibt jedoch dem Läufer überlassen. Damit hat man im Grunde einen Hauptaspekt des Marathonlaufens umrissen.
Vor zehn Jahren hatte ich zum ersten Mal die Idee, ein Buch über das Laufen zu schreiben. Ich probierte hin und her, und es verging viel Zeit, ohne dass ich tatsächlich etwas zu Papier brachte. Das Thema Laufen an sich ist etwas schwammig, und es fiel mir schwer zu bestimmen, worüber ich eigentlich genau schreiben wollte.
Irgendwann beschloss ich jedoch, meinem Stil treu zu bleiben und einfach offen und ehrlich meine Gefühle und Gedanken niederzulegen. Damit war der Anfang gemacht, und ich schrieb von Sommer 2005 bis Herbst 2006 an diesem Buch. Abgesehen von einigen wenigen Stellen, an denen ich frühere Arbeiten von mir zitiere, dokumentiert der vorliegende Text meine Empfindungen und Gedanken in der Phase des Schreibens als eine Art ›laufendes‹ Tagebuch. Dabei fiel mir eine Sache besonders auf: Ehrlich über das Laufen und ehrlich über mich selbst zu schreiben war fast das Gleiche.
Auch wenn ich nichts von alledem als Philosophie bezeichnen würde, schildert dieses Buch doch einige Lektionen, die das Leben mich gelehrt hat. Sie machen vielleicht nicht viel her, aber es sind persönliche Erfahrungen, die ich durch körperliche Bewegung erlangt habe und die mir zu der Erkenntnis verholfen haben, dass Leiden nur eine Option ist. Meine Erkenntnisse lassen sich vielleicht nicht verallgemeinern, aber was ich hier zeigen möchte, bin ich – der Mensch, der ich bin.
August 2007
1
FREITAG, 5. AUGUST 2005KAUAI, HAWAII
WER KÖNNTE ÜBER MICK JAGGER LACHEN?
Ich bin auf Kauai, North Shore. Der Himmel ist unglaublich klar und sonnig, keine Wolke ist zu sehen. Nicht einmal eine Andeutung dessen, was man Wolke nennt. Ich bin Ende Juli angekommen, und wie immer haben wir ein Apartment gemietet. Morgens, wenn es noch kühl ist, sitze ich am Schreibtisch und arbeite. Ich schreibe alles Mögliche, wie jetzt diesen Text über das Laufen. Es ist Sommer und daher ziemlich heiß. Hawaii wird häufig als Insel des ewigen Sommers bezeichnet, aber da es auf der nördlichen Halbkugel liegt, gibt es doch so etwas wie vier Jahreszeiten. Der Sommer ist heißer als der Winter. Verglichen mit der feuchten Hitze in Cambridge, Massachusetts, zwischen all den Backsteinen und dem Beton fühlt man sich hier allerdings wie im Paradies. Man braucht keine Klimaanlage, muss nur das Fenster öffnen und eine erfrischende Brise weht von allein ins Haus. Meine Bekannten in Cambridge sind immer ganz verblüfft, dass ich im August nach Hawaii fliege. »Warum verbringst du den Sommer an so einem heißen Ort?«, rufen sie aus, denn sie wissen nicht, dass die Sommer dort durch die beständigen Passatwinde aus dem Nordosten kühl sind. Und auch nicht, wie heiter das Leben hier ist, wo man die Muße hat, im Schatten der Bäume zu lesen oder, sooft man Lust dazu verspürt, ein Bad in der Bucht zu nehmen.
Seit meiner Ankunft habe ich es an kaum einem Tag versäumt, etwa eine Stunde zu laufen. Diesen mir von früher vertrauten Lebensstil führe ich nun seit zweieinhalb Monaten wieder. Ich setze nur aus, wenn es wirklich unvermeidlich ist. Heute bin ich eine Stunde und zehn Minuten gelaufen und habe dabei zwei Alben von The Lovin’ Spoonful auf meinem Walkman gehört: Day Dream und Hums of the Lovin’ Spoonful, die ich auf MD-Disc aufgenommen hatte.
Da ich vorläufig dabei bin, meine Distanzen zu steigern, spielt die Zeit noch keine so große Rolle. Es kommt mir allein darauf an, eine bestimmte Strecke zu schaffen. Wenn ich mein Pensum schneller absolvieren möchte, lege ich auch schon mal einen Spurt ein, aber wenn ich das Tempo erhöhe, verkürze ich auch die Laufzeit. Jedenfalls kommt es mir darauf an, das Wohlbefinden, das ich am Ende jedes Laufs empfinde, auf den nächsten Tag zu übertragen. Den gleichen Trick wende ich an, wenn ich an einem Roman schreibe. Ich höre stets an einem Punkt auf, an dem ich das Gefühl habe, ich könnte eigentlich noch weiterschreiben. Dann geht mir die Arbeit am nächsten Tag erstaunlich gut von der Hand. Ich glaube, Ernest Hemingway hat einmal etwas Ähnliches gesagt. Um weitermachen zu können, muss man einen Rhythmus einhalten. Dies ist ein wichtiger Faktor bei langfristigen Projekten. Sobald man sein Tempo gefunden hat, ergibt sich der Rest ganz automatisch. Aber bis das Schwungrad anfängt, sich in einer bestimmten Geschwindigkeit zu drehen, kann man nicht genug auf die Einhaltung eines bestimmten Ablaufs achten.
Während ich lief, geriet ich in einen kurzen Schauer, der angenehm kühlend wirkte. Eine dicke Wolke zog vom Meer herüber, bedeckte den Himmel, und ein leichter Regen fiel. Dann verschwand sie, ohne sich noch einmal umzuwenden, als sei ihr etwas Dringendes eingefallen, und wieder strahlte erbarmungslos die sengende Sonne herab. Hier herrscht ein sehr leicht verständliches Klima, das nichts Unheimliches oder Zweideutiges hat, nichts Symbolisches oder Metaphorisches. Unterwegs begegnete ich mehreren Joggern, die Anzahl der Männer und Frauen hielt sich ungefähr die Waage. Die Sportlichen trabten leichtfüßig über den Boden und durchschnitten den Wind, als wären ihnen Räuber auf den Fersen. Daneben gab es die Übergewichtigen, die sich mit halbgeschlossenen Augen und lustlos hängenden Schultern schnaufend dahinschleppten. Manch einem hatte vermutlich der Arzt vor einer Woche gesagt, er habe Zucker und müsse sich Bewegung verschaffen. Ich bin irgendwo dazwischen.
The Lovin’ Spoonful kann ich immer wieder hören. Ihre Musik ist entspannt und nie unecht. Ihr weicher Sound ruft viele Erinnerungen an die Mitte der sechziger Jahre in mir wach. Nichts Weltbewegendes. Würde man einen Film über mein Leben drehen (allein bei dem Gedanken graust mir), wären das die Szenen, die herausgeschnitten würden. »Auf die Episode können wir verzichten, sie ist nicht gerade schlecht, aber zu alltäglich.« Mir hingegen bedeuten diese Erinnerungen viel, und wahrscheinlich lächele ich dabei oder runzele die Stirn, ohne es zu merken. So unerheblich sie auch sein mögen – sie sind da, hier und jetzt an der Nordküste von Kauai. Wenn ich mir mein bisheriges Leben vor Augen führe, habe ich mitunter das Gefühl, nicht mehr zu sein als ein Stück Treibholz, das an den Strand geworfen wurde. Der Passat weht vom Leuchtturm herüber und lässt die Blätter der Eukalyptusbäume über mir rascheln.
Seit Ende Mai dieses Jahres wohne ich in Cambridge, Massachusetts, und seitdem ist der Langstreckenlauf wieder zu einer festen Größe in meinem Alltag geworden. Ich trainiere ernsthaft. In konkreten Zahlen heißt das, ich laufe sechzig Kilometer in der Woche, an sechs Tagen je zehn Kilometer. Besser wäre es natürlich, an sieben Tagen je zehn Kilometer zu laufen, aber es gibt immer einen, an dem es regnet oder an dem ich zu viel zu tun habe. Oder zu müde bin und keine Lust habe. Daher kalkuliere ich jeweils einen freien Tag in der Woche ein. Bei sechzig Kilometern pro Woche komme ich auf zweihundertsechzig im Monat – für meine Verhältnisse bedeutet das »ernsthaftes« Training.
Im Juni hielt ich mich strikt an diesen Plan und lief exakt 260 Kilometer. Im Juli verlängerte ich die Strecke und schaffte 310 Kilometer. Ich rannte jeden Tag zehn Kilometer, ohne einen Tag auszusetzen, was jedoch nicht heißt, dass ich jeden Tag genau 10 Kilometer lief. Wenn ich an einem Tag 15 schaffte, lief ich am nächsten nur 5, aber so ergaben sich im Durchschnitt 10 Kilometer pro Tag. (Wenn ich im Jogging-Tempo laufe, schaffe ich in der Regel 10 Kilometer in einer Stunde.) Für mich ist das jedenfalls ein ernsthaftes Training. Seit ich in Hawaii bin, behalte ich dieses Pensum bei. Es ist schon viel zu lange her, dass ich ein festes Trainingsprogramm mit solchen Strecken einhalten konnte.
Wer noch nie einen Sommer in Neuengland erlebt hat, kann sich nicht vorstellen, wie anstrengend das ist. Natürlich weht an manchen Tagen eine schöne kühle Brise, aber viel häufiger ist es unangenehm schwülheiß. Wenn ein Wind weht, kann man es noch einigermaßen ertragen, aber kaum legt er sich, scheint sich eine Feuchtigkeit vom Meer über das Land zu wälzen, die den Körper wie mit einer dünnen nassen Decke überzieht. Man braucht nur eine Stunde am Charles River entlangzulaufen, dann ist man klatschnass, als hätte jemand einen Eimer Wasser über einem ausgekippt. Die Haut brennt von der Sonne, und der Kopf ist so völlig leer, dass man keinen klaren Gedanken mehr fassen kann. Doch wenn ich mich in dieser Zeit zum Laufen zwinge und den letzten Tropfen an Energie aus mir herauspresse, fühle ich mich am Ende auf eine gewisse verzweifelte Art belebt.
Dass ich an einem bestimmten Punkt meines Lebens aufhörte, ernsthaft zu laufen, hatte verschiedene Gründe. Zum einen war mein Leben hektischer geworden, und ich konnte in meinem Alltag einfach nicht mehr so frei über meine Zeit verfügen. Was nicht heißt, dass ich in meiner Jugend unbegrenzt viel Freizeit hatte, aber mit dem Alter scheinen auch die Verpflichtungen zuzunehmen. Ein weiterer Grund war wohl auch mein zunehmendes Interesse am Triathlon, zu dem – wie Sie wissen – neben dem Laufen noch Schwimmen und Radfahren gehören. Für mich als Läufer war das Erste kein Problem, aber um in den beiden anderen Disziplinen zu trainieren, musste ich eine Menge Zeit einsetzen. Beim Schwimmen musste ich praktisch von vorne anfangen, um mir einen effizienteren Stil anzueignen, und auch beim Radfahren musste ich die Technik erlernen und die erforderliche Muskulatur aufbauen. All das ging auf Kosten der Zeit, die mir für den Langstreckenlauf blieb.
Der Hauptgrund, aus dem ich nicht mehr so eifrig lief, bestand jedoch darin, dass ich keine rechte Lust mehr dazu hatte. Seit dem Herbst 1982, als ich mit dem Laufen angefangen hatte, waren beinahe dreiundzwanzig Jahre vergangen, in denen ich fast jeden Tag gejoggt war, jedes Jahr an einem Marathon (bis heute dreiundzwanzig) und an mehr Langstreckenläufen auf der Welt teilgenommen hatte, als ich zählen kann. Lange Strecken zu laufen entspricht meinem Wesen und hat mir immer Spaß gemacht. Von allen Dingen, die ich mir im Laufe meines Lebens zur Gewohnheit gemacht habe, ist das Laufen die hilfreichste und sinnvollste, das muss ich zugeben. Über zwanzig Jahre Langstrecke zu laufen hat mich stärker gemacht, sowohl körperlich als auch emotional.
Ich bin kein Mensch, der sich für Mannschaftssportarten eignet. Ob das nun gut ist oder schlecht, so bin ich nun mal. Wenn ich Fußball spiele oder Baseball (was seit meiner Kindheit kaum mehr vorgekommen ist), fühle ich mich unbehaglich. Vielleicht kommt es daher, dass ich keine Brüder habe, aber Spiele, bei denen man im Team spielt, haben mir nie gelegen. Sportarten wie Tennis mit einem Gegner sind auch nicht mein Fall. Squash macht mir Spaß, aber gegen jemanden zu spielen – ob ich nun gewinne oder verliere – ist mir immer etwas unangenehm. Kampfsportarten kommen für mich ebenfalls nicht in Frage.
Natürlich habe ich nichts dagegen zu gewinnen. Aber aus irgendeinem Grund hat es mir schon als Kind nie viel bedeutet, und auch als ich erwachsen wurde, hat sich daran im Wesentlichen nichts geändert. Gegen andere anzutreten bedeutet mir nicht viel. Weit mehr liegt mir daran, die Ziele zu erreichen, die ich mir selbst gesteckt habe, und daher ist der Langstreckenlauf die ideale Sportart für mich.
Wer schon einmal einen ganzen Marathon gelaufen ist, wird mich verstehen. Für die meisten Läufer geht es nicht um die Frage, ob sie eine bestimmte Person besiegen. Natürlich ist es die Aufgabe eines Weltspitzenläufers, seine Rivalen zu überholen, aber für die Amateurläufer ist der individuelle Wettkampf kein großes Thema. Bestimmt gibt es darunter auch Menschen, die der Vorsatz, nicht gegen eine gewisse Person zu verlieren, zu härterem Training motiviert. Sollte der Rivale jedoch aus irgendeinem Grund nicht an dem Lauf teilnehmen können, ist ihnen damit (zumindest teilweise) der Wind aus den Segeln genommen, und sie werden nicht lange dabei bleiben.
Die meisten durchschnittlichen Läufer werden von einem persönlichen Ziel angetrieben: Sie möchten eine bestimmte Zeit laufen. Wenn sie es schaffen, haben sie ihre persönliche Messlatte erreicht, wenn nicht, dann eben nicht. Auch wenn ein Läufer seinen eigenen Rekord nicht brechen kann, aber dennoch das Gefühl hat, sein Bestes gegeben zu haben, und dabei vielleicht sogar eine wichtige Erkenntnis über sich selbst gewonnen hat, ist dies eine Leistung, die er mit in seinen nächsten Lauf hinübernehmen kann. Mit anderen Worten, das Wichtigste für einen Langstreckenläufer ist es, nach dem Lauf stolz (oder etwas Ähnliches) auf sich zu sein.
Das Gleiche kann ich über meine Arbeit sagen. Im Beruf des Schriftstellers gibt es – zumindest was mich betrifft – weder Sieg noch Niederlage. Verkaufszahlen, Literaturpreise oder Kritikerlob sind vielleicht äußere Zeichen des schriftstellerischen Erfolges, aber nichts davon zählt. Entscheidend ist nur, ob das Geschriebene das Ziel erreicht, das man sich als Autor gesetzt hat. Dieser Anspruch duldet keine Ausreden. Vielleicht kann man andere mit einer passenden Erklärung beschwichtigen, aber das eigene Herz lässt sich nicht betrügen. In dieser Hinsicht hat ein Roman eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Marathonlauf. Die Motivation eines Schriftstellers liegt in ihm selbst, und er sollte keine Bestätigung durch Äußerlichkeiten anstreben oder sich an äußeren Maßstäben messen.
Für mich ist das Laufen körperliche Bewegung und Metapher zugleich. Durch tägliches Training und die Teilnahme an Läufen habe ich die Messlatte nach und nach immer ein Stückchen höher gelegt und mich dadurch selbst gesteigert. Zumindest habe ich mich jeden Tag darum bemüht. Natürlich bin ich kein überragender Läufer. Ich befinde mich auf einem sehr durchschnittlichen, mittelmäßigen Niveau. Aber das spielt überhaupt keine Rolle. Mir kommt es lediglich darauf an, ob ich besser war als gestern, mich selbst übertroffen habe. Der einzige Gegner, den es beim Langstreckenlauf zu überrunden gilt, ist die eigene frühere Person.
Doch ab etwa Mitte vierzig hat sich mein System der Selbsteinschätzung allmählich verändert. Vereinfacht gesagt, ich konnte meine Zeiten nicht mehr verbessern. In Anbetracht meines Alters war dies wohl unvermeidlich; einmal ist jeder auf dem Höhepunkt seiner körperlichen Leistungsfähigkeit angelangt. Natürlich gibt es dabei individuelle Unterschiede, aber Schwimmer erreichen ihn meist mit Anfang zwanzig, Boxer mit Ende zwanzig und Baseballspieler mit Mitte dreißig. Nur dass man ihn unvermeidlich einmal überschreitet, ist allen gemeinsam. Als ich einmal einen Augenarzt fragte, ob es jemals einen Menschen gegeben habe, der im Alter nicht weitsichtig geworden sei, sah er mich an, als hätte ich nicht alle Tassen im Schrank, und lachte. »Ich bin noch nie einem begegnet«, antwortete er. (Glücklicherweise sieht die Sache bei Künstlern ganz erheblich anders aus. So schrieb Dostojewski zwei seiner Hauptwerke – Die Dämonen und Die Brüder Karamasow – erst gegen Ende seines sechzigjährigen Lebens. Und Domenico Scarlatti komponierte den größten Teil seiner 555 Klaviersonaten zwischen seinem siebenundfünfzigsten und zweiundsechzigsten Lebensjahr.)
Meinen läuferischen Höhepunkt erreichte ich mit Ende vierzig. Davor war es mein Ziel, einen Marathon in dreieinhalb Stunden zu laufen, also genau einen Kilometer in fünf oder eine Meile in acht Minuten. Mal schaffte ich es, dann wieder – öfter – nicht. Immerhin war ich in der Lage, in etwa dieser Zeit einen Marathon zu beenden. Auch wenn ich es mal vermurkst hatte, blieb ich doch unter drei Stunden und vierzig Minuten. Selbst wenn ich wenig trainiert hatte oder schlecht in Form war, blieb es für mich unvorstellbar, vier Stunden zu überschreiten. Auf diesem Niveau hielt ich mich eine ganze Weile, bis irgendwann eine Wende eintrat. Auf einmal fiel es mir immer schwerer, unter drei Stunden vierzig Minuten zu laufen. Ich brauchte nun fünfeinhalb Minuten für einen Kilometer, und die Vier-Stunden-Marke für einen Marathon rückte immer näher. Das war ein kleiner Schock für mich. Was war nur los? Das konnte doch nicht am Alter liegen! Im Alltag hatte ich nicht das Gefühl, physisch nachzulassen. Doch ganz gleich, wie sehr ich es zu leugnen oder zu ignorieren versuchte, meine Leistungen gingen Schritt für Schritt zurück.
Vielleicht trug auch noch etwas anderes dazu bei, dass meine Marathon-Zeiten unbefriedigend wurden: Ich hatte begonnen, mich für noch längere Strecken und für andere Sportarten wie Triathlon und Squash zu interessieren. Immer nur rennen, dachte ich, ist vielleicht zu einseitig. Ob es nicht besser wäre, andere Sportarten einzubeziehen und abwechslungsreicher zu trainieren?
Mit einem Privattrainer korrigierte ich meine Schwimmhaltung und lernte schneller und besser zu schwimmen als vorher. Auch meine Muskulatur stellte sich auf das neue Element ein, und mein Körper veränderte sich sichtbar. Doch unaufhaltsam, wie das Meer sich bei Ebbe zurückzieht, verschlechterten sich meine Zeiten beim Marathon immer mehr. Außerdem machte mir das Laufen nicht mehr so viel Spaß wie früher. Zwischen dem »Laufen« und mir tat sich eine ständige Kluft der Erschöpfung auf. Mich befiel Enttäuschung darüber, dass all das anstrengende Training sich nicht gelohnt hatte und etwas mich nun aufhielt, als würde mir eine Tür, die für gewöhnlich offen stand, vor der Nase zugeschlagen. Ich gab diesem Zustand den Namen »Runner’s Blue«. Ich werde später noch genauer darauf eingehen, was für ein Zustand dieses »Blue« war.
Zehn Jahre sind vergangen, seit ich das erste Mal in Cambridge gelebt habe (von 1993 bis 1995, damals war Bill Clinton Präsident.) Als ich den Charles River wiedersah, überkam mich die Sehnsucht, wieder einmal zu laufen. Solange keine großen Umwälzungen stattfinden, bleiben sich Flüsse für gewöhnlich immer gleich, und der Charles River wirkte besonders unverändert. Die Jahre sind vergangen, die Gesichter der Studenten haben sich gewandelt, und ich bin zehn Jahre älter geworden. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes viel Wasser den Fluss hinuntergeflossen, er selbst jedoch ist unverändert. Sein Wasser strömt weiter rasch und fast lautlos auf den Bostoner Hafen zu. Es durchtränkt die Ufer, lässt die sommerlichen Gräser sprießen und nährt die Wasservögel. Gemächlich fließt es unter alten Steinbrücken hindurch, spiegelt die Sommerwolken (im Winter treiben Eisschollen darauf) und ergießt sich ohne Eile und doch ohne Unterlass stumm in den Ozean – eine unwandelbare, sich stets aufs Neue selbst bestätigende Idee.
Als ich die aus Japan mitgebrachten Umzugsgüter eingeräumt, die zahlreichen Formalitäten erledigt und mich einigermaßen eingelebt hatte, begann ich wieder ernsthaft zu laufen. Während ich die frische kühle Morgenluft in meine Lungen pumpte, verspürte ich die Freude, auf vertrautem Boden zu laufen. Der Klang meiner Schritte, meine Atmung und mein Herzschlag verbanden sich zu einem einzigartigen, vielgestaltigen Polyrhythmus. Der Charles River ist ein Wallfahrtsort für Ruderer, und irgendjemand ist immer auf dem Wasser. Oft mache ich mir einen Spaß daraus, mit den Booten um die Wette zu laufen. Natürlich sind sie meist die Schnelleren. Aber wenn jemand gemächlich dahinrudert, ist es ein prima Rennen.
Vielleicht gibt es in Cambridge so viele Läufer, weil der Boston Marathon hier zu Hause ist. Der Joggingpfad am Fluss ist endlos und man kann ihn, wenn man will, stundenlang entlanglaufen. Allerdings wird er auch von Radfahrern benutzt, und man muss ständig vor von hinten heranflitzenden Rasern auf der Hut sein. Auch ist der Weg an verschiedenen Stellen rissig, und man muss aufpassen, dass man nicht stolpert. Dann gibt es noch ein paar Ampeln, die einen störend lange aufhalten, aber ansonsten ist es ein sehr angenehmer Weg.
Wenn ich laufe, höre ich meistens Rockmusik, hin und wieder auch Jazz. Aber Rock passt am besten zum Laufrhythmus. Mir gefallen die Red Hot Chili Peppers, die Gorillaz, Beck und Oldies von Creedence Clearwater Revival oder den Beach Boys. Je einfacher der Rhythmus, desto besser. Heutzutage benutzen viele Läufer iPods, aber ich ziehe meinen gewohnten MD-Spieler vor. Er ist etwas größer als ein iPod, und seine Speicherkapazität ist geringer, aber mir genügt das. Beim Laufen möchte ich Computer und Musik nicht verbinden. Ebenso wie ich nicht gern Freundschaft, Sex und Arbeit vermische.
Im Juli bin ich also 310 Kilometer gelaufen. An zwei Tagen hat es geregnet und an zweien war ich unterwegs und konnte nicht laufen. Außerdem war es an einigen Tagen auch zu schwül. In Anbetracht dessen sind 310 nicht übel. Gar nicht übel. Wenn 260 Kilometer im Monat als ernsthaftes Training gelten, sind 310 Kilometer auf jeden Fall hart. Je länger die Strecken wurden, desto mehr verlor ich an Körpergewicht. In den zweieinhalb Monaten nahm ich etwa drei Kilo ab, und der Bauchansatz, den ich bekommen hatte, verschwand. Stellen Sie sich vor, Sie gingen zum Metzger, würden drei Kilo Fleisch kaufen und es nach Hause tragen. So bekommen Sie einen Eindruck von dem Gewicht. Ich fand es selbst schon bedenklich, so viel zusätzliches Gewicht mit mir herumzuschleppen. Samuel Adams Summer Ale und Dunkin’ Donuts sind wichtige Bestandteile des Bostoner Lebens, aber auch diese Genüsse kann man sich gönnen, wenn man täglich trainiert.
Vielleicht wirkt es ein bisschen albern, wenn ein Mann in meinem Alter so etwas immer wieder schreibt, aber um es ganz klarzustellen: Ich bin ein Mensch, der besonders gern für sich ist. Oder noch präziser ausgedrückt: Es bereitet mir keinerlei Unbehagen, allein zu sein. Ich finde es weder schwierig noch langweilig, am Tag ein oder zwei Stunden allein zu laufen und dann vier oder fünf Stunden allein am Schreibtisch zu sitzen. Schon in meiner Jugend hatte ich diese Neigung. Vor die Wahl gestellt, habe ich es immer vorgezogen, ein Buch zu lesen oder allein Musik zu hören, statt mit anderen zusammen zu sein. Mir fiel immer etwas ein, was ich allein tun konnte.
Dennoch habe ich jung geheiratet (mit zweiundzwanzig) und mich allmählich an das Zusammenzuleben mit einem anderen Menschen gewöhnt. Nach dem Studium führte ich ein Lokal und lernte, wie wichtig es ist, mit anderen auszukommen, und dass wir – versteht sich – allein nicht überleben können. So erfuhr ich, wenn auch auf meine etwas unorthodoxe Weise, was es heißt, ein soziales Wesen zu sein. Rückblickend ist mir klar, dass sich in meinen Zwanzigern meine Weltsicht änderte und ich menschlich reifer wurde. Indem ich vieles ausprobierte, erwarb ich die praktischen Fähigkeiten, die ein Mensch zum Überleben braucht. Ohne diese zehnjährige Lebenserfahrung hätte ich womöglich nie einen Roman geschrieben, oder es wäre, selbst wenn ich es versucht hätte, nichts daraus geworden. Dennoch verändert sich der Charakter eines Menschen nie ganz drastisch. Der Wunsch, allein zu sein, ist mir unverändert eigen. Deshalb ist auch die eine Stunde am Tag, die ich schweigend und für mich verbringe, von so großer Bedeutung für mein psychisches Wohlergehen. Beim Laufen muss ich mit niemandem reden und niemandem zuhören. Ich brauche nur auf die vorüberziehende Landschaft zu schauen. Um nichts in der Welt würde ich diese kostbaren Momente eintauschen.
Häufig werde ich gefragt, woran ich beim Laufen denke. Meist haben die Menschen, die diese Frage stellen, selbst keine Erfahrung im Langstreckenlauf. Jedes Mal denke ich angestrengt darüber nach. Was denke ich denn eigentlich so, wenn ich laufe? Ehrlich gesagt, kann ich mich überhaupt nicht daran erinnern.