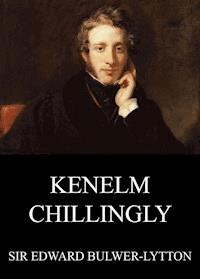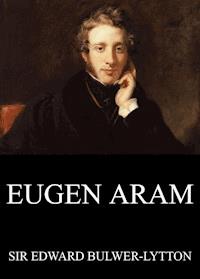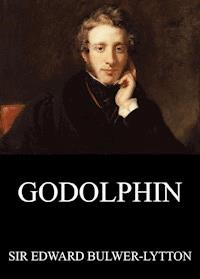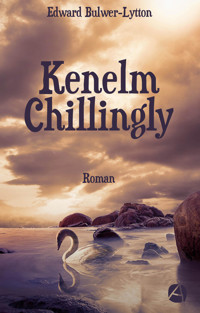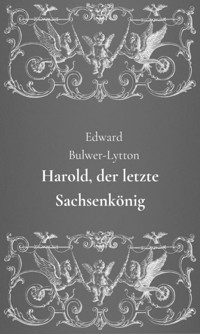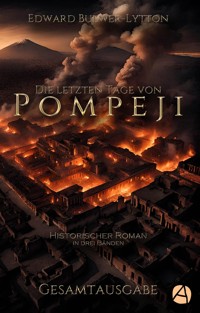Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zanoni ist ein okkulter Roman von Edward Bulwer-Lytton aus dem Jahr 1842, eine Geschichte über Liebe und okkultes Streben. Er erzählt die Geschichte eines Mannes, der in Chäldea geboren wurde und dort von seinen Meister Adonai (Mejnour) das Elixier des ewigen Lebens bekam. Viele Tausend Jahre lebt er isoliert von der Menschheit, bis er sich zur Zeit der Französischen Revolution in die italienische Opernsängerin Viola verliebt. Sein Meister Mejnour warnt ihn vor einer Liebesaffäre, da er sich nicht verlieben darf, ohne seine Macht der Unsterblichkeit zu verlieren. Ein Engländer namens Glyndon liebt Viola ebenfalls, entsagt aber seiner Liebe, um sich okkulten Studien zu widmen. Er gerät in den Bann des "Hüters der Schwelle", jenes Wächters, der den Unwürdigen den Zugang zum Einweihungsweg verweigert. Ein Buch über den Fall eines unsterblichen Meisters.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 760
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zanoni
Ein okkulter Roman
* * *
Verlag Heliakon
Titelbild: Jacob's Dream by William Blake
Umschlaggestaltung: Verlag Heliakon
Originaltitel: Zanoni
Übersetzer: Gustav Pfizer
Vertrieb: epubli – ein Service der neopubli GmbH, Berlin
Das Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verfassers unzulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über dnb.de abrufbar.
Inhaltsverzeichnis
Titelseite
Einleitung
I. Der Musiker
Kapitel 1.1
Kapitel 1.2
Kapitel 1.3
Kapitel 1.4
Kapitel 1.5
Kapitel 1.6
Kapitel 1.7
Kapitel 1.8
Kapitel 1.9
Kapitel 1.10
II. Kunst, Liebe, Wunder
Kapitel 2.1
Kapitel 2.2
Kapitel 2.3
Kapitel 2.4
Kapitel 2.5
Kapitel 2.6
Kapitel 2.7
Kapitel 2.8
Kapitel 2.9
Kapitel 2.10
Theurgie
Kapitel 3.1
Kapitel 3.2
Kapitel 3.3
Kapitel 3.4
Kapitel 3.5
Kapitel 3.6
Kapitel 3.7
Kapitel 3.8
Kapitel 3.9
Kapitel 3.10
Kapitel 3.11
Kapitel 3.12
Kapitel 3.13
Kapitel 3.14
Kapitel 3.15
Kapitel 3.16
Kapitel 3.17
Kapitel 3.18
Die Hüterin der Schwelle
Kapitel 4.1
Kapitel 4.2
Kapitel 4.3
Kapitel 4.4
Kapitel 4.5
Kapitel 4.6
Kapitel 4.7
Kapitel 4.8
Kapitel 4.9
Kapitel 4.10
Kapitel 4.11
Die Wirkungen des Elixiers
Kapitel 5.1
Kapitel 5.2
Kapitel 5.3
Kapitel 5.4
Kapitel 5.5
Kapitel 5.6
Der Aberglaube siegt über den Glauben
Kapitel 6.1
Kapitel 6.2
Kapitel 6.3
Kapitel 6.4
Kapitel 6.5
Kapitel 6.6
Kapitel 6.7
Kapitel 6.8
Kapitel 6.9
Die Schreckensherrschaft
Kapitel 7.1
Kapitel 7.2
Kapitel 7.3
Kapitel 7.4
Kapitel 7.5
Kapitel 7.6
Kapitel 7.7
Kapitel 7.8
Kapitel 7.9
Kapitel 7.10
Kapitel 7.11
Kapitel 7.12
Kapitel 7.13
Kapitel 7.14
Kapitel 7.15
Kapitel 7.16
Kapitel 7.17
Einleitung
„Kurz, ich konnte weder Kopf
noch Schwanz daran anbringen.“
Der Graf von Gabalis
Vielleicht befinden sich unter meinen Lesern einige Wenige, denen ein alter Buchladen nicht unbekannt ist, welcher vor einigen Jahren in der Nähe von Covent Garden existierte; ich sage einige Wenige, denn sicherlich war in den kostbaren Bänden, welche die Arbeit und Mühe eines Lebens auf den bestäubten Bücherbrettern meines alten Freundes D*** aufgehäuft hatte, wenig, was die Menge anziehen könnte. Da fanden sich keine populären Abhandlungen, keine unterhaltende Romane, keine Geschichten, keine Reisen , keine „Bibliothek für das Volk“, keine „Belustigungen für Millionen.“ Aber es entdeckte dort der Neugierige die merkwürdigste Sammlung vielleicht in ganz Europa, die je ein enthusiastischer Liebhaber von alchemistischen, kabbalistischen astrologischen Werken zusammengebracht hat.
Der Besitzer hatte ein Vermögen verschwendet auf den Ankauf von unverkaufbaren Schätzen. Aber der alte D*** hatte gar keine Lust zu verkaufen. Es schnitt ihm wirklich ins Herz, wenn ein Käufer in seinen Laden trat; er beobachtete die Bewegungen des anmaßlichen Eindringlings mit rachgierigen, eifersüchtigen Blicken, er umschwebte ihn mit unruhiger Wachsamkeit; er runzelte die Stirne, er stöhnte, wenn profane Hände seine Idole in ihren Nischen verrückten. Wenn es eine der Lieblingssultaninnen seines Zauberharems war, die einen anzog, und der genannte Preis nicht enorm genug war, pflegte er nicht selten die Summe zu verdoppeln. Zeigte man Bedenken, so riss er einem in ungestümer Freude den ehrwürdigen Bezauberer aus den Händen; ging man auf die Forderung ein, so wurde er das Bild Verzweiflung. Nicht selten pochte er in sinkender Nacht an der Tür des Abnehmers, und flehte ihn an, ihm wieder zu beliebigen Bedingungen zu verkaufen, was derselbe zu so hohem Preis von ihm gekauft hatte. Selbst ein gläubiger Anhänger seines Averroes und Paracelsus, war er so abgeneigt wie die Philosophen, welche er studierte, den Profanen die von ihm gesammelte Gelehrsamkeit mitzuteilen.
Es traf sich, dass ich vor mehreren Jahren, in den jüngeren Tagen meiner Schriftstellerei und meines Lebens, den Wunsch empfand, mich mit dem eigentlichen Ursprung und den Lehren der sonderbaren, und unter dem Namen der Rosenkreuzer bekannten Sekte vertraut zu machen. Unbegnügt mit den dürftigen und oberflächlichen Nachrichten, die sich in den Werken finden, auf welche man gewöhnlich in Betreff dieses Gegenstandes verweist, fiel mir plötzlich die Möglichkeit ein, dass Mr. D—s Sammlung, die nicht nur an Drucken, sondern auch an Handschriften reich war, vielleicht genauere und authentischere Aufschlüsse über diese berufene Brüderschaft enthalte – geschrieben etwa. Wer weiß! Von einem ihres eigenen Ordens und durch gewichtiges und ausführliches Zeugnis die Ansprüche auf Weisheit und Tugend bekräftigend, welche Bringaret den Nachfolgern der Chaldäer und Gymnosophisten zugeschrieben.
Demgemäß begab ich mich an den Ort, der, wie ich ohne Zweifel mit Scham bekennen muss, einmal einer meiner Lieblingsaufenthalte war. Aber finden sich denn keine Irrtümer und Täuschungen in den Chroniken unserer Tage, so absurd wie die der alten Alchemisten? — Unsere Zeitungen selbst möchten unseren Nachkommen so voll von Täuschungen erscheinen, wie uns die Bücher der Alchemisten — und doch ist die Presse die Luft, die wir nehmen — und seine ungemein neblige Luft ist es!
Als ich in den Laden trat, fiel mir das ungemein ehrwürdige Äußere eines Kunden auf, den ich noch nie dort gesehen hatte. Noch mehr wunderte ich mich über die Achtung, mit welcher er von dem arroganten Sammler behandelt wurde. »Sir«, rief der Letztere mit Emphase, als ich den Katalog durchblätterte, »Sir, ihr seid der einzige Mann, der mir in den fünfundvierzig Jahren, welche ich mit diesen Nachforschungen zugebracht, vorkam, welcher wert ist, mein Kunde zu sein. Wie — wo, in dieser frivolen Zeit, konntet ihr so tiefe Kenntnisse euch erwerben? Und jene erhabene Brüderschaft, deren Lehren, leise angedeutet schon von den frühesten Philosophen, noch den spätesten ein Geheimnis sind, — sagt mir, ob wirklich auf Erden ein Buch, ein Manuskript existiert, woraus ihre Entdeckungen, ihre Lehrsätze zu erlernen sind?«
Bei den Worten erhabene Brüderschaft war, wie ich kaum zu sagen brauche, meine Aufmerksamkeit auf einmal rege geworden, und ich lauschte gierig auf die Antwort des Unbekannten.
»Ich glaube nicht«, sagte der alte Herr, »dass die Meister der Schule je anderes als in dunkeln Andeutungen und mystischen Parabeln ihre wirklichen Lehren der Welt mitgeteilt haben. Und ich tadle sie nicht wegen dieser Zurückhaltung.«
Hier schwieg er und schien sich entfernen zu wollen, als ich etwas rasch zu dem Sammler sagte: »Ich finde nichts, Mr. D —, in diesem Katalog, was sich auf die Rosenkreuzer bezieht.«
»Die Rosenkreuzer!« wiederholte der alte Herr und jetzt fasste er seinerseits mich mit bedächtlicher Überraschung ins Auge. »Wer anderes als ein Rosenkreuzer könnte die Geheimnisse der Rosenkreuzer erklären? Und könnt ihr euch vorstellen, dass Mitglieder dieser Sekte, der eifersüchtigsten unter allen geheimen Gesellschaften, selbst den Schleier sollten lüften wollen, der die Isis ihrer Weisheit der Welt verbirgt?«
»Aha!« dachte ich, »das ist also die erhabene Brüderschaft, von welcher ihr gesprochen. Dem Himmel sei Dank! Gewiss bin ich auf Einen von dem Bunde gestoßen!«
»Aber«, sagte ich laut, »wenn nicht aus Büchern, Sir, wo soll ich denn sonst Aufschluss erlangen? Heutzutage kann man im Druck nichts wagen ohne Autoritäten, und man darf kaum Shakespeare zitieren, ohne Kapitel und Vers anzugeben. Wir leben in der Zeit der Tatsachen — der Zeit der Tatsachen, Sir!«
»Nun gut«, sagte der alte Herr mit einem wohlgefälligen Lächeln, »wenn wir uns wieder treffen, kann ich vielleicht wenigstens eure Nachforschungen auf die eigentliche Quelle der Erkenntnis hinlenken.« Und damit knöpfte er seinen Oberrock zu, pfiff seinem Hunde und ging weg.
Es traf sich, dass ich dem alten Herrn genau vier Tage nach unserem kurzen Gespräch in Mr. D…s Buchladen wieder begegnete. Ich ritt ganz gemächlich nach Highgate, als ich am Fuß seines klassischen Hügels den Unbekannten entdeckte; er ritt ein schwarzes kleines Pferd und vor ihm trottete sein Hund, der auch schwarz war.
Wenn einer dem Mann, den er kennenzulernen wünscht, zu Pferde, unten an einem langen Berg begegnet, wo er, wenn er nicht eines Freundes Lieblingspferd entlehnt hat, gemäß den Gesetzen der Menschlichkeit gegen die vernunftlosen Geschöpfe, einem nicht davon reiten kann: da ist es, fürchte ich, die eigene Schuld des nach der Bekanntschaft Lüsternen, wenn er nicht, ehe er den Gipfel erreicht, weit gediehen ist in seinem Wunsch und Vorhaben. Kurz es gelang mir so gut, dass, als wir Highgate erreichten, der alte Herr mich einlud, in seinem, ein wenig vom Dorf abgelegenen Haus auszuruhen; und ein herrliches Haus war es — klein, aber bequem, mit einem großen Garten, und mit einer Aussicht aus den Fenstern, wie sie Lukrez Philosophen empfehlen würde, — die Türme und Kathedralen von London an einem klaren Tage deutlich sichtbar; hier die Zurückgezogenheit des Einsiedlers, und dort das große Meer der Welt.
Die Wände der Hauptzimmer waren geschmückt mit Gemälden von außerordentlichem Verdienst, und von jener hohen Schule der Kunst, die außer Italien so wenig verstanden wird. Mit Überraschung erfuhr ich, dass sie alle von der Hand des Besitzers selbst waren. Meine sichtliche Bewunderung gefiel meinem neuen Freunde und führte zu Gesprächen über sein Talent, welche zeigten, dass er in seinen Kunsttheorien nicht minder erhaben, als in der Ausübung ein Adept war. Ohne den Leser mit gleichgültigen Kritiken zu ermüden, muss ich doch wohl, um den Plan und Charakter des Werkes, dem diese Vorworte zur Einleitung dienen, in ein helleres Licht zu setzen, in der Kürze bemerken, dass er ebenso sehr an dem Zusammenhang der Künste bestand, wie ein berühmter Schriftsteller auf dem der Wissenschaften; dass er behauptete, in allen Werken der Fantasie, in Worten oder mit Farben ausgeführt, müsse der Künstler der höheren Schulen den schärfsten Unterschied machen zwischen dem Realen und dem Wahren — mit anderen Worten, zwischen der Nachahmung der Wirklichkeit, und der Erhebung der Natur zum Idealen.
»Das eine«, sagte er, »macht die niederländische Schule, das andere die griechische.«
»Sir«, sagte ich, »die niederländische ist am meisten in der Mode.«
»Ja, in der Malerei vielleicht«, antwortete mein Wirt, »aber in der Literatur …«
»Von der Literatur sprach ich. Unsere heranwachsenden Dichter sind alle für Einfachheit und Betty Foy,1 und unsere Kritiker halten es für das höchste Lob bei einem Werk der Fantasie, zu sagen, dass seine Charaktere ganz genau dem gemeinen Leben entsprechen. Selbst in der Skulptur …«
»In der Skulptur! Nein — nein! hier wenigstens muss das hohe Ideale wesentlich sein!«
»Verzeiht; ich fürchte, ihr habt nicht Souter Johny und Tam OʼShante gesehen!«
»Ach!«, sagte der alte Herr, den Kopf schüttelnd; »ich lebe ganz außer der Welt, wie ihr seht. Ich denke, Shakespeare hat aufgehört bewundert zu werden.«
»Im Gegenteil; die Leute nehmen die Anbetung Shakespeares zur Entschuldigung, wenn sie jedermann sonst angreifen. Aber dafür haben auch unsere Kritiker die Entdeckung gemacht, dass Shakespeare so realistisch ist!«
»Realistisch! Der nie einen Charakter gezeichnet hat, dem man im wirklichen Leben begegnete — der nie herabgestiegen ist zu einer Leidenschaft, die falsch, noch zu einer Person, die real wäre!«
Ich wollte eben ernstlich auf dieses Paradoxon antworten, als ich bemerkte, dass mein Wirt etwas hitzig zu werden anfing. Und wer einen Rosenkreuzer zu erhaschen wünscht, der muss sich wohl hüten, das Wasser zu trüben. — Ich hielt es daher für besser, die Unterhaltung auf etwas anderes zu lenken.
»Revenons à nos moutons«, sagte ich; »ihr verspracht, meine Unwissenheit in Betreff der Rosenkreuzer aufzuklären.«
»Wohl!« versetzte er ziemlich herb; »aber zu welchem Zweck? Vielleicht wünscht ihr nur in den Tempel einzutreten, um die heiligen Gebräuche zu verspotten.«
»Wofür haltet ihr mich? Gewiss, hätte ich auch Lust dazu, das Schicksal des Abbe de Villars ist eine hinreichende Warnung für alle Menschen, nicht ein eitles Geschwätz von den Reichen des Salamanders und der Sylphen zu führen. Jedermann weiß, wie geheimnisvoll dieser scharfsinnige Mann ums Leben kam, zur reichenden Strafe für die witzigen Spöttereien seines Grafen von Gabalis.«
»Salamander und Sylphe! Ich sehe, dass ihr in den gemeinen Irrtum verfallt und die allegorische Sprache der Mystiker buchstäblich übersetzt.«
Damit geruhte der alte Herr in einen sehr interessante, und wie mir schien, sehr gelehrte Auseinandersetzung der Lehren der Rosenkreuzer einzugehen, deren noch einige, wie er versicherte, existierten, und immer noch, in hehrer Heimlichkeit, ihre tiefen Forschungen in Naturwissenschaften und verborgener Philosophie verfolgten.
»Aber diese Bruderschaft«, sagte er, »wie achtungswert auch und tugendhaft ― tugendhaft, sage ich, denn kein Mönchsorden ist strenger in der Ausübung moralischer Gesetze oder brünstiger im christlichen Glauben — diese Brüderschaft ist nur ein Zweig von anderen, noch überschwänglicheren in den Kräften, die sie sich angeeignet, und noch erlauchteren in ihrer Abkunft. Seid ihr bekannt mit den Platonikern?«
»Ich habe mich gelegentlich in ihrem Labyrinthe verirrt«, sagte ich. »Wahrhaftig, diese Herrn sind ziemlich schwer zu verstehen.«
»Und doch sind ihre verwickeltsten Probleme noch nie veröffentlicht worden. Ihre erhabensten Werke sind nur handschriftlich vorhanden und bilden das einleitende Wissen nicht bloß der Rosenkreuzer, sondern auch der genannten edleren Brüderschaften. Ernster und erhabner noch sind die Kenntnisse, die aus den älteren Pythagoräern und aus den unsterblichen Meisterstücken des Apollonius zu schöpfen sind.«
»Apollonius! der Betrüger von Tyana! sind seine Schriften vorhanden?«
»Betrüger!«, rief mein Wirt. »Apollonius ein Betrüger!«
»Ich bitte euch um Verzeihung; ich wusste nicht, dass er euer Freund ist; und wenn ihr für seinen Charakter bürgt, will ich glauben, dass er ein sehr achtbarer Mann gewesen, der nur Wahrheit sprach, wenn er sich rühmte, an zwei Orten zu gleicher Zeit sein zu können.«
»Ist das so schwer?«, sagte der alte Herr; »wenn dies ist, so müsst ihr nie geträumt haben.«
Hier endete unser Gespräch; aber von dieser Zeit an war zwischen uns eine Bekanntschaft entstanden, welche dauerte, bis mein ehrwürdiger Freund aus diesem Leben schied. Friede seiner Asche! Er war ein Mann von eigentümlichen Angewöhnungen und exzentrischen Ansichten; aber der größte Teil seiner Zeit war mit Taten und Handlungen ruhiger und anspruchsloser Güte ausgefüllt. Er war ein Enthusiast in den Pflichten des Samariters und wie seine Tugenden das sanfte Gewand der mildesten Menschenliebe trugen, so waren seine Hoffnungen auf den hingebendsten Glauben gegründet. Er sprach nie von seiner eigenen Abkunft und seiner Geschichte, auch habe ich nie das Dunkel zu durchdringen vermocht, worein sie gehüllt waren. Er schien viel von der Welt gesehen zu haben, und ein Augenzeuge der ersten französischen Revolution gewesen zu sein, ein Gegenstand, über den er ebenso beredt als lehrreich sprach. Dabei betrachtete er die Verbrechen dieser stürmischen Periode nicht mit der philosophischen Gelindigkeit und Nachsicht, womit aufgeklärte Schriftsteller unserer Tage (deren Kopf ungefährdet auf ihren Schultern sitzt) geneigt sind, die blutigen Metzeleien der Vergangenheit zu beurteilen, er sprach nicht wie ein Gelehrter, der gelesen und nachgedacht, sondern wie ein Mann, der gesehen, erlebt und gelitten hat. Der alte Herr schien allein zu stehen in der Welt; auch wusste ich nicht, dass er auch nur einen Verwandten hatte, bis sein Testamentsvollstrecker, ein entfernter Vetter, der außer Lands lebte, mich in Kenntnis setzte, welches schöne Legat mein armer Freund mir vermacht hatte. Dies bestand erstens aus einer Summe, in Betreff deren ich es für das Beste halte, reinen Mund zu halten, in Voraussicht der Möglichkeit einer neuen Steuer auf reales und fundiertes Eigentum und zweitens aus gewissen kostbaren Handschriften, welchen dieses Buch sein Dasein verdankt.
Ich bilde mir ein, ich bin dies letztere Vermächtnis einem Besuch schuldig, den ich dem Weisen, wenn ich ihn so nennen darf, wenige Wochen vor seinem Tod abstattete.
Mein Freund, obwohl er wenig von moderner Literatur las, erlaubte mir doch, mit der ihm eigenen leutseligen Gutmütigkeit, mit verbindlichster Gefälligkeit, ihn über verschiedene literarische Unternehmungen um Rat zu fragen, denen ich mit dem unsteten Ehrgeiz eines jungen und unerfahrenen Liebhabers der Literatur nachsann. Und zu jener Zeit erbat ich mir seinen Rat über ein Werk der Fantasie, das die Wirkungen des Enthusiasmus auf verschiedene Gattungen von Charakteren schildern sollte. Er hörte meine Erfindung, welche prosaisch und abgedroschen genug war, mit seiner gewöhnlichen Geduld an; und dann nachdenklich zu seinen Bücherbrettern sich wendend, nahm er einen alten Band herab und las mir zuerst griechisch, und dann englisch, einige Auszüge folgenden Inhalts:
»Plato bezeichnet hier vier Arten von Mania, worunter ich Enthusiasmus und göttliche Begeisterung verstehen möchte. Erstlich die musikalische, zweitens die telestische oder mystische; drittens die prophetische; und viertens die der Liebe angehörige.«
Der von ihm zitierte Autor, nachdem er behauptet, dass in der Seele etwas sei, das höher als der Verstand und dass in unserer Natur gesonderte Kräfte seien, durch deren eine wir Wissenschaften und Theorien mit beinahe intuitiver Schnelligkeit entdecken und erfassen, und eine andere, durch welche die hohe Kunst ihre Werke schafft, wie die Statuen des Phidias behauptete dann weiter: »Enthusiasmus, im wahren und echten Sinne des Wortes, bestehe darin, dass der Teil der Seele, der höher ist als der Verstand, zu den Göttern aufgeregt sei und daher seine Begeisterung empfange.«
Im Verlauf seines Kommentars zum Plato bemerkt der Autor dann weiter, dass „Eine dieser Arten Mania schon hinreichen könne, (besonders die zur Liebe gehörige), um die Seele zu ihrer ersten Göttlichkeit und Glückseligkeit zurückzuführen; aber dass eine innige Verbindung sie alle zur Einheit verknüpfe, und dass die gewöhnliche Ordnung, in welcher die Seele emporsteige, sei zuerst durch die musikalische, sodann durch die telestische oder mystische; drittens durch die prophetische; und zuletzt durch den Enthusiasmus der Liebe.«
Während ich mit verwirrtem Verstand und widerstrebender Aufmerksamkeit diesen verwickelten Erhabenheiten lauschte, schloss mein Ratgeber das Buch wieder, und sagte mit Wohlgefälligkeit: »Das ist das Motto für euer Buch — die Thesis für euer Thema!«
»Davus sum, non Oedipus«, sagte ich, missmutig den Kopf schüttelnd. »Das alles mag ausnehmend schön sein, aber, der Himmel vergebe es mir — ich verstehe kein Wort davon. Die Mysterien eurer Rosenkreuzer und eurer Brüderschaften sind nur ein Kinderspiel gegen das Rotwelsch der Platoniker.«
»Und doch könnt ihr, ehe ihr diese Stelle recht versteht, die höheren Theorien der Rosenkreuzer oder der noch edleren Brüderschaften, von welchen ihr so leicht sprecht, nicht verstehen.«
»O, wenn das ist, so stehe ich in Verzweiflung ab. Warum aber, da ihr in der Materie so bewandert seid, nehmt ihr nicht selbst das Motto für euch zu einem Buch?«
»Und wie, wenn ich schon ein Buch verfasst hätte, dessen Thema jener Satz bildet, wolltet ihr es für das Publikum zurichten?
»Mit dem größten Vergnügen«, sagte ich — ach, allzu rasch!
»Ich werde euch beim Wort nehmen«, versetzte der alte Herr, »und wenn ich nicht mehr bin, werdet ihr die Manuskripte erhalten. Nach dem, was ihr mir von dem herrschenden Geschmack in der Literatur sagt, kann ich euch nicht mit der Hoffnung schmeicheln, dass ihr mit dem Unternehmen viel gewinnen werdet. Und ich sage euch im Voraus, ihr werdet das Geschäft nicht wenig mühsam finden.«
»Ist euer Werk ein Roman?«
»Es ist ein Roman und ist es nicht. Es ist eine Wahrheit für die, die es verstehen können, und eine Fantasterei für die, die es nicht können.«
Endlich kamen die Manuskripte an, mit einem kurzen Briefchen meines verstorbenen Freundes, das mich an mein unvorsichtiges Versprechen erinnerte.
Mit kummervollem Interesse und doch mit lebhafter Ungeduld öffnete ich das Paket und putzte meine Lampe. Man denke sich meine Überraschung und meinen Verdruss, als ich das Ganze in unverständlichen Chiffren geschrieben fand. Ich gebe dem Leser hier eine Probe:
und so fort, 940 tödliche Blätter Propatriapapier! Ich traute kaum meinen Augen; in der Tat, es wollte mir nachgerade schon scheinen, die Lampe brenne ganz sonderbar blau, und seltsame Ahnungen von einer unheiligen Beschaffenheit der Schriftzüge, die ich so unvorbereitet aufgeschlagen, verbunden mit den wunderlichen Andeutungen und der mystischen Sprache des alten Herren, bewegten sich durch meine zerrüttete Fantasie. Wahrhaftig, um nichts Schlimmeres zu sagen, das ganze Ding sah unheimlich aus! Ich war im Begriff, die Papiere hastig in mein Pult zu schleudern, mit dem frommen Entschluss, nichts mehr damit zu tun haben zu wollen, als mein Auge auf ein Buch fiel, hübsch in blau Maroquin gebunden, das ich in meinem Eifer bisher übersehen hatte. Ich öffnete diesen Band mit großer Vorsicht, da ich nicht wusste, was herausspringen könnte, und — man denke sich meine Freude! ― fand, dass es einen Schlüssel oder ein Wörterbuch zu den Hieroglyphen enthielt.
Um den Leser nicht zu ermüden mit der Erzählung meiner Mühen, begnüge ich mich zu sagen, dass ich mich endlich imstande glaubte, die Charaktere zu deuten und mich mit Ernst ans Werk zu machen. Dennoch war es keine leichte Aufgabe und zwei Jahre verstoßen, ehe ich bedeutende Fortschritte gemacht hatte. Ich erlangte damals, um einen Versuch mit dem Publikum zu machen, die Einrückung einiger abgerissener Kapitel in eine periodisch erscheinende Schrift, mit welcher ich einige Monate in Verbindung zu stehen die Ehre hatte. Sie schienen mehr Aufsehen und Neugier zu erregen, als ich zu vermuten gewagt hatte; und ich ging mit neuem Mut an mein mühsames Unternehmen. Aber jetzt traf mich ein nettes Missgeschick; ich fand, wie ich weiter vorrückte, dass der Verfasser zwei Kopien seines Werkes gemacht hatte, die eine weit ausgearbeiteter und ausführlicher als die andere; mir war zuerst die frühere Kopie unter die Hände gekommen, und ich hatte nun das ganze Werk umzugestalten, hatte die schon geschriebenen Kapitel aufs neue zu übersetzen.
So darf ich denn sagen, dass mich, Zwischenzeiten abgerechnet, welche dringenderen Geschäften gewidmet waren, mein unseliges Versprechen eine mehrjährige Arbeit kostete, ehe ich es gänzlich erfüllen konnte. Die Aufgabe war um so schwieriger, als das Original in einer Art rhythmischer Prosa geschrieben ist, wie wenn der Wunsch des Verfassers gewesen wäre, dass sein Werk gewissermaßen als ein nach Idee und Plan poetisches betrachtet werden solle.
Diesem Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, war nicht möglich und bei dem Bestreben es zu tun, habe ich ohne Zweifel sehr oft die nachsichtige Billigkeit des Lesers in Anspruch zu nehmen. Meine natürliche Achtung vor des alten Herren grillenhaftem Gebaren mit einer Muse von zweideutigem Charakter muss meine einzige Entschuldigung sein, wenn öfters die Sprache, ohne sich zum üppigen Schmuck des Verses zu erheben, Blumen entlehnt, die der Prosa kaum natürlich sind. Auch verpflichtet mich die Wahrheit zu dem Bekenntnis, dass ich, trotz aller meiner Mühe, keineswegs gewiss bin, in jedem einzelnen Fall genau den richten Sinn der Chiffren wiedergegeben zu haben; ja, dass hin und wieder eine Lücke in der Erzählung, oder die plötzliche Aufnahme einer neuen Chiffre, für welche kein Schlüssel vorhanden war, mich nötigte, zu Interpolationen auf eigene Faust meine Zuflucht zu nehmen, die ohne Zweifel leicht kenntlich, aber, wie ich mir schmeichle, nicht im Widerspruch und Missklang mit der Idee des Ganzen sind. Dies Geständnis führt mich zu dem Satz, mit welchem ich schließen will: Wenn in diesem Buch etwas ist, o Leser, was dir gefällt, so ist es gewiss mein, so oft du aber auf etwas stößt, was dir missfällt, so lass den Tadel auf den alten Herrn fallen!
London, im Jahr 1841.
1 Die ländliche Heldin einer Erzählung von Wordsworth: „Der blöde Knabe.“
I. Der Musiker
Kapitel 1.1
In Neapel lebte und blühte in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts ein ehrenwerter Künstler, Gaetano Pisani mit Namen. Er war ein Musiker von großem Genius, aber von nicht sehr populären Ruf; in allen seinen Kompositionen war etwas Launenhaftes und Fantastisches, was dem Geschmack der Musikliebhaber in Neapel nicht zusagte. Er war ein Freund von fremdartigen Vorwürfen, die er mit Arten und Symphonien ausstattete, welche in den Hörern eine Art Angst und Entsetzen erweckte. Die Namen feiner Stücke schon werden vermutlich einen Begriff von ihrer Beschaffenheit geben. Ich finde z. B. unter seinen Manuskripten folgende Titel: „Das Fest der Harpye“, „Die Herrn zu Benevento“, „Das Hinabsteigen des Orpheus in den Hades“, „Der böse Blick“, „Die Eumeniden“, und manche andere, die eine gewaltige Einbildungskraft beurkunden, welche sich im Unsichtbaren und Übernatürlichen gefällt, aber oft, vermögen einer erhabenen und zarten Fantasie, durch Passagen von ausnehmender Anmut und Schönheit erfreut. Es ist wahr, dass, bei der Wahl seiner Vorwürfe uns der alten Fabel, Gaetano Pisani dem fernen Ursprung und dem früheren Genius der italienischen Oper weit treuer blieb, als seine Zeitgenossen. Dieser zwar verweichlichte Sprössling aus der alten Vermählung von Gesang und Drama hatte, als er nach langer Verborgenheit und Entthronung, ein schwaches Zepter, wenn auch einen prächtigeren Purpur, an den Ufern des etrurischen Arno oder unter den Lagunen Venedigs wieder erlangte, alle seine ersten Eingebungen aus den fernliegenden klassischen Quellen der heidnischen Sage geschöpft; und Pisanis „Hinabsteigen in den Hades“ war nur eine kühnere, dunklere und wissenschaftliche Wiederholung der „Eurydike“, welche Jacopo Peri in Musik gesetzt hatte bei der festlichen Hochzeit Heinrichs non Navarra mit Maria von Medicis.1 Dennoch, wie schon gesagt, behagte im Ganzen der Stil des neapolitanischen Musikers den Ohren wenig, welche durch die mehr süßen und schmeichelnden Melodien des Tages verzärtelt und ekel geworden waren; und leicht zu entdeckende Fehler und Ausschweifungen, die oft dem Anschein nach ganz mutwillig waren, dienten den Kritikern als Entschuldigung ihrer Abneigung. Zum Glück — denn sonst hätte der arme Musiker Hungers sterben können — war er nicht bloß Komponist, sondern auch ein trefflicher ausübender Künstler, besondere auf der Violine und mit diesem Instrument erwarb er sich ein anständiges Auskommen als Mitglied des Orchesters bei dem großen Theater San Carlo. Hier hielten förmlich und streng vorgeschriebene Aufgaben seine exzentrischen Launen notwendigerweise so ziemlich im Zaum, obwohl berichtet wird, dass er nicht weniger alle fünf Mal von seinem Notenpult habe abtreten müssen, weil er die Kenner erschreckt, und das ganze Orchester in Verwirrung gebracht hatte durch improvisierte Variationen von so ergreifender und wahnsinniger Art, dass man wohl hätte wähnen können, die Harpyien oder Hexen, welche ihm seine Kompositionen eingaben, haben mit ihren Krallen sein Instrument gepackt. Aber die Unmöglichkeit, einen gleich trefflichen Künstler, wie er, in seinen hellen und ordentlichen Zeiten, war, aufzutreiben, hatte seine Wiederanstellung geboten und er hatte sich jetzt fast gänzlich mit der beschränkten Sphäre der ihm vorgeschriebenen Adagios und Allegros versöhnt. Auch das Publikum, bekannt mit seinen Neigungen, bemerkte sehr schnell die leiseste Abweichung vom Text; und wenn er einen Augenblick sich verirrte, was sich dem Auge ebenso wie dem Ohr verriet, durch eine seltsame Verzerrung des Gesichts und ein ominöses Schwingen seines Bogens, rief ein leises warnendes Gemurmel den Musiker aus seinem Elysium oder Tartarus zu den nüchternen Regionen seines Notenpultes zurück. Dann fuhr er auf wie aus einem Traum, — warf einen hastigen, ängstlichem und Entschuldigung bittenden Blick um sich und zwang mit einem gedemütigten kleinlauten Wesen sein rebellisches Instrument in das ausgetretene Gleise der glatten Eintönigkeit zurück. Zu Haus aber pflegte er sich für seine widerwillige Knechtsarbeit schadlos zu halten. Da griff er mit ungestümen Fingern auf der unglücklichen Violine herum, und erpresste ihr, oft bis der Morgen heraufkam, seltsame, wilde Noten, welche den frühen Fischer am Gestade unten mit abergläubischem Grausen durchzückten, dass er sich bekreuzte, als hätten Nixen oder Geister eine überirdische Musik ihm ins Ohr gestöhnt.
Die Erscheinung dieses Mannes war ganz in Übereinstimmung mit dem Charakter seiner Kunst. Die Züge waren edel und regelmäßig, aber sein Gesicht hohl und mager, mit schwarzen, nachlässigen Locken, in ein Labyrinth von Ringeln verschlungen und einem starren, brütenden, träumerischen Blick aus den großen, tief liegenden Augen. Alle seine Bewegungen waren eigentümlich, hastig, unzusammenhängend, wie ihn gerade Gefühl und Gedanke beherrschten; und wenn er durch die Straßen oder am Meeresufer hinwandelte, hörte man ihn lachen und mit sich selbst sprechen. Im Ganzen war er ein unschuldiges, harmloses, sanftes Geschöpf, und teilte gern sein Bisschen mit jedem der müßigen Lazzaroni, welche zu betrachten, wenn sie sich so faul und behaglich in der Sonne wärmten, er oft ausdrücklich stehen blieb. Doch war er gänzlich ungesellig. Er erwarb sich keine Freunde, schmeichelte keinen Gönnern, suchte keine von den Lustbarkeiten auf, die sonst den Kindern der Musik und des Südens so lieb sind. Er und seine Musik schienen allein für einander zu passen — beide seltsam, ursprünglich, unweltlich, unregelmäßig. Man konnte den Mann nicht sondern von seiner Musik ― sie war er selbst. Ohne sie war er Nichts, eine bloße Maschine. Mit ihr war er König über Welten, die ganz sein gehörten. Der arme Mann, er hatte in dieser Welt wenig genug! — In einer Manufakturstadt in England ist ein Grabstein, dessen Inschrift spricht von einem: „Claudius Phillipps, dessen gänzliche Verachtung des Reichtums und unnachahmliches Spiel auf der Violine ihn zur Bewunderung aller machte, die ihn kannten!“ Logische Verbindung von entgegengesetzten Lobsprüchen! Im Verhältnis, o Genius, zu dritter Verachtung des Reichtums sieht dein kunstvolles Spielen der Violine.
Gaetano Pisanis Talente als Komponist hatten sich hauptsächlich betätigt in Musik, welche für dies sein Lieblingsinstrument berechnet war, ― unstreitig in den ihm zu Gebote stehenden Mitteln und seiner Macht über die Leidenschaften das mannigfaltigste, das königlichste unter allen. Was Shakespeare unter den Dichtern, ist die Cremoneser Geige unter den Instrumenten. Doch hatte er auch andere Musikstücke gesetzt von umfassenderen Ansprüchen und reicheren Eigenschaften, und darunter seine kostbare — seine unverkaufte — seine nicht veröffentlichte, nicht zu veröffentlichende und unvergängliche Oper: „Die Sirene.“
Dies große Werk war der Traum seiner Jugend gewesen — die Geliebte seiner Mannesjahre; im vorgerückteren Alter „stand sie neben ihm, wie seine Jugend.“ Umsonst hatte er gerungen, sie der Welt hinzustellen. Selbst der sanfte, uneifersüchtige Paesiello, der Kapellmeister, schüttelte sein wildes Haupt, als der Musiker ihm eine Probe aus einer der erschütterndsten Szenen mitteilte. Und doch, Paesiello, obgleich diese Musik abweicht von allem, was Durante dich nacheifernd erstreben lehrte, doch mag — aber Geduld, Gaetano Pisani! — erwarte deine Zeit und halte deine Violine gestimmt!
So sonderbar es dem schöneren Teil meiner Leser erscheinen mag, dieser groteske Mann hatte doch auch jene Bande geknüpft, welche von gewöhnlichen Sterblichen gern als ihr ausschließliches Monopol betrachtet werden — er war verheiratet und hatte ein Kind. Was noch seltsamer: seine Gattin war eine Tochter des ruhigen, nüchternen, unfantastischen Englands; sie war viel junger als er; sie war sanft und blond, mit einem holden englischen Gesicht; sie hatte ihn aus freier Wahl geheiratet, und (werdet ihr es glauben?) sie liebte ihn auch.
Wie sie dazu kam, ihn zu heiraten, oder wie dieser scheue, ungesellige, grillenhafte Mann je wagte, einen Heiratsantrag zu machen, kann ich nur mit der Gegenfrage beantworten, wie ihr, wenn ihr euch umseht, mir erklären wollt, wie die Hälfte der Männer und Weiber, die euch vorkommen, je Gatten fanden? Doch bei näherer Überlegung war diese Verbindung eigentlich gar nicht so außerordentlich. Das Mädchen war das natürliche Kind von Eltern, die zu edel waren, um sie je anzuerkennen und zu sich zu nehmen. Sie wurde nach Italien gebracht, um die Kunst zu erlernen, von welcher sie leben sollte, denn sie besaß Geschmack und Stimme; sie war sehr abhängig und hart behandelt und der arme Pisani war ihr Lehrmeister und seine Stimme seit ihrer Wiegenzeit die einzige, die keinen Ton des Spottes oder des Schellens zu haben schien. Und so — nun , ist das Übrige natürlich? Natürlich oder nicht, sie heirateten sich. Das junge Weib liebte ihren Gatten; und so jung und sanft sie war, doch könnte man beinahe sagen, sie habe beide geschützt und beschirmt. Aus wie vielen Ungnaden bei den Despoten von San Carlo und beim Konservatorium hatte ihre geheime, geschäftige Vermittlung ihn gerettet! In wie vielen Kränklichkeiten — denn sein Körper war schwächlich ― hatte sie ihn gewartet und gepflegt. Oft in den dunklen Nächten wartete sie am Theater, um ihm mit ihrer Laterne heimzuleuchten, ihn mit ihrem festen Arme zu unterstützen; denn sonst, wer weiß, ob nicht der Musiker in seiner träumerischen Zerstreutheit seiner Sirene nach ins Meer hineingewandelt wäre. Und dann hörte sie so geduldig, vielleicht auch (denn der echten Liebe wohnt nicht eben immer der feinste Geschmack bei), so entzückt jene Stürme exzentrischer und fieberhafter Melodien an und entführte ihn — immerfort Lob und Bewunderung flüsternd — von seiner ungesunden Nachtwache zu Ruhe und Schlaf! Ich habe gesagt, seine Musik sei ein Teil des Mannes gewesen und dies sanfte Wesen schien ein Teil der Musik; in der Tat, nur wenn sie an der Seite saß, schlich sich, was in seiner bunten Fantasie Zärtliches oder Feenhaftes war, wie verstohlen in die Harmonie ein. Ohne Zweifel wirkte ihre Gegenwart auf die Musik, gestaltete und milderte sie, aber er, der nie untersuchte, woher seine Begeisterung kam oder was sie war, wusste es nicht. Alles, was er wusste, war, dass er sie liebte und segnete.
Er bildete sich ein, er sage ihr das zwanzigmal des Tages; aber er tat es nie, denn er war nicht ein Mann von vielen Worten, selbst gegen seine Frau nicht. Seine Sprache war seine Musik, wie die ihrige — ihr Sorgen! Er war mitteilsamer gegen ein Barbiton, wie der gelehrte Mersennus alle Varietäten der großen Familie der Violine zu nennen uns anrät. Gewiss klingt Barbiton besser als Geige; und so sei es denn Barbiton. Mit ihm sprach er Stunden lang an einem fort; er lobte es, schalt es, schmeichelte ihm, ja, (so ist der Mensch, auch der harmloseste!) man hatte ihn dabei schwören hören; aber für diesen Fehltritt büßte er immer mit den reuevollsten Gewissensbissen und das Barbiton hatte seine eigene Zunge, konnte seine eigene Rolle spielen und wenn es auch schalt, befand es sich am besten dabei. Es war ein edler Kamerad, das Barbiton! Ein Tyroler, das Werk des berühmten Steiner. In seinem hohen Alter lag etwas Geheimnisvolles. Wie viele Hände, jetzt Staub, hatten seinen Saiten Töne entlockt, ehe es der Hausgenosse und Geist Gaetano Pisanis war! Selbst sein Behälter war ehrwürdig, — schön gemalt, wie es hieß von Caracci. Ein englischer Sammler hatte mehr für den Behälter geboten, als Pisani je mit der Violine erworben hätte. Aber Pisani, dem es gleichgültig gewesen wäre, wenn er selbst eine Hütte bewohnt hätte, war stolz auf den Palast, den sein Barbiton hatte; sein Barbiton — es war sein älteres Kind! Er hatte noch ein Kind, und zu diesem müssen wir uns jetzt wenden.
Wie soll ich dich schildern, Viola? Gewiss hatte die Musik ihren Anteil an dem Kommen dieses jungen Gastes. Denn in ihrer Gestalt wie in ihrem Charakter konnte man eine Familienähnlichkeit entdecken mit jenem eigentümlichen und geisterhaften Tonleben, das Nacht für Nacht in lustigem und feenhaftem Spiel über das sternfunkelnde Meer sich ergoss … Schön war sie, aber von einer ganz ungemeinen Schönheit — eine Verschmelzung, eine Harmonie von entgegengesetzten Eigenschaften: — ihr Haar von reicherem und reinerem Gold, als man selbst im Norden sieht, aber die Augen ganz voll des dunkelsten, zartesten, schmachtendsten Lichtes von mehr als italienischem — von beinahe orientalischem Glanz; die Farbe ausnehmend schön, aber nie dieselbe — lebhaft im einen Augenblick, blass im anderen. Und mit der Färbung wechselte auch der Ausdruck; — es gab bald nichts so Trauriges, bald nichts so Fröhliches.
Mit Bedauern muss ich sagen, dass, was man eigentlich Erziehung nennen kann, von diesem seltsamen Paar bei ihrer Tochter sehr vernachlässigt wurde. Freilich hatte keines von beiden viele Kenntnisse mitzuteilen und Gelehrsamkeit war damals nicht Mode, wie jetzt. Aber der Zufall oder die Natur begünstigte die junge Viola. Sie lernte, als etwas ganz Natürliches, ihrer Mutter Sprache zugleich mit der ihres Vaters. Und bald konnte sie lesen und schreiben, und ihre Mutter, eine Katholikin, beiläufig bemerkt, lehrte sie beizeiten beten. Aber dann machten ― allen diesen geistigen Erwerbungen entgegenarbeitend! ― die seltsamen Angewöhnungen Pisanis und die unablässige Pflege und Sorgfalt, deren er von seinem Weib bedurfte, dass das Kind oft allein blieb mit einer alten Wärterin, die es zwar herzlich liebte, aber keineswegs geeignet war, sie zu unterrichten. Dame Gianetta war jeden Zoll eine Italienerin und Neapolitanerin. Ihre Jugend war ganz Liebe gewesen und ihr Alter war ganz Aberglauben. Sie war redselig, zärtlich — eine Schwätzerin. Jetzt plauderte sie dem Mädchen vor von Cavalieren und Prinzen zu ihren Füßen und dann machte sie ihr wieder das Blut erstarren mit Märchen und Sagen, vielleicht so alt als die griechische oder etruskische Fabel ― von Dämonen und Vampiren — von den Tänzen um den großen Walnussbaum zu Benevento und dem beschädigenden Zauber des bösen Blickes. Alles das trug in der Stille dazu bei, bezaubernde Netze über Violas Fantasie zu weben, welche zu zerreißen Nachdenken und reifere Jahre sich umsonst bemühen mochten. Und dies alles machte sie ganz besonders geeignet, mit einer bangen Freude an ihres Vaters Musik zu hängen. Diese geisterhaften Noten, immerdar ringend, in wilde, abgebrochene Töne die Sprache überirdischer Wesen zu übersetzen, umschwebten sie von ihrer Geburt an. So hätte man sagen können: ihr ganzes Gemüt sei voll Musik gewesen — Mahnungen, Erinnerungen, angenehme oder schmerzliche Empfindungen — alles war unauflöslich vermischt mit jenen Tönen, die sie bald entzückten, bald ängstigten — die sie begrüßten, wenn sie ihr Auge gegen die Sonne öffnete und sie zitternd weckten auf ihrem einsamen Lager im Dunkel der Nacht. Die Legenden und Märchen Gianettas dienten nur dazu, das Kind die Bedeutung jener geheimnisvollen Töne besser verstehen zu machen, sie lieferten ihr die Worte zu der Musik. Es war natürlich, dass die Tochter eines solchen Vaters bald einigen Geschmack an seiner Kunst zeigte. Aber dieser entwickelte sich hauptsächlich im Ohr und in der Stimme. Sie war noch ein Kind, als sie göttlich sang. Ein großer Kardinal, — groß ebenso im Staat wie im Konservatorium, hörte von ihren Anlagen und ließ sie zu sich holen. Von diesem Augenblick an war ihr Schicksal entschieden; sie sollte der künftige Stolz Neapels, die Prima Donna von San Carlo werden. Der Kardinal drang auf die Erfüllung seiner eigenen Vorhersagungen und sorgte für die berühmtesten Lehrer für sie. Um ihr den Geist des Ehrgeizes und Wetteifers einzuflößen, nahm seine Eminenz sie eines Abends mit in seine Loge; musste einen Eindruck auf sie machen, die Darstellung zu scheu, — einen noch größeren, den Beifall zu hören, welchen man an die schimmernden Signoras verschwendete, die sie später ausstechen sollte! O! wie herrlich und glänzend ging ihr dies Leben der Bühne — diese Feenwelt von Musik und Gesang auf! Es war die einzige Welt, welche ihren seltsamen kindischen Gedanken zu entsprechen schien. Es war ihr, als ob sie bisher an eine fremde Küste verschlagen, endlich dazu gekommen wäre, die Gestalten ihrer Heimat zu sehen, ihre Sprache zu hören. Schöner und echter Enthusiasmus, reich an Verheißungen des Genius! Knabe oder Mann, du wirst nie ein Dichter werden, wenn du nicht das Ideal, die Romantik, die steh vor dir auftuende Calypsos-Insel empfunden hast, als zum ersten Mal der magische Vorhang aufgezogen war, und die Welt der Poesie in die Welt der Prosa hereintreten ließ! Und jetzt war die Einführung und Weihe begonnen. Sie musste lesen, studieren, ausdrücken mit einer Gebärde, einem Blick, die Leidenschaften, die sie auf den Brettern darstellen sollte; eine gefährliche Schule freilich für manche, aber nicht für den reinen Enthusiasmus, der aus der Kunst entspringt; denn der Geist, der die Kunst recht in sich aufnimmt, ist nur ein Spiegel, der, was auf seine Fläche fällt, getreu zurückgibt, solange er unbefleckt ist. Sie bemächtigte sich der Natur und Wahrheit mit intuitiver Sicherheit. Ihre Rezitation war bald voll unbewusster Gewalt, ihre Stimme rührte das Herz zu Tränen, oder erwärmte es zu edlem Zorn. Aber dies rührte von der Sympathie her, welche der Genius immer selbst in seiner frühesten Unschuld mit allem hat, was nur immer fühlt, oder strebt, oder leidet. Es war nicht ein frühes reifes weibliches Wesen, das die Liebe oder Eifersucht verstanden hatte, welche die Worte aussprachen; ihre Kunst war eines jener wunderbaren Geheimnisse, die uns die Psychologen enträtseln mögen, wenn sie Lust haben, und uns sagen: warum Kinder vom einfältigsten Gemüt und vom reinsten Herzen oft so scharfsinnig zu unterscheiden wissen in den Märchen, die man ihnen erzählt, in den Liedern, die man ihnen singt, den Unterschied zwischen der wahren und der falschen Kunst — Leidenschaft und Jargon — Homer und Racine, — wenn aus Herzen, die noch nicht empfunden haben, was sie wiederholen, die melodischen Akzente des natürlichen Pathos widerhallen.
Außer ihren Studien war Viola ein einfaches, gefühlvolles, aber etwas launenhaftes Kind; launenhaft nicht in ihrem Temperament, denn dies war sanft und folgsam, aber in ihrer Stimmung, die, wie ich oben angedeutet, von Traurigkeit zur Fröhlichkeit, und von der Lustigkeit zum Trübsinn ohne eine in die Augen fallende Ursache umschlug. Wenn es eine Ursache davon gab, so musste man sie in den frühen geheimnisvollen Einflüssen suchen, die oben angedeutet worden, wo ich gesucht die Wirkung zu erklären, welche auf ihre Einbildungskraft die sie beständig umspielenden rastlosen Tonströmungen hervorbrachten, denn es ist bemerkenswert, dass solchen, welche für die Wirkungen der Musik sehr empfänglich sind, Melodien und Noten oft, bei den alltäglichen Geschäften des Lebens, wieder Vorkommen, sie gleichsam verfolgen und quälen. Die Musik, einmal in die Seele aufgenommen, wird auch eine Art von Geist und stirbt nie. Sie wandelt verstört durch die Hallen und Gänge des Gedächtnisses, und oft hört man sie wieder deutlich und lebendig, wie damals, als sie zuerst mit ihren Schwingungen durch die Luft zitterte. Diese Gespenster von Tönen nun tauchten zu Zeiten ihrer Fantasie wieder auf; die fröhlichen, um jedem Grübchen ein Lächeln zu entlocken; die traurigen, um einen Schatten auf ihre Stirne zu werfen, und zu machen, dass sie ihrer kindischen Fröhlichkeit vergaß, sich bei Seite setzte, und vor sich hin brütete.
Mit Recht daher konnte in einem bildlichen Sinne dies holde Geschöpf, so luftig in ihrer Bildung, so harmonisch in ihrer Schönheit, so fremdartig in ihrem Wesen und ihren Gedanken — mit Recht konnte sie eine Tochter — weniger des Musikers, als — der Musik selbst genannt werden — ein Wesen, dem, wie man leicht auf den Gedanken kommen konnte, ein Geschick Vorbehalten war, das weniger der Wirklichkeit angehören mochte als der Romantik, die, sehenden Augen und fühlenden Herzen erkennbar, immer mit und neben dem wirklichen Leben, Strom an Strom dahingleitet, dem dunkeln Ozean zu.
Und daher erschien es nicht sonderbar, dass Viola selbst schon als Kind, und noch mehr als sie in den süßen Ernst der jungfräulichen Jugend hinüber blühte, sich einbildete, ihrem Leben sei ein Los — des Glückes oder des Wehes — bestimmt und zugeteilt, das der Romantik und Träumerei, worin sie als in ihrer Atmosphäre atmete, entsprechen wurde. Häufig klomm sie durch das Dickicht, das die benachbarte Grotte Pofilipo — das gewaltige Werk der alten Cimmerier — überkleidete, und hing, an dem vielbesuchten Grabe Virgils sitzend, jenen Gesichten nach, deren feine Nebelhaftigkeit keine Poesie greifbar machen und gestalten kann; — denn der Dichter, der alle, die je gesungen, übertrifft, ist das Herz der träumenden Jugend. Häufig auch saß sie neben der Schwelle, welche das Nebenlaub umrankte, im Angesicht der dunkelblauen, willenlosen See, am Herbstmittag oder in der Dämmerung des Sommers und baute ihre Luftschlösser. Wer tut nicht dasselbe — nicht bloß in der Jugend, sondern selbst mit den getrübten Hoffnungen des Alters? Des Menschen Vorrecht ist es zu träumen; das gemeinsame Fürstenrecht des Bauers und des Königs. Aber jene wachen Tagesträume Violas waren regelmäßiger, deutlicher und ernster, als welchen die meisten von uns nachhängen. Sie schienen, wie die Schauungen der Griechen, Prophezeiungen, während es nur Fantasmen waren.
1 Orpheus war der Lieblingsheld der früheren italienischen Oper oder des lyrischen Dramas. Der „Orfeo“ von Angelo Politiano war 1475 aufgeführt. Der Orfeo von Montevere war in Venedig 1667 dargestellt.
Kapitel 1.2
Jetzt endlich ist die Bildung vollendet! Viola ist beinahe sechzehn Jahre alt. Der Kardinal erklärt, dass die Zeit gekommen, wo der neue Name eingetragen werden soll in das libro d'oro, das goldene Buch, welches Vorbehalten ist den Kindern der Kunst und des Gesanges. Ja, aber in welcher Rolle? — Wessen Genius soll sie Gestalt und Verkörperung leihen? Ha, das ist das Geheimnis! Gerüchte gehen um, dass der unerschöpfliche Paesiello, entzückt über ihren Vortrag seines „Nel cor più non mi sento” und seines „Io son Lindoro”, neues Meisterstück schaffen werde, um die Debütantin einzuführen. Andere bestehen darauf, dass ihre Stärke im Komischen liege, und dass Cimarosa eifrigst beschäftigt sei, mit einem neuen „Matrimonio segreto.”
Mittlerweile aber ist in der Diplomatie irgendetwas quer gegangen und verstimmt. Man hat bemerkt, dass der Kardinal übler Laune ist. Er hat öffentlich gesagt — und die Worte sind unheilbedeutend — „das einfältige Mädchen ist so toll wie ihr Vater — was sie verlangt, ist ganz verkehrt!” Besprechung folgt auf Besprechung — der Kardinal redet dem armen Mädchen sehr ernstlich zu in seinem Kabinett — alles umsonst. Neapel ist außer sich vor Neugier und Vermutungen. Die Ermahnung endet mit einem Streit, und Viola kommt heim, mürrisch und schmollend, sie will nicht auftreten — sie hat das Engagement aufgesagt.
Pisani, zu unerfahren, um alle Gefahren der Bühne zu kennen, hatte sich gefreut bei der Vorstellung, dass wenigstens eine von seinem Namen, in seiner Kunst neuen Ruhm erwerben werde. Des Mädchens Verkehrtheit missfiel ihm. Er sagte jedoch nichts — er schalt nie mit Worten, aber er nahm das getreue Barbiton. O! getreues Barbiton, wie entsetzlich schaltest du! Es kreischte — es belferte — es stöhnte — es grollte. Und Violas Augen füllten sich mit Tränen, denn sie verstand diese Sprache. Sie schlich zu ihrer Mutter und flüsterte ihr ins Ohr; und als Pisani sein Geigen aufgab, siehe! da weinten Mutter und Tochter. Er starrte sie verwundert an, und dann, als wenn er fühlte, dass er zu hart gewesen, floh er wieder zu seinem Hausgeist. Und jetzt hätte man glauben können, das Wiegenlied zu hören, das eine Fee einem unruhigen ausgewechselten Kind singe, das sie angenommen und zu beschwichtigen suche. Flüssig, leise, silberhell quollen die Töne unter dem bezauberten Bogen, der hartnäckigste Gram hätte darauf lauschen müssen; und bei all dem kam zu Zeiten eine wilde, lustige, gellende Note, wie ein Gelächter, aber kein bitteres Gelächter. Es war eine seiner gelungensten Melodien aus seiner geliebten Oper — die Sirene, im Begriff die Wellen und Winde in Schlaf zu zaubern. Der Himmel weiß, was weiter gekommen wäre, aber sein Arm ward gehemmt, Viola hatte sich an seine Brust geworfen, und küsste ihn glücklichen Augen, die durch ihr sonniges Haar hindurch lächelten. In diesem Augenblick ging die Tür auf — eine Botschaft vom Kardinal. Viola musste sofort zu Sr. Eminenz. Ihre Mutter ging mit ihr. Alles war ausgeglichen und abgemacht! Viola hatte ihren Willen und wählte sich selbst ihre Oper.
O ihr schwerfälligen, stumpfen Völker des Nordens mit euren Zänkereien und Wortkämpfen, mit eurem lärmenden Leben auf der Pnyr und der Agora! — ihr habt keine Ahnung davon, welche Aufregung in dem ganzen musikalischen Neapel erregt wurde durch das Gerücht von einer neuen Oper und einer neuen Sängerin! Aber wessen Oper? Keine Kabinettsintrige wurde je so geheim gehalten. Pisani kam in einer Nacht einmal sichtlich verstört und zornig vom Theater heim. Wehe deinem Ohre, hättest du in jener Nacht das Barbiton gehört! Man hatte ihn in seinem Amt suspendiert — man fürchtete, die neue Oper und das erste Auftreten seiner Tochter als Prima Donna möchte für seine Nerven zu viel sein. Und seine Variationen, seine Teufeleien von Sirenen und Harpyien drohten in einer solchen Nacht mit einer Gefahr, die man sich nicht ohne Grausen denken konnte. Aber bei Seite gesetzt zu werden, und das in eben der Nacht, wo sein Kind, dessen Melodie nur ein Ausfluss seiner eigenen war, auftreten sollte — um einem neuen Nebenbuhler Platz zu machen, das war zu viel für eines Musikers Fleisch und Blut. Zum ersten Mal sprach er in Worten von der Sache, und fragte ernst, — denn diese Frage konnte das Barbiton mit all seiner Beredsamkeit nicht deutlich ausdrücken — was die Oper sei und was die Rolle? Und Viola antwortete eben so ernst, dass sie dem Kardinal ihr Wort gegeben, es nicht zu verraten. Pisani sagte nichts, aber verschwand mit seiner Violine, und alsbald hörten sie den Hausgeist vom Dach des Hauses (wohin der Musiker in der schlimmsten Laune manchmal floh), winseln und seufzen, als wäre ihm das Herz gebrochen.
Die zärtlichen Gefühle Pisani's waren äußerlich wenig sichtbar. Er war keiner von jenen zärtlichen liebkosenden Vätern, deren Kinder immer um ihre Knie herum spielen; sein Geist und seine Seele waren so ganz bei seiner Kunst, dass das häusliche Leben ihm dahinglitt, anscheinend als wenn dieses ein Traum und die Kunst die wesenhafte Form und Leiblichkeit des Daseins wäre. Personen, die ein abstraktes Studium treiben, sind oft so; die Mathematiker sind hierin sprichwörtlich geworden. Als zu dem berühmten französischen Philosophen sein Diener gerannt kam und schrie: »… das Haus steht in Flammen, Herr!« sagte der weise Mann, indem er sich wieder zu seinen Problemen hinsetzte: »So geh und sag es meiner Frau, du Narr! mische ich mich denn je in häusliche Angelegenheiten?« Aber was ist Mathematik gegen Musik — Musik, die nicht nur Opern komponiert, sondern auf dem Barbiton spielt! Wisst ihr, was der berühmte Giardini sagte, als der Anfänger ihn fragte, wie viel Zeit er brauchen würde, das Violinspieler zu lernen? Hört es und verzweifelt, ihr, die ihr den Bogen spannen möchtet, gegen welchen der des Ulysses ein Kinderspiel war: »Zwölf Stunden täglich, zwanzig Jahre hindurch!« Und kann nun ein Mann, der das Barbiton spielt, immerfort auch mit seinen Kindern spielen? Nein Pisani! oft hatte die arme Viola, mit der lebhaften Empfindlichkeit der Kinder, sich aus dem Zimmer gestohlen und geweint bei dem Gedanken, dass du sie nicht liebst. Und doch, unter dieser äußerlichen Zerstreutheit des Künstlers, quoll eben so frisch und stark die natürliche Zärtlichkeit; und als sie heranwuchs, hatte die Träumerin den Träumer verstanden, und nun — er selbst ausgeschlossen von allem Ruhm — ausgeschlossen selbst davon, seiner Tochter Ruhm zu begrüßen! — und diese Tochter selbst in der Verschwörung gegen ihn! Schärfer als Schlangenbisse war der Schmerz über diese Undankbarkeit, und schärfer als Schlangenbisse war das Wehklagen des bemitleidenden Barbiton!
Die verhängnisvolle Stunde ist gekommen. Viola ist in das Theater gegangen — ihre Mutter mit ihr. Der erbitterte Musiker bleibt zu Hause. Gianetta stürzt ins Zimmer — des Herrn Kardinals Wagen steht vor der Haustür — er schickt nach dem Padrone. Dieser muss seine Violine weglegen — er muss seinen Brokatrock und seine Spitzenmanschetten anziehen. Da sind sie — schnell, schnell! Und schnell rollt die vergoldete Kutsche dahin, und majestätisch sitzt der Kutscher oben, und stattlich bäumen sich die Rosse.
Der arme Pisani ist versunken in einen Nebel unbehaglichen Erstaunens. Er kommt am Theater an, er steigt bei dem großen Thor aus — er dreht sich um und um, und schaut nach allen Seiten — er vermisst etwas. — Wo ist die Violine? Ach, seine Seele, sein tiefstes Selbst ist zurückgeblieben! Er ist nur ein Automat, den die Lakaien die Treppen hinauf führen, durch den Gang in die Loge des Kardinals. Aber jetzt — was stürmt auf ihn herein? Ist es ein Traum? Der erste Akt ist vorüber (man ließ ihn erst holen, als der Erfolg nicht mehr zweifelhaft schien). Der erste Akt hat alles entschieden. Das fühlt er aus der elektrischen Sympathie, welche jedes einzelne Herz auf einmal mit einem großen Publikum verbindet.
Er erkennt es aus der atemlosen Stille dieser Menge — er erkennt es selbst aus dem aufgehobenen Finger des Kardinals. Er steht seine Viola auf der Bühne, strahlend in ihren Gewändern und Edelsteinen — er hört ihre Stimme durch das Herz jedes Einzelnen von Tausenden dringen! Aber die Szene — die Rolle — die Musik! Es ist sein anderes Kind — sein unsterbliches Kind — das Geisterkind seiner Seele — sein Liebling von vielen Jahren der verborgenen Geduld und des schmachtenden Genius — sein Meisterstück — seine Oper: die Sirene!
Das also war das Rätsel, das ihn so erbittert — das die Ursache des Streites mit dem Kardinal — dies das Geheimnis, das nicht kund werden durfte, bis der Erfolg errungen war, und die Tochter ihres Vaters Triumph mit ihren, eigenen vermählt hatte!
Und da steht sie, und alle Seelen beugen sich vor ihr — schöner als die Sirene selbst, die er aus den Tiefen der Melodie hervorgerufen! O! späte und süße Belohnung des mühevollen Ringens! Wo ist auf Erden eine Wonne gleich der, welche der Genius empfindet, wenn er endlich aus seiner verborgenen Höhle an das Licht des Ruhmes hervortritt!
Er sprach nicht — er rührte sich nicht — er stand wie angenagelt, —die Tränen rollten ihm über die Wangen — nur von Zeit zu Zeit bewegten sich seine Hände in der Luft — mechanisch suchten sie nach dem treuen Instrument — warum war es nicht da, seinen Triumph zu teilen?
Endlich fiel der Vorhang; aber unter welch einem Sturm und Gedröhne des Beifalls! Aufstand das Publikum wie ein Mann — wie mit einer Stimme wurde der teure Name jauchzend gerufen. Sie trat vor — zitternd, blass — und von der ganzen Versammlung sah sie nur ihres Vaters Antlitz. Die Anwesenden folgten den Blicken dieser feuchten Augen — sie erkannten mit einem süßen Schauer das Gefühl und den Sinn der Tochter. Der gute alte Kardinal zog ihn sanft hervor. Wilder Musiker! Deine Tochter hat dir mehr zurückgegeben, als das Leben, das du ihr gabst!
»Meine arme Violine!«, sagte er, sich die Augen wischend — »jetzt werden sie dich nicht mehr auszischen!«
Kapitel 1.3
Trotz des Triumphs der Sängerin und der Oper war dennoch während des ersten Akts ein Moment gewesen, — mithin vor der Ankunft Pisanis, wo die Waage mehr als zweifelhaft schwankte. Es war bei einem Chor, ganz voll von den Eigentümlichkeiten des Komponisten, und als dieser Malstrom von capricci brauste und schäumte, und Ohr und Sinn durch alle Wechsel der Töne riss, erkannte das Publikum im gleichen Augenblicke die Hand Pisanis. Man hatte der Oper einen Namen gegeben, welcher bisher alle Vermutung ihrer Herkunft verhindert hatte; und die Ouvertüre und der Anfang, wo die Musik regelmäßig und sanft war, hatten das Publikum glauben machen, es wehe darin der Genius seines geliebten Paesiello. Lang gewohnt, die Bestrebungen und Ansprüche Pisanis als Komponist zu verspotten und beinahe zu verachten, wollte sie es jetzt bedünken, als wären sie durch einen Betrug und auf ungebührliche Weise zu dem Beifall vermocht worden, womit sie die Ouvertüre und die ersten Szenen begrüßt hatten. Ein ominöses Gemurmel durchflog das Haus; — die Singenden, das Orchester, von einer elektrischen Empfindlichkeit für die Eindrücke und Gefühle des Publikums, wurden selbst unruhig und verlegen, und ließen in der Energie und Präzision nach, welche allein der grotesken Musik den Sieg verschaffen konnten.
In jedem Theater gibt es immer viele Rivalen eines neuen Autors, eines neu aufstrebenden Künstlers — eine Partei, die immer unmächtig ist, solang alles gut geht, aber ein gefährlicher Hinterhalt, im Augenblick, wo ein Zufall den Marsch auf das Ziel des Triumphs zu in Verwirrung bringt. Ein Zischen erhob sich; zwar beschränkte es sich auf Wenige, aber das bedeutsame Verstummen alles Applauses schien den bevorstehenden Augenblick zu weissagen, wo das Missfallen ansteckend werden würde. Ein Hauch konnte die drohende Lawine in Bewegung setzen. In diesem kritischen Augenblick tauchte Viola, die Sirenenkönigin, zuerst aus ihrer Meereshöhle hervor. Als sie gegen die Lampen vertrat, machte die Neuheit ihrer Lage, die frostige Gefühllosigkeit des Publikums, das im Anfang nicht einmal durch den Anblick einer so eigentümlichen Schönheit aufgeregt wurde, das Geflüster der übelwollenden Sängerinnen auf der Bühne, das Flimmern der Lichter, und mehr, weit mehr als alles Übrige, das jüngst entstandene Zischen, das sie in ihrem Versteck vernommen hatte, das alles machte ihre Kräfte erstarren und lähmte ihre Stimme. Und statt der großen Anrufung, in welche sie hätte hastig ausbrechen sollen, stand die königliche Sirene, wieder in das zitternde Mädchen umgewandelt, blass und stumm vor dem strengen, kalten Heer dieser zahllosen Augen.
In diesem Augenblick, wo das Bewusstsein selbst sie zu verlassen drohte, gewahrte sie, als sie einen scheuen, flehenden Blick über die stumme Menge hinschweifen ließ, in einer Loge nahe bei der Bühne ein Angesicht, das auf einmal, wie ein Zauber, auf ihr Gemüt eine nie zu erklärende und vergessliche Wirkung hervorbrachte. Es war ein Gesicht, das eine unklare, sie umschwebende Erinnerung erweckte, als hätte sie es schon in jenen wachen Träumen gesehen, welchen sie von Kindheit an nachzuhängen gewohnt gewesen. Sie konnte ihren Blick nicht abwenden von diesem Gesicht, und wie sie danach schaute, schwand die Angst und Kälte, welche sie zuvor ergriffen, wie Nebel vor der Sonne.
In dem dunklen Glanz der Augen, welche den ihrigen begegneten, lag in der Tat so viel zarte Aufmunterung, so viel wohlwollende und teilnehmende Bewunderung, so viel Erwärmendes, Belebendes, Nervenstärkendes, dass jeder Schauspieler oder Redner, der je einmal den Eindruck empfunden hat, den ein einziger, tiefgefühlter und freundlicher Blick unter einer Versammlung, welche angeredet und gewonnen werden soll, auf das Gemüt macht, leicht den plötzlichen und begeisternden Einfluss sich erklären kann, welchen das Auge und das Lächeln des Unbekannten auf die Debütantin ausübte.
Und während sie noch hinschaute, und die Wärme in ihr Herz wiederkehrte, stand der Unbekannte halb auf, als wollte er im Publikum das Bewusstsein wieder erwecken, von der Artigkeit, die man einem so schönen und jungen Wesen schulde; und im Augenblick, wo seine Stimme das Zeichen gab, fiel das Publikum mit einem Ausbruch großmütigen Applauses ein. Denn dieser Fremde selbst war ein angesehener Mann und seine kürzlich erfolgte Ankunft in Neapel hatte sich mit der neuen Oper in das Geschwätz der Stadt geteilt. Und dann, als der Applaus nachließ, strömte klar, voll, und befreit von allen Fesseln, wie ein Geist vom Erdenstaub — die Stimme der Sirene ihre bezaubernde Musik aus. Von diesem Augenblick an vergaß Viola die Menge, die Gefahr, die ganze Welt— außer der Feenwelt, die sie jetzt beherrschte. Es war als diente die Gegenwart des Fremden dazu, nur noch mehr jene Illusion zu steigern, in welcher der Künstler keine Schöpfung mehr sieht, außer dem Kreise seiner Kunst; es war ihr, als flößten diese klare Stirne, diese glänzenden Augen, ihr vorher nie gekannte Kräfte ein, und, wie eine Sprache suchend, um die durch seine Gegenwart erregten wunderbaren Empfindungen auszudrücken, flüsterte diese Gegenwart selbst ihr die Melodien und den Gesang zu.
Erst als alles vorüber war, und sie ihren Vater sah, und seine Wonne fühlte, verschwand dieser wunderbare Zauber vor dem süßeren der heimische, kindlichen Liebe. Doch schaute sie, als sie von der Bühne abtrat, noch einmal unwillkürlich zurück, und des Fremden ruhiges und halb melancholisches Lächeln senkte sich in ihr Herz — um darin fortzuleben und mit verworrenen, halb freudigen, halb schmerzlichen Erinnerungen, wieder aufgefrischt zu werden.
Wir übergehen die Glückwünschungen des guten Kardinalvirtuoso, der erstaunt war zu finden, dass er und ganz Neapel bisher im Irrtum gewesen über einen Gegenstand des Geschmacks — und noch mehr erstaunt darüber, dass jetzt er und ganz Neapel einstimmig es bekannten; wir übergehen die geflüsterten Verzückungen der Bewunderung, welche das Ohr der Sängerin bestürmten, als sie wieder in ihrem sittsamen Schleier und ihrer einfachen Kleidung dem Schwarm von galanten Herren entrann, welche jeden Zugang hinter der Szene belagerten; wir übergehen die süße Umarmung von Vater und Kind, welche durch die sternhellen Straßen und über die verödete Chiaja in des Kardinals Wagen nach Hause kehrten; wir halten uns nicht dabei auf, die Tränen und Ausrufungen der guten, treuherzigen Mutter zu schildern … wir sehen sie zurückgekehrt — sehen das wohlbekannte Zimmer, venimus ad larem nostrum — sehen die alte Gianetta mit dem Nachtessen beschäftigt, und hören Pisani, wie er das Barbiton aus seinem Gehäuse nimmt, und dem klugen Hausgeist alles Vorgefallene erzählt; wir hören der Mutter fröhliches, leises, englisches Lachen. — Warum, Viola, sonderbares Kind, sitzest du so beiseite, dein Gesicht auf die schönen Hände stützend, deine Augen in den leeren Raum hinaus starrend? Auf! ermanne dich! Jedes Grübchen auf der Wange der Häuslichkeit muss in dieser Nacht lächeln!1
Und eine glückliche Wiedervereinigung war es um diesen bescheidenen Tisch herum! Ein Mahl, das Lukullus hätte beneiden mögen in seinem Apollosaal, bei den getrockneten Weinbeeren, und den leckeren Sardellen, und der köstlichen Polenta, und dem alten Lacrymä, ein Geschenk des guten Kardinals. Das Barbiton, auf einen Stuhl gelegt, einen großen Stuhl mit hoher Lehne, neben dem Musiker, schien an dem festlichen Mahl Teil zu nehmen. Sein ehrliches, gefirnisstes Gesicht glänzte beim Licht der Lampe: und in seinem Schweigen selbst lag ein dämonischer, schlauer Ernst, wenn sein Herr, zwischen jeden Mundvoll Essen hinein, sich wieder zu ihm wandte, um von etwas zu erzählen, was er zuvor vergessen hatte. Das gute Weib sah in liebevoller Rührung allem zu und konnte vor Freuden nicht essen; aber plötzlich stand sie auf und drückte auf des Künstlers Stirn einen Lorbeerkranz, den sie in zärtlicher Ahnung vorher schon gewunden hatte: und Viola, auf der anderen Seite ihr Bruder, das Barbiton, rückte den Kranz ganz zurecht, und streichelte ihres Vaters Haare glatt, und flüsterte: »Caro Padre, jetzt lasst ihr mich von diesem nicht mehr schelten!«
Jetzt wandte sich der arme Pisani, halb außer sich zwischen beiden hin und her gezogen, aufgeregt von dem Lacrymäwein und seinem Triumph, zu seinem jüngeren Kind mit einem so naiven und komischen Stolz: »ich weiß nicht, wem am meisten danken. Du schenkst mir so viel Freude, Kind — ich bin so stolz auf dich und auf mich. Aber ich und der da, der arme Kerl, sind so oft miteinander unglücklich gewesen!«