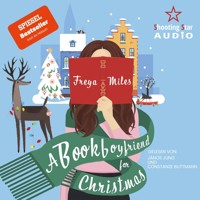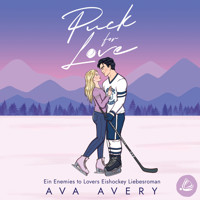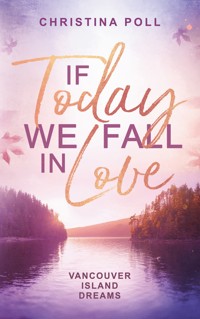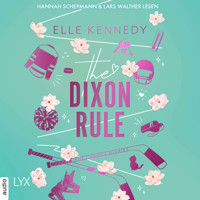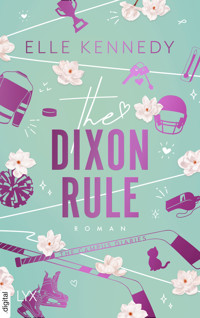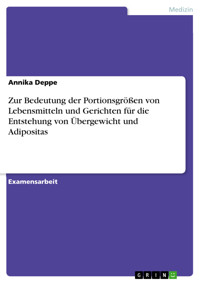
Zur Bedeutung der Portionsgrößen von Lebensmitteln und Gerichten für die Entstehung von Übergewicht und Adipositas E-Book
Annika Deppe
29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Examensarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich Gesundheit - Ernährungswissenschaft, Note: 1,7, Universität Paderborn (Naturwissenschaften), Sprache: Deutsch, Abstract: Seit den 80er Jahren ist die Prävalenz von Übergewicht und Adipositas weltweit, insbe-sondere in den Industriestaaten, stark angestiegen. Das Aufhalten dieser Entwicklung ist eine der größten gesundheitspolitischen Herausforderungen der heutigen Zeit. Folgen des Übergewichts sind nicht nur im Erwachsenenalter sondern bereits im Kin-desalter weit verbreitet. Kinderkrankheiten weichen immer mehr den typischen Erwach-senenkrankheiten. Zudem sind Adipöse zumeist von Stigmatisierungen betroffen, die eine geringere Lebensqualität zur Folge haben. Die durch Adipositas verursachten Krankheiten bedeuten enorme Kosten für das Gesundheitssystem. Da Therapiekonzepte keine langfristigen Erfolge versprechen, rückt die Primärprävention immer mehr in den Fokus der Forscher. Die prädisponierenden Faktoren der Adipositas sind vielfältig, je-doch bislang nur mäßig erforscht. Daher ist Adipositas ein aktuelles Thema, welchem eine große gesundheitliche und bil-dungspolitische Bedeutung für die Zukunft zugeschrieben wird. Gegenstand dieser Arbeit ist es, die Bedeutung der Portionsgrößen von Lebensmitteln und Gerichten für die Entstehung von Übergewicht und Adipositas herauszustellen. Dabei wird in dieser Arbeit der Schwerpunkt auf die Betrachtung von Übergewicht und Adipositas im Kindes- und Jugendalter gelegt. Um dieses Problem näher zu erläutern, erfolgt in Kapitel 2 der vorliegenden Arbeit eine Definition und Klassifizierung der Begrifflichkeiten “Übergewicht“ und “Adipositas“. In diesem Kapitel wird den Fragen nachgegangen, inwieweit Adipositas im Kindes- und Jugendalter klassifizierbar ist, welche Prävalenzentwicklungen es gibt und welche Aus-wirkungen für die Gesellschaft absehbar sind. Zudem wird hinterfragt, ob alle Alters-gruppen gleichermaßen von Übergewicht und Adipositas betroffen sind, welche medi-zinischen und psychosozialen Folgebelastungen auftreten und inwieweit sie die Lebens-qualität übergewichtiger und adipöser Menschen beeinflussen. Besonders die prädisponierenden Faktoren, die an der Entstehung von Übergewicht und Adipositas beteiligt sind, werden im Kapitel 3 fokussiert. Der Energiehaushalt sowie genetische und soziokulturelle Faktoren werden als mögliche Ursachen erörtert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Page 4
5 Therapie und Prävention von Adipositas
6 Schlussbemerkung
7 Literaturverzeichnis
Page 1
1 Einleitung
Seit den 80er Jahren ist die Prävalenz von Übergewicht und Adipositas weltweit, insbesondere in den Industriestaaten, stark angestiegen. Das Aufhalten dieser Entwicklung ist eine der größten gesundheitspolitischen Herausforderungen der heutigen Zeit.
Folgen des Übergewichts sind nicht nur im Erwachsenenalter sondern bereits im Kindesalter weit verbreitet. Kinderkrankheiten weichen immer mehr den typischen Erwachsenenkrankheiten. Zudem sind Adipöse zumeist von Stigmatisierungen betroffen, die eine geringere Lebensqualität zur Folge haben. Die durch Adipositas verursachten Krankheiten bedeuten enorme Kosten für das Gesundheitssystem. Da Therapiekonzepte keine langfristigen Erfolge versprechen, rückt die Primärprävention immer mehr in den Fokus der Forscher. Die prädisponierenden Faktoren der Adipositas sind vielfältig, jedoch bislang nur mäßig erforscht.
Daher ist Adipositas ein aktuelles Thema, welchem eine große gesundheitliche und bildungspolitische Bedeutung für die Zukunft zugeschrieben wird.
Gegenstand dieser Arbeit ist es, die Bedeutung der Portionsgrößen von Lebensmitteln und Gerichten für die Entstehung von Übergewicht und Adipositas herauszustellen. Dabei wird in dieser Arbeit der Schwerpunkt auf die Betrachtung von Übergewicht und Adipositas im Kindes- und Jugendalter gelegt.
Um dieses Problem näher zu erläutern, erfolgt in Kapitel 2 der vorliegenden Arbeit eine Definition und Klassifizierung der Begrifflichkeiten“Übergewicht“ und “Adipositas“.In diesem Kapitel wird den Fragen nachgegangen, inwieweit Adipositas im Kindes- und Jugendalter klassifizierbar ist, welche Prävalenzentwicklungen es gibt und welche Auswirkungen für die Gesellschaft absehbar sind. Zudem wird hinterfragt, ob alle Altersgruppen gleichermaßen von Übergewicht und Adipositas betroffen sind, welche medizinischen und psychosozialen Folgebelastungen auftreten und inwieweit sie die Lebensqualität übergewichtiger und adipöser Menschen beeinflussen. Besonders die prädisponierenden Faktoren, die an der Entstehung von Übergewicht und Adipositas beteiligt sind, werden im Kapitel 3 fokussiert. Der Energiehaushalt sowie genetische und soziokulturelle Faktoren werden als mögliche Ursachen erörtert.
Page 2
Kapitel 4 stellt den Kern dieser Arbeit da, wobei zunächst auf die Entwicklung der Portionsgrößen in den letzten Jahrzehnten eingegangen wird. Weiterhin wird erläutert, inwieweit die Energieaufnahme durch Portionsgrößen beeinflusst wird und ob der Nährstoffgehalt, die Energiedichte oder weitere Eigenschaften von Lebensmitteln und Gerichten den Portionsgrößenverzehr steigern. Anschließend wird das Augenmerk auf Umwelteinflüsse gelegt, die den Verzehr großer Portionen beeinflussen. Es wird hinterfragt, inwieweit Portionsgrößen in Deutschland der Norm entsprechen. In Kapitel 5 werden Therapiekonzepte angesprochen. Anschließend werden Präventionsmöglichkeiten diskutiert, die dem Verzehr steigender Portionsgrößen entgegenwirken.
Zum Schluss erfolgt unter Kapitel 6 eine kurze Zusammenfassung der Arbeit.
Diese Ausarbeitung will einen Beitrag dazu leisten, die in Deutschland bisher nur wenig diskutierte Problematik steigender Portionsgrößen in Bezug auf Übergewicht und Adipositas zu fokussieren.
Page 3
2 Übergewicht und Adipositas im Kindes- und Jugendalter-ein Gesundheitsproblem mit gewichtigen Folgen
In diesem Kapitel erfolgt eine Beschreibung des Krankheitsbildes der kindlichen und jugendlichen Adipositas. Ausgehend von der Definition und Klassifikation in Kapitel 2.1 wird in Kapitel 2.2 der Body Mass Index zur Diagnostik von kindlicher und jugendlicher Adipositas vorgestellt. Bevor in Kapitel 2.4 mögliche Folgebelastungen dargelegt werden, erfolgen in Kapitel 2.3 Angaben zur Prävalenz von Adipositas im Kindes- und Jugendalter.
2.1 Definition und Klassifikation kindlicher und jugendlicher
Adipositas
In vielen Publikationenwerden die Begriffe “Übergewicht“ und “Adipositas“ als Syno-nymeverwendet (vgl. Wenzel, 2003, S. 58). Jedoch sind diese Begrifflichkeiten zu differenzieren (vgl. Wirth, 2008a, S. 10), da Adipositas im medizinischen Vokabular, imGegensatz zum “einfachen Übergewicht“, generell pathologischer Natur ist und miteinem erhöhten Gesundheitsrisiko assoziiert wird (vgl. Kopczynski, 2008, S. 25). DieWorld Health Organisation (WHO) definiert Adipositas als „eine übermäßige Anreicherung der Körperfettmasse, die zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führt“ (Müller-Nordhornund Muckelbauer, 2010, S. 31). Das Ausmaß der Fettakkumulation, die Fettverteilung innerhalb des Körpers sowie die Dauer der Adipositas beeinflussen dabei die individuellen Auswirkungen auf die Gesundheit (vgl. Bischoff und Betz, 2010, S. 406).Von Übergewicht wird gesprochen, wenn „im Vergleich zur Körpergröße ein zu hohes Körpergewicht vorliegt“ (Lehrke und Leassle, 2009, S. 3). Übergewicht wird im Unter-schiedzu Adipositas nicht mit Hilfe des Fettanteils definiert und geht auch nicht mit einem erhöhten Morbiditäts- und Mortalitätsrisiko einher (vgl. Kurth und Schaffrath Rosario, 2010, S. 643). Umgangssprachlich wird Adipositas als Fettsucht bezeichnet. Dieser Begriff ist jedoch bedenklich, da er einen diskriminierenden Beiklang besitzt (vgl. Wirth, 2008a, S. 6).
Die Folgeerkrankungen einer Adipositas treten bereits im Kindes- und Jugendalter auf (vgl. Wabitsch, 2004, S. 253). Adipöse Kinder und Jugendliche sind von orthopädi-
Page 4
schen, psychosozialen und metabolischen Folgekrankheiten betroffen (vgl. Heseker, 2008, S. 102). Um den Schweregrad einer Adipositas und die damit zusammen hängenden Morbiditäts- und Mortalitätsrisiken besser abschätzen zu können, wurden in den letzten Jahren verschiedene Klassifikationssysteme entwickelt. Zwei mögliche Klassifikationssysteme werden im Folgenden vorgestellt.
Diemorphologische Klassifikationberuht auf einer Einteilung der Fettzellularität in hypertrophe beziehungsweise hyperplastische Adipositas (vgl. Lehrke, 2004, S. 19; Wirth, 2008a, S. 12). Die Morphologie von Adipozyten (Fettzellen) wird vorwiegend durch Ernährungs- und Umwelteinflüsse bestimmt. Übergewichtige und normalgewichtige Individuen verfügen zunächst über die gleiche Anzahl von Adipozyten. Anhand der Adipozytenentwicklung in der Kindheit, lassen sich Rückschlüsse auf ein mögliches Übergewichtsrisiko im Erwachsenenalter ziehen. In der Kindheit erfolgt eine Hyperplasie der Adipozyten, die bei übergewichtigen Kindern schneller verläuft. Im Erwachsenenalter findet hingegen vorwiegend eine Hypertrophie der Adipozyten statt (vgl. Wirth, 2003, S. 56).
Nach Fischer-Posovszky und Wabitsch (vgl. 2004, S. 839), liegt der Fettanteil bei einem Neugeborenen zwischen 13% bis 16%. Im ersten Lebensjahr steigt dieser Fettanteil weiter an und erreicht bei normalem Wachstum den größten Körperfettanteil von etwa 28% im Alter von 6 Monaten. Das subkutane Fettgewebe steigt in diesem Zeitraum von 0,7g bei der Geburt auf bis zu 2,8g an. Bis zum 6. Lebensjahr fällt der Körperfettanteil wieder kontinuierlich ab und beginnt daraufhin erneut anzusteigen. Die Zunahme des Körperfettanteils dient in dieser Zeit unter anderem der Ausbildung geschlechtsspezifischer Merkmale (vgl. Zwiauer, 2003, S. 214). Der Zeitpunkt des erneuten Anstiegs desKörperfettanteils wird als “AdiposityRebound“ bezeichnet und ist ein guter Prädikator für einespätere Adipositas. Setzt der “Adiposity Rebound“ bedeutend früher ein alsnormal, dann ist die Wahrscheinlichkeit im Erwachsenenalter eine Adipositas zu entwickeln hoch. Jedoch haben Kinder stets die Möglichkeit aus ihrem Übergewicht herauszuwachsen, indem sich die Anzahl der Adipozyten mit dem Wachstum wieder normalisiert (vgl. Kromeyer-Hauschild, 2005, S. 11; Zwiauer, 2005, S. 106).
Page 5
Auf der Grundlage dieser Morphologie der Adipozyten kann eine Klassifikation von Adipositas erfolgen. Bei der hyperplastischen Adipositas liegt eine vermehrte Anzahl
von Fettzellen vor. Diese Form beginnt meistens in der Kindheit, kann sich aber auch in einem höheren Alter entwickeln, denn die Neubildung von Adipozyten geht im jugendlichen Alter zwar zurück, bleibt nach Lehrke (vgl. 2004, S. 19), aber dennoch bis ins hohe Alter erhalten. Daher ist diese Form der Adipositas nur schwer therapierbar. Nach Niewöhner (vgl. 2010, S. 143) haben neueste Studien ergeben, dass die Lebensdauer der Adipozyten etwa 10 Jahre beträgt. Es werden somit jedes Jahr nur ungefähr 10% der körpereigenen Fettzellen ersetzt. Ebenfalls wird davon ausgegangen, dass die Adipozyten sowohl die Charakteristika ihres Umfelds als auch ihre Größe zum Zeitpunkt der Entstehung speichern können und somit eine Art Gedächtnis besitzen. Die Effektivität einer Diät wird hierdurch erschwert, da die Adipozyten versuchen, ihre ursprüngliche Fülle anzunehmen. Nach Niewöhner (vgl. 2010, S. 143) muss der Energiehaushalt eines Individuums für mindestens fünf Jahre umgestellt werden, damit sich die Anzahl der Adipozyten reduziert und das angestrebte Volumen der Adipozyten gesenkt werden kann. Winkler et al. (vgl. 2010, S. 686) schreibt hingegen, dass es bei Erwachsenen zwar einen beträchtlichen Umsatz an Adipozyten gibt, die Anzahl jedoch auch nach einem Gewichtsverlust durchaus konstant bleibt. In der gegenwärtigen Forschung besteht diesbezüglich noch kein Konsens.
Eine hypertrophe Adipositas liegt vor, wenn die Adipozyten eines Individuums lediglich vergrößert, die Anzahl der Adipozyten aber nicht erhöht ist. In den meisten Fällen geht die hypertrophe Form mit einer abdominalen Adipositas einher. Sie entsteht vorwiegend im Erwachsenenalter und nach einer Schwangerschaft. Die hypertrophe Adipositas lässt sich im Gegensatz zur hyperplastischen Adipositas relativ gut therapieren (vgl. Wirth, 2008a, S. 12; Lehrke, 2004, S. 19).
Des Weiteren ist eineanatomische Klassifikationder Adipositas in der Forschung weit verbreitet (vgl. Lehrke, 2004, S. 19; Wirth, 2008a, S. 10). Neben dem Grad des Übergewichts ist auch die regionale Fettverteilung ein wichtiges Indiz, um das metabolische und kardiovaskuläre Gesundheitsrisiko eines Individuums bestimmen zu können. Die Fettverteilung ist genetisch bestimmt und unterscheidet sich bei Männern und Frauen.
Page 6
Es ist zu beachten, dass sich das Fettverteilungsmuster eines Individuums während der Pubertät manifestiert und die folgende Klassifikation somit erst zum Ende der Pubertät erfolgen sollte (vgl. Lehrke und Leassle, 2009, S. 5). Bei der anatomischen Klassifikation wird zwischen der gynoiden und androiden Form (vgl. Lehrke und Leassle, 2009, S. 6) unterschieden.
Die gynoide Form geht vorwiegend mit einer Fettansammlung im Hüft- und Oberschenkelbereich einher. Im Vergleich zu normalgewichtigen Personen treten metabolische Folgeerkrankungen bei Übergewichtgen nicht signifikant häufiger auf (vgl. Wirth, 2008a, S. 12).
Die androide Form ist durch eine Fettvermehrung im Abdominalbereich gekennzeichnet. Das bedeutet, dass die Fettansammlung vorwiegend intraabdominal und weniger subkutan erfolgt. Mit dieser Form geht ein erhöhtes Risiko an Hypertonie, Diabetes mellitus Typ 2, Cholelithiasis und Arteriosklerose zu erkranken einher, was ein erhöhtes Morbiditäts- und Mortalitätsrisiko bedingt (vgl. Wirth, 2008a, S. 12).
2.2 Body Mass Index: Diagnoseverfahren zur Bestimmung von Adi-
positas im Kindes- und Jugendalter
Aufgrund der alters- und geschlechtsspezifischen physiologischen Veränderungen im Kindes- und Jugendalter existieren sowohl in Deutschland als auch im internationalen Vergleich verschiedene Definitionen (vgl. Reinehr, 2008, S. 374) und Referenzsysteme (vgl. Pigeot et al., 2010, S. 654) für Übergewicht und Adipositas. Im Folgenden wird das Referenzsystem nach Kromeyer-Hauschild et al. näher erläutert. Dieses Verfahren ist gut für die Praxis erprobt und dient in der vorliegenden Arbeit als grundlegendes Diagnoseverfahren. Daher wird auf die Vorstellung weiterer Diagnoseverfahren verzichtet.
Verschiedene Institutionen in Deutschland, unter anderem die Arbeitsgemeinschaft Adipositas im Kindes- und Jugendalter (vgl. Kromeyer-Hauschild, 2005, S. 5), empfehlen die Verwendung einheitlicher Body Mass Index Perzentile. Diese unterscheiden sich von den von der World Health Organisation (WHO) festgelegten Kriterien für das Erwachsenenalter (vgl. Wabitsch, 2010, S. 391), jedoch gehen sie fließend in die risikobe-