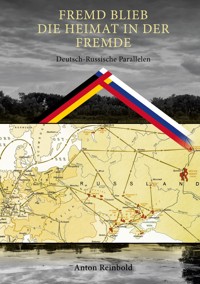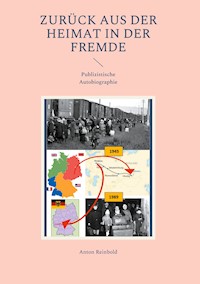
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ich bin nicht unter einem glücklichen Stern geboren. Im Frühjahr 1945, der Zweite Weltkrieg war noch nicht zu Ende, hat mir meine Mama in Eilenburg bei Leipzig das Leben geschenkt. Gerade einmal fünf Monate danach wurde ich mit Mama, ihren zwei Schwestern und meinen zwei Brüdern sowie auch einigen Hunderttausend meiner Landsleute sechs Tausend km nach Osten, ins russische Ostsibirien, hingebracht, das heißt Deportiert. Die meisten ohne Russisch- und Ortskenntnisse. Es waren überwiegend Frauen ohne Männer, Kinder ohne Väter. Zur gleichen Zeit befand sich mein Vater fünf Tausend km noch weiter, nordöstlich von uns entfernt, als Kriegsgefangener in den Goldminen. Ich traf ihn zum ersten Mal als ich acht Jahre alt war. Zu meiner Zeit und noch viel früher, waren es Verbannungsorte für Verbrecher aller Art, auch Staatsgegner. Waren wir das auch? Wir alle sind Nachkommen der deutschen Volksgemeinschaft, die vor über 200 Jahren ihre Kolonien im Russischen Reich gegründet und zu Wohlstand gebracht hatten. Durch das Ungewitter des 20ten Jahrhunderts wurde alles zerstört. Wir wurden gejagt, verfolgt. Richtsichtlos hat die herrschende Macht Menschen in die ungewöhnlichen geographischen Gegenden mit extremen klimatischen Bedingungen, fremder Moral, in die Recht- und Perspektivlosigkeit umgesiedelt. Um uns aus persönlicher Erfahrung geht es in diesem Buch. Wir Jüngeren, ich selbst, wuchsen in das System hinein. Die Erziehung folgte nach den herrschenden kommunistischen Kriterien. Das komplexe und vielfärbige Leben bestand keineswegs nur aus Kummer und Sorgen. Ich versuche auch die Vielfältigkeit, unseren Alltag, Bedürfnisse, Prioritäten ohne Vorurteile vorzutragen. Es war unser Leben. Wir waren jung, dynamisch, genossen und nutzten das Gute, was wir hatten. Entwickelten uns auf eigene Weise. In der Zeit transformierte sich die Welt., schrittweise auch das Land. Der Staat hat einige Einschränkungen aufgehoben. Einzelne von uns wurden erfolgreich, dürften letztlich studieren, weiterbilden. erhielten bessere berufliche Chancen. Das aber nur zögerlich, halbherzig. Das Leben, das System hat uns nichts geschenkt. Nach vielen Jahren der Zwangssiedlung wurde der Lebensbereich uns heimlich, die dort lebenden Menschen ins Herz gewachsen. Wir fanden gute Freunde. Doch wirkliche Heimat war es nie. Unser Nationalgefühl litt alle Jahre weiter. Wir strebten nach voller Freiheit, gleich unter Gleichen zu sein. All das, was uns lange Jahre vorbehalten war. Im Alter von 44 Jahre
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 755
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Im Gedenken an meine Familie, in der ich in Harmonie aufwuchs. An meine liebe Tochter Lisa, die tragischerweise viel zu früh von uns gegangen ist.
Ich sage herzlichen Dank Renate Gelsinger-Sutardjo für den ersten Schliff des Manuskripts, meinem Sohn Michael als Haupt-Buchkorrektor und Begutachter sowie seiner Frau Birgitt für tatkräftige Unterstützung.
Lebenserfahrungen eines Zeitzeugen.
Die letzte Phase der über 200jährigen Geschichte der Deutschen in Russland mit Rückkehr in ihre ursprüngliche deutsche Heimat. Zeitraum: vom Ende des Zweiten Weltkrieges bis in die 20er Jahre 2021. Extreme und kontrastreiche Zeiten, politische Systeme und Politiker, Menschenschicksale, Familie, Alltag.
2021, Bad Nauheim
Inhalt
Einführung: Unter amerikanischer Besatzung
Mein Vater und seine Zeit – typische Biographie
Die Repatriierung
Die erzwungene Heimat
Mein Cousin Pius Scherer
Meine ersten Jahre in Sibirien
Untere Baracke (
нижний барак
)
Am Fluß Uschakowka
Das kulturelle Leben im Dorf
Schule
Die Lehrer
Freizeit
Im Winter
Freizeit im Sommer
Hausarbeiten, -verpflichtungen
Nutztiere, unsere Kuh
Unsere Ernährung, Gesundheitspflege, medizinische Versorgung
Die letzten Jahre in Sibirien
Mein Freund Anton Schnurr
Zurück zu meinem Vater: Wehrmacht, Kriegsgefangenschaft
Strapazen in der Kolymaregion
Goldmine „Schturmowoi
“
Goldmine Dschelgala
Goldmine „Mayoritsch“ und "Pjatiletka".
Goldmine „Debin
“.
Diktator tot – Amnestie
Familienzusammenführung, Entlassung aus der Kommandantur
Michael Scherer, mein Adoptivbruder. Seine leibliche Familie
Anton und Michael Volz
Konkreter Fall zu trauriger Vergangenheit: Memorial in Piwowaricha
Sibirien, Ende der Kommandantur, Beschränkte Freiheit
Wir ziehen nach Moldawien
Die ersten Jahre in Moldawien
Unvermutete Verwandtschaften
Die katholische Kirche in Kischinev
Die Schuljahre in Moldawien
Technikum in Odessa
Schulende, Hochschulreife
Arbeit auf der Baustelle
Polygraphiekombinat
Meine Zweiräder
Studium an der Universität Kischinev
Chruschtschows Visionen und Taten
Abendstudium
Familiengründung; Institut für Chemie, Akademie der Wissenschaften
Promotion
Unsere Kinder. Familienalltag
Die zweite Wohnung in Kischinev
Mein Bruder Rafael
Wir lebten in den Zeiten der Stagnation
Deutsche Sowjetbürger: „Jetzt dürft ihr rüber“
Ein Nachwort zu meinen Tanten Brigitta und Mathilde
Neues Forschungsthema, Karriere
Laborklima, Arbeitsdisziplin
Dienstreisen und Übernachtungen
Bewertung der Forschungsarbeiten
Ein Blick ins private Leben in Moldawien
Nationalgefühl
Zurück zur Geschichte: Deutschland nach dem Krieg
Besatzungsmächte, Diplomatie, Teilung Deutschlands
Die Bundesrepublik und ihre Ostpolitik
Umsiedlung nach Deutschland wird Realität
Das schicksalsträchtige Jahr 1989
Moskau, ade - Wir landen in Frankfurt
Zwei deutsche Staaten wurden vereinigt
Die Arbeitssuche
Arbeitsstelle – üble Bekanntschaft
Der Fall mit dem Hauskauf
Meine Arbeit als Selbständiger
Lisa - Ganz Persönlich; Würdigung; die Enkel
Privat, Vertraut
Mischa, unser Sohn - Nachtrag
Nachwort
Einführung: Unter amerikanischer Besatzung
Es waren die letzten Monate des Zweiten Weltkrieges, der noch gerade in diesen Gegenden tobte, als ich am sechsten März 1945 im Krankenhaus der Stadt Eilenburg bei Leipzig in Sachsen das Licht der Welt erblickte. Fliegeralarm gehörte zum Alltag. Und so musste meine Mama oft in dem gemeinsamen Keller des Gebäudes Schutz suchen. Mit mir hat sie es noch geschafft, vor dem Ende des Krieges. Ich erhielt eine Geburtsbescheinigung, erstellt im März 1945 von der noch existierenden Behörde. Und am 15. März wurde ich in der Kirche getauft, was ebenfalls bescheinigt wurde. Nach knapp zwei Monaten war das „Deutsche Reich“ aufgelöst. Welche Geburtsurkunde hätte ich dann erhalten können? Meine Mama hat die Urkunde durch alle Lebensumstände aufbewahrt – was für damalige Zeiten nicht selbstverständlich war.
Ich hatte Pech, nicht zu richtiger Zeit und nicht am richtigen Ort das Licht der Welt zu erblicken. Damals hat ein Menschenleben nicht viel gezählt. Und ein Neugeborener hatte auch wenig Chancen durchzukommen. Zu unserer Familie gehörten damals außer meiner Mutter, dem älteren Bruder Rafael, auch zwei Schwestern meiner Mutter - die Tante Brigitta und Tante Mathilde - sowie noch der acht Jahre Ältere Michael, der noch in Vorkriegsjahren in die Familie aufgenommen wurde. Sie alle ermöglichten mir mein Leben, ihnen allen kann ich es verdanken, dass ich diese Zeilen schreiben kann. Alle haben als Familie zusammengehalten. Der Vater war bei der deutschen Wehrmacht, wo, wussten wir nicht.
Der Zusammenhalt aller Familienmitglieder, die ständige Opferbereitschaft für den Schwächeren war bei uns normal. Doch was war schon normal im März 1945, am Ende des brutalsten aller bisher in der Menschengeschichte geführten Kriege.
Der letzte Aufenthaltsort der Familie bei Ankunft in Deutschland war das Dorf Wölpern, fünf Kilometer von Eilenburg entfernt. Alle wurden bei ihrer Ankunft bei der einheimischen Bevölkerung untergebracht. Unsere Schwarzmeerdeutsche sprachen zwar deutsch, doch die Einheimischen wussten nichts von uns, und die hatten ja genug eigene Sorgen. Und doch hatten sie uns gut und friedlich aufgenommen. Das heißt, mit Mitleid. Die Angekommenen waren ja praktisch nur Frauen und Kinder.
Anmerkung: An dieser Stelle bedarf es einer kurzen Erklärung. Meine Eltern, zusammen mit mehreren Hunderttausenden in Deutschland angekommenen Landsleuten waren bereits über ein Jahr unfreiwillig unterwegs. Die Welle der aus Russland rückziehenden Wehrmacht im Frühling 1944 zog sie alle aus ihren angesiedelten Heimatorten mit. Zuerst Tausend Kilometer mit Pferdewagen und zu Fuß leidlich bis Ungarn, weiter mit der Eisenbahn, einigen Monaten Aufenthalt im polnischen Warthegau, und dann, wieder unverzüglich geflüchtet von der anrückenden Roten Armee, kamen sie endlich nach Deutschland. Unglaublichen Strapazen, Leiden wurden hinter sich gelassen. Und es waren Deutsche, die vor mehr als 200 Jahren in Russland ihre Bleibe eingerichtet haben. Waren sie jetzt hier in ihrer alten Heimat in Sicherheit? So einfach war es bei Leibe nicht. Ihre Odyssee ging weiter. Ihr Schicksal, ihre lange Geschichte hat es in sich. Und so konzentrieren wir uns auf ihre Zukunft weiter.
Die Erlebnisse dieser Deutschen in der Zeit seit ihrer Auswanderung im 18 Jh. aus dem damals zersplitterten Deutschland nach Russland, in allen nachkommenden schweren und spannenden Jahren bis zum Zweiten Weltkrieg, das kann der interessierte Leser in meinem anderen nachfolgenden Buche miterleben.
Nun hatte der Krieg ein Ende. Die Amerikaner zogen in Wölpern ein. Die Bevölkerung krabbelte vorsichtig aus den Kellern heraus. Ob man sich freuen kann? Vor allem brauchte man die Deckungsgräben zum Schutz vor Bomben im Garten neben dem Hause nicht mehr.
Tante Magdalena, die Frau meines Onkels Josef, ängstlich und doch neugierig, so wie sie halt war, schaute aus dem Fenster heraus, beobachtete, wie die Panzer und die Infanterie der Amerikaner vorbeizogen. Deutlich erkennbar kam sie an den Vorhang, von außen sichtbar, und die Amerikaner rannten in voller Ausrüstung in die Stube herein. Der Schreck war groß, die Ungewöhnlichkeit der Situation auch. Tante Magdalena hob freiwillig die Hände hoch und begrüßte die Gäste mit einem lauten „Hurra!“. Unsinn, doch witzig war es auf keinen Fall. Die Soldaten sahen eine volle Stube mit Frauen und Kindern, beruhigten sich und zogen weiter.
Die Amerikaner stationierten im Dorf Wölpern eine Einheit. Einige Häuser wurden beschlagnahmt. Die Einwohner mussten bei den Nachbarn unterkommen. Auch von hier aus beschoss ihre Artillerie das nicht weit entfernte Eilenburg. In neun Tagen unter Dauerbeschuß waren dort 65% aller Gebäude zerstört, 200 Menschen getötet. Leipzig war bereits eingenommen.
In einem kleinen Dorf, was konnte hier viel passieren? Und doch: wurde ein Lazarett, in einer Scheune untergebracht, in Brand gesetzt, es kamen Soldaten ums Leben. Für die Bevölkerung ein Horror. Ein amerikanisches Flugzeug abgeschossen. Der Pilot konnte sich mit dem Fallschirm retten, wurde gefangen genommen und erschossen. Beteiligt an dieser Aktion war ein Dorfschmied. Und als dann die Sieger im Dorf eintrafen, wurde ihnen über die Exekution des Piloten berichtet. Jetzt kam der Schmied an die Reihe, ihn traf dasselbe Schicksal, auch er wurde hingerichtet. Sowohl für den amerikanischen Piloten als auch für den deutschen Schmied gab’s keinen Sieg. Beide wurden Opfer des unsinnigen Krieges.
Bei Weitem nicht jeder Deutsche kam mit dem verlorenen Krieg zurecht. Hier im Dorf haben in den ersten Tagen nach der Kapitulation die Familie des Schullehrers samt Frau und Tochter Selbstmord begangen. Ihr Schwiegersohn, der Eilenburger Kommandant, wurde bestimmt von der Besatzungsmächten auch nicht verschont. Die Einwohner von Wölpern teilten sich die Habseligkeiten der Lehrerfamilie untereinander. Diese Ereignisse, geschehen in einem kleinen Ort, spiegelten gewissermaßen das Schicksal und die Agonie des ganzen Landes.
Vom 18. April 1945 an, dem Tag des Einmarsches amerikanischer Truppen in Leipzig, bis zu dem Tag der Kapitulation im Mai, gab es Kämpfe. Dann begann der schwierige Nachkriegsalltag. Die amerikanische Militärregierung, geführt vom Stadtkommandanten Major Keaton, erließ zahlreiche Verordnungen und Proklamationen. Diese Regeln, unter anderem die Sperrstunde, Verbot u.a. die Herausgabe von Zeitungen und das Benutzen von Fotoapparaten. Doch das amerikanische Engagement hielt sich in Grenzen. Denn ihnen war klar, dass die Truppen - gemäß den Vereinbarungen von Jalta – bald die Stadt verlassen würden. Im besetzten Ostdeutschland haben sie im Juni die Inhaber der Verlage Brockhaus, Thieme, Dieterich, Insel und andere in einem Konvoi nach Wiesbaden verfrachtet, später folgte Ernst Reclam Verlag. Aber auch führende Wissenschaftler und leitende technische Angestellte wurden im Auftrag der CIC (Counter Intelligence Corps, Spionageabwehr) gezwungen, in die Westzone zu gehen. Die alle brauchte man. Die sowjetischen Flüchtlinge waren ihnen unwichtig.
Ab Ende Juni bereiteten sich die Amerikaner auf den Abzug. Dieser sollte bis zum 2. Juli 1945 erfolgen. Der Wechsel der Besatzungsmächte kam für die sowjetischen Flüchtlinge überraschend. Einfache russische Pferdewagen, russische Klein-LKW „Полуторки“ neben modernen, aus Amerika stammenden Studebacker durchzogen plötzlich die Straßen. Nur wenige Plakate begrüßen in den Städten die neuen Besatzer. Im Dorf Wölpern selbst wurden keine sowjetischen Soldaten stationiert. Es spielte auch keine Rolle mehr. Für unsere Leute begann ein neues, unerwartetes und schlimmes Kapitel ihrer Geschichte.
Mein Vater und seine Zeit – typische Biographie
Verlassen wir jetzt vorübergehend das Dörflein Wölpern und kommen zum Lebenslauf meines Vaters. Sein Leben war charakteristisch für die damalige Zeit. Übrigens, in Ostdeutschland war er nicht bei uns. Nach langen acht Jahren hatte ich doch das Glück, ihn erstmals kennenzulernen.
Vater Michael Reinbold
Wie haben unsere ältere Generation, unsere Eltern, diese von Gewalt geprägten Zeiten in der Sowjetunion gemeistert? Zu Ehren meiner Mutter habe ich bereits ein Buch „Das Jahr 2013. Meine Mama wäre 100“ herausgegeben. Jetzt fülle ich mich verpflichtet, die Geschichte meines Vaters kurz zu präsentieren. Sein Name, Michael Reinbold, Jahrgang 1914, hatte ein für heutige Zeiten ungewöhnliches Leben. Nein, ein Held war er nie. Ungewöhnlich war seine Epoche, seine Schicksalsschwankungen. Er lebte in einer kontrastreichen Zeit: zuerst im Zarenreich, dann während der Oktober-Revolution und wilden bolschewistischen Umbrüchen unter Stalins Herrschaft. Er leistete Militärdienste in zwei Armeen – der sowjetischen und der deutschen, trug auch eine dritte Kriegsuniform – als amerikanischer Kriegsgefangener (POW für „Prisoner of war“). Er nahm am zweiten Weltkrieg teil, der ihn in amerikanische und anschließend acht Jahre in die sowjetische Gefangenschaft brachte, in unwürdigen, schlimmsten Gegenden im Nordosten der UdSSR, im Permafrost der Tundra, in der gefürchteten Kolyma-Region. Er lebte danach mit uns in der Familie in Sibirien, Moldawien und schließlich im wiedervereinigten Deutschland bis zu seinem Tod mit 82 Jahren.
In seinen letzten Jahren haben Krankheiten und die erlebten Strapazen aus ihm einen zerbrechlichen, willenlosen, wortkargigen alten Mann gemacht, der für viele jüngere Leute unattraktiv war, mit dem man nichts anfangen konnte, für den man oft nur Hohn übrig hatte. Traurig, wieso am Ende noch eine Strafe? O Gott! Ist das Leben oft ungerecht!
Er hat sich nie abgesondert, war ein einfacher arbeitstüchtiger Mensch. Er war auf keine Art auffällig, war bescheiden und ehrlich. Keinem hat er Schaden zugefügt. Solche Leute sind als „Arbeitspferde“ bekannt, sie stellen keine großen Ansprüche gegenüber den Anderen. Und eben sie sind die wichtigste Stütze eines jeden Staates, gerade sie sind das Rückgrat der Gesellschaft. Gib ihnen eine stabile Versorgung und Arbeit, so erledigen sie diese zuverlässig und ohne Wenn und Aber.
Sein Beruf: Bauer im deutschen Dorf Baden, einer von mehreren deutschen Kolonien bei Odessa am Schwarzen Meer. Als Ältester von sieben Geschwistern musste er so auch früh große Verantwortung für der Familie übernehmen.
Seine Eltern: Ignatz, 1890 und Regina, 1891 Jg., geborene Volz, hatten zehn Kinder, Letztlich blieben nur sechs, die anderen haben das Alter von einem Jahr nicht überlebt. Die Familie gehörte nach den damaligen Verhältnissen vor der Revolution zu den Wohlhabenden, doch nicht zu den Reichsten. Mit welchen Vorteilen? Sie schufen sich materielle Unabhängigkeit und wirtschaftliche Stabilität. Erkauft durch rastlose Bauerntätigkeit, alles war der Arbeit unterstellt. Stolze Bauern, vorbildlich im Dorf, hatten sie zum allgemeinen Wohlstand beigetragen. Und eben diese Eigenschaften brachten ihnen im kommunistisch - sowjetischen Russland entscheidende Nachteile. Sie wurden zu „Klassenfeinden“, automatisch als „Feind des Volkes“ abgestempelt, mit einem abwertenden Begriff „Kulak“ (die Faust).
Seine besten Erinnerungen galten den Kinderjahren. Scheinbar unbedeutende Episoden verewigten sich in seinem Gedächtnis – seine Oma bot den Kindern einfache begehrte Bonbons; da wurde ihm anvertraut, beim Judenhändler im kleinem Dorfladen, für ein paar Kopeken einen Hering als Luxus zu holen. Zum Ereignis - nicht nur für ihn eine Seltenheit - wurde ein durch die Straßen rollendes Automobil. Dem liefen die Kinder mit Begeisterung hinterher, stürzten sich auf die Straße und rochen die seltsamen Abgase, die das selbstfahrende Wunder ausstieß. Es waren Episoden, die er mit strahlendem Gesichtsausdruck erzählt hatte. Es blieb nicht viel mehr an heiteren Ereignissen im Gedächtnis.
Viel mehr nahm man aus der Vergangenheit Ereignisse mit bitterem Nachgeschmack mit. Schon seit seiner Kindheit gehörte Arbeit im Hof und Land zum Alltag. Als Ältester hatte man auch zusätzliche Aufgaben – die jüngeren nachwachsenden Geschwister betreuen. Mit voller Verantwortung und ohne Pardon, falls etwas schieflief. Dies alles gehörte zu den Pflichtaufgaben.
In den wenigen Jahren der Neuen Ökonomische Politik (NEP), 19211928, nach dem Bürgerkrieg, hat sich noch die produktive Bauernarbeit im eigenen Land gelohnt. Die ganze Familie ohne Ausnahme war im Einsatz. Gelegentlich hat man auch zusätzliche Arbeiter zur Aushilfe auf dem Feld gebraucht. Meine Mutter arbeitete als Kind bei ihnen auch bei Bedarf. Ohne ihren früh verstorbenen Vater mussten auch Kinder zu Familieneinnahmen beitragen. Das kleine hübsche schwarzhaarige Mädchen Johanna Scherer sollte schon damals dem Vater aufgefallen sein. Wer konnte schon ahnen, dass es seine zukünftige Liebe und Frau fürs Leben werden sollte!
Mamas Vater verstarb 1922 an Hunger, die Familie mit Kleinkindern wurde in die Armut getrieben, sie mussten schon früh als Lohnarbeiter Geld dazuverdienen.
Die Kirche war bei allen Generationen das wichtigste Zentrum im kulturellen und geistlichen Leben. Nach ihren Bräuchen liefen die wichtigsten Ereignisse der Familien und des Dorflebens - Geburt, Kommunion, Heirat, Sterben – ab, alles streng nach den Kanonen und Regeln der Kirche. Im Kirchenchor konnten die Begabten ihre gesanglichen Qualitäten vorzeigen. Der Pfarrer war ein angesehener Mann, ein Dorffunktionär, dem hat man auch die Beichte anvertraut. Sontags war obligatorisch der Kirchenbesuch. Viel mehr an aufregenden Momenten gab es im Leben kaum. Monoton war es, so glaubt man es aus heutiger Sicht. Und doch war das Leben in der Gemeinde angenehm friedlich, mit eigenen Höhepunkten. Man hat sich schon gefreut, wenn man rechtzeitig gesät hatte, es rechtzeitig geregnet hat, über die Entwicklung der Saat, und vor allem, wenn die Ernte gut ausgefallen war.
Auch im Winter gab’s genug Arbeit – im Stall, bei der Vorbereitung auf die Frühjahrssaat, beim Korbflechten, Besenmachen, Schneidereien u.a. Man gönnte sich gemütliche angenehme Pausen. Da hat man in den Kreisen der Familie per Hand Maiskörner von den Kolben ausgedroschen, zusammen mit Freunden gesessen, gesungen, geplaudert, Witze erzählt, ein Glas Wein genossen. Junge Leute waren unter sich, haben Streiche gespielt, sich nach passendem Lebenspartner /-in umgeschaut.
Die Sitten waren streng. Gings bei der Partnersuche immer im Einklang mit diesen Sitten? Sollte mal ein junges Paar als Ausnahme die sexuellen Grenzen bei der Beziehung vor der festen Bindung überschreiten, oder wurde gar die Junge Partnerin schwanger, so blieb nichts übrig als zu heiraten. Gut, wenn dabei es zwischen den Beiden die wahre Liebe war. Schlimmer war´s, wenn es ein oberflächlicher, zufälliger Flirt war, dann hat der Fehler ihr ganzes Leben verdorben. Solche Ehen waren zwar selten, aber gehörten auch zur Realität. Der unfreundliche und unglückliche Bund dauerte das ganze Leben. Von einer Trennung, Scheidung konnte keine Rede sein. In unserem Dialekt sagt man: „Wie T u tein Bett mochsch, so schlofst Tu aach“. Wie eine solche Ehe funktionierte, wussten vor allem ihre Kinder ganz genau. Mir waren solche Fälle aus anderen Familien auch bekannt.
Man lebte direkt am Ufer des Kutschurganer Limans – einer Süßwasserlagune, der bot den Leuten immer genügend Wasser. Hier konnte man im Sommer baden, im Winter auf selbstgebastelten Schlitten oder Schlittschuhe fahren. Hier wuchs Schilf, mit dem man Dächer decken oder heizen konnte.
So wie die Dörfer nach strengen Regeln organisiert und gebaut waren, ging es auch in Wohnhäusern. Im Frühling hat alles geblüht, die Akazien entlang der Straßen haben ihren Duft abgegeben. In der Nähe des Dorfes waren Obst- und Gemüsegärten angelegt. Die deutschen Dorfer sahen aus wie Oasen in der baumlosen Steppe.
Großzügig angelegt waren die 50 Meter breiten Straßen. Sie wurden einmal in der Woche gefegt. In der Nähe der Siedlung waren Sand- und Lehmgruben. Von hier holten die Einwohner dieses wertvolle Material für Bauzwecke, aber auch, wenn man samstags die Lehmböden im Hause frisch mit Pferdemist gemischtem Lehm schmierte und obendrauf mit Sand bestreute. In den Gruben haben auch Kinder gespielt, hier wurde unsere Tante Brigitta bereits im jungen Alter durch Lehm verschüttet. Ein Unfall, der ihr ganzes Leben geprägt hat. Sie blieb an einem Bein lahm. Eine hübsche junge Frau mit Behinderung, sie hat auch keine Familie gründen können.
Gerade diese einzelnen friedlichen Momente haben sich bei allen älteren, mir bekannten Landsleuten, tief ins Gedächtnis eingeprägt. Das alles verband die Menschen, machten das Leben angenehm und erträglich. Dadurch hat sich eine Gemeinschaft gebildet, die das Gefühl einer lieben, eigenartigen Heimat gab.
Mit Nostalgie tauchten immer wieder aus dem Gedächtnis diese früheren Oasen, mit dem gewöhnlichen ruhigen Leben „daheim“ während der nachkommenden schlimmen Zeiten auf.
Genauer genommen, hatten es die Menschen im Lande damals immer nicht einfach. Die anstrengende körperliche Arbeit hat die jungen menschlichen Körper früher altern lassen. Und das war auffallend besonders bei den Frauen. Aus bezaubernden geschmeidigen Staturen wurden in wenigen Jahren auffällig homogene formlose Körpermassen. Kein Wunder, wenn die Frauen sehr oft Männerarbeiten übernehmen und öfter viel mehr für die Familie leisten mussten als ihre Ehegatten. Sie mussten schwere Säcke schleppen, graben, ganze Tage unter Hitze oder Kälte in ungewöhnlicher Körperhaltung Landarbeiten verrichten, jähen, Kinder pflegen.
Und wenn das alles wäre. Die Staatsmacht in den politisch instabilen Zeiten, und das waren die Zeiten des „Aufbaus von Kommunismus“ brachte zusätzlich auch moralische Unterdrückung, Sklavengefühle, Unzufriedenheit, riss die Menschen aus dem gewöhnlichen Rhythmus heraus, übte ständigen unangenehmen Druck und Zwang aus.
Keiner konnte ahnen, was für ein Sturm über die Generation unserer Eltern hereinbricht. Er machte unser Volk ähnlich dem pflanzlichen Steppenläufer, der unterwegs zu seinem eigenen Erbgut, auch das Erbgut von anderen Ethnien dazugewonnen hat. Aus Homogen entstand ein Völkergemisch, wir sind jetzt Weltweit zerstreut.
Üblicherweise herrschte im Dorf allgemein sozialer Frieden, die Mittelschicht war groß. Es muss betont werden, dass galt für früher, „vor der Revolution“. Es gab Familien mit größerem Wohlstand, aber es gab auch relativ arme Familien. Es gibt in jeder sozialen Gemeinschaft Ärmere und Reichere. Ursache für Verarmung gibt es immer: Verlust des Haupternährers, unverhoffte Kataklysmen, Krankheiten aber auch Faulheit und Trunkenheit. Gehungert hat aber im Dorf damals keiner. Es gab auch Neid, wie überall. Nur kann man allgemein behaupten, führte es halt in den deutschen Dörfern nicht zu sozialen Unruhen.
Die an die Macht angetretenen Bolschewiki stifteten Unruhen, wo immer sie auch ihre Ideologie ansetzten. Plötzlich haben sie die niedrigsten Instinkte bei den ärmeren Mitbürgern des Dorfes geweckt. Auf Proletariat im Sinne vom Marx und Engels hat man sich auch gestützt, deshalb hat man wohlhabende Bauern auch im Dorf nicht geduldet. Die Ideologie der Kommunisten konnte mit besser gestellten Bürgern nichts anfangen. Das heißt, es durften keine Wohlhabende, geschweige denn reiche Familien existieren. Sprich, letztendlich müssen alle gleich arm werden. Ein normaler Staat versucht seine Bürger möglichst zum Wohlstand zu bringen, vor allem das konfliktfreie Zusammenleben seiner Bürger zu fördern. Nur die damalige herrschende Macht versuchte es nicht. Mit armen Bürgern konnte man viel leichter die widerwärtige Ideologie zu eigenen Zwecken umsetzen.
Die neue Macht versuchte die ärmeren Dorfeinwohner gegen die anderen aufzuhetzen, als Instrument der Verfolgung der wohlhabenden Bauern zu benutzen. Nicht alle Menschen haben sich an diesen Maßnahmen beteiligt, aber es reichte schon, wenn ein paar schwarze Schafe den sozialen Frieden verdarben. Eigentlich herrschte während des „sozialistischen Umbruchs“ im ganzen Land kein sozialer Frieden mehr. Später wurden alle Bauern gleich, gleich Arm wohlbemerkt.
Vaters Bildung bildeten die obligatorischen vier Klassen der Grundschule, mehr war für ihn nicht drin. Als ältester von den Kindern sollte er später das Familiengut übernehmen. Das Land durfte zwischen den Nachkommen nicht geteilt werden, sodass die männlichen Geschwister andere Aufgaben übernehmen mussten. Einer von seinen Brüdern, der Rafael, durfte lernen, wurde Schullehrer; der jüngste Bruder, der Anton, sollte ein Handwerk erlernen. Sollte, es kam anders - mit 16 Jahren im Jahr 1933 ist er verhungert.
Vaters Generation hat Kriege erlebt, die Revolution, Umwandlungen der Systemordnung, tragische rücksichtslose politische Experimente der Kommunisten an Millionen Menschen. In diesen stürmischen Zeiten waren die deutschen Dörfer zwangsläufig in ihre Wirbel hineingezogen. Unsicherheit und Elend brachten sie mit.
Im Bürgerkrieg standen die Dorfbewohner schutzlos gegenüber aller möglichen Parteien, Parteifarben: den Roten, Weisen, Grünen bzw. selbstständig agierenden Banden – Machno, Grigorjew und wie sie alle nur hießen. Jeder brauchte Proviant, Zugpferde – alles, was ein Dorf so lieferte. Neutralität zu wahren half den Bauern nicht. Gegen die marodierenden bewaffneten Banden wurde in den Dörfern, auch in nicht deutschen, Selbstschutz organisiert. Doch gegen die gut bewaffneten großflächig agierenden Banditen und besonders gegen die Übermacht der Roten Armee hat’s nicht geholfen. Der Widerstand wurde auf brutale Weise gebrochen. Bei dem Versuch, ihr Leben und Eigentum zu schützen, kamen im Kampf gegen das ständige Expropriieren in ihrem Dorf 72 Widerstandskämpfer um. Unter ihnen auch Vaters Großpapa mütterlicherseits, Michael Volz. Alle wurden 1919 von den Bolschewiki ohne Gerichtsverfahren erschossen. Dieses Ereignis übte auf den damals noch Fünfjährigen einen dramatischen Einfluss aus. Es blieb ein ganzes Leben lang in Vaters Erinnerung. Die sowjetischen Zeiten prägten die Menschen, ihr öffentliches Verhalten. Um zu überleben, versuchte man möglichst unauffällig zu sein.
Was kann für den Bauer schlimmer sein als ihn zur Abgabe seines Vermögens (Land, Pferd, Nutztiere, Landmaschinen) zu erzwingen? Und das zum nicht nachvollziehbaren Zweck der kommunistischen Ideologie. Mühsam wurde das Vermögen in mehreren Generationen mit Stolz und Liebe aufgebaut, erzogen und gepflegt. Während und nach der Revolution brach das alles zusammen. Die neue Macht setzte ihre Ziele nur mit Zwang und Gewalt durch. Bereits nach der Revolution wurden die Großgrundbesitzer ohne Rücksicht enteignet und verfolgt worden. Nach einigen Jahren der Erholungspause, die man den Bauern bis Ende der 20er Jahre gegönnt hat, kamen die Zeiten des großen Umbruchs. Jetzt waren die anderen Bauern an die Reihe. Die Enteignung und Kollektivierung der Landwirtschaft betrafen jetzt alle Bauern. Nach der Devise: „Alles in die Kolchose!“ Der Höhepunkt war das Jahr 1929. Die Nicht-Willigen wurden massiv verfolgt, vertrieben, ermordet.
Die Familie des Vaters wurde u.a. zuerst in die Kolchose im Jahr 1929 gezwungen, dann 1932 als Kulaken eingestuft, entkulakisiert und aus der Kolchose ausgeschlossen. Später wurde die Familie in die Tochterkolonie Neu-Baden vertrieben. Das Vermögen wurde sowieso beschlagnahmt. Die Verbannung in die weit entfernten Gebiete im Norden oder Osten des Landes blieb ihnen zum Glück (noch) erspart. Nach Paar Jahre dürfte er zurück, musste auch in die Kolchose.
Mit der Kollektivierung fing auch die ganz große Not an. Stalin brauchte Getreide zur Finanzierung seiner Politik der Industrialisierung. Angefangen hat es 1930, als die geplante Getreidebeschaffung hinter den Erwartungen lag. 1932 wurden die Pläne verschärft. Die Bauern wollten nicht ohne materielle Entschädigung für den Staat in Zwangskollektivbetrieben arbeiten. Hunderte von Dörfern, die den Plänen nicht nachkamen, wurden auf die schwarze Liste gesetzt. Auf die „Straftafel“ kamen bald ganze Regionen, vor allem ganz Ukraine. Die Reaktion kam vom Stalin prompt: Er versetzte der Bauernschaft einen "vernichtenden Schlag" (seine eigene Aussage). Es folgte die gnadenlose Getreiderequirierung und mit ihr auch genauso die schreckliche Hungersnot. Der Prozess wurde 1933 fortgesetzt, als während der Hungersnot von 1933 sämtliche Lebensmittelvorräte den Bauern abgenommen wurden. Die Bauern in den Dörfern mussten in ihren Orten bleiben, und wohin konnte man auch fliehen? Während die Ortsbehörden ohne Skrupel und Moral, ohne Mitleid mit den sterbenden Menschen umgingen, lehnte die Regierung Stalins Hilfe aus dem Ausland ab. Dies auch von den bereits früher aus diesen Gegenden ausgewanderten Russlanddeutschen.
Die Regierungen im Westen wussten über diese Tragödie Bescheid, nur wollten sie die Bolschewiken nicht „reizen“. Im Hungersjahr 1933 nahmen die USA sogar diplomatische Beziehungen mit der UdSSR auf.
Das besonders tragische dabei ist, dass der Hunger gezwungen ausgelöst wurde. Das bestätigen verschiedene Quellen. Mein Vater wiederholte es ständig. Die Ernte in dem Jahr war gut ausgefallen. Der Vater erzählte, wie in diesen Zeiten die sog. Aktivisten – üblicherweise 3 bis 5 Mann - von Haus zu Haus gingen, um nach verstecktem Getreide zu suchen. Es wurden Wände, Fußböden aufgerissen, Speicher, Ställe durchsucht. Das Grundstück hatte man gründlich untersucht. Leute hatten oft Getreide vergraben. Mit Spießen durchbohrten sie die Erde am Hausgrundstück. Bei der Suche waren ja Aktivisten des sog. Armutskomitees auch am Werk, und die wussten ja, wo zu suchen war. Die Ärmeren wurden im Dorf mobilisiert, um die Politik der Sowjets durchzuführen. Nichts blieb unentdeckt, sogar in die Kochtöpfe hat man reingeschaut. Das requirierte Getreide wurde abgeführt und zum nächsten Eisenbahnknoten, Rasdeljnaja, nahe Odessa, oft im Freien abgeladen. Hier ist es auf dem offenen Gelände zum Teil auch verfault. Die Behörden schafften es nicht, es rechtzeitig weiter zu leiten.
Die Hungersnot 1932-1933 nahm dramatischere Ausmaße an. Es traf mehrere Regionen der UdSSR. Die meisten Menschen starben in der Ukraine, wo rund 3,3 Millionen Tote zu beklagen waren. Einige Quellen nennen noch höhere Zahlen. Auch die Familien meiner Eltern wurden nicht verschont. Diese Jahre hatten tiefe Spuren in der Familiengeschichte und in den Erinnerungen des Vaters hinterlassen. Der jüngste Bruder Anton und sein Vater selbst (Ignatz Reinbold, 1990 Jg. - mein Großvater) sind verhungert. Anton ging mit den zwei älteren Schwestern nach der Arbeit zurück ins Dorf. Alle schwach, ausgehungert. Anton – starker junger Mann mit 16 Jahren - wollte sich auf der Strecke ausruhen, die Schwestern sollten weiter gehen. Der Winter war kalt, mit Schnee. Der Junge kam aber nicht mehr nach Hause. Im Frühling, Ende Mai wurden seine sterblichen Überreste in einem Wäldchen gefunden.
In den Monaten läuteten jeden Tag die tontiefsten Totenglocken der Kirchen anlässlich der nicht enden wollenden Begräbnisprozessionen, an denen letztendlich sogar die Verwandten wegen der Schwäche nicht mehr teilnehmen konnten. Es gab auch keine Bretter für Särge mehr.
Es gab kaum eine Familie, in der nicht mindestens ein Familienmitglied verhungert war. Die Hungersjahre wurden üblicherweise von Krankheiten begleitet. Der geschwächte menschliche Körper ist sehr für Krankheiten anfällig. Die Sterberate durch Krankheiten war hoch.
In der Familie meiner Mutter waren zwei ihrer Schwestern an Typhus erkrankt. Beide lagen im Krankenhaus im Nachbardorf Selz. Am schwersten litt die Brigitta. Und gerade ihr Organismus hat die Krankheit besiegt. Traurigerweise hat die Elisabeth die Krankheit nicht überstanden.
Mit dem Hunger machte der Vater üble Erfahrungen, in den Hungersjahren - 1922, 1933 und 1946 - musste er daran leiden. Fachlich genau erzählte er in Einzelheiten, wie schwer es war, hungern zu müssen: irgendwann wird der Körper geschwollen, man hat keine Kraft, bis der Körper versagt.
Die hohe Sterblichkeit v.a. unter den Kleinkindern war in allen, sagt man „früheren“ Jahren üblich. Die Medizin selbst erreichte noch nicht das hohe Niveau, die medizinische Versorgung war unzureichend. Und so nannte man es „natürlichen“ Tod. In der Familie meines Vaters starben als Kleinkinder drei Geschwister des Vaters. Doch in Hungersjahren nahm die Sterberate dramatische Ausmaße an. Wie bewältigten denn die Eltern diese vielen Todesfälle von eigenen Kindern?!
Mein Vater hat immer mit Entsetzen die bolschewistische Macht durch ihr Vorgehen nicht anders als „Banditen“ bezeichnet. Auf „Sozialismus“ war er nicht gut zu sprechen, es war für ihn eine Art von Schimpfwort. Nach seinen Äußerungen waren meist die Unfähigen, Taugenichtse, Faulenzer und Säufer Freunde des neuen Regimes, des sog. „Armutskomitees“, das plötzlich Macht hatte und oft über andere Schicksale urteilen durfte.
Im August 1932 wurde das sog. „Ährengesetz“ erlassen. Für die "Verschwendung sozialistischen Eigentums" gab es bis zu zehn Jahre Haft oder auch die Todesstrafe, keine Gnade. In diesem Hungersjahr wurde der Vater mal mit ein paar Maiskolben erwischt und im Keller der Kolchosverwaltung eingesperrt. Man hat ihm bei Arrest angekündigt, dass man ihn erschießen werde. Der Arme erzählte, welch eine Furcht er beim Einsitzen in diesen paar Tagen hatte und wie er dabei laut geheult hat. Er wurde aber schließlich frei gelassen. Ich empfand seine Erzählung damals als einen lustigen Streich (den Vater als „Panikmacher“), den jemand mit ihm machen wollte. Witzig war es aber nicht. Nach dem sog. „Drei Ährengesetz“ wurden auch in der Tat Tausende verurteilt. Warum sollte der Vater nach alldem, diesen sozialistischen Staat lieben?
Und andersrum: Warum aber gab es und gibt´s immer noch Leute, die bis heute dem damaligen Sozialismusimperium nachträumen? Es ist ein anderes Thema.
In den berüchtigten 30er Jahren, 1936 wurde er in die sowjetische Armee einberufen. Er diente bis 1938 in Westsibirien, Stadt Omsk in einem Schützenbataillon. Die Nummer der Einheit und den genauen Ort der Dienststelle konnte er bis ins Detail auch im hohen Alter aus dem Gedächtnis heraufrufen. Wegen der Härte des Dienstes beim Militär klagte er nie, man war ja durch das tägliche Leben auf dem Land abgehärtet. Die Besonderheit dieser Jahre – es war die Zeit des „Großen Terrors“. Der Terror hat auch Säuberungen in der Armee einbezogen. Ständig waren sowohl hochrangige Offiziere, als auch einfache Soldaten aus dem Dienst ins „nirgendwo“ abgeholt worden. Nachts erschienen in der Kaserne Leute von den Verhaftungskommandos des Sicherheitsdienstes, weckten gezielt Soldaten aus dem Schlaf und nahmen sie mit. Die ersten Worte der Opfer bei der Abholung in der Nacht waren: „Wohin“, „Warum? Was habe ich getan?“ Darauf die Ansage: „Wirst sehen. Willst Du Propaganda machen? Und wenn Du unschuldig bist, kommst Du wieder heraus.“ Die Erfahrung zeigte aber, dass es mit dem vorigen Leben vorbei war.
Vater im Dienst der Sowjetarmee 1937
Jeder war in Angst, dass er der Nächste sein könnte. Man hat immer mit Erleichterung zur Kenntnis genommen, dass „Du“ selbst noch die Freiheit genießen durftest. Keiner war sich sicher.
In diesen Zeiten tobte der Säuberungsprozess auch in den deutschen Dörfern im vollen Gange. Plötzlich fand man auch hier – wie aus dem Nichts - „Feinde“, „Spione“, „Mitglieder der verbotenen Parteien“, die nach den allgemeinen Ansichten des Stalinregimes liquidiert werden mussten. Die Feinde: „Wie sahen die aus? Wer war das? Wie viele waren es? Wie hat man sie entdeckt? Wo kamen die her?“ Wie in einem absurden Theater. Genau konnte keiner auf diese Fragen eine Antwort finden. Jedenfalls war das die tägliche Realität. Und die Teilnehmer aus diesem Theater? Tags tagten die Regisseure, die ihre Opfer (sprich Akteure) auswählten, sie hatten doch die Pflicht, die, nach dem von Oben mitgeteilten Befehl, Feinde des Staates zu finden. Die Menschen kamen ins Gefängnis nach Verleumdung durch eigenen Dorfbewohner, oder durch Rache. Ein spontanes schlecht überlegtes Wort konnte zur Verhaftung führen. Negativ wurde auch die Annahme von Hilfspaketen aus Amerika oder Deutschland während den Hungerjahren 1921-22 bewertet.
Nachts spielte sich dann das vorbereitete Drama nach dem gleichen Muster ab. Ein heftiges Klopfen an der Tür. Ab diesem Moment wusste der Akteur im Hause bereits, dass er die tragische Rolle spielen musste. Nur waren halt die ausgewählten Opfer Männer (selten auch Frauen), die keinem etwas im Sinne der Machthaber getan hatten. Sie selbst wurden brutal aus dem intakten Familienkreis herausgerissen. Frau, Kinder weinten – alles vergebens. Sie alle sahen ihren Ernährer zum letzten Mal. Er wurde abgeführt, die Frau blieb ohne ihren Mann, die Kinder ohne Vater. Und das ihr ganzes Leben lang. Wem haben sie was Übles getan? Welcher Teufelsregisseur veranstaltete dieses Schauspiel?
Allein in Baden wurden in den Jahren der „Säuberung“ 1936 bis 1938 95 abgeholte Personen bekannt. Vergessen Sie aber nicht die Opfer der Revolution, des Bürgerkrieges, der Entkulakisierung, die Hungersnot! Diese 95 Opfer kamen jetzt noch dazu. Und die ungeborenen Kinder, die nicht die Welt entdecken durften, weil die jungen Eltern auseinandergerissen wurden. Der brutale Zweite Weltkrieg mit Millionen Opfern hatte aber noch gar nicht begonnen, doch war bereits ein Drittel der Familien in den deutschen Gemeinden schon jetzt ohne ihre Familienväter. Und das berichte ich nicht aus einem Horrorroman, dafür gibt es klare Beweise und historische Belege. Man überlegt sich: „Können Menschen der gleichen Spezies einander das antun?“ – „Normale“ Menschen nicht.
Kaum war mein Vater aus dem Wehrdienst zu Hause, dann traf das bolschewistische Schwert auch seine Familie. Nun wurde sein Bruder Rafael nach einer Denunziation am 03.06.1938 verhaftet und ins benachbarte Dorf gebracht. Alle Gefangenen wurden zuerst nach Selz ins Rayongefängnis gebracht. Mein Vater hat versucht, etwas über ihn zu erfahren. Er ging dorthin, hielt sich beim Dorfsowjet auf. Und tatsächlich konnte er seinen Bruder sehen, stieß auf ihn als Rafael unter Geleit von einem Wachmann auf der Straße zum Verhör geführt wurde. Beide waren vom Treffen überrascht. „Michel, bist Du es? Gut, Dich zu sehen, dass Du hier bist.“ – “Was will man von Dir? Was wird mit Dir?“ - „Keine Ahnung, schlecht…“. Ein kurzes Gespräch wurde vom Wachmann grob abgebrochen: „Wolltet ihr hier ein Gerichtsverfahren führen?!“
Das Verhör fand im Gebäude statt. Es war Sommer, Fenster halb geöffnet. Und Vater konnte dem Verhör von draußen etwas nachlauschen. Konnte einige Wörter des Anklägers mithören: „Der Gefangene ist Sohn eines Kulaken, hat Verbindung zu feindlichen Elementen…“ und so ähnlich.
Ja, aus Erfahrung der letzten Zeit machte man wenig Hoffnung auf ein Wiedersehen. Es war auch bekannt, wer ihn im Dorf angezeigt hatte. Keiner von den im Dorf Abgeholten kam wieder zurück. Nun geschah eine Ausnahme. Rafael, der Lehrer, war sehr redegewandt, für damalige Zeit gut gebildet, klug. Viel Lob habe ich selbst über meinen Onkel, über seine Fähigkeiten später von seinen Schülern und Dorfeinwohnern erfahren. Das könnte zu seiner Entlassung beigetragen haben. Nun, denke ich aber, der Grund seiner Entlassung war ehr ein anderer. Der Gipfel des großen Terrors war bereits vorbei. Der große Terror konnte auch nicht ewig dauern (der übliche Druck war im Lande immer). Aus den zuletzt erforschten Archiven ist bekannt, dass mein Onkel nach Paragraph 4-10 Teil 2, 54-11 Strafgesetz der Ukrainischen Sowjetrepublik 1927-60 р.р. (konterrevolutionäre Propaganda) verurteilt wurde.
Die Vernichtungsquote für 1937, von oben vorgegeben, war erreicht, deshalb kam Rafael am 18.03.1939, nach neun Monaten Haft frei. Sicher haben das Gefängnis und die ganzen Strapazen seiner Zeit ihn nicht unbeeinflusst gegenüber dem Regime lassen können. Er meldete sich später während der deutschen Besatzung freiwillig als Dolmetscher und wurde bei der deutschen SD eingesetzt.
Vaters Freund, Bonavenduri Kirschner, der in Baden nicht weit vom Vatershaus wohnte, wurde auch 1937 abgeholt und in Odessa erschossen. Bereits 1933 war er zu drei Jahren Haftstrafe verurteilt. Und erst später, 1937, wurde sein Leben endgültig ausgelöscht. Diese Informationen konnte man später aus den Archiven in Odessa erfahren. Kirschner hatte gerade geheiratet, seine Frau Barbara war schwanger. Ihr Sohn hat seinen Vater nie kennengelernt. Barbara musste ihren Sohn Josef allein durch alle schwierigen Jahre hindurch großziehen. Wie es ihnen nach dem Krieg erging? Mal hat Josef im Hungersjahr 1946 die Brotkarte für sich und die Mutter – Ration für eine ganze Woche - verloren. Seinem minderjährigen Sohn hat sie aus Verzweiflung vorgeworfen, dass sie beide jetzt verhungern würden. Sie hatten, wie man weiß, überlebt. Meine Mama hätte gesagt: „Gott hat ihnen geholfen“. Nachdem meine Mutter 1978 starb, heiratete mein Vater die Barbara. Sie war seine zweite Frau.
Meine Mama und Tante Brigitte in jüngeren Jahren
Aus den Archiven ist auch ein anderer Fall bekannt. Der Lehrer Peter Krim (Петр Андреевич Крым), 1937 verhaftet und zu 10 Jahren Haft verurteilt, wurde 1939 freigesprochen. Über den Freispruch wurde ihm nicht berichtet. Und so musste er die ganze zehn Jahre durchsitzen! Schicksale! Schicksale! Wie mein Vater sagte „Banditen“!
Was war aber mit meinem Vater nach dem Militärdienst in Russland? Er heiratete glücklich meine Mutter. Mein Bruder Rafael kam im Dezember 1940 zur Welt.
Mama kam in die Familie ihres Mannes. Hier waren auch noch seine Mutter, ein Bruder und vier Schwestern. Wohnungsraum für alle war kaum da. Unterstützung konnte man auch von Niemandem erwarten. Und so blieb das Einzige - nur ein Anbau eines Zimmers zum Eigenbedarf – mit ständig begleitender Armut. Wie dies geschehen ist, ohne ausreichende Finanzmittel, wurde vom Vater oft erzählt. Die einzige Stütze war der Zusammenhalt der Eltern und die alles bewältigten, jugendliche Kräfte. An Arbeit war man ja gewöhnt.
Die oben beschriebenen Zeiten bis zu Krieg sowie die Flucht aus dem Heimatdorf ins deutschbesetze Polen im Jahr 1944, machten er mit meiner Mutter gemeinsam, Hand in Hand mit. Im polnischen Warthegau wurde er, wie die meisten russlanddeutschen Männer, in die Wehrmacht einbezogen. Durchs Schicksal kriegsbedingt trennten sich dort ihre Wege für neun unvergessliche Jahre. Er blieb seiner Frau bedingungslos treu, tauschte nach dem Krieg freiwillig die amerikanische Gefangenschaft gegen die sowjetische in der Hoffnung, zu seiner Frau und Familie vielleicht noch irgendwann wieder zu kommen! Damals eine Illusion mit ausgeprägter Opferbereitschaft. Er wusste ja, dass Mama mit mir schwanger war. Er wusste aber auch, dass er in der Tat dadurch seine Freiheit gegen die brutale Gefangenschaft in der Sowjetunion opferte.
Sein nächster Lebensabschnitt wird unten im Kapitel „Zurück zu meinem Vater: Wehrmacht, Gefangenschaft, Kolyma„ nachgeholt.
Nun verlassen wir kurz die Geschichte meines Vaters und gehen zurück zum gleichzeitigen Geschehen ins Dorf Wölpern bei Eilenburg in Deutschland.
Meine Mama mit Dorffreunden
Im Zentrum meine Mama, links – Tante Mathilde in Baden
Die Repatriierung
Die sowjetischen Militärbehörden haben keine Zeit verloren. Die Repatriierung der Russlanddeutschen wurde nach durchdachtem Schema umgesetzt. Zuerst mal mussten die „Schafe“ in eine Herde zusammengetrieben werden. Damals wurden die Schwarzmeerflüchtlinge in Sammelläger der Sowjets im besetzten Deutschland zusammengebracht. Unsere waren in einer ehemaligen Kaserne bei Halle versammelt. In den größten Sammellägern waren damals in drei Monaten etwa 11.000 Personen eingebracht.
Die amerikanischen Truppen hatten - bevor sie abzogen und den Russen die in Jalta vereinbarten Ostgebiete überließen - bei allen vorhandenen deutschen DP (displaced persons) Personalien erfasst und Listen der Russlanddeutschen erstellt, auch Fingerabdrücke aufgenommen. Die Menschen deuteten das als Zeichen dafür, dass sie in Deutschland bleiben werden. Auf irgendwelche Auskunft wartete man bei den Amerikanern vergeblich. Sie ließen die Fingerabdrücke bei sich für den Fall der Fälle archivieren. Diese erstellten Listen wurden dann den sowjetischen Militärbehörden übergeben. Somit leisteten sie ihren „Beitrag“ zu deren Repatriierung zurück ins Unglücksland.
Mit Propaganda und Lügen wurde die Rückkehr vorbereitet. Allerlei Versprechungen wurden gemacht. Gezielt wurde eine Broschüre herausgegeben, wo versprochen wurde, dass kein Volk der Sowjetunion durch das Kriegsschicksal diskriminiert wird, die Kirchen wiedereröffnet werden und dass die Heimkehrer bei der Ankunft mit Darlehen und weiterer Unterstützung rechnen könnten. Unterstützt wurde diese Propaganda durch gute Verpflegung. In der sowjetischen Zone wurden Küchen eingerichtet, dreimal täglich warmes Essen gab es aus dem Feldkochherd „Gulaschkanone“, mit üblichem, bekanntem russischem Essen – Borsch, Kascha. Und das am Ende des Krieges! Was ging in den Menschen vor?
Es waren nicht viele, die den Versprechungen mistrauten und die Situation richtig einschätzen konnten, die Willkür der sowjetischen Mächte in den 20er und 30er Jahren nicht vergessen hatten und sich nicht blenden ließen. Diese suchten nach Wegen, die nach Westen, in die anderen Zonen führten und auch noch mutig genug waren, das umzusetzen.
In den ersten Tagen nach Kriegsende konnte man das bei dem herrschenden Durcheinander fast ungehindert machen. Man musste sich nur weiter in den Westen begeben, dort untertauchen bzw. weiter in ein anderes Land – Amerika, Argentinien schaffen, das ging noch. Das war aus der Sicht von heute sehr logisch. Aber damals? Da musste man schon klug und einfallsreich sein und eigene Initiative zeigen. Und die Gefahr, von den Siegermächten in die sowjetische Zone abgeschoben zu werden, war real. Das geheime Protokoll der Jalta-Konferenz blieb ja noch geheim. Trotzdem taten viele das und konnten Sibirien, der Kommandantur, dem Gefängnis und vielleicht dem Tod entgehen.
Diejenigen, denen es gelungen war, hatten wir danach in Sibirien und anderen schlimmen Verbannungsorten groß beneidet. Fotos, die wir später aus dem Westen geschickt bekamen, erschienen uns, als ob sie von einem anderen Planeten stammten. Lange und sorgfältig untersuchte ich diese Fotos und versuchte mir ein Bild über ihr Leben zu erstellen. Ihre Kleider, ihre Gesichtsausdrücke, die Fotoqualität, alles schien weit weg und niemals erreichbar zu sein.
Währenddessen durchkämmten speziell ausgebildete Kommandos der sowjetischen Offiziere auch die von den Alliierten besetzten deutschen Gebiete, um „ihre Bürger“ zurückzuholen. Sie durften von einer deutschen Stadt, von einer Besatzungszone zur anderen reisen. Und so überließen die Alliierten den Kommandos aus Russland freie Hand. Besonders in der britischen Zone wurden die sowjetischen Bürger rücksichtslos ausgeliefert. Sowjetische „Spürhunde“ pickten sich die Ostarbeiter, „Wlassowzi“, Kriegsgefangene, KZ-Insassen und unsere Deutsche aus Russland heraus mit voller Unterstützung der alliierten Besatzungsmächte. Die Anmeldeinformation über die Opfer bekamen sie von den Amerikanern.
Nelli Däs, eine russlanddeutsche Schriftstellerin, beschrieb so eine Episode, als das suchende sowjetische Kommando in der amerikanischen Zone, wo sie wohnte, auftauchte. Unter Begleitung eines amerikanischen Vertreters wollten sie mit Versprechungen und Propaganda die aufgespürten Russlanddeutschen mitnehmen. In vielen Fällen gelang dies ihnen auch. Doch es gab auch Ausnahmen. Nellis weitsichtige Mutter währte sich verzweifelt dagegen und die Familie durfte bleiben. Tief in ihrer Erinnerung blieben immer noch die schlimmen Jahre, auch das Jahr 1937, als ihr unschuldiger Ehemann aus der Familie in den Tod gerissen wurde. Der anwesende amerikanische Offizier hatte Mitgefühl und erlaubte den russischen Offizieren nicht, die Familie mit sich zu nehmen. Dieser eine Moment hat das Schicksal der gesamten Familie entschieden. Sie durften die Freiheit genießen und den kommenden Wohlstand miterleben. Welch ein Kontrast zu den meisten Anderen, die in die Ostzone gebracht wurden und denen der zukünftige Weg in die Sklaverei nicht erspart blieb. Schicksale, Schicksale!
In den Sammellagern untergebracht, ließen sich die Menschen überreden oder besser gesagt verdummen. Haben sie die Strapazen des bolschewistischen Regimes vergessen? Waren sie wirklich so blöd, um den Versprechungen zu glauben? Eine gute Frage. Jeder hat sich bestimmt darüber Gedanken gemacht. Doch in der damaliger Situation?
Zuerst mal wurde keiner von ihnen direkt angesprochen. Welche Alternative sahen die Menschen, die bereits eine tragische Flucht hinter sich hatten? Man hat sie als Deutsche ins „Reich“ gebracht. Viele waren hier auch eingebürgert. Diese deutschen Behörden gab es jetzt nicht mehr. Welchen Status hatten die Flüchtlinge jetzt? Sie hatten das Gefühl, keiner braucht sie hier, zumal auch noch jeden Tag neue Flüchtlingswellen heranrollten. Und nun kümmerten sich die sowjetischen Behörden um sie, organisierten und entschieden alles für sie. Man verpflegte sie, wie beschrieben, auch gut. Und die Versprechungen klangen verlockend, gaben neue Hoffnung, wieder in die alten Dörfer zurückkommen zu können. Und das Heimweh steckte immer tief in ihnen. So hat man sich treiben lassen, in einer Herde zusammen war es leichter. Und bei den Sowjets war es nicht die letzte dreiste Lüge. Tatsächlich befanden sich die Flüchtlinge in der Falle.
Einzeln kamen auch beunruhigende Gerüchte, die angeblich von einem russischen Offizier stammten, der bereits ein Flüchtlingszug nach Russland begleitet hat und jetzt die nächsten Opfer abholen sollte. Die lauteten, es wird nicht in die alte Heimat nach Hause gehen, sondern nach Sibirien. Dem konnte man, wollte aber nicht glauben. Den Anderen gab es vielleicht den letzten Impuls, sich noch in den Westen abzusetzen. Nur zur Massenaufregung kam es nicht, die Lagerverwaltung hat auch dafür gesorgt, verschärfte auch die Vorkehrungen. Wenn in der ersten Zeit Menschen aus dem Lager relativ frei raus und rein gehen konnten, wurde zuletzt der Ausgang sehr eingeschränkt und schließlich eingestellt. Je näher der Termin zum Abtransport kam, desto strenger wurde die Bewachung des Lagers. Die Wachen am Tor hatten gut aufgepasst. In der Nacht wurde der Aus- und Eingang sowieso verboten.
Und alle Erwachsene wurden von einer Militärkommission genauestens erfasst, sowjetische Passe, Bescheinigungen, Arbeitsbücher, deutsche Ausweise, Einbürgerungsurkunden, alles wurde abgenommen. Bereits hier wurden Männer über ihre Tätigkeit in den letzten Monaten befragt, einige auch verhaftet.
Bald wurde der freie Verkehr auch zwischen den Besatzungszonen unterbunden. Nur durch ein Visum / eine Erlaubnis durfte man Grenzen übertreten. Bei nicht Einhalten der Regeln kam man vors Militärgericht und bekam einige Tage Haft.
Und so kam der Verschleppungstag immer näher. Güterwaggons wurden angetrieben, die Verladung fing an. Und zuerst hoffte man auf einen guten Ausgang, die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Sie nahm aber verschiedene Formen an, alle Hoffnungen starben nacheinander, bis sie sich auf das nackte Überleben beschränkten.
Es ging los. Täglich verließen Züge Richtung Osten. Wohin es tatsächlich ging, wussten die Insassen nicht, erfuhren sie erst später, da hatten die Menschen keine Wahl mehr. Aber zuerst – „Ade Deutschland!“
Die meisten hatten noch Gelegenheit, sich möglichst gut auf die Fahrt vorzubereiten. Wer es konnte, sammelte Kleider, warme Sachen, auch einige Lebensmittel. Diese Gegenstände hatten später sehr großen Wert gehabt. In den schrecklichen nachfolgenden Hungerjahren waren es Tauschobjekte, dafür konnte man Lebensmittel eintauschen und Manchem das Leben retten. Ich kann mich an eine große stabile Stahlwanne erinnern, etwa 100x50x40 cm, die lange, mehr als 30 Jahre sehr nützlich bei uns für verschiedene Zwecke gebraucht wurde. Sogar eine Nähmaschine Marke „Singer“ konnte die Tante Brigitte mitnehmen und bis nach Sibirien heil bringen. Sie hatte das Nähen noch in Baden in der Schule gelernt. Für das Überleben in Sibirien war das ein großer Schatz. Sie konnte im Sibirien damit bei den Einheimischen Kartoffeln und Milch für mich bekommen. Sie traute sich zu, alles Mögliche zu nähen - Hemde, Röcke - auch neu zuzuschneiden. Die Nähmaschine war von hoher Qualität – „Made in Germany“. Später produzierte die Sowjetunion eine eigene Nähmaschine unter dem Namen „Podoljskaja“ – eine 100%ige Kopie unserer „Singer“.
Die Güterwaggons waren für Menschentransporte nicht vorgesehen, wurden auch nicht umgerüstet. Um die 50 bis 70 Menschen wurden in einem Waggon zusammengepfercht. Jeder auf dem Boden, auf den Säcken. Und für die menschlichen Bedürfnisse wurden in einem Teil des Waggons Eimer aufgestellt. Diese provisorische Toilette wurde mit Tüchern gegen fremde Einblicke abgeschirmt. Verlegenheit, Schamgefühl – nicht unbedingt, es waren ja praktisch lauter Frauen und Kinder. Beim Halt des Zuges liefen Menschen wett auf der Suche nach einem geeigneten Busch, Baum oder Hügel.
Ja, zuerst mal musste man das ungewisse Ziel erreichen. Der Zug rollte durch Deutschland, in Polen hat er öfter angehalten. Oft auf Abstellgleise geschoben, manchmal für mehrere Tage vergessen. Einige Strecken waren nur eingleisig. Militärzüge hatten Vorfahrt. Große Truppeneinheiten wurden im fernen Osten für den bevorstehenden Krieg gegen Japan aufgestockt. In diesem Strom floss auch die Kriegsbeute (Fabrikanlagen, Möbelstücke, Kleidung u.a.). Zu der Kriegsbeute gehörten auch die repatriierten Menschen. Nur hatten die keine Vorfahrt.
Bei jedem Halt versuchten die Leute Essen zuzubereiten: zwei Ziegelsteine auf den Boden, dazwischen mit Spaltholz und Reisig offenes Feuer angelegt. Manchmal blieb der Zug nur kurz stehen, und plötzlich begann er ohne Vorankündigung weiter zu rollen. Das halbgekochte, karge Essen musste schnell aufgeladen und bei der Fahrt halbroh aufgegessen werden. Vom Zeitplan keine Rede.
Die Leute überbrückten die erste Zeit ihre Essbedürfnisse mit ihren eigenen mitgenommenen Lebensmitteln. Bekamen aber dann auch von dem Zugführer wöchentlich Proviant (Zwieback - Suchari, Salzfisch, Päckchen Tee, ab und zu etwas Zucker) zugeteilt, welches an den Waggonältesten abgegeben wurde. Nur es waren Mengen, die nicht einmal für ein paar Tage ausreichten. Die Menschen, die zuletzt im Dorf beim Bauer arbeiteten, hatten auch entsprechend mehr Lebensmittel dabei. Und es wurde irgendwie im Waggon untereinander so verteilt, dass der Hunger einigermaßen erträglich war. Auf die gerechte Verteilung passte der Waggonälteste auf.
Der Weg war lang und dauerte ewige 2 Monate. Von Anfang an war das Ziel der Fahrt unbekannt. Man kriegte sowieso vom Begleitpersonal auf diese Frage keine Antwort. Einige, mit Erdkunde vertraute Leute, versuchten durch die Namen der Bahnstationen die Zugrichtung zu erraten, hofften, dass es irgendwann der Zug die Richtung ihrer alten Heimat einfährt. Alles vergeblich, sie wurden langsam enttäuscht, es tauchten andere, für sie unbekannte Orte im Norden, im Ural, in Sibirien oder Mittelasien auf. Die Mehrheit der Insassen hatten jedoch kein Gefühl für Raum- und Zeitorientierung. Jetzt hatten auch sie bedingungslos kapituliert.
Man sollte sich diese Reise möglichst gut vorstellen, mehrere Tausende von Kilometern durch mehrere Zeit- und Klimazonen, vom Sommer in den Winter, ohne den kleinsten Komfort oder Waschmöglichkeiten. Mehrere Schwierigkeiten mussten überwunden werden. Viele Menschen blieben oft zurück von ihren Zügen, Glück hatten die gehabt, die dann nachkamen. Einige aber auch nicht. Maria Bullach, die Frau von unserem Michael, ist fast zurückgeblieben, dank eines Mannes wurde sie mit ihrer Schwester in den fahrenden Waggon hineingezogen. Die damals 15jährige Julja, meine Cousine, verpasste den Zug nach dem Versuch, Wasser zu holen. Ihr Glück war, sie konnte schon damals Russisch. Und so wurde sie dann mit einem anderen Militärzug bis zur nächsten Station gebracht, wo ihr Zug im Abstellgleis stand. Unter den mehreren Waggons kletternd erreichte sie die Eltern.
Kleinkinder? Waren doch auch dabei. Ihre Überlebenschancen waren nahezu Null. War es kein Widerspruch, dass ich ja am Leben blieb? Ein 4 bis 5-monatiger Säugling braucht ja Einiges. Vor allem Dank meiner lieben Tanten und meiner Mama, die das Unmögliche ermöglicht haben. Vieles mussten sie improvisieren. Die nassen Windeln an ihren Körpern trocknen. Die ganze Kinderpflege, alles, was ein Kleinkind brauche, war pure Improvisation, großer Wille und Einsatz. Jetzt habe ich eigene Kinder und Enkel. Wie viele Leben blieben aber mit den Verstorbenen, kleinen Sprösslingen ungeboren auf der Strecke? Das gilt auch für Millionen umgekommener Menschen in diesem furchtbaren Krieg.
Während des langen Weges waren Kleinkinder und in den großen Maßen auch Erwachsene verschiedenen Gefahren und Krankheiten ausgesetzt. Meine gute Bekannte, Emma Schurr, erzählte, wie der Zug während der Fahrt an einem großen Fluss halten blieb. Die Kinder waren auf sich allein gelassen, hielten sich am hohen Ufer auf. Und wie es so manchmal ist, war ein junger Knabe ins Wasser ausgerutscht, wurde vom Strom mitgezogen, konnte nicht mehr gerettet werden. Die junge Mutter des Kindes schrie erbärmlich, aus Verzweiflung stieß sie sich ununterbrochen den Kopf an die Stahlträger der Brücke, Blut floss ihr übers Gesicht.
In dem Waggon waren neben mir auch einige andere Kinder. Die Schwester meines Vaters, Tante Maria, hatte einen einjährigen Sohn Adolf. Die Fahrt hat er nicht überlebt. Die Familie meines Onkels Josef, Mamas Bruder, hatte auch eine kleine Tochter, Maria. Ihr erging dasselbe Schicksal. Die ältere Julia hielt ihre kleinere Schwester am Arm, plötzlich: „Mama, Mama, schaut mal, die Maria zittert ganz!“ In Kürze war das Kind erlöst. Allen Verstorbenen konnte keine letzte Ehre erbracht werden. Sie wurden in Tücher, Lumpen eingewickelt und neben dem Gleis zurückgelassen. Wie viele waren es? Keiner hat eine Statistik geführt. Die Namen blieben zerstreut nur in Erinnerungen der Überlebenden. Frauen haben sich mit Gebeten getröstet.
Während der Fahrt war keiner sich sicher. Die Reisenden wurden den Witterungsverhältnissen, der Willkür der begleitenden Mannschaft und der marodierenden Banden und Vergewaltiger, die unterwegs ihre Gräueltaten verübten, ausgesetzt. Bei einem Stopp in Polen in der Nacht drangen mit Maschinenpistolen bewaffnete Männer in den Waggon. Wer konnte oder wollte sie aufhalten? Ein Schreck, der noch lange in Alpträume verursachte. Die Ganoven nahmen mehrere Säcke, Packungen mit Hab und Gut mit. Gleich morgens entdeckten die Ausgeraubten weiter unten am Fluss Reste der zerrissenen Verpackungen. Alles noch Nützliche wurde aufgenommen und weiter ging’s.
Unser prominenter Historiker Dr. Anton Bosch beschrieb sein Familiendrama bei der Zwangsfahrt aus Deutschland unterwegs nach Udmurtien. Seine Sechsjährige Schwester verstarb bereits in Warthegau an Kehlkopfdiphtherie. Er selbst, damals ein 11-jähriger Junge, erkrankte unterwegs an Typhus, lag einige Tage mit hohem Fieber im vollgestopften Waggon, oft ohne Trinkwasser, zwischen Leben und Tod. Das Schicksal war gnädig - er überlebte. In dem Grenzübergang zur UdSSR in Kowel, Tschechoslowakei, mussten sie vor dem Weiterreisen eine Woche unter freiem Himmel und im Dauerregen, im Schlammlager ausharren. Jede Nacht wurden die Menschen von betrunkenen und bewaffneten Banditen bedroht. Diese nahmen sich, was sie wollten – auch junge Mädels zum Spaß. Auf Schreie von Opfern hatte keiner mehr reagiert. Menschen waren froh, wenn es sie nicht traf. Die Banditen richteten ihren Hass in erster Linie gegen die Russlanddeutschen, gegen die, aus ihrer Sicht, Verräter. Antons beide sechs Monat kleine Zwillingsschwestern waren es, im Gegensatz zu ihm selbst, das Überleben nicht geglückt. Sie verstarben am Ende der zweimonatigen Reise. Die Mutter wickelte die Leichen in Tücher und befestigte sie mit einem Strick auf dem Dach des Waggons. Gelegentlich überprüfte sie, ob das schmerztragende Päckchen noch vorhanden war. Im Verbannungsort in Udmurtien angekommen, suchten sie einen Friedhof, fanden einen ohne Namensschilder (der gehörte den verstorbenen Häftlingen) und begruben dort im herrschenden Winter notgedrungen ihre Lieblinge. Wenig später wurde dieser Friedhof aufgelöst und mit Häusern bebaut. Unzählige solche Gräber „produzierte“ damals die brutale Gegenwart. So bestand die Familie am Ende der Reise nur noch aus Anton und seiner Mutter. Der Vater blieb nach der amerikanischen Gefangenschaft in Westdeutschland, verstarb danach an seinen Wundverletzungen.
Ein anderer seltener Fall war mit Emma Petkau. Sie mit ihrem Mann Peter und Kindern haben wir bereits seit 1989 in Deutschland als gute Freunde kennengelernt. Emma selbst war vom gleichen Jahrgang wie ich, Ende Juli 1945 geboren. Ihre Mutter war vor der Deportation hoch schwanger. Alles war damals schon für die Rückfahrt in die Sowjetunion vorbereitet, der Zug sollte schon rollen. Ihre Mutter brachte Emma am Bahnhof zur Welt. Es ging danach in den Zug und weg. Ihrer sorgfältigen, mutigen und sehr klugen Mutter, sowie ihren Begleitern verdankte auch Emma ihr Überleben. Das waren alles große Ausnahmen. Der Zufall war ihr barmherzig. In einer Nacht in Weißrussland hielt der Zug, die ältere Schwester Martha, 9 Jahre, stieg in der Notdurft aus dem Waggon. Der Zug fuhr weg, das Kind lief hinterher, jemand konnte sie noch im letzten Moment hineinziehen. Sonst hätte die Mama ein Kind geboren und das andere verloren. In Weißrussland bekam ihre Mutter nach einem verdorbenen Essen Dauerdurchfall dazu. Sie hatte letztendlich keine Milch mehr, um das Baby zu stillen. Die mitgenommenen Kleidersachen aus Deutschland hatte sie gegen Milch eingetauscht. Nicht weit von der Grenze, bereits in der Westukraine (Wladimir-Wolynsk), am 3. August, stand der Zug die ganze Nacht und sie mussten unter freiem Himmel ausharren. Die Mutter hatte das Kleinkind an der Brust gehalten, um es zu wärmen. Angekommen in Duschanbe (Tadschikistan), mussten sie in einer offenen Lore noch eine lange Strecke mit dem Kind an der Brust fahren. Es regnete und es war frostig, die Füße eisig. Wegen Dauerunterkühlung, mit schlimmer Bronchitis am Ziel angekommen, litt sie anschließend an chronischem Asthma. Ihr ganzes Leben lang begleiteten sie diese und andere Krankheiten. Emma selbst blieb nicht von vielen Krankheiten verschont – Magenprobleme und viele anderen chronischen Krankheiten plagten sie ihr Leben lang. Ihrem Vater, auf einem Auge praktisch blind, blieb zwar der Wehrdienst an der Front fern, er musste jedoch zivilen Dienst leisten, stand ein paar Mal sowohl von bei den Deutschen als auch vor den Russen vor der Exekution. Nach Ankunft in der UdSSR musste er noch in Akmolinsk (Kasachstan) Dienst in der Arbeitsarmee leisten. Er blieb danach mit der Familie noch ein paar Jahre am Leben.
Laut sowjetischer Statistik wurden in den 40er Jahren über eine halbe Mio. Deutsche nach sowjetisches Mittelasien deportiert und nach offiziellen Angaben, 40 Tausend – nach Tadschikistan. Das waren zuerst mal die in der „Wolgadeutschen-Arbeitsarmee“- Menschen, die hinter Stacheldraht untergebracht und schwerste Zwangsarbeit ausüben mussten. Später wurden Repatrianten aus Deutschland auch gerne in den Uranminen eingesetzt, wo sie ohne jeglichen Schutz vor radioaktiver Strahlung nach ein paar Jahren starben. Vielen ist nicht bekannt, dass Tadschikistan über 10 % bis13 % der Uranvorräte der Welt verfügt.
In der Stadt Taboschar, ordnete das sowjetische Verteidigungsministerium am 27. November 1942 an, Uranerz in einer Fabrik im Rahmen eines Atombombenprogramms aufzubereiten. Der Mangel an Uran war anfangs das wesentliche Hemmnis für das Atomprogramm. Das als streng geheim deklarierte Dekret (Nr. 2542) von 1942 sah vor, jährlich vier Tonnen Uranerz in Taboschar zu gewinnen und zu verarbeiten und darüber hinaus weitere Uranerzlager zu erschließen. Die tadschikische Stadt Istiklol (bis 2012 Таboschar) war zu diesem Zeitpunkt auf keiner Karte der Welt markiert. Alle Arbeitsschritte, um hieraus das erste angereicherte Uran in der Sowjetunion zum Bau einer Atombombe zu gewinnen, erfolgten manuell. Die Aufbereitungsanlage blieb in Taboschar bis Anfang der 1970er Jahre in Betrieb. In den 1940er Jahren erbauten im Ort die vertriebenen Deutsche sowie die deutschen Kriegsgefangenen, die dort als Arbeiter für den Uranabbau angesiedelt wurden, die für Tadschikistan ungewöhnlichen Einfamilien- und Reihenhäuser. Die Architektur dieser Stadt gestalteten deutsche Kriegsgefangene. Ein krasser Unterschied zu den einheimischen Häusern. Man könnte meinen, man wäre irgendwo in Deutschland.
Die ersten Deutschen wurden hierhin noch in den Zeiten der Kollektivierung verschickt. Die Zahl der Russlanddeutschen in Tadschikistan nahm allmählich zu. Wegen des wirtschaftlichen Zusammenbruchs nach der Unabhängigkeit des Landes 1991 wurde der Uranabbau in Tadschikistan 1992 eingestellt.
Seitdem hat sich vieles verändert. Das ökologische Hauptproblem der stillgelegten Uranmine sind die ungeschützten Schutthalden mit 55 Millionen Tonnen Abraum, von dem etwa zwölf Millionen Tonnen aus Uran enthaltenden Erden besteht. Alle verseuchten Flächen betragen 180 Hektar. Einige Abraumhalden sind bis heute nicht durch eine neutrale Erdschicht versiegelt. Die ehemalige Urangrube ist zu einem tiefblauen See geworden, dessen Wasser radioaktiv verseucht ist. Für die Entsorgung radioaktiver Stoffe benötigt man etwa 55 Millionen US-Dollar, und diese Mittel kann Tadschikistan nicht selbst aufbringen. Die EU ist dabei zu helfen, Die Einwohner setzen auf die Chinesen ihre große Hoffnung. Der angrenzende Staat Kasachstan ist heute der größte Uranproduzent mit 36,5% der Weltproduktion im Jahr 2012.
Unterwegs boten sich traurige Nachkriegsbilder: zerbombte Städte und Bahnhöfe, Granatentrichter, verstümmelte stählerne Schienen. Vieles lag in Schutt und Asche. Aufgewachsen in der ukrainischen Steppe, in geweißten schönen Häusern, in Dörfern zwischen den grünen Oasen, war man nun in eine ganz fremde Welt hineingerissen. Die Landschaft selbst wirkte fremd und düster. Es ging durch grenzenlose Weiten, in diesen Gegenden kamen bewohnte Orte nur gelegentlich vor. Vorbei flogen armselige Dörfer mit dreckigen Lehmhäusern mit Strohdächern, dann schwarzgraue hölzerne Häuschen mit kleinen Fenstern. Und je weiter nach Osten desto mehr sah man nur Wald und Wald. Waren diese Frauen mit ihren Kindern überhaupt geeignet für ein Leben im Wald in Sibirien, oder in der kasachischen unfreundlichen Steppe und mittelasiatischen Bergen? Trostlosigkeit und Gewalt machte sie alle dazu geeignet.
Auf diese oder ähnliche Weise wurden die etwa 300 Tausend deutsche Repatrianten behandelt. Nach dem Zufallsprinzip wurden sie in dem einen oder anderen Ort untergebracht. Anton Bosch und seine Verwandten sollten „planmäßig“ nach Krasnojarsk in Ostsibirien gebracht werden, landeten aber in Udmurtien! Angeblich war die Quote für Sibirien erfüllt. Man sagt ja: „Wie, wo und wann der Mensch auf die Welt kommt, hängt von Gott ab – kein Zufall, dahinter stehen göttliche Kräfte“. Das Regime in der Sowjetunion übernahm quasi göttliche Funktionen, wie mit einem Zauberstab wühlten sie ganze Völker und Millionen Schicksale durcheinander, wie es ihnen gefiel.
In meinem Leben kreuzten sich die Wege mit vielen deutschen Menschen, die nach dem Krieg sowohl im Ural und hohen Norden, in Sibirien, im Nordosten Russlands, in Kasachstan und Mittelasien lebten – in allen schlimmen Gegenden des riesigen sowjetischen Reiches. Allesamt wurden sie mit ihren Wurzeln aus ihrem gewöhnlichen Leben herausgerissen und in den unwürdigen Gegenden niedergelassen.
In solchen schweren Zeiten bestanden die Überlebenschancen in großem Maße von der Fähigkeit ab, sich an die Situation anzupassen und die richtigen Entscheidungen, im richtigen Moment zu treffen. Mein Onkel Rafael hat bei SD als Dolmetscher gedient, kam in die russische Gefangenschaft. Die Behandlung, Erniedrigung war für ihn unerträglich. Bei ihm war ein Freund, beide stammten aus dem gleichem Dorf Baden. Nun war Onkel Rafaels Geduld gebrochen, er hat irgendwie kurz seinen Frust über die Behandlung geäußert. Die Reaktion hat nicht lange auf sich warten lassen. Ihm wurde ein Spaten gegeben, er musste sich ein Loch in der Erde graben und wurde direkt in die Grube herunter erschossen. So hat es sein Freund viel später der Tante Monika – der Witwe vom Onkel Rafael – in Detail erzählt. Er selbst hat es ohne zu meckern und Widerworte zu geben ertragen und wurde irgendwann freigelassen.
Die erzwungene Heimat
Onkel Rafael während des 2ten Weltkrieges