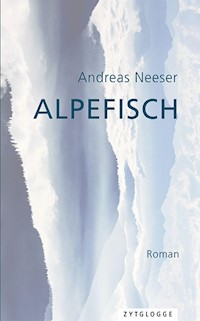Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
DIE BERÜHRENDE GESCHICHTE VON LIEBE UND ABSCHIED IN DER BRETAGNE Die Welle ist da, bevor man sie sieht ? und nichts ist mehr, wie es war. Ein Paar pflückt Muscheln auf den Granitfelsen von Feunteun Aod in der Bretagne, als unvermittelt eine mächtige Brandungswelle vor den beiden aufsteigt. Véro wird unwiederbringlich ins offene Meer hinausgetragen, der Mann überlebt wie durch ein Wunder. Und genau das ist sein Problem. Die körperlichen Verletzungen lassen sich kurieren ? wie aber das Schicksal des Überlebenden annehmen? Ein Jahr nach dem Unfall reist der Zurückgebliebene erneut in das kleine bretonische Küstendorf. Hier will er Abschied nehmen, sich mit dem Meer und sich selbst versöhnen. Die Dorfbewohner helfen ihm dabei ebenso wie sein Freund Max, der sich eine ganz besondere Therapie für ihn ausgedacht hat ? EMOTIONAL, MITREISSEND UND LEBENSECHT In seinem neuen Roman findet Andreas Neeser eine beeindruckende Sprache für die existenziellen Fragen nach Schicksal, Zufall und Schuld. Er lässt uns die Kraft der Natur am bretonischen Atlantik erfahren ? und erzählt zugleich die berührende Geschichte einer großen Liebe, die über den Tod hinweg lebendig bleibt. "Andreas Neeser hat eine vorsichtige, fragile, doch kraftvolle Sprache, sie ist fein, sie ist bitter, sie ist leise, sie ist verletzlich. Und genau. Also schön. Ruhig, aber dann unerwartet auf einmal: ein schwarzes Loch, man kann nicht alles wissen. Aber es wird uns viel gesagt. Über Zufall und Schicksal, Leben und Tod, über Liebe und Liebe. Wortnähe und Herznähe: Das haben wir selten." Péter Esterházy
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 178
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andreas Neeser
Zwischen
zwei
Wassern
Roman
Der Autor dankt dem Künstlerhaus Edenkoben, dem Stuttgarter Schriftstellerhaus, der UBS Kulturstiftung und dem Aargauer Kuratorium für die Unterstützung der Arbeit an diesem Buch.
Enfant du voyage
Ton lit c’est la mer
Ton toit les nuages
Été comme hiver
Ta maison c’est l’océan
Tes amies sont les étoiles
Tu n’as qu’une fleur au coeur
Et c’est la rose des vents.
aus einem französischen Chant de marin
Ce n’est pas l’homme qui prend la mer,
C’est la mer qui prend l’homme.
Moi la mer elle m’a pris
Comme on prend un taxi.
Renaud, Dès que le vent soufflera
1
Fünfzehn Steine, der Haufen wird größer. Jeden Tag gehe ich die wenigen Schritte von meinem Chambre d’hôtes zur Küste, klettere seitlich die Felsnase hinunter. Ich schaue in den Himmel, der seit Tagen wolkenlos ist, kompromissloses Blau. Ich prüfe die Richtung des Windes, atme tief ein und lege den mitgebrachten Stein zu den andern. Wählerisch bin ich nicht, mir ist jeder Stein recht, den ich auf dem Weg zur Klippe finde. Unansehnlich sind sie alle. Staubiges Graubraun, Splitter eines uralten, undenklichen Zusammenhangs.
Robinson würde Kerben ins Holz schneiden. Bei Tagesanbruch würde er von seinem Unterstand zum Strand gehen, eine Markierung ins Kreuz schnitzen und für sein Leben danken. Ich lege jeden Tag einen Stein auf den Haufen und setze mich hin. Ob ich zu danken hätte – ich werde es vielleicht nicht erfahren, und vielleicht werde ich es nicht erfahren wollen. Ich lebe. Das ist genug. Und ich bin freiwillig hier am Ende der Erde. Kein Meer hat mich ausgespuckt, gestrandet bin ich höchstens in mir selbst.
Noch drei Wochen, dann wird von meiner Anwesenheit hier nichts geblieben sein als ein Haufen Granit, und selbst der wird spätestens vom ersten Wintersturm von der Klippe gefegt werden. Einzig mir selbst bin ich auf dieser Terrasse verpflichtet. Dennoch fällt mir immer wieder Robinson ein. Der große Überlebende meiner Kindheit. Am Tag meiner Ankunft habe ich mich hier hingesetzt. Erschöpft von der langen Reise, erschöpft überhaupt, schlief ich ein. Als ich die Augen aufschlug, blickte ich in die Sonne – und sie brannte die Farbe aus der Welt. Während ich im Schmerz die Lider zusammenkniff, dachte ich an meinen ersten Helden. Halb nackt lag er im tropischen Sand, Haut und Knochen. Die aufgesprungenen Lippen. Der menschenleere Strand, das Wasser, die sengende Sonne. Ein Zucken um die Augen, ein Blinzeln. Weißblende. – Das Verschwinden von allem im Augenblick des Erwachens. So war das damals im Fernsehen. So war es am Tag meiner Ankunft. Mehr verbindet mich nicht mit Robinson Crusoe. Doch der Gedanke an ihn war in jenem Moment das Einzige, was mich mit mir selbst verband.
Und dann war da dieses Blau. Hunderte Male schon hatte ich das Blau dieses Himmels gesehen; zum ersten Mal sah ich es nun wirklich. Und mir war klar: Blau ist die Farbe am Anfang, und diesen Anfang gibt es. So ist das noch immer. Fünfzehn Steine. Jeden Tag lege ich einen weiteren auf den Haufen – für den Anfang von allem, und den Anfang danach. Vielleicht gibt es ihn nur hier, weil es nirgendwo sonst einen solchen Himmel gibt. Und weil nur hier überhaupt ein Anfang zu denken ist.
Jeden Tag dieses anfängliche Blau. Gäbe es Auskunft, ich wüsste nicht, was ich würde wissen wollen. Es ist ein Blau der widerspruchslosen Stille. Eine unmissverständlichere Farbe gibt es nicht. In ihrer Tiefe fühle ich mich auf abgründige Weise geborgen, ihre Kälte verhöhnt mich, ihre Distanzlosigkeit macht mich ratlos. Was wäre zu fragen? Was wäre zu vernehmen von da oben? – Je länger ich auf der kanzelartigen Terrasse in das Blau starre, desto stärker saugt es mich auf, spült mich in sich hinein. Wenn es mich nicht mehr gibt, wenn es mich gegeben haben wird, stellt sich keine Frage mehr. Auch die eine nicht.
Vor mir, über mir der Himmel, in meinem Rücken flechtiger Stein, unter mir das Meer. Feunteun Aod. Hier beginnt der Anfang. Hier geht alles weiter. Die Wellen zerbersten dumpf an der Klippe, sie verschlucken sich an der eigenen Wucht, wühlen sich in Wirbeln in sich selbst hinein, und sie sammelten ablandig neue Kraft, würden sie nicht bereits überrollt von einer nächsten, die mit nicht geringerer Gewalt dasselbe schaurige Schauspiel vollzieht. Ich höre sie. Ich sehe sie kommen und sich erschöpfen am Fels. Ich habe sie immer gehört und gesehen.
Mein Anfang aber hat keine Wellen und keine Brandung. Denn hier ist kein Wasser, hier gibt es kein Meer. Seit ich allein aus dem Urlaub mit Véro zurückgekehrt bin, ist diese Landschaft Himmel und Erde. Das Blau gibt es, mit all seinen Schattierungen und Abstufungen bis ins Stürmische hinein, den Granit gibt es, die Heide, die vom Wind gebürstete Kuppe der Landzunge, das Weiß der Häuser. Das alles gibt es hier. Das Meer aber, das ich im Ohr habe, als wäre es meine eigene Stimme, das Meer, das in allen möglichen Zuständen von Regung in meine Netzhaut eingebrannt ist – nein, das Meer gibt es nicht.
2
Die Kanzel habe ich Max zu verdanken. – Vor mittlerweile fünfzehn Jahren hat er mich in seine Wahlheimat eingeführt. Während ich mich auf die letzten Prüfungen meines Geografiestudiums vorbereitete und als Lehrer Fuß zu fassen versuchte, wanderte er aus. Er ließ die Grabsteinklopferei hinter sich und freute sich auf seine neue Existenz als Steinbildhauer.
Wenige Wochen vor seiner Abreise hatte ich ihn kennengelernt; in den darauffolgenden Schulferien besuchte ich ihn zum ersten Mal. Ich schlief auf dem behelfsmäßig eingerichteten Dachboden der alten Steinhütte, in die er sich eingemietet hatte, tagsüber streunten wir über die Klippen. Wir aßen rohe Muscheln, die wir bei Ebbe von den Felsen pflückten, und tranken zu viel Wein. Max, fünf Jahre älter als ich, hatte hier seine eigentliche Heimat gefunden. Eigener, störrischer, stummer als in anderen Regionen der Bretagne seien die Menschen auf dem Cap, sagte er. Ausgeblasen vom Wind. Dennoch und deshalb seien sie beseelt, erfüllt von dem, was ein Leben lang nicht auszublasen sei.
Dass Max hier wirklich angekommen war, wurde mir klar, wenn ich ihm bei der Arbeit zusah. Beim Spalten, Spitzen oder Überhauen der tonnenschweren Granitblöcke, die ihm Freunde ins Atelier gekarrt hatten, wirkte seine Erscheinung noch beeindruckender als auf den Küstenspaziergängen. Max war ein Koloss. Er arbeitete sorgfältig und konzentriert, führte Fäustel und Spitzeisen in seinem eigenen Rhythmus, scheinbar ohne zu ermüden. Nicht gegen den Stein arbeitete er, sondern mit ihm, respektierte den Verlauf von Einschlüssen und kleinsten Rissen. Licht, Stein und Wasser – mehr brauche ich nicht zum Leben, sagte er einmal, als er einen Bar de ligne in die flüssige Butter legte. Dann hob er das Glas: À nos femmes, à nos chevaux et à ceux qui les montent!
Innerhalb weniger Monate hatte er die misstrauischen Dorfbewohner eines Besseren belehrt und war einer der ihren geworden. Vor allem aber war er hier draußen er selbst, das, was er immer hatte sein wollen. Mit Schnorchel und Harpune jagte er Fische, tauschte ein, was er nicht selbst zu essen vermochte. Lieu Jaune gegen Tomaten, ein paar Seespinnen gegen Kartoffeln; Salat gab es obendrauf. Er half den Bauern beim Schlachten, und am Abend genoss er in der Männerrunde das gebratene Fleisch. Schweinekopf, Schafshoden, Lammkeule. Ihm war jeder Schlachtlohn recht, solange genug Wein da war. Und er erzählte freimütig von seinem Traum, dem eigenen Atelier mit Kran, Schmiede und Meersicht.
Die Kanzel war seine Kirche, eine Felsterrasse in der Klippe, direkt unter dem Abriss der Pointe. Ganze Tage verbrachte Max da oben, nicht selten blieb er sogar über Nacht, notfalls im alten Armeeschlafsack, vierzig Meter über der Brandung. Die Kanzel war sein Ort der Andacht und der Einkehr, aber auch eine Bühne für einsame Protestreden. Er studierte die Lichtreflexe auf dem Wasser, den Gang der Gezeiten, den Wechsel der Winde. Er untersuchte die Morphologie des Steins und die Textur der Flechten – oder er saß einfach nur da und staunte, bis der mitgebrachte Lambig leergetrunken war und jedes der zweiundvierzig Volumenprozente sich in seinem Kopf bemerkbar machte.
Je mehr von seiner Welt Max mit mir teilte, desto mehr wurde ich Teil von ihr. Eine kleine Welt, die mir doch bei jedem Besuch wieder ganz neu aufging und deren Reichtum mir noch immer unerschöpflich vorkommt. Was mir diesen Ort noch kostbarer macht, ist die Freundschaft zu Max. Der Künstler und der Geographielehrer. Der Koloss und die Konfektionsgröße. Manchmal, spätabends, haben wir zum Spaß Listen mit Eigenschaften erstellt, die uns ausmachen. Stunden haben wir im Lauf der Jahre damit zugebracht – und nichts als Gegensatzpaare gefunden. Spätestens nach der zweiten Flasche einigten wir uns jeweils auf die grundsätzliche Unmöglichkeit unserer Freundschaft, fanden uns im Lachen über den andern und uns selbst. – Der gewesene Pfarrer und der amtierende.
Zur Kanzel, die ich Max zu verdanken habe, gehört auch die Aussicht. Im Osten, leicht zurückversetzt, liegt der Fischerhafen von Feunteun Aod. Nachdem Stürme die gemauerte Steinmole zerlegt hatten, bauten die Fischer in derselben Bucht einen neuen Hafen. Er besteht einzig aus einer Rampe, die von der nunmehr ungeschützten Bucht auf ein kleines, in den Fels gepflastertes Plateau führt. Bei drohendem Sturm lassen sich die Boote mittels Drahtseilwinden an erhöhter Lage in Sicherheit bringen. Jenseits der Bucht liegt ein aus Naturstein gemauertes Quellbecken auf halber Höhe im Hang. Das begehbare Lavoir, von üppiger Vegetation umwachsen, gibt Feunteun Aod seinen Namen. Westwärts, in der Verlängerung der Küstenlinie, steht im offenen Meer La Vieille. Auf einem Felsbrocken gebaut, dessen Fläche kaum größer ist als der Grundriss des Leuchtturms, bietet die mehr als hundertjährige Alte den Fischerbooten wie den Frachtern zwischen Pointe du Raz und Île de Sein Orientierung.
Noch drei Wochen lang werde ich in dieser Urlandschaft sitzen. Drei mal sieben Steine. Dann wird mein Anfang hier zu Ende sein. Ich werde meinen Dienst auf der Kanzel quittieren, wie Max ihn quittiert hat, und nach Hause fahren. Gewesener Pfarrer, auf Lebenszeit.
3
Mi-homme, mi-bête nennen sie Max. Mi-homme, mi-bête haben sie den Halbwilden schon damals genannt, als sie ihn ins Herz schlossen. Sie mochten seine urtümliche Art, der alles Gespielte oder Aufgesetzte fremd war und die für all das stand, was er war. Nachdem er Sophie kennen gelernt hatte, eine Bretonne bretonnante, warteten alle auf die Veränderung des wunderlichen Ausländers. Nicht ohne Bedauern sah man seiner Domestizierung entgegen, die unausweichlich schien. Sophie werde schon zum Rechten sehen, hieß es im Dorf, und das bedeutete, etwas Rechtes aus Max zu machen. Eine tragfähige Existenz galt es aufzubauen, ein Fundament für ein eigenes Haus mit Familie.
Tatsächlich hatte Max die Chancen, mit seinen Granitskulpturen Geld zu verdienen, falsch eingeschätzt. In der alten Scheune nebenan, die ihm als Atelier diente, verstaubten zahlreiche Modelle aus Gips oder Mörtel. Die erste Skulptur, die er fertiggestellt hatte, ein menhirartiges Objekt, stand in den Boden eingelassen hinter der Hütte. Fast ein Jahr lang hatte Max daran gearbeitet, die ausgeprägten Rundungen so verfeinert, dass sie bei jedem Sonnenstand ein optimales Licht- und Schattenspiel garantierten. Nach und nach wurde der Stein von der Natur in Besitz genommen. In Abständen kamen weitere dazu, und mit der Zeit entstand im verholzenden Gebüsch eine Art Steingarten; in Wahrheit jedoch war das Skulpturengelände nichts anderes als die letzte Ruhestätte seiner Kunstobjekte.
Er aber dachte nicht daran, den Traum der Künstlerexistenz auf dem Cap zu begraben. Das wenige Ersparte war zwar längst aufgebraucht, Zuschüsse von den Eltern waren keine zu erwarten, aber Max kümmerte das nicht. Er wäre ohnehin zu stolz gewesen, ein Leben auf Pump zu führen und seinen Traum mit fremder Hilfe zu verwirklichen. Er kämpfte. Und er kämpfte gegen ein Schicksal, das er nicht würde akzeptieren können. Für einen deutschen Hausbesitzer im Nachbarort machte er einen Gartentisch auf Bestellung, für eine befreundete Familie gestaltete er einen Brunnentrog. Er war sich nicht zu schade, im Stundenlohn bei einem auf Restaurationen spezialisierten Steinmetz zu arbeiten oder einem Gärtner bei der Gestaltung von Steinlandschaften zur Hand zu gehen. Max verhehlte nicht, dass er auf diesem Weg doch noch den einen oder anderen künstlerischen Auftrag zu ergattern hoffte. Umwegrentabilität, sagte er manchmal, plötzlich interessiert sich einer für meine Skulpturen, und es geht los. Immer missriet das verschmitzte Lächeln.
Sophie unterstützte ihn, sprach ihm Mut zu, beteuerte ihren Glauben an eine gelingende Zukunft. Sie tat es in wachsender Verzweiflung, denn gegen den innersten Wunsch war nicht anzukommen. Die Sehnsucht nach dem, was Max nie sein würde, ließ sich nicht länger wegreden. So erging es Sophie wie einer Reihe von jungen Frauen nach ihr. Sie gestand sich ein, dass hier nichts mehr zu hoffen war. Gegen die Steine, sagte sie, gibt es kein Argument, und keines gegen die Liebe.
Richtig erstaunt war niemand im Dorf, als Sophie ihre wenigen Sachen aus Max’ Hütte trug und sich vorübergehend wieder bei ihren Eltern einrichtete. Max lebte sein Künstlertum allein weiter, und er wurde nicht müde zu versichern, dass er diese Existenz mit keiner anderen tauschen würde, trotz allem. Der Bitterkeit, die sich dann und wann zeigte, begegnete er am Stein, oder er räsonierte auf der Kanzel über sich selbst und den unglücklichen Lauf der Dinge.
Anfangs hatte ihn jede enttäuschte Hoffnung auf Erfolg noch verbissener arbeiten lassen; nach und nach jedoch vermochte der Trotz die Frustration nicht mehr aufzuwiegen, und Max begann sich einzurichten in seinem Winkel am Ende der Welt. Ein kleiner Künstler war er geworden, der Koloss. Zermürbt von der Realität des Kunstbetriebs. Auch wenn er sich nie ganz würde aufreiben lassen – es war nicht zu übersehen, dass er hier zwischen Brombeerbüschen, Stechginsterstauden und Farn am eigenen Friedhof arbeitete. Es mochte ein Friedhof für die Ewigkeit sein, ein Friedhof war es doch.
Zu bemitleiden war er deswegen nicht, und er hätte dafür auch kein Mitleid haben wollen; zu sehr war er überzeugt von dem, was er tat, und jeder einzelne Schlag mit dem Fäustel bestärkte ihn in dieser Überzeugung. Mitgefühl war es auch nicht, was Sophie immer wieder zu ihrem Künstler in Nebenstunden zurückkehren ließ. Nach der Trennung von Max hatte sie ihre Anstellung als Köchin in einem Hotel in Audierne verloren, was sie zum Anlass genommen hatte, ihr berufliches und privates Glück im Landesinnern zu suchen. Tatsächlich fand sie in Rennes nicht nur einen neuen Job, sondern auch den Mann, der ihr bieten konnte, wovon sie geträumt hatte. Bernard. Inhaber eines Schuhgeschäfts im Stadtzentrum. Sophie erzählte nie von ihm, wenn sie Max besuchte. Max stellte keine Fragen. Was man von Bernard wusste, war gerüchteweise bis aufs Cap gedrungen. Eine gute Partie, hieß es; groß und dennoch unauffällig, kein Operngänger, kein Marathonläufer – einer aber, der sich offenbar liebevoll um sie kümmerte und das geräumige Haus am Stadtrand möglichst schnell mit eigenem Nachwuchs beleben wollte. Dafür tat Bernard, was er tun musste. Sophie erwartete bald das erste Kind und beschloss, fortan ganz für die Familie da zu sein.
Die heimlichen Besuche bei Max aber ließ sie sich deswegen nicht nehmen. Dass es eine Capiste in der Fremde ans Meer und zu ihrer Verwandtschaft zieht, leuchtete Bernard ein, und es war ihm eine Selbstverständlichkeit, sich während der sporadischen Abwesenheiten seiner Frau persönlich um die kleine Maëlle zu kümmern. Fast immer tauchte Sophie unangekündigt bei Max auf. Für einen Abend suchte sie seine Nähe, seinen Geruch, die Kraft seiner Arme. Es war, als wollte sie sich auf diese Weise etwas von dem bewahren, was sie nie wirklich gehabt hatte und nie hatte haben wollen. Bei Max richtete sie sich ein Refugium für ihre Träume ein. Bei ihm lebte sie in ungezwungener Heimlichkeit, für einen Tag, für eine Nacht. Und weil sie es ebenso unschuldig wie arglos tat, gab es nichts, was ihr kurzes Glück hätte trüben können.
Alle paar Monate kam sie. Alle paar Monate kommt sie noch heute, während sich Bernard zu Hause ahnungslos um Maëlle und ihre zwei Brüder kümmert. Jedes Mal bahnt Max für sie mit Säge und Heckenschere einen Weg durch das Gestrüpp des Steingartens, der ein Friedhof ist. Danach essen sie Fisch. Eine Vieille, einen Lieu Jaune. Sie trinken Muscadet, sie rauchen, und sie lieben sich.
Wenn Max am Morgen erwacht, ist das Bett da, wo Sophie gelegen hat, noch warm, das Laken riecht nach ihr. Dann geht er zur Küste, ein Findling aus Fleisch. Auf der Kanzel hockt er sich hin, schaut übers Wasser, bis er sich wieder spürt. Seine Kanzel. Meine Kanzel. Wann immer ich sie betrete, denke ich an ihn, den Friedhofsgärtner, den Freund, der er mir bis heute ist.
Und ich denke an Véro. Jeden Tag lege ich einen Stein auf den Haufen, jeden Tag zerreiße ich ein Bild von ihr – bis es unseren Urlaub hier so nicht gegeben haben wird. Stundenlang sitze ich auf meiner Terrasse. Ich rede in den Wind, oder ich schreibe auf, was mir einfällt. Manchmal gehe ich den Küstenweg auf und ab, spreche aufs Band, was ich zu sagen habe. Eine Botschaft habe ich nicht. Keine Fragen und keine Antworten. Nicht bei diesem Blau, das sich seit Tagen hält. Nicht abends im Chambre d’hôtes, wo ich versuche, am Laptop den Überbleibseln des Tages eine Form zu geben, oder auch nicht.
Viel habe ich gemacht in den vierzehn Tagen, seit ich hier bin. Getan ist wenig. Der Körper braucht Zeit. Der Kopf. Sprache wächst langsam nach. Dabei ist in drei Wochen Schulanfang. Spätestens dann wird der Versuch meines Anfangs beendet sein müssen. Ich werde die Klassen begrüßen, wir werden weiterfahren, wo wir vor den Ferien stehengeblieben sind. Gebirge Europas mit der zweiten, Mecklenburgische Seenplatte mit der dritten, Permafrost und Klimawandel mit der sechsten. Noch aber zerreiße ich jeden Tag ein Bild von Véro, stopfe die Schnipsel in den offenen Kopf einer Langoustine, werfe ihn über den Rand der Kanzel. Dann schließe ich die Augen und stelle mir vor, wie der gefüllte Krebs unten aufschlägt oder geschluckt wird von der steigenden Flut, die es hier nicht gibt. So trenne ich mich von Véro, ein Jahr danach. Portionenweise gebe ich etwas von ihr her, alles, weil es anders nicht geht. Weil es irgendwie gehen muss. Krabbenfutter. Was für ein Wort.
4
Du, auf der Pointe de Penharn. Hinter dir der Abgrund, im Dunst die Presqu’île de Crozon. Du stehst auf einem Bein, die Arme und das andere Bein weit ausgestreckt, den Kopf schief gelegt und den Oberkörper leicht abgewinkelt. Der Westwind bläst dir das offene Haar ins Gesicht. Du scheinst zu fallen, aber du fällst nicht, du stehst in sicherer Balance auf einem der äußersten Felsbrocken. Eine Gewohnheit von dir, die ich nie verstanden habe.
Es gibt Dutzende Fotos, die dich so zeigen. Aufnahmen im Gebirge, am Meer, und immer ist dir ein spontanes Glück ins Gesicht geschrieben. Das Glück des Adlers, der seine Kreise zieht, das Glück der Möwe im Wind. – Manchmal, wenn die Lebensfreude unversehens zum Übermut wurde und dich der Leichtsinn anfiel, bist du davongerannt, auf irgendeinen exponierten Felsblock geklettert, die Schwingen ausgebreitet zum Flug. Minutenlang standest du in prekärer Schräglage, simuliertest auf einem Bein die perfekte Schwerelosigkeit, während ich mich beeilte, den Fotoapparat aus dem Rucksack zu nehmen und dich abzulichten, auf dass der Spuk ein Ende habe.
Wie du auf diesen Bildern strahlst, Véro. Auch auf dieser Aufnahme. Du strahlst wie eine, der das Glück alle Glieder langzieht. Und ich habe dich nie gefragt, weshalb.
5
Vielleicht hätte ich mit einem Plan herkommen sollen, einer Strategie für meinen Anfang. Die gemeinsam besuchten Orte nicht nur vergegenwärtigen, sondern bewusst aufsuchen: Da war ich mit Véro, dort war ich mit Véro, hier bin ich allein. Vielleicht sollte ich erst einmal die kindische Fotozerreißerei lassen. Stattdessen könnte ich mir Aufgaben stellen. Kleine, leicht zu bewältigende, und jede einzelne wäre Voraussetzung für die nächst schwierigere. Vor Ablauf meines Aufenthalts würde ich die Konfrontation suchen, denn eine Konfrontation müsste es geben. Schockheilung. Danke, gut. Der Patient kann gehen.
Wenn das so einfach wäre. Es gibt Momente hier oben, da weiß ich nichts mehr. Losgelöst von allem und am meisten von mir selbst räsoniere ich im Kreis herum, bis mir schwindlig ist. Dann schlafe ich ein. Und wenn mir auch das nicht gelingt, rotiere ich weiter, bis sich der Himmel auftut. Aber der Himmel tut sich nicht auf. Immer fliegt zur Unzeit eine krächzende Möwe ins Bild. – Bin ich mit Max an der Küste unterwegs, hebt er manchmal den Zeigefinger und sagt: Wir bedrohen ihr Nest. Oder: ein verliebtes Männchen. Oder: Streit ums Essen. Er spricht von Flugruf, Katzenruf, Alarmruf. Ich sage: Ich will sie fliegen sehen. Sie sollen fliegen, die Künstler, aber dieses Gejammer und Gekrächze – das klingt für mich alles gleich, und es tut mir weh in den Ohren.