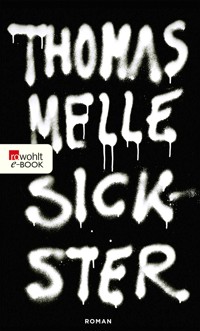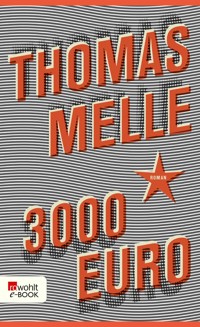
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Denise kommt mehr schlecht als recht mit ihrem Leben klar. Sie arbeitet im Discounter, ihre kleine Tochter Linda überfordert sie oft; eine langersehnte New-York-Reise bleibt ein – immerhin tröstlicher – Traum. Mit dem Lohn für einen Pornodreh will sie endlich weiterkommen, aber man lässt sie auf ihr Geld warten. Immer öfter steht Anton an ihrer Kasse, der abgestürzte, verschuldete Ex-Jurastudent, der im Wohnheim schläft. Vorsichtig kommen sich die beiden näher. Während Denise wütend, aber auch stolz um ihr Recht und für ihre Tochter kämpft, während Anton seiner Privatinsolvenz entgegenbangt, arrivierte frühere Freunde trifft, mal Hoffnung schöpft und sie dann wieder verliert, entwickelt sich eine zarte, fast unmögliche Liebe. Beide versuchen, sich einander zu öffnen, doch als Denise endlich ihr Geld bekommen soll und Antons Gerichtstermin naht, müssen sie sich fragen, wie viel Nähe ihr Leben wirklich zulässt ... Thomas Melle erzählt von einer Liebe am unteren Rand der Gesellschaft, von der menschlichen Existenz in all ihrer drastischen Schönheit und Zerbrechlichkeit – ein zärtlicher, heftiger Roman über zwei Menschen und die Frage, was dreitausend Euro wert sein können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 242
Ähnliche
Thomas Melle
3000 Euro
Roman
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Denise kommt mehr schlecht als recht mit ihrem Leben klar. Sie arbeitet im Discounter, ihre kleine Tochter Linda überfordert sie oft; eine langersehnte New-York-Reise bleibt ein – immerhin tröstlicher – Traum. Mit dem Lohn für einen Pornodreh will sie endlich weiterkommen, aber man lässt sie auf ihr Geld warten. Immer öfter steht Anton an ihrer Kasse, der abgestürzte, verschuldete Ex-Jurastudent, der im Wohnheim schläft. Vorsichtig kommen sich die beiden näher. Während Denise wütend, aber auch stolz um ihr Recht und für ihre Tochter kämpft, während Anton seiner Privatinsolvenz entgegenbangt, arrivierte frühere Freunde trifft, mal Hoffnung schöpft und sie dann wieder verliert, entwickelt sich eine zarte, fast unmögliche Liebe. Beide versuchen, sich einander zu öffnen, doch als Denise endlich ihr Geld bekommen soll und Antons Gerichtstermin naht, müssen sie sich fragen, wie viel Nähe ihr Leben wirklich zulässt …
Über Thomas Melle
Inhaltsübersicht
you can’t fire me because I quit
Erstes Kapitel
Da ist ein Mensch drin, auch wenn es nicht so scheint. Unter den Flicken und Fetzen bewegt sich nichts. Die Passanten gehen an dem Haufen vorbei, als wäre er nicht da. Jeder sieht ihn, aber die Blicke wandern sofort weiter. Zwei Flaschen stehen neben dem Haufen, trübe und abgegriffen. Die Sonne knallt herunter. Es riecht streng, nach Urin, nach Säure und frühem Alter.
Anton träumt einen dünnen Traum, in ihm sind alle Arschlöcher weg. Jana betritt sein Zimmer, oder ist es eine industrielle Höhle; Anton muss eine Maschine bedienen, die etwas stanzt, Geldscheine aus Blech, vielleicht. Jana, sein Jugendschwarm, hockt sich zu ihm nieder und lächelt mit großen Augen. Ihr Hemd steht offen, halb sind die Brüste sichtbar. Anton nickt. Jana legt sich zu ihm, sie reden. Noch berühren sie sich nicht.
Wenn Anton träumt in diesen Wochen, dann von den alten Zeiten, die es so nie gab. Alternative Versionen seiner Jugend: Das Personal ist zwar dasselbe, aber die Ereignisse sind komplett irreal. Er schläft mit den Mädchen, die er nie haben konnte, er rettet die Freunde, die nicht mehr Teil seines Lebens sind, er feiert die Erfolge, die er nie hatte. Treibgut aus der Zeit, als noch alles möglich schien.
Der Haufen rührt sich. Die Passanten gehen weiter dran vorbei, machen teils einen größeren Bogen. Anton merkt, dass er aufwacht, gegen seinen Willen. Die Traumbilder werden durchsichtig, lösen sich auf. Jana ist weg, bevor er sie berühren konnte, die Maschine ist auch weg. Der Traumkanal schließt sich. Anton ärgert sich. Der Schlaf ist alles, was er noch hat. Er hält die Augen geschlossen, Schweiß läuft ihm die Wange hinunter. Noch nicht, denkt er, noch nicht, und versucht, den Schlaf zu verlängern.
Das ist eine Disziplin, in der Anton es zu einer Art Meisterschaft gebracht hat: den Schlaf verlängern, das Dämmern ausdehnen, den Traum stauchen und modulieren. Die Konsistenz des Schlafes willentlich verändern, das Bewusstsein verdünnen: Man ist da, aber unscharf, ganz tief unten, als tierische Präsenz, kein Gewahrwerden, nur Schemen um eine unbewusste Mitte. Wo normalerweise ein alarmierender Gedanke den Schlafenden zurück in die Realität reißt, kann Anton das Konkrete verwischen und im Ungenauen, Schläfrigen verweilen, die Schlafreste ausschöpfen. Mittlerweile fällt es ihm jedoch schwerer und schwerer.
Ein Sonnenstrahl trifft sein Gesicht, stichelt darin herum, die Augen erwachen und sehen durch die Lider rot. Das war’s. Er öffnet die Augen und orientiert sich, Bushaltestelle, Rucksack, Supermarkt, hier die Ecke, die nachts noch so gemütlich schien. Erster Müll um ihn herum. Sein Leben schießt ihm wieder in den Kopf, stimmt, so sieht das aus hier, so ist, was wurde. Er erinnert sich an seinen Entschluss, seinen Plan für die nächsten Tage, vor dem Gerichtstermin. Und er erinnert sich an die dreitausend Euro. Zunächst aber will er auf und weg von hier, wo er argwöhnisch beäugt wird, wohl den ganzen Morgen schon. Aufstehen, aufräumen, losgehen. Es ist ja wohl kaum so, dass er kein Zuhause hat! Denkt das nicht, Leute! Sein Zuhause, auch wenn er es nie so nennen würde, ist das Übergangsheim im Westen der Stadt. Dort sind sein Bett, sein Schrank, sein Tisch, o ja. Er hat sich am Abend einfach hier hingelegt, und aus der kurzen Verschnaufpause wurde eine Nacht im Freien. Warum auch nicht. Einübungen in die Zukunft, Vorwegnahmen des Unausweichlichen. Oder nur ein Witz, denkt Anton, ein Witz wie alles. Er steht auf, macht eine Verbeugung, grüßt ins Ungewisse und geht.
Die Uhr ist ständig eingeblendet in einem kleinen Sonnensymbol, und darin rattern die Minuten weg, viel zu kurz und schnell wieder. Die Moderatoren grinsen in den Morgen hinein und scherzen. Denise mag sie sehr. Sie wäre gerne so fröhlich wie sie, und so blond. Aber sie ist, wie sie ist. Dann dröhnt ein Jingle, dass die kleinen Boxen scheppern, dann kommt ein Beitrag über die nächste Mode. Denise sucht Lindas blaue Regenjacke und findet sie nicht, nicht im Schrank, nicht im Wäschehaufen, nicht auf der Anrichte, nicht in der Küche, wo die Spuren vom Frühstück noch auf Tisch und Boden kleben. Eine smarte Frauenstimme spricht von irgendwelchen Hinguckern. Denise will eigentlich sehen, was da so sehenswert sein soll, bemerkt aber, dass Linda schon seit Minuten verdächtig still ist. Als sie im Kinderzimmer nachsieht, sitzt ihre Tochter noch immer im Schlafanzug da. «Anziehen, aber schnell», zischt Denise, lässt Linda jedoch keine Zeit für Umständlichkeiten, sondern zwängt sie bereits in die Hose. Linda wehrt sich, will flüchten. Denise atmet schwer. Es kann nicht sein, dass jeden Morgen dasselbe Theater ist. Das kann einfach nicht sein. Linda entwischt ihr, torkelt, den einen Fuß halb im Hosenbein, in Richtung Schrank, stolpert und schlägt mit dem Kopf gegen das Holz. Sofort schreit sie auf und heult, das Gesicht verfärbt sich zu einer Boje. Denise reißt sich zusammen, geht zu ihrer Tochter und schaut nach, ob es eine Wunde gibt. Nichts, nur verweinte Augen und dieses Kreischen, das ihr die Tochter zum fremden, verhassten Kind macht. Langsam, sagt sie sich, ruhig, sie will kein Monster sein. Linda ist erschöpft und lässt sich ankleiden, nicht ohne gesagt zu haben, dass sie Denise den Tod wünscht. Sie sagt: «Du sollst tot sein.» Doch das sagt sie alle paar Tage. Es heißt nur, dass sie sich ergeben hat.
Vor der Praxis der Ergotherapeutin raucht Denise ihre erste Zigarette. Drinnen klettert ihre Tochter jetzt über Böcke und Würfel, greift nach Turnringen, schwingt ins Leere, während sie sanft gehalten wird. Linda liebt diese Dreiviertelstunde bei der Ergotherapie. Für sie ist es ein morgendlicher Ausflug zu einem geheimen Spielplatz, einem Ort ohne Wettbewerb, ohne andere Kinder, die sie in die Ecke drängen und drangsalieren wollen, voll abgerundetem Spielzeug und mit einer weichen Frau, die nur für sie da ist.
Die erste Zigarette am Tag ist die beste, und Denise genießt den Flash, der sie nach den ersten Zügen durchfährt. Rauchen ist Atmen, bisweilen, wie nach einem langen Sprint. Die Welt in ihrem Kopf fühlt sich kurz weicher an, wie gepolstert, die Gedanken betäubt, die Glieder leicht gelähmt. Denise starrt ins Nichts und doch auf die Straße, wo die Autos kurz verschwimmen. Noch ein Zug, tiefer jetzt. Die Verwaltungsgebäude um sie herum, aus welchem langweiligen Jahrzehnt auch immer, bekommen einen Stich ins Metallene. Der Himmel weitet sich, und für einen Augenblick sieht Denise sie wieder, die Stadt, die sich über alle anderen schiebt, wenn sie es nur will: New York. Ein New York aber, das keiner je sah, das nur sie kennt, mit hoch aufgeschossenen Wolkenkratzern, in denen sich zehn Sonnen spiegeln, die so hellgelb strahlen wie die Taxis, aus denen cremefarbene Models steigen, von denen Denise eines hätte sein können, wenn sie nur gewollt hätte, und zusammen mit ihnen würde sie diese Luxusversion, diesen Traum des Kurfürstendamms bevölkern, wenn Straßen denn träumen könnten, mit Hoteldienern in Livree, die freundlich grüßten und ihre glattschwarzen Zylinder lüfteten, Limousinen, die nicht protzten, sondern wirkten, an jeder Ecke ein Candyman, rotweißblaue Fransen in den Bäumen und Pollen in der Luft, so leicht und süß wie Zuckerwatte. Und ohne einen Laut würde sich der Fahrstuhl hinter ihr schließen, es ginge hoch in das ideale Apartment, so dezent und geschmackvoll, dass Börsenfilme aus den Achtzigern hier spielen könnten, mit einem paranoiden Michael Douglas in der Hauptrolle. Aber hat Michael Douglas nicht Krebs? Oder hat er ihn inzwischen besiegt? Weg ist das Traumbild, die Limousinen sind wieder Rostbeulen, die Bauten Verwaltungsklötze, und Denise ist Denise und hat aufgeraucht.
Nachdem sie Linda im Hort abgegeben hat, checkt sie im Bus einen ihrer drei Facebook-Accounts: den, der mit Badoo verknüpft ist. Fünf neue Nachrichten, zehn neue Freundschaftsanfragen. Sie nimmt alle an. Danach checkt sie ihren Kontostand. Noch immer nichts eingegangen. Auf WhatsApp hat ihr Fred einen vertrockneten Blumenstrauß geschickt, im Gegenlicht auf dem Küchentisch, was poetisch und zugleich vorwurfsvoll sein soll, oder melancholisch, Denise kann es nicht recht verstehen, und Anja hat ihren Sohn mit Burger-King-Krone und missgelaunter Ketchupschnute abgelichtet, was vermutlich süß sein soll. Denise macht als Antwort ein Bild von sich, findet das dann aber selbstverliebt und sich selbst, wie sie da im grauen Bus sitzt, eh hässlich. Sie löscht es, steht auf und verlässt den Bus.
Und schwitzt. Eigentlich hatte sie das Schwitzen überwunden, durch Autosuggestion und ein mehliges Antitranspirant aus Kalzium und Talk, aber in den letzten Tagen ist es zurückgekommen. Es liegt in der Familie. Ihr Großvater hatte immer so stark geschwitzt, hieß es, dass er sich regelmäßig die verkrusteten Achselhaare stutzen musste. Solche Details bleiben haften, auch wenn sie nur einmal erwähnt werden.
Und jetzt sie, hier an der Kasse, am Förderband. Sie spürt den Schweißfilm auf der Stirn, die Nässe am Rücken. Sie schämt sich dafür. Das ewige Einerlei der Kassentöne und Waren macht sie schon lange nicht mehr schwindlig. Aber die Blicke tun es, neuerdings. Vielleicht bildet sie sich alles auch nur ein? Automatisch schiebt Denise die Waren über den Scanner, es piept und piept und piept, dann die Geldübergabe, gerne auch Eurocard, Kasse auf, Kasse zu, Unterschrift her oder Wechselgeld hin, und heimlich prüfen, ob ihr kein Falschgeld untergejubelt wird.
Sie meidet die Blicke der Kunden, vor allem die der männlichen. Sie triefen vor Geilheit, das weiß sie, und sie haben allen Grund dazu. Nein, sie triefen nicht. Sie sind einfach nur da, streifen ihren Lidschatten, tasten ihren Mund ab, bleiben an ihrem Piercing hängen, verbeißen sich in ihrem Auge, wenn sie nicht schnell genug wegsieht. Sie fahren ihr über Schenkel und Brüste und Bauch und Hals. Normal, würde sie sagen, wenn es nicht diesen Moment gäbe, wo es kurz im Gesicht des anderen zuckt, wo sich vielleicht die Pupillen zusammenziehen, wo irritiert erst weggesehen, dann wieder hingesehen wird. Wer ist das? Kenne ich die nicht? Ich kenne sie. Woher? Doch nicht etwa –? Doch, doch, denkt Denise dann, genau daher, genau daher. Sie hat inzwischen ein kaum merkbares Lächeln als Maske gewählt, wenn die Scham ihr Nadelkissenwellen den Rücken hinunterschickt. Gerade steht wieder einer vor ihr, ein Student vielleicht, mit rasierter Brust und einem T-Shirt mit einer Waschmaschine drauf, und scheint nervös. Ist sie es? Ist sie es nicht? Sein Blick schweift umher, bleibt dezent an ihr hängen, dann sucht er vorauseilend das Geld aus dem Portemonnaie zusammen, rechnet mit der Kasse um die Wette. Nein, entscheidet sie, der hier kennt sie doch nicht. Jedenfalls nicht auf die obszöne Weise. Jedenfalls nicht aus dem Internet. Er kennt sie von hier, von der Kasse, er ist normal, sie ist normal. Die Kasse geht auf, geht zu. Sie muss nicht lächeln. Sie muss gar nichts, nur arbeiten. Sie ist nicht die aus dem Internet, sie ist die aus dem Supermarkt. Nächster.
Spaghetti, Spaghetti, Tomatenmark, Bier und Katzenfutter. Es stellen sich keine Bilder der Wohnungen und Kühlschränke dazu mehr ein, es ist eher wie eine Notenvergabe, ein schnelles Einschätzen des Lebensstandards, was eigentlich verboten ist. Man soll blind sein. Die Kundin hat es ihrerseits auch eilig und würdigt Denise keines Blickes. Sie hat Elefantenhaut im Dekolleté und ein feines Nest aus geplatzten Äderchen an den Nasenflügeln. Aber sie war einmal schön, das strahlt das ganze Leben nach, und sei es in der tragischen Aura des Verlustes. Denise nennt die Endsumme, sie muss an das Wort «Endgegner» denken, an Bushido, und schon hält sie wieder alle Männer, zumal die, die in ihrer Schlange stehen, für aggressive Schweine. Und es stehen wieder ausschließlich Männer in ihrer Schlange. Und ja, ihre Blicke triefen wieder vor Geilheit. Ein Schweißtropfen rinnt ihr über die Schläfe, am Ohr vorbei, sie wischt ihn beiläufig weg. Vor ihr steht ein gut gekleideter Mittfünfziger und sieht nach echtem Wohlstand aus, ungewöhnlich für hier, er hat nur ein paar Gemüsetüten auf das Band gelegt. Sicherlich hat seine Frau ihm das noch für den Nachhauseweg aufgetragen, aber bitte beim Biomarkt, und er hat den nächstbesten Discounter genommen, es wird schon keiner merken. Er sieht sie durchdringend an, vielleicht soll es auch freundlich sein, und kurz ist sich Denise sicher, das ist er, das ist der Mann, der sie heute erkennt, der sich in einsamen Minuten für sie entschieden hat, der sie benutzt, sich an ihr vergangen hat, der ihr stellvertretend für die anderen gleich ein eindeutiges Zeichen geben wird, und sie weiß nicht einmal, ob sie sich dann geschmeichelt oder gedemütigt fühlen soll. Sie weicht seinem Blick aus, landet bei anderen Blicken, Schweine oder Nichtschweine, und stellt den Kopf, so gut es geht, auf Leere, auf Standby um, nur noch Zahlen haben Zutritt. Ihre Hände sollen die Arbeit einfach verrichten, nicht zittern. Es geht.
Hinten am Pfandautomat steht wieder der Typ, der anscheinend Flaschensammler ist, aber so wirkt, als mache er das nur aus Spaß oder als Projekt. Denise kennt sich nicht aus bei Projekten, aber sie weiß, dass die halbe Stadt aus ihnen besteht. Der Typ, den sie «Stanley» nennt, sieht aus wie ein Student, der zu lange freihatte, oder der sich in seinem Projekt, dessen Sinn Denise nie verstehen würde, völlig verloren hat. Er ist einer von denen, die sich immer bei ihr anstellen. Doch bei ihm hat sie keine Paranoia. Sie weiß, dass er sie nur von hier kennt, und selbst wenn nicht, wäre es bei ihm nicht so schlimm. Er hat etwas Sanftes, Fremdes. Gleich ist er dran und wird, das hat sie schon erfasst, mit dem Pfandbon eine der billigen Tiefkühlpizzen kaufen. Keinen Alkohol. Alkohol kauft er nie. Jedenfalls nicht bei ihr.
Als Stanley vor ihr steht und grüßt, kann sie sich zu einem Lächeln durchringen, das sich wirklich wie ein Lächeln anfühlt. Gleichzeitig nimmt sie seinen strengen Geruch wahr, der auf dem Weg zum säuerlichen, dichten Gestank der Obdachlosen ist, aber noch nicht ganz. Sie muss sich schütteln und verbirgt das hinter einem Husten. Freundlich verabschiedet er sich, und sie blickt ihm hinterher. Als er aus der Tür ist, sieht sie ihn als Penner in New York, im Hoodie, vor einer brennenden Tonne, wie im Hip-Hop. Er hat die Kapuze auf und wärmt sich die Hände. Doch furchtbar, er kommt dem Feuer zu nahe und verbrennt im Zeitraffer, wird völlig zu Asche, die wild und in Spiralen nach oben steigt.
«Entschuldigung, ich muss auch nach Hause», sagt eine Frau, und Denise erschrickt und nickt und schüttelt dann den Kopf, während ihre Hände schon wieder am Werk sind.
Humpeln die Penner an uns vorbei, berührt uns das unangenehm. Nicht nur ist es eine ästhetische Belästigung, sondern auch ein moralischer Vorwurf. Wieso bitte ist dieser Mensch so tief gesunken, welche Gesellschaft lässt einen derartigen Verfall zu? Das ist schon kein Mensch mehr, das ist ein Ding. Dann geht man weiter, angewidert fast, und verscheucht den Eindruck, lässt das Ding hinter sich zurück. Ein Schicksal, ja, unter vielen, und sicher nicht meins. Man hat Zeitungsgedanken, erinnert sich an Statistiken, auch wenn man sie nicht aufsagen könnte, und doch, kürzlich hat man da doch etwas gelesen, die Zahl der Wohnungslosen hat wieder dramatisch zugenommen, im Osten oder im Westen, oder war es nur in den Großstädten?, und ordnet dieses Menschending irgendeinem abstrakten Gesellschaftskommentar zu. Der Diskurs kümmert sich schon drum. Die Gesellschaft ist im Grunde nicht böse. Und das Gesicht, das einen angeblickt hat, verschwimmt zu comicartiger Versoffenheit, zu einer Karikatur seiner selbst. Weg damit.
Dreitausend Euro sind es. Mehr eigentlich, addiert man alles zusammen, etwa zehntausend insgesamt, aber gerade geht es nur um dreitausend Euro. Dreitausend Euro, denkt Anton, während er durch die U-Bahn wankt, dreitausend Euro, wie viel ist das, wie wenig. Der Gerichtstermin rückt näher, noch zehn Tage. Anton hat sich diese Frist gesetzt. Bis dahin will er – und er denkt den Ausdruck wörtlich und grinst darüber – klar Schiff gemacht haben. Das Wort Deadline vermeidet er. Draußen ziehen die Gebäude vorbei, die Schulden der anderen. Anton rechnet mit und nickt.
Er singt in Gedanken, 3000 Euro, 3000 Euro; und ganz leise singt er auch wirklich, ohne sich dessen bewusst zu sein. Die Lippen formen ein paar Verse, die nichts bedeuten und nicht hängenbleiben. Früher hat das Singen ihm geholfen, sich zusammenzuhalten, sich neu zu formieren, und die Schülerband war ein gutes Vehikel zum kurzzeitigen Ausbruch aus der Familie gewesen. Jetzt passiert es nur noch selten, das Singen, und wenn, dann unbewusst. Wie jetzt. Die anderen Passagiere ignorieren sein Singen. Bei ihnen kommt es wohl als Wimmern an.
Supermärkte sind meist rot oder gelb. Rot steht hierbei für höherwertig, gelb für billig. Anton betritt den Supermarkt, natürlich einen gelben. Die Massen an lieblos aufgestapelten Waren sagen ihm nichts. Schon früher hat er es immer gehasst, für sich alleine einzukaufen, und wenn er heute manchmal noch einkauft, erinnert ihn das stets an die furchtbare Bedrücktheit, die er schon vor Jahren dabei gespürt hat, allein mit sich und den Waren. Das Piepen der Kassen schneidet durch die Luft. Einzelne Personen huschen durch die Gänge. Er nimmt Bananen in die Hand und tut so, als würde er sie begutachten. Dann lässt er sie in den Korb fallen. Vor dem Kühlregal angekommen, kann er sich zwischen all den Billigwürsten nicht entscheiden. Er greift nach dem rohen Bauernschinken, den er früher immer mitnahm, und legt ihn in den Korb. Am liebsten würde er sich einfach dazulegen. Von den Toastbroten wählt er den Vollkorntoast, von den Buttern die billigste, von den Milchtüten die blaueste. Bei der Cola fragt er sich, ob das Pfand für die Flasche auch bei anderen Märkten einlösbar ist. Dann schmunzelt er ob solcher Überlegungen. Schließlich verstaut er den halb vollen Korb irgendwo zwischen den Waschmitteln und geht zum Pfandautomaten. Eine Flasche nach der anderen schiebt er in das verschmierte Loch und sieht den Betrag dabei langsam wachsen. Hinter ihm macht eine Frau durch Flaschenklimpern auf sich aufmerksam. Gleich fertig, versucht er telepathisch zu übermitteln.
Schließlich kauft er eine Salamipizza, um kein Aufsehen zu erregen. Die Kassiererin kennt er, sie ist auf prollige Weise sehr hübsch, und manchmal denkt er, wieso nicht so jemand.
Zuhause angekommen (er will es nicht «Zuhause» nennen!), huscht Anton ins Gemeinschaftsbad, es ist nicht besetzt, und verriegelt hinter sich die Tür. Geschafft, sagt es in ihm, und er entledigt sich schnell seiner Kleider. Der Hahn wird aufgedreht, das Wasser sprudelt stoßhaft los. Er hat sich entschieden, ein Bad zu nehmen, wennschon, dennschon. Eine leere Duschgelflasche füllt er auf, schüttelt sie und kippt das leicht schaumige Wasser wieder in die Badewanne. Heiß bitte, noch heißer. Einen Fuß taucht er probeweise ins Wasser, die Drecksflecken lösen sich sofort auf; es ist zu heiß, er mischt etwas kaltes Wasser hinzu.
Anton hat immer länger als andere gebraucht, um die eigene Lage zu erkennen. Als er die Pubertät bemerkte, war sie fast schon wieder vorbei. Dann dauerte es fünfzehn Jahre, bis er erkannte, dass er «seelisch labil» ist, wie es im Sozialarbeitersprech jetzt heißt. Und zuletzt mussten etwa sechs Wochen verstreichen, bis er sich eingestand, obdachlos geworden zu sein. Solange man noch im Kontakt mit irgendwelchen Ämtern steht, kann man sich über den eigenen Status hinwegtäuschen, hat man das soziale Netz noch auf Tuchfühlung. Seit ein paar Tagen aber weiß er: Jetzt ist er obdachlos, jetzt ist er unten. Wie lange schon? Seitdem er im Übergangsheim wohnt? Glauben kann er es aber noch immer nicht ganz. Manchmal hält er unvermittelt inne und fragt sich, ob das wirklich er ist, der da gerade Flaschen aus dem Mülleimer fischt, der schlecht riecht, abgerissen aussieht, mehr torkelt als geht. Ich? Wirklich? Das war doch mal ganz anders gedacht. Dann aber geht das Torkeln weiter, und die Selbstvergessenheit, und das sinnlose Ablaufen der Momente. Und doch, den Kopf hält er hoch dabei, so hoch es eben nur geht.
Er taucht ein, das Wasser verfärbt sich und stichelt heiß und angenehm. Das ist genießbar wie nur noch wenig. Manches Essen macht noch Freude, der Cheeseburger vorgestern etwa, die Gulaschsuppe in der Volksküche vor einer Woche. Und jetzt, dieser Verlust von Gewicht, eine Wohltat, die Schwere schwindet kurz aus den Gliedern, die Hitze wandert in den Körper ein. Er wäscht sich, wie er es gelernt hat. Dann liegt er da, lässt bisweilen heißes Wasser nachlaufen, gerade so, dass es noch erträglich ist, liegt da und ist einfach, ohne viel zu denken. Schließlich wird es ihm zu langweilig, und er zieht den Stöpsel, duscht den Drecksfilm auf der Haut ab und steht auf. Durch das Fenster winken die Bäume. Es ist wohl ein schöner Tag.
Draußen auf dem Flur sind Schritte zu hören, ein Klopfen an der Bürotür, jemand redet aufgeregt. Wieder ein abgewiesener Antrag, irgendeine Unverschämtheit vom Amt, Anton kennt den empörten Tonfall des Unverständnisses, der sofort aufgefangen und kanalisiert wird, diesmal von Sonja, die Schicht zu haben scheint. Sonja ist auch Antons Sozialarbeiterin. Der Redeschwall versiegt, im Büro wird sich der Sache angenommen. Anton hört die Stimmen nur noch abgedämpft. Er zieht sich an, bemerkt jetzt erst den stechenden Geruch seiner Kleidung. Vor dem Spiegel richtet er sich das Haar, fährt mit den Fingern durch die Strähnen. Im Gesicht kommen ihm nur noch die Augen entfernt bekannt vor. Dann packt er seinen Rucksack und horcht, ob die Luft rein ist. Er öffnet die Tür und schlurft eilig in den Flur, nur drei, vier Schritte, dann ist er in seinem Zimmer. Es begrüßt ihn die Unordnung. Es begrüßen ihn die tausend Formulare und Schreiben, die er in zwei Ecken geworfen hat. Links die Rechnungen und Mahnungen und Inkassoschreiben und Gerichtsvorladungen und Urteile. Und rechts die anderen Briefe und Zuschriften, die er schon nicht mehr öffnen konnte. Vielleicht ist ein Haftbefehl darunter, vielleicht auch nicht.
Harald Schmidt macht einen Witz. Er macht das auf die gespielt naive Weise, die eine angebliche Empörung als überraschendes Politikum ausstellt und meist mit «Aber entschuldige mal bitte …» anfängt. Das Publikum schmeißt sich weg, und Andrack presst ein nasales Grunzen hervor. Anton wacht auf, aber nicht von Schmidt, sondern von dem verbrannten Geruch in seinem Zimmer, von den Rauchschwaden, die aus Richtung der Kochecke kommen und ihn jetzt aufscheuchen. Seine Pizza ist verkohlt.
Nachdem sie vor der kleinen, offenen Fensterscharte seiner Kochecke kalt geworden und der Rauch größtenteils abgezogen ist, begutachtet Anton die Pizza, schabt den dunklen Rand ab und isst sie schließlich am Tisch. Asche in sein Maul. Währenddessen klickt er eine neue Folge der Harald-Schmidt-Show an. Die Leute auf YouTube haben eine Menge Folgen hochgeladen. Anton sieht am liebsten die klassische Phase zwischen 11. September 2001 und der sogenannten Kreativpause Ende 2003. Da hatte Schmidt die größte Sicherheit und den meisten Spaß, und auch Anton ging es damals gut, mit Nicole, seiner Freundin. Er glaubt es kaum, dass das weit über zehn Jahre her sein soll. Eigentlich lebt er, kulturell gesehen, noch immer in dieser Zeit, die Witze versteht er alle, egal wie zeitbezogen, die Prominenten sind ihm sämtlich vertrauter als die gängigen Namen von heute.
Während Schmidt mit Suzana, Zerlett und Andrack wichtelt, was jedes Mal eine besonders gelungene Folge garantiert, schreibt Anton auf der Rückseite eines Überweisungsvordrucks eine Namensliste auf. Wie ein Fußballtrainer mit seiner Aufstellung hantiert Anton dabei, streicht Namen wieder durch, ersetzt sie, schickt andere ins Spiel: Hermann, Mutter, Raoul, Peter, Janka, Max. Auch Nicole schreibt er versuchsweise hin, streicht sie dann entschlossen wieder durch. Es sind die Menschen, die er in den nächsten zwei Wochen besuchen will, um sich zu offenbaren. Offenbaren – Offenbarungseid? Das kennt er doch aus seiner Kindheit. Wenn seine Mutter den Vater wieder mal auf Unterhalt verklagte, machte der einfach einen falschen Offenbarungseid. Offenbar ein Wort für Versager. Doch betteln wird Anton nicht. Er will nur, dass sie ahnen, in welcher Lage er sich befindet. Zumindest sollen sie später nicht sagen können, sie hätten rein gar nichts gewusst. Und für manche dieser Namen müssten dreitausend Euro doch aus der sogenannten Portokasse zu zahlen sein, nicht wahr? Verdient Max das nicht an einem Tag? In einer Stunde? Er prägt sich die Namen ein und überkritzelt sie dann mit einer Emphase, die ihn überrascht.
Dreitausend Euro, denkt Anton. Dreitausend Euro. Meine Ablösesumme. Kreisliga, Bezirksliga, Behindertenliga. Er steckt das letzte Stück Pizza in den Mund und lässt es krachen. Ein schwarzer Keks ist das, der nach nichts mehr schmeckt. Harald Schmidt macht einen Witz. Andrack grunzt durch die Nase. Das Publikum schmeißt sich wie auf Kommando weg. Anton versteht das alles und verzieht keine Miene.
Namen, einer über dem anderen, bekannte und unbekannte, Fakes und Stammchatter. Denise sucht ihn. Er ist nicht da. Sie loggt sich unter anderem Namen ein und beobachtet den Chat. Alle grüßen, dann Stille, Stillstand. Dann reden sie über ihre Medikationen. Dann beschimpfen sie einander. Dann spammt einer den Bildschirm voll, dass es flackert. Die, die sie kennt, sind wohl im Privatchat. Sie sagen nichts. Denise geht in die anderen Räume, in denen er sein könnte. Es wird doch wohl nicht so sein, dass er nur auf sie gewartet hat, um sie zu ködern, und jetzt nie wieder auftaucht? Er ködert doch sicherlich täglich, auch andere. Oder zumindest wöchentlich.
Jemand schreibt Denise an, wie geht’s, woher, wie alt. Sie lügt sich jünger. Linda ruft, sie kann nicht schlafen. Sie will Wasser, sie will die CD noch einmal hören. Denise kümmert sich um alles, gibt ihr einen Kuss auf die Wange und deckt sie zu. Das Licht bleibt an, die Tür offen. Zurück am PC sieht sie, dass ihr wieder ein paar einsame Herzen oder kaputte Seelen geschrieben haben. Oft fragt sie sich, wie es sein kann, dass sie mit ihrer mittleren Reife korrekter schreibt als alle diese angeblichen Akademiker. Und es zeigt sich, wie abgefuckt die Menschen eigentlich sind. Die Naivsten werden schnell zu den schlimmsten Sadisten. Aber alles nur unter dem Mantel der Anonymität, alle testen sich nur aus, Denise nicht anders.
Sie fragt Kimba, ob El Duce in letzter Zeit da war. Kimba verneint nach zehn Minuten, aber wie es Denise denn so ginge? Denise vermutet El Duce hinter jedem zweiten Nick. Sie flirtet lustlos mit zwei Männern, die nicht El Duce sind, und checkt gleichzeitig ihren Kontostand. Wieder nichts. Daniela Katzenberger redet in einem TV-Special über ihre Sendung. Denise kann die Katzenberger nicht hassen, obwohl sie es gerne würde. Die Katzenberger, die will doch auch nichts Böses, denkt sie. Die macht einfach nur das Beste aus allem. Würde Denise doch auch tun. Das heißt, Denise würde es eben nicht tun, weil sie ihre Chancen nicht erkennt. Denise würde aus der Castingshow rausfliegen und sich zurückziehen und ihre Wunden lecken, anstatt die Aufmerksamkeit zu nutzen. Sie würde beschämt zurück zum Lidl gehen.
Nein, Denise würde nicht einmal in eine Castingshow gehen. Denise würde ganz unten ansetzen. Sie würde in Pornos mitspielen. Denise würde echt in Pornos mitspielen. Unfassbar. Noch unfassbarer: Denise hat in Pornos mitgespielt. Sie hat wirklich in Pornos mitgespielt, keine drei Wochen her. Sie schwitzt. Stimmt das wirklich? Wie um sich zu vergewissern, geht sie auf die Pornoseite und gibt ihren Pornonamen ein. Sofort sind da die drei Videos, ganz oben in der Thumbnail-Liste. Eindeutig Denise. Eine Mischung aus Scham und Stolz durchströmt sie. Nein, sie will sich nicht nur vergewissern. Sie will die Kommentare lesen. Sie will die Geilheit lesen. Sie will wissen, was sie wert ist. Denise klickt das erste Video an, stellt den Ton ab und liest.
Rasierschaum knistert in seinem Gesicht. Ein Bart aus Kleister, humorig aufgetragen. Anton sieht bescheuert aus im Spiegel, fast muss er lachen. Hermann tänzelt um ihn herum und gibt den Maestro. Die effeminierten Kiekser und Gesten sind zu klischiert gespielt, aber das kennt Anton schon. So wie Anton lange dachte, er sei ein begnadeter Sänger, hielt Hermann sich immer für den geborenen Schauspieler. Nach