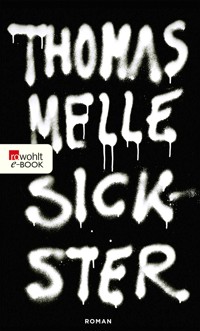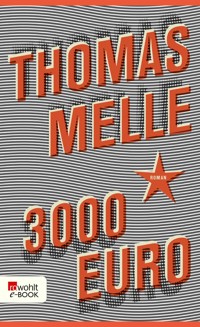12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Thomas Melles neuer Roman zeigt kaleidoskopartig die Auswüchse einer übersexualisierten Gesellschaft, »Das leichte Leben« ist die lange eingekochte Essenz unserer Gegenwart - schmerzhaft, komisch, brutal genau. Der neue, lang erwartete Roman eines der großen Schriftsteller unserer Zeit, der laut WELT »der Weltliteratur nahe« ist. Jan und Kathrin hatten mal alles, ihr leichtes Leben ließ sie schweben durch eine Welt, die dem schönen Paar vor allem wohlgesonnen war. Doch dieser Zustand ist ihnen abhanden gekommen. Zu schnell verändert sich die Welt um sie herum und sie selbst fühlen nur Stillstand, sind gefangen in den Konventionen der Ehe und des bürgerlichen Lebens. Kathrin war mal eine gehypte Schriftstellerin, heute fristet sie ihr Dasein als Aushilfslehrerin und versucht sich bei einer Sexparty wieder zu spüren. Jan, ein berühmter TV-Journalist, wird geplagt von einem anonymen Erpresser, der Nacktfotos von ihm als Internatsschüler verschickt. Während ihr Mann panisch fürchtet, dass sein schreckliches Geheimnis ans Licht kommen könnte, begehrt Kathrin ausgerechnet den wunderschönen und mysteriösen Freund ihrer Tochter Lale, der dazu noch ihr Schüler ist. Nach seinem autofiktionalen Roman »Die Welt im Rücken«, der auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises stand und in 22 Sprachen übersetzt wurde, liefert Thomas Melle mit seinem neuen Buch eine literarische Bestandsaufnahme einer Gesellschaft getrieben von Sehnsucht, eben nach dem leichten Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 348
Ähnliche
Thomas Melle
Das leichte Leben
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Inhaltsverzeichnis
Über Thomas Melle
Über dieses Buch
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
Inhaltsverzeichnis
In diesem Roman finden sich überarbeitete Passagen aus Thomas Melles »Bilder von uns«, mit freundlicher Genehmigung des Rowohlt Theaterverlags, Hamburg.
Inhaltsverzeichnis
Sunday Morning
It’s just the wasted years so close behind
Watch out, the world’s behind you
The Velvet Underground
Inhaltsverzeichnis
COUNTDOWN
Und der Vogel besprang den Vogel. Die Schnäbel glänzten aufgerissen im Licht, die Köpfe ruckten hektisch durch die Luft. Der hintere der beiden prahlte mit seiner Flügelspannweite, streckte die Schwingen weit auseinander, schrie und spie und rieb sich nüchtern in das Gefieder des anderen Vogels. Waren das jetzt Amseln oder Raben? Zu schnell, um es zu erkennen. Es hätten Begattungsschreie zu hören sein müssen, aber die Fenster hielten den Schall draußen. Kaum wurde Kathrin bewusst, was sie da erblickt hatte, war es auch schon wieder vorbei, und die Vögel sausten auseinander. Sie schluckte.
Denn Kathrin mochte Tiersexszenen. Sie war fasziniert von den Discovery Channels dieser Welt, konnte nicht wegschauen, wenn die TV-Viecher in ihren Herden und Horden und Rudeln und Schulen und Schwärmen und Kolonien bunt und wild und wie tödlich aufeinandertrafen, einander bekämpften, um sich dann zurückzuziehen und sich durch Begattung, ja, durch Vögeln zu vermehren. Der Einzelfall war immer so lehrreich.
»Ja, Schweinskram bräuchten wir auch mal wieder«, sagte Catharina. »So richtigen.«
Ihre Blicke trafen sich.
»Was?«
Catharina war Kathrins Blick offensichtlich gefolgt: »Aber richtig geiles Zeug, nicht so eine Trockenübung wie bei den Dohlen da. Gezwitscher für nichts.«
Kathrin lachte, dann fand sie die Bemerkung unpassend, zumal so offen vor Lale, die ja immerhin noch Catharinas Patenkind war. Dann dachte Kathrin an den Sex von letzter Nacht mit Jan. Es war, obwohl der erste Sex seit einem Jahr vielleicht, eine müde, zwanghafte Sporteinheit gewesen, ein Ringen, ein Kampf, und doch war Kathrin (als sie sich ergab, weil sie sich ergab?) gekommen. Sie hatte dabei an jemand anderen gedacht. Jan hatte länger gebraucht, auch das ein trüber, fast deprimierender Gewaltakt. Und sie hatte seinen Samen nicht mehr recht gemocht, den er ihr auf den Bauch gespritzt hatte. Fast hatte sie sich vor ihm geekelt. Nein, sie hatte sich geekelt. Der Schlaf danach war unruhig gewesen.
»Jedenfalls kommen sie ihrer evolutionären Aufgabe nach«, sagte Kathrin spitz.
»Welche evolutionäre Aufgabe eigentlich?«, fragte Catharina rhetorisch und wandte sich wieder dem riesigen Fernseher zu.
Jans erster TV-Auftritt stand an. Aufgrund eines Skiunfalls des eigentlichen Moderators hatte schnell eine Notlösung, ein Ersatz für drei, vier Wochen gefunden werden müssen, und anstatt eine oder einen der in solchen Fällen stets in den Startlöchern stehenden Billigmoderatoren oder eben -moderatorinnen zu schnellcasten, war Jan als stellvertretender Chefredakteur der Boulevardsendung einfach von oben, von der Senderspitze, in die Rolle des Anchormans gedrängt worden.
Jetzt saßen sie alle um den Fernseher wie um ein Lagerfeuer herum: Kathrin und Catharina, dazu deren skandinavischer Lover Lasse, Kathrins Schwester Saskia, schließlich Kathrins Kinder Lale und Severin mit einem weiteren Freund, dessen Namen Kathrin nicht richtig verstanden hatte, Torsven oder so. Es war kurz vor achtzehn Uhr.
Werbung lief, der Flatscreen strahlte die Clips in die Welt und in die Köpfe. Die Gesichter waren, im geschmackvoll und mithilfe vieler indirekter Lichtquellen ausgeleuchteten Wohnzimmer, vom Monitor illuminiert wie die Figuren auf einem Gemälde von Bellini. Das andere, das echte Gemälde, das Kathrin und Jan sich zum Hochzeitstag geschenkt hatten, mit einem seltsam ätherischen, dünnen Mädchen vor einem tiefen Sternenhimmel darauf, hing über ihnen und schien die Szene von oben herab gottgleich zu observieren.
Im TV-Studio lief schon der Countdown, und Jan wurde noch ein letztes Mal abgetupft (von einem, der eigentlich Filmemacher sein wollte, wie er Jan gleich am Anfang des Gesprächs hatte stecken müssen). Jan schossen die Bilder des Tages durch den Kopf, Bilder auch seines Tages, dann seines Lebens, wirre, eidetische Schnappschüsse auf der Retina, wild durcheinandergewirbelt, ohne Chronologie. Warten aufs rote Licht, vom Team auch scherzhaft »Rotlicht« genannt. Aufseiten Jans aber: Panik.
Auf Kathrins Seite: Nervosität. Wie würde ihr Mann sich präsentieren? Würde der Auftritt glatt über die Bühne gehen? Könnte Jan diesem Druck, dessen Effekt auf ihn von der Linse der Kamera in alle Öffentlichkeit zerstreut und ausgestrahlt würde, standhalten?
Lale und Severin, die Kinder der beiden, waren trotzdem gelangweilt: Die Pubertät war schon aufgeknallt in ihnen und hatte mit den ersten Problemen die üblichen Pickel mit sich gebracht, bei Lale die kleinen Narben schon fast wieder verheilen lassen, beim rundlichen Severin stand die Akne leider gerade in voller Blüte. Wie bleiche Marionetten saßen die beiden da, in der Sitzecke, eindeutig einander zugehörig.
Catharina und ihr sinistrer Lover Lasse dagegen, der, wie ihr schien, auch noch mit Kathrin flirtete, saßen wie Verschwörungstheoretiker der Liebe da. Er hatte einen langen, roten Bart, sie hochstehende elektrisierte Lockenwicklerlocken, aber hip, und sie lächelten die ganze Zeit auf eine derart esoterisch-verschwommene Weise in die Runde, dass Kathrin sich selbst schon wieder in anderen, hippiesk vernebelten Sphären wähnte, so ausgelaugt machte sie dieses Gehabe. Sie war noch nie in der polyamourösen Wohngemeinschaft Catharinas gewesen, aber sie betrachtete jedes Exemplar daraus, jeden Bewohner, mit Skepsis. Und gerade bärtige, schweigsam flirtende Männer mit glänzenden Alkoholikerpausbacken.
»Wann kommt er denn endlich?«, fragte Lale.
»Gleich«, sagte Kathrin und winkte ab.
Frischkäsewerbung. Alpengipfel vor einem viagrablauen Himmel, dann eine Familie, dann knackigstes Brot, bestrichen mit diesem Frischkäse, der den Namen einer Stadt und eines Films trug. Dann schwarz. Jingle. Es war so weit.
… sieben … sechs … Jan räusperte sich … fünf … vier … vier … noch mal vier … drei … Achtung, den Blick fokussieren, Jan! … zwei … entspanntes, seriöses Gesicht, bitte, nein, nein, bitte nur weg hier … eins. Atem holen, Jan. Und los. Die Welt stürzte ein, es gab nur noch die Kamera. Jan zitterte. Null.
Kamera lief. Die Familie samt fremdem Anhang hielt die Luft an. Da war er. Seltsam klar und älter als in Wirklichkeit, realer und gleichzeitig künstlicher: mehr Falten und doch glatthäutiger. Eine hochpräzise Maske, mehr Details zu sehen als in Wirklichkeit. Viel zu detailliert, alles, er, der Hintergrund. Und die Dimensionen fehlten.
»Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Skyline, Ihrem Up!-Boulevardmagazin – Menschen, Meinungen, Momente.« Sein Lächeln wollte ihm aus dem Gesicht rutschen.
Als es vorbei war, ging Jan aufs Klo und kühlte sich die Stirn am Spiegel. Er hatte den falschen Schritt getan, fühlte er. Aber es gab kein Zurück. Er war jetzt öffentlich.
Die Familie beredete währenddessen den Auftritt.
»Also, nee.«
»Doch, das war doch ziemlich souverän.«
»Schon, aber auch – weiß nicht.«
»Hatte er da ’nen Pickel?«
»Also, ich fand seinen Auftritt noch tastend, oder so.«
»Na ja, war halt sein erster.«
»Für mich war das nicht Papa.«
»Klar war das Papa«, sagte Kathrin.
Werbung lief: Mon Chéri.
WIE IMMER
Zwei Wochen nach seinem ersten Auftritt als Moderator wollte es der Zufall, dass Jan Drescher, gleich nachdem er die lebenszersetzende Bildnachricht erhalten hatte, von einem Radargerät geblitzt wurde. Gerade hatte ihm noch die Eichel vom Sex der letzten Nacht gejuckt, aber angenehm, denn es war aus seiner Sicht tierisch und zart gewesen. Seitdem er im Fernsehen auftrat, hatten sie endlich wieder Sex – und er hatte nichts dagegen. Seltsam, dass man sich an den Akt selbst nie gut erinnern kann, dachte er noch und wunderte sich, wie Erfolg und Bildschirmpräsenz anscheinend doch sexy machten, und dachte, wer denkt, er sei attraktiv, wird, wenn er es nicht gänzlich grundlos tut, noch attraktiver. Das war wohl die Anziehungskraft des Selbstbewusstseins, eine immer wieder erstaunliche Banalität. Aufgeladen von den Blicken der Frauen auf der Straße, die ihn offensichtlich erkannten, war er besonders bewusst auf dem Bürgersteig herumstolziert: festen Schrittes, aber auch Bescheidenheit ausstrahlend. Und hatte sich weiter mit Blicken aufgeladen.
Dann, im Auto, hatte er wie als Experiment einer Frau besonders lange ins Gesicht gesehen, einer schönen Fußgängerin an der Ampel, doch als sich, nach einer kurzen Irritation, ihre Blicke das zweite Mal trafen, hatte er dem ihren nicht standhalten können und leicht hektisch in die andere Richtung geblickt, um seine Aufdringlichkeit zu kaschieren. Der Verkehr war danach noch zäher gewesen.
Das Foto, mit dem Bußgeldbescheid später zugeschickt, zeigte sein unscharfes, doch erkennbar fassungsloses Gesicht beim Blick hinunter auf das Display seines Smartphones, um ihn herum das verschwommene Grau der Straße, unten, grell erleuchtet, das Nummernschild seines SUVs.
Die Tatsache, dass er ein, zwei Sekunden später fast von der Straße abgekommen wäre und einen womöglich verheerenden Unfall gebaut hätte, wird dagegen von keinem Bild eingefangen. Diese Tatsache, eigentlich nur die Möglichkeit einer Tatsache oder die Tatsache einer Möglichkeit, besteht allein in seiner Erinnerung und vielleicht noch in den verblassenden Gedächtnisbildern der Lehrerin und ihrer Zöglinge, die fröhlich lärmend in Dreierreihen auf dem Bürgersteig unterwegs waren, als Jan auf sie zuschoss.
Sicher hätte es einige von ihnen erwischt, wenn er nicht im letzten Augenblick das Lenkrad herumgerissen hätte und mit einer nicht sehr spektakulären, doch verräterischen Kurskorrektur sein Sport Utility Vehicle wieder auf Spur gebracht hätte.
Er geriet nicht ins Schleudern.
Anstatt jedoch einfach weiterzufahren, beherrscht und kaltschnäuzig, wie es sonst seine Art war, trat Jan abrupt auf die Bremse. Vielleicht waren es selbst für ihn zu viele Adrenalinstöße gewesen, die sein System nun auf Überlebensmodus herunterfuhren und ihn dazu drängten, sich selbst vorübergehend und instinktiv die Zulassung als Verkehrsteilnehmer zu entziehen.
Der ansehnliche Bremsweg rieb sich quietschend in die Straße und endete unmittelbar vor einer Ampel, die gerade auf Rot schaltete. Jan ließ den Motor noch einmal aufheulen und bugsierte den SUV so elegant wie möglich an den Straßenrand. Dann wischte er sich über Stirn und Augen und versuchte, wieder zu sich zu kommen. Was war soeben geschehen? Bild, Blitz, Schlingern. Und jetzt Stillstand. Ja, so war es gewesen. Das Smartphone hielt er noch immer in der Hand, darin das Bild.
Es hämmerte gegen die Fensterscheibe. Bleich, klamm und noch immer nicht ganz bei sich, erblickte Jan eine zornige Frauenvisage und ließ das Fenster runterfahren.
»Können Sie nicht aufpassen, Mann!«, fuhr das Lehrerinnengesicht ihn an. »Immer auf die Telefone gaffen, was! Sie hätten die Kinder fast umgefahren!«
»Ja, ich – Entschuldigung«, stammelte Jan.
»Ja, passen Sie doch auf!« Sie hatte eine Art Bienenkorb als Frisur, eine Reminiszenz an hippere Zeiten, oder doch schon ein Vorzeichen der sich ankündigenden Altjungfernexistenz?
»Mache ich ja.«
»Machen Sie nicht!«
»Jetzt hören Sie mal. Es ist ja nichts passiert.«
»Zum Glück! Die Kinder sind ganz verschreckt! Scheißtelefone überall! Verbieten sollte man die! Sind sie ja schon!«
»Was?«
»Beim Fahren sind die verboten! Das ist ein Delikt!«
»Jetzt halten Sie mal die Luft an. Ich hatte alles unter Kontrolle, habe ja gebremst«, beschwichtigte Jan sie.
»Aber wie! Wie so ein Irrer, mit Ihrem Panzer hier!«
Stille. Ein Panzer also – der Neid der unteren Mittelschicht hatte das Wort. Einfach nicht widersprechen, dachte Jan, einfach ins Leere laufen lassen.
»Haben Sie dazu nichts mehr zu sagen?«
Jan schüttelte benommen den Kopf.
»Gut.« Sie beruhigte sich etwas. »Haben wir noch mal Glück gehabt, was. Aber passen Sie auf, sage ich Ihnen, passen Sie auf.«
»Mache ich. Versprochen.«
Tatsächlich schien die Lehrerin oder Erzieherin oder Kindergärtnerin langsam zum Rückzug bereit. Der skeptische Blick durchwanderte noch einmal den Innenraum des SUVs, die Lederbezüge, das Touchscreenradio, die ganze ausgetrocknete Wohlfühlatmosphäre, und blieb beim Smartphone hängen. Jan hielt es noch immer schlaff in der Hand wie eine lange verlegte Fernbedienung, die nun keinem Gerät mehr zuzuordnen war.
»Was ist das denn?«, fragte die Frau.
»Was?«
»Na, das.«
Jan verstand erst nicht, dann sofort. Er wollte etwas sagen, doch sie kam ihm zuvor.
»Sie Schwein! Sie Perversling!«
»Hören Sie, das ist –«
»Ich weiß schon, was das ist. Ich hole die Polizei.«
»Sie wissen gar nichts.«
»Und ob. Und das ist sicherlich nicht Ihr Sohn!« Sie hielt ihr Handy ebenfalls in der Hand, aber wie ein Küchenmesser.
»Nein, ist es auch nicht.«
»Auch noch so unverblümt. Ekelhaft.«
»Sie wissen nichts darüber, und alle Ihre Annahmen sind falsch. Ich werde jetzt weiterfahren.«
»Sie bleiben schön hier.«
»Nein.«
»Doch.«
Sie zückte ihr völlig veraltetes Nokiahandy und machte umständlich Anstalten, die Polizei zu rufen. Sie wollte Jan offensichtlich noch Gelegenheit geben, sich zu erklären.
»Also gut. Soll ich Ihnen sagen, wer das ist?«
»Ja.« Sie lauerte.
»Das bin ich.«
»Wie, das sind Sie?«
»Ja, ich. Der Junge da bin ich.«
Diese Worte überraschten ihn selbst. So konsequent, dass er sie hätte aussprechen können, hatte er sie noch gar nicht zu Ende gedacht.
Er sah ihr an, dass sie ihm sofort glaubte, obwohl sie es nicht wollte. Sie ließ das Handy sinken.
»Aber –«
»Das ist mir selbst neu, wissen Sie. Und ich weiß nicht, was ich damit machen soll.«
Schweigen. Hinter ihr hatten die Kinder den Vorfall bereits vergessen und sich zu neuen Spielgruppen formiert. Sie wurden unruhig und lauter.
»Ich fahre jetzt los«, sagte Jan bestimmt.
Die Lehrerin oder Erzieherin oder Kindergärtnerin nickte.
»Alles Gute Ihnen, und Ihren Kindern auch«, sagte Jan und ließ die Fensterscheibe wieder hochfahren. »Guten Tag.«
Und fuhr ab, lauter und bestimmter als zuvor.
SCHWELLENZEIT
Der Clown kam nicht. Er pumpte und pumpte, aber umsonst, und auch Kathrin blieb bis auf Weiteres unerlöst. Orgasmen schienen aber auch gar nicht Sinn und Zweck dieser Übung zu sein. Mehr als um das Kommen ging es in diesem weitläufigen Schlafzimmer wohl um das Haben, um den schnellen Konsum von möglichst vielen Menschen, um die Gelegenheit, alle kurz zu benutzen und von allen kurz benutzt zu werden. Die etwas ungelenke Hektik führte also gerade nicht zum großen Rausch, zur entgrenzenden Ekstase, die Kathrin sich versprochen hatte – aber sie genoss dennoch, was passierte. Manche Pärchen strahlten vorübergehend sogar eine dreckig-verspielte Innigkeit aus, fanden wirklich zueinander, fast romantisch, fast wie in ein sündiges Instant-Paradies eingekehrt, Adam und Eva für ein paar verrauschte Sekunden. Die meisten der Anwesenden aber waren, so schien es Kathrin, Debütanten wie sie – und genau wie sie auch darauf bedacht, ihre Nervosität zu verlieren oder immerhin zu überspielen. Manche masturbierten nur.
Zum Beispiel jetzt, genau vor ihrem Gesicht. Sie starrte auf den neuen Schwanz. Dunkel und auffällig gerade stand er vor ihr und wurde langsam gerieben. Hatte sein Besitzer (dem sie absichtlich nicht in die Augen sah) etwas bemerkt, wollte er den Clown entlasten, es ihr statt seiner geben? Würde es dabei spritzen oder tropfen? Schon geil, wenn er spritzen würde, aber bitte nicht in die Augen, grinste Kathrin kurz, das brennt nämlich höllisch. Und ja, sie wollte es ja wirklich, sein Sperma, und wollte es anonym. Ihr Blick wurde unscharf, auf endlos gestellt, ihre Lippen schlaff und gleichzeitig voll. Sie war der Widerstand, der gebrochen werden wollte. Hinter ihr mühte der Clown sich weiter ab, aggressiv, wütend, die Schminke wahrscheinlich verlaufen, ließ es schneller klatschen, tiefer hallen, fand dabei einen guten Winkel. Kathrin machte das wilde Gestoße (zusammen mit dem aufgekratzten Schwanz vor ihr) durchaus geil – Hatefuck, Hatefuck, dachte sie, das puk-puk-puk, das zut-zut-zut –, aber nur bis zu einer gewissen Grenze, vor der sie in Duldungsstarre verharrte, am Gesichtsrand das mal träge, mal emsige Tummeln der anderen. Es ging noch nicht, fühlte sich einfach anders an als in den Pornovideos zu Hause, viel softer, gesitteter, bürgerlicher. Kathrin dagegen hatte sich Gier und Geilheit verordnet, Sekt gesoffen wie wild, das Ganze mit einer Tavor gekrönt (Tavor und Alkohol ergaben bei ihr einen wunderbaren, angstfreien Kick) und schon auf dem Weg derbe Witze gerissen, Catharina in den Schritt gepackt – sie wollte nun endlich die Einlösung, die Auflösung, und zwar so ordinär wie nur möglich. Trotz und Lust schwappten in ihr hoch, sie wollte sich selbst brechen, den eigenen Widerstand, und ahmte nun die Gesten, Mienen und Verhaltensstanzen der Darstellerinnen in den Pornos nach. Sie schob ihr Becken weiter nach hinten, hielt gegen das Trommelfeuer an, streckte die Zunge steif heraus, blickte hinauf zu dem Fremden und machte mit der linken Faust Wichsbewegungen in der Luft.
Der Fremde kam innerhalb von zehn Sekunden, kam heftig, aber übersichtlich, rein von der Menge her, traf Kathrins Gesicht dabei nicht einmal. Sofort wandte er sich ab und ging. Der Clown hatte nun auch genug von seinem Hatefuck (ein Filmstill blitzte vor ihrem inneren Auge auf, ein Clown, aber mit kunstblutbeschmierten Fangzähnen hinter milchigen Speichelfäden), hastete nach vorne, die rote Nase verrutscht, ein Film aus Schweiß und Schminke im Gesicht, und tat es seinem Vorgänger nach. Mit einem kurzen, manischen Reiben spritzte er ihre Stirn und rechte Wange voll, wollte ihr dann den Schwanz noch zum Ablutschen in den Mund stecken, was sie nicht zuließ.
Drüben sah sie Catharina im Türrahmen stehen, mit an sich verbotener Zigarette und im Gespräch mit irgendeinem Zorro. Ihre Blicke trafen sich, leer und unverständig. Kathrin musste die Scham, die in ihr aufkam, sofort wieder niederdrücken. Für Scham war sie nicht hier. Im Gegenteil.
Sie hatte etwas gegen das Verschwinden tun müssen, gegen das körperliche Nichtmehrvorkommen, hatte sich zusammenschaben, neu entwerfen und dann, und sei es nur für einen Abend, umso heftiger verschwenden wollen. Seit einem Jahr (oder waren es gar schon anderthalb?) hatten Jan und sie kaum mehr miteinander geschlafen, und wenn, war es der Erinnerung nicht mehr zugänglich – im Alkoholrausch vielleicht oder im Halbschlaf, wenn überhaupt; sie wusste es nicht, und wenn sie etwas nicht wusste, war es für sie besser auch nicht passiert. Was sie jedoch wusste und spürte, immer wieder und immer stärker: Sobald sie an Jan dachte, wurde es kalt und abweisend in ihr. Auch seine Fernsehauftritte hatten daran nichts ändern können.
Kathrin wischte sich das Gesicht mit einem Frotteehandtuch sauber und zog den nächsten fremden Mann heran, der sich unförmig auf sie draufschob, übergewichtig und übergesichtig dazu, weil maskiert, so wie die Regeln für Männer es hier eben vorsahen. Er war ein Anonymous mit der altbekannten Guy-Fawkes-Larve über dem Fettgesicht, sie eine Leichtmatrosin. Fast kam es ihr vor wie ein bürokratischer Akt, wie das Hervorziehen eines weiteren Leitz-Ordners, dessen Inhalt eigentlich bekannt war. Vielleicht lag es an den Masken, dass sie nicht kam.
Für Kathrin hatten Masken nämlich, gerade in ihrer verschlagenen Zweideutigkeit, schon immer etwas Albernes und Abstoßendes gehabt. Sie hatte alles Karnevaleske stets abgelehnt und sich von venezianischen Maskenbällen, die kürzlich in befreundeten Adelskreisen en vogue gewesen waren, ferngehalten. Diese süßliche, schwülstige Stimmung, in der angeblich alles passieren könnte aus einer kribbligen Anonymität, aus der Dialektik von Zeigen und Verbergen heraus – ihr war schon der bloße Gedanke an diese spießige Halbwelt der Identitäten ekelhaft, und der Kubrick-Film »Eyes Wide Shut« hatte ihr damals, wo andere so rotwangig begeistert geschwärmt hatten, einfach nur eine abstrakte Übelkeit beschert. Ging es beim Sex denn nicht immer auch ums Gesicht, um die Person, vielleicht in kurzzeitiger Auflösung begriffen, aber dennoch da, im Selbstverlust spürbarer denn je?
Oder ging es eben doch um das totale Gegenteil, das andere Ende der Skala? Das Phantasma einer völligen Verdunkelung, einer restlosen Anonymität erregte sie, wenn sie ehrlich war, doch viel mehr: der Gedanke ans Tiersein, ans Dingsein, an Glory Holes und Dark Rooms und Trennwände, durch deren Öffnungen sie nur den Unterleib schieben müsste, um rücksichtslos genommen zu werden, egal von wem oder was – von einem dreckigen All am Ende, das sie erschöpfend benutzen und vollspritzen würde. Sie wollte nicht verkleidet sein, nein, wenn überhaupt, dann wollte sie gleich unsichtbar und blind sein: ein Gegenstand. Deshalb war sie hier.
Der Mascara lief ihr in die Augen. Es brannte, das Gesichtsfeld verschwamm, das satinverhangene Bettenlager wurde zu einem einzigen Stoff, in dem die Körper zappelten wie Fische auf dem Trockenen. Die auf Rosenblättern gebetteten Teelichter, die die Gastgeber namens Katja und Ferenc überall verteilt hatten, verliefen im Wandspiegel zu einem unscharfen Dämmer. Kathrin mied den Blick in diesen Spiegel jetzt. Während sich zwei weitere Männer (ein Teufel und ein Schwarzer) an ihr zu schaffen machten – oder sie sich an ihnen: reiben, verschlingen, abmelken –, wurde sie ungeduldig und trotzig. Es war einigermaßen geschmacklos hier, es war hinreichend dirty, es entsprach beinahe ihren Fantasien, und doch konnte sie sich nicht hingeben. Das Beinahe schmerzte. Wo waren Gier und Geilheit hin, die sie so lange begleitet und befeuert hatten, im Auto, auf den Gehwegen, im Kino, im Klassenzimmer? Lag dieser Mangel allein an ihr? Zwischen der Vorstellung einer Sexparty und deren Wunscherfüllung lagen Welten. Sex war immer nur eine schlechte Kopie der ihm vorgeschalteten Fantasien; das kannte sie schon von Jan, das kannte sie von den meisten seiner Vorgänger; das kannte sie von sich. Eine Radikalisierung bräuchte sie, auch hier, ein Ausreizen der Grenzen bis ins Absurde, denn die Körper neben ihr, diese Zweier, Dreier und Vierer, die sich gegenseitig benutzten und rieben und stießen, sie waren noch viel zu bürgerlich eingehegt und geschmackvoll, dachte sie, waren sich ihrer selbst viel zu bewusst. Sie sparten verschämt an Obszönität. Tavor für alle!, dachte sie. Kathrin hätte nämlich ganz andere Sprüche und Dialekte gebraucht, alberne, dreckige Entsaftungssprüche aus den Dark Rooms ihres Bewusstseins, »die längste Praline der Welt« vielleicht, oder ein unerhörtes Schimpfwort für ihren Anus, am besten auf Sächsisch, mit sich überschlagender Stimme hervorgepresst. Richtigen, atemlosen Bauernslang hätte sie gebraucht, grobes Hinlangen, banales Hengsttum. Das alles fehlte hier, das fehlte ihr bei Jan, das fehlte eigentlich immer. Sie müsste irgendjemanden von Grund auf ins Obszöne formen, einen Toyboy, einen Zwischensklaven, einen heimlich gehaltenen SM-Kaspar-Hauser, dachte sie und nahm wieder an Fahrt auf, sie müsste ihm Wörter soufflieren und Taten beibringen, die sie selbst noch nie gesagt oder geschrieben oder getan hatte, allenfalls im Netz gehört und gesehen.
Plötzlich trug auch Kathrin eine kleine, niedliche Hundemaske vor dem Gesicht. Der Teufel hatte sie ihr mit einem Flüstern übergestülpt. Sie betrachtete sich verschwommen im Spiegel: weiße Bäckchen, große Augen, süße Zunge. Sie war nun eine kleine Hündin; sie war ein Kindchenschema. Und so klappte es. Sie hechelte erst ironisch, dann eins zu eins, zog den Schwarzen näher an sich heran, wuchtete seinen Schoß gegen ihren, immer härter, immer schneller, und er antwortete, wurde krasser und grober und größer, stampfte, verzögerte, rammte sich gegen und in sie. Gleichzeitig blies und rieb sie den Teufel, funktional und gierig und geil, nahm ihn dann aus dem Mund, um zu winseln und zu hecheln und ihre Zunge zu zeigen, hier, meine Zunge, ihr Schweine, macht. Dann tat sie alles gleichzeitig, reiben, winseln, blasen, hecheln, ficken, beißen, hier, du Welt, mach und nimm. Und kam endlich, mit einem Laut zwischen Bellen und Stöhnen, den Teufel tief im Mund, den Schwarzen hart im Schoß: hier, Welt, hier.
Am nächsten Morgen musste sie kichern. Ich Hündin! Beim Blick in den Badezimmerspiegel hechelte sie sogar kurz los, ganz leise und heimlich, sich selbst die beste Komplizin – und sah dabei, dass ihre Zunge ungewöhnlich pelzig war, erschrak darüber, kicherte dann erneut, doch schon künstlicher als vorher, schon forciert, als wäre da plötzlich ein Publikum, dem sie etwas vorspielen musste. Ein Schub schlechten Gewissens stichelte im Rücken. Was war das eigentlich gewesen?
Sie hatte ja gewusst, dass der angebliche Maskenball eine Sexparty sein würde, eine Sexparty in einer schnöden, schönen Eigentumswohnung, ein langweiliger Exzess der dekadenten Gentrifizierung, und sie hatte gewusst, dass sie hingehen und rummachen würde. Bei der ersten, zaghaften Erwähnung vonseiten Catharinas hatte sie es vor Wochen schon gewusst, gepackt vom Reiz des Verbotenen, und während Catharina noch am Telefon gegluckst hatte: Wir müssen ja nichts machen, hatte Kathrin schon gedacht: O doch, und ob.
SCHLUMMERFUNKTION
Jan betrachtete das Bild auf dem Handy. Was ist das, dachte er. Kathrin kam sofort hinzu, um ihn von hinten zu umarmen. Er versteckte das Smartphone, nicht zu aufgeregt, aber angespannt.
»Hast du was?«, sagte Kathrin.
»Nein. Wo ist Severin?«
»Bei Reimo.«
»Und Lale?«
»Auch.«
»Die Nacht durch, bis morgen?«
»Sogenannte Slumberparty. Schlechte Nachrichten?«
»Nein. Doch. Also, was heißt schon schlecht.«
»Nicht so ganz positiv, vielleicht?«
»Die Netzzahlen brechen noch schlimmer ein, als die Einschaltquote es eh schon tut, und die machen nichts dagegen, nur die komischen ›Kennste?‹-Beiträge. Nur, wer das nicht kennt, was dadrin ist, der hat auch kein Internet und ist nicht jung. Ich hab’s von Anfang an gesagt, macht das Netz auf, sperrangelweit, aber die Programmchefin ist an die Weisung der Senderchefin gebunden, und die ist halt frühsenil. Keine Zähne im Maul, aber am Alten festbeißen.«
Kathrin lachte kurz und überzeugend, also war der Witz gut gewesen.
»Und uns«, fuhr Jan fort, »sterben die Zuschauer weg. Das hätte gleich eingeführt werden müssen, alles, als das Internet aufkam. Jetzt muss man um Sachen kämpfen, die eigentlich selbstverständlich sind.«
»Ah so. Aber passiert ist passiert. Und jetzt bist du ja da, die jungen Dinger anzulocken.«
»Jaja, blabla«, sagte Jan gespielt verärgert. »Dennoch, lange geht das nicht mehr. Und das wissen auch alle. Aber wir sind halt die Ersten, die es ganz und tausendprozentig durchziehen müssen. Wird schon.«
»Aber sonst alles gut?«, fragte Kathrin, wie immer.
»Alles gut, ja.«
»Und gut ist gut.«
»Gut ist gut, ja.«
Sie gaben sich einen Kuss, der Jan zu nass vorkam.
»Und wir jetzt? Auch Slumberparty?«, säuselte Jan im Versuch, auf billige Weise erotisch zu klingen.
»Erst Theater.«
»Was! Schon wieder Familienkatastrophen?«
»Warum nicht«, kicherte Kathrin, kurz und überzeugend. »Solange wir keine sind, können wir uns ja das Elend der anderen reinziehen«, setzte sie hinzu.
Jan war nicht zufrieden. »Mir kommt das so gekünstelt vor«, sagte er. »Immer sitzen sie da und sind steif und glücklich, dann saufen sie, dann passiert irgendeine Katastrophe und es tanzen irgendwelche Gespenster der Vergangenheit, und schließlich zerfleischen sie sich wie Zombies. Und die Zuschauer gaffen, finden ihr eigenes Leben widergespiegelt, aber halt, stopp – ihr Leben haben sie ja an der Garderobe abgegeben und kurzfristig outgesourct, weshalb sie sich jetzt schön – wie hieß das? Wie hieß das noch? Das von Platon, wovon du sprachst?«
»Katharsis«, sagte Kathrin. »Von Aristoteles.«
»Genau, Katharsis. Dann können sie sich alle also schön kathartisch durchnudeln lassen, aber bringen tut es nix. Und dann stehen alle auf, sind schockiert und satt und ziehen sich ihr Leben wieder an und haben was zum Reden, um sich gleich, noch im Foyer, wieder dreckig zu machen, mit ihrem eigenen dreckigen Leben und Reden und all dem Bla.«
»Jan.«
»Ach, ja, entschuldige. Aber das ist alles einfach sehr weit weg, wenn du mich fragst.«
»Es unterhält und belebt das Gespräch«, sagte Kathrin. »Und wir brauchen auch mal anderen Input. Und früher hast du’s gemocht. Oder?«
»Ja, früher. Weiß nicht. Vielleicht hab’ ich nur so getan. Weil das hat nichts mit dem Leben zu tun, das alles. Das Leben ist viel flacher und dabei komplizierter als das ganze Getue. Das Leben ist vor allem Gerede und, und – Genichtse.« Jan schien selbst überrascht von seiner Wortneuschöpfung zu sein.
»Jetzt komm, abregen«, beschwichtigte Kathrin ihn (und kam sich dabei kurz vor, als würde sie die Hundemaske von gestern tragen, das Kindchenschema aus Plastik, diese Niedlichkeit und Süße und Falschheit und – äh, sie wurde rot, schämte sich am ganzen Körper) und sagte schnell: »Ziehst du dich um oder bleibst du im Anzug?«
Jan roch seine Achselhöhle ab, unterm Helmut-Lang-Hemd. »Vielleicht zieh ich mich lieber um, was?«
»Liegt auf dem Bett. Bis gleich.«
»Danke.«
Vor dem Schlafzimmerspiegel machte Jan erst ein paar Verrenkungen zwischen sportlich und albern, dann ein paar Grimassen zwischen albern und hässlich, dann griff er sich in den Schritt, noch da, dann zog er sich um. Als er sein Handy aus der getragenen Hose nahm, betrachtete er das Bild.
Er begann, ein Geheimnis zu haben.
NACH DEM VORHANG
Nach dem Raunen gingen die Lichter aus: Theater also. Okay, dachte Jan, okay, okay.
»Tod in Venedig« wurde gegeben. Die Darsteller hatten, so kam es Jan jedenfalls vor, echten Sex auf der Bühne. Das befremdete ihn zutiefst, und er schweifte ab im Kopf; er dachte an Stein, Stein und das Internat, auf dem er gewesen war.
Die Darsteller steckten sich derweil anscheinend gegenseitig den Finger in den Po und formten einen Ringelreigen. Etwas Alberneres hatte Jan noch nie gesehen. Er regte sich still auf und guckte weg. Da war ein Notausgang, grün glomm das Lichtkästchen. Sonst war es dunkel.
Nach dem Stück kam Jan sich leicht beobachtet vor, einerseits wegen seiner neuen Rolle im TV, andererseits wegen der Bilder in seinem Kopf, von damals. Leicht paranoid stand er herum, alleine.
Da erblickte er Malte. Was machte gerade der denn nun wieder hier? Da stand er, klein, glatzköpfig, ein Schlawiner. Jan wusste Dinge über ihn, die keiner wusste. Er winkte, Malte grinste, nickte und kam herüber.
»Nein! Wer ist denn da?«
»Nein! Wer ist denn da da?«
»Der helle Wahnsinn! Der Drescher.«
»Der helle Wahnsinn! Der Carlowitz.«
»Der helle Wahnsinn. Hey, Kathrin.«
Kathrin betrachtete einen kleinen, trapezförmigen Lichtreflex auf seiner Glatze. »Hey, Malte.«
Zwischen Malte und Kathrin gab es ein Küsschen-links-Küsschen-rechts. Die Männer umarmten sich kumpelhaft und schlugen einander auf die Schultern.
»Der helle Wahnsinn. Seit wann lässt man dich denn ins Theater?«, fragte Malte.
»Seit es seine Würde verloren hat«, grinste Jan.
»Stimmt, da passt du hin. Wo Würde nichts mehr zählt.«
»Wir nehmen uns da nichts, Malte.«
»Seid ihr noch im Stück drin?«, ging Kathrin dazwischen.
»Waren wir je draußen?«, sagte Malte.
»Was sind wir wieder philosophisch, was?« Kathrin verdrehte die Augen.
»Färbt wohl ab, die Bühne«, sagte Jan.
»Ich habe euch schon drinnen gesehen, ich war drei Reihen hinter euch. Ihr seht reizender aus denn je. Vor allem von hinten«, grinste Malte.
»Drei Reihen hinter uns, da sitzt du richtig.«
»Kathrin, du bist reizend, wirst aber immer mehr wie dein Mann.«
»Andersrum, er wird wie ich.«
»Was aufs selbe rauskommt.«
»Aber etwas Grundverschiedenes ist.«
»Wie fandst du’s denn?«, beendete Jan das alberne Duell.
»Ja, wie fand ich’s, wie fand ich’s. Durchwachsen fand ich’s.«
»Durchwachsen ist auch so ein Nullwort.«
»Wieso auch?«
»Wie fandest du’s denn?«
»Durchwachsen.«
»Sag ich doch. Kathrins Urteil wird da fundierter sein.«
»Sicher. Aber es reift noch.« Auch in Maltes Brillengläsern diese Lichtreflexe, der Typ schien wieder nur aus Oberfläche zu bestehen, dachte Kathrin.
»Wollen wir noch was trinken, um es weiter reifen zu lassen?«
»Nein, geht nicht, leider«, wiegelte Kathrin sofort ab.
»Wir müssen nach Hause«, stimmte Jan ein.
»Die Kinder.«
»Schade.«
»Wirklich schade. Ich hole schon mal die Mäntel.« Kathrin ging Richtung Garderobe und atmete auf.
»Sie konnte mich noch nie leiden.« Malte hatte sein besonders schlaumeier-schlawinerhaftes Gesicht aufgesetzt.
»Was ein Quatsch, übertreib mal nicht. Wir müssen wirklich, du hast ja keine Kinder.«
»Sind die nicht schon erwachsen?«
»Nein.«
»Okay, okay. Aber wir beide gehen mal einen trinken? Ist lange her.«
»Auf jeden Fall.«
»Ist ja auch viel passiert in letzter Zeit.«
»Ja, sicher.« Es passiert immer so viel, jaja, dachte Jan. Aber die Pause nach dem Satz wurde größer, fast bedeutungsschwer, genau wie Maltes Blick. Also fragte Jan nach: »Was denn?«
»Was?« Malte schien aus einem düsteren Gedanken aufzuwachen.
»Was ist denn passiert?«
»Ja, Matuschke?!«
»Ja, was, Matuschke?«
»Das weißt du noch gar nicht?«
Jan hielt inne. »Was?«
»Na, da sieh mal einer den Boulevardheini hier an! Wo nehmt ihr denn eure Infos her? Vogelflug? Kaffeesatz? 4chan?«
Jan schwamm. »Ja, Matuschke, Matuschke, warte. Heiratet, soviel ich weiß, bald sein schwedisches Supermodel, vertickt Real Estate an die Promis in Amerika und hat gewiss noch immer eine der hübschesten Klosterschwestern im deutschen Businessadel. Alles beim Alten, also.«
»Haha. Alles beim Alten. Alter. Der Drescher. Der helle Wahnsinn.«
»Was denn?«
»Matuschke ist im Gefängnis.«
»Was?«
»Ja.«
»Weshalb?«
»Die Sache mit den Kindern. Und den Bildern.«
»Was?«
»Ja, bitter. Skurril. Bodenlos.«
»Wovon redest du?«
»Die behandeln ihn jetzt wie einen Mörder da.«
»Wie, Kinder, Bilder?«
»Wo lebst du? Kriegst du nichts mehr mit, oder was? Zu viele Redaktionssitzungen?«
Jan blickte im Foyer umher, die Gesichter waren ihm teils zugewandt und nickten und verschwammen anderenorts zu bloßen Flecken, Fingerkuppen, Klecksen.
»So.« Kathrin war zurück, schneller als gedacht.
»Das müssen wir wirklich bald besprechen«, sagte Jan.
»Aber klar«, nickte Malte.
»Was denn?«, fragte Kathrin.
»Ein Schulkamerad von uns steckt in Schwierigkeiten«, sagte Malte.
»Aber kein Ding. Geht um Hypotheken, Cum-Ex, so was«, relativierte Jan.
»Schon ein Ding also«, sagte Kathrin und zog die Augenbrauen zusammen, dazwischen die alte Falte des Zweifels, ein kleiner Keil.
»Aber nichts, das man nicht lösen könnte«, sagte Jan.
»Nein. Das gibt es eh nicht. Für alles gibt es eine Lösung, zumal eine kommunikative«, sagte Malte verschmitzt. »Vor allem für Leute wie uns.«
»Du sprichst ein heikles Wort gelassen aus«, lächelte Jan. »Wir müssen.«
»Die Kathrin, der Drescher. Der helle Wahnsinn.«
»Der helle Wahnsinn.«
»Haltet die Ohren steif. Und immer am Ball bleiben. Und flach halten, den Ball. Dranbleiben und flach halten. Wahnsinn. Der Drescher.«
»Tschüss, mach’s gut, Malte.«
»Und den Ball auch mal reinmachen, Drescher. Am Ende den Ball auch mal echt reinmachen, irgendwann. Ciao, Drescher. Ciao, Kathrin, ciao. Der helle …« –
Aber sie hörten ihn schon nicht mehr.
PLATEAUPHASE
Ein Geheimnis ist ein innerer Ort der Einsamkeit, der sich ausbreiten kann wie ein Brandherd, wenn man ihn lässt. Schnell würde er sich entzünden und schwären.
Waren die Kinder weg, hatte es früher Sexgebot gegeben. Das hatte dann ausgenutzt werden müssen, und zwar so laut es eben ging – so hatte es in den ungeschriebenen Statuten dieser vorbildlichen Ehe gestanden. Die Regel schien jetzt wieder zu gelten, jedenfalls halb. Unter dem Martin-Eder-Gemälde, das Jans ganzer Stolz war und seinen distinguierten Geschmack belegte, gerade weil es kaum jemand mochte, wollte Jan sie nehmen, doch Kathrin entwand sich und fing an, seinen Schwanz zu reiben. Dabei stöhnte sie laut, extra laut, gespielt laut. Und seine Schreie hallten durch die bodenbeheizten Flure, und fast wie im Film, wie in einem Jack-Nicholson-Drama, ließ er sich enthemmt darauf ein und kam, so obszön und kamerawirksam er nur konnte. Nur lief keine Kamera.
Danach fand Jan keinen Schlaf. Der Sex mit seiner noch immer begehrten Frau hatte etwas von einer Performance gehabt, während deren er zugleich Darsteller und Zuschauer gewesen war. Das war nicht schlimm, aber ungewohnt. Er kam sich wie ein Lügner vor, der sich selbst beim Lügen betrachtete, schwitzend, unsicher, jede fahrige Geste ein Puzzleteil des Geständnisses, das als Gesamtes noch nicht begriffen war. Was hatte er zu gestehen?
Er versuchte, sich möglichst wenig zu bewegen.
»Kannst du nicht schlafen?«
»Doch, doch.«
Die Decken lagen auf ihm wie etwas Tranchiertes, wie Carpaccio, dünn und feucht und kürzlich noch lebendig. Er schwitzte. Er war selbst Carpaccio. Er wollte sich nicht bewegen. Er wollte sich und ihr nicht eingestehen, schlaflos zu sein. Wie in eine Deckenhöhle seiner Kindheit wühlte er sich ein, schraubte sich durch das erst steife, dann feuchte Bettzeug, schraubte sich durch das Geflüster in seinem Kopf, langsam, in Zeitlupe, über Minuten. Unter seinen Augenlidern, die ebenfalls feine, hauchdünne Fleischscheiben waren, lagen die Pupillen gelähmt im Trüben.
Kathrin umarmte ihn: »Schsch. Hast du schlecht geträumt?«
»Nein. Ich schlafe doch.«
Totes Fleisch war er, faserquer geschnitten aus der Seite des Herrn, filetiert und bereit zum Verzehr.
Wie alt war er gewesen? Elf, zwölf? Dreizehn?
Sofort hatte er den Park erkannt, die flachen Hänge, die Wiesen hoch zur Villa Dolorosa, wo die Sextaner wohnten, er einer von ihnen, und eines der Pferde war auf dem Bild zu sehen gewesen, in der Ferne, einer der Hengste, die Carvalho dann … und wie lange hatte er nicht mehr an Carvalho gedacht, was der jetzt wohl machte? Carvalho, der Pyromane, Carvalho, der stille Kim-Basinger-Spast, Carvalho, der blonde Portugiese mit eingesackter Haltung, undurchschaubar dümmlich – einer der Hengste also, die Carvalho eines Tages, genauer, eines normalen Nachmittags in der Mittelstufe, einfach so und aus dem Nichts mit einer gewöhnlichen Plastiktüte masturbiert und also abgemolken hatte, ihre Riemen regelrecht abgewichst, um dann mit dem Samen in der Tüte … er schreckte auf.
»Was ist denn?«, fragte Kathrin, jetzt fast ungeduldig.
»Nichts. Schlecht geträumt.«
»Hmhm.« Sie legte ihre Hand auf seinen Kopf.
Und was war mit Matuschke? Hatte auch er eines dieser Bilder erhalten? War Matuschke deshalb – ausgerastet? Oder was war ihm passiert, was hatte er gemacht? Waren diese Bilder vielleicht etwas zum Ausrasten? Und wenn ja, warum waren sie etwas zum Ausrasten, und war »Ausrasten« überhaupt das richtige Wort?
Warum, warum, warum. Wasauchimmer warum, dachte Jan, wasauchimmer wie, und verscheuchte die Gedanken wieder, oder spielte es sich vor, tat so, als wenn er sie verscheuchen könnte wie lästige Fliegen. Aber die Scheiße, die die Fliegen anzog, war in ihm. Unter den Decken wurde es eng und nass.
Es ist nichts, es ist ein Bild, es ist ein Bild von mir, von früher, ich bin das, wieso bin ich das, ich bin da nackt, wieso. Welcher Psychopath schickt mir überhaupt anonym ein derartiges Bild aufs Handy, das muss ein Psychopath sein, woher hat der Psychopath meine Nummer? Und wieso erinnere ich mich nicht? Woran?
»Klar erinnerst du dich«, sagte Kathrin. Er träumte schon.
»Du doch auch«, sagte sie zu Malte, der den beiden zu nahe kam, im Traum.
»Wir alle erinnern uns.« Eine grauschwarze Menge von Leuten, verschwommen, wie bei einer Totenprozession. Der Fokus pulsierte dunkel.
»Ich weiß nicht, wovon ihr redet.« Jan schwitzte, im Traum und in echt.
Dann tauchte Konstantin auf, hinter einem Baum, ein Dealer, der Blick verstellt, fast verrückt, die Kleidung zerfetzt, und zeigte Jan drei Pillen in seiner rissigen Hand, eine blaue, eine rote, eine braune, die sofort zu Brei zerfiel und zerlief, und flüsterte:
»Die Scheiße ist in dir.«
REDUCTIO A.D.
Am nächsten Tag in der Redaktion saß Jan am Schreibtisch und dachte kurz an nichts. Da kam die Praktikantin (oder Volontärin?) herein und lächelte mit den Augen, die blau waren (oder grau?). Jan lächelte zurück, mit dem Mund, falsch, dachte er, ich lächle falsch und unschuldig und tue geziert unsexy, womit ich wohl das Gegenteil erreichen will, nämlich auf unschuldige Weise sexy zu wirken, oh Mann. Kurz fragte er sich, ob er die Praktikantin (oder Volontärin?) atemberaubend, langweilig, schön oder egal fand. Sie legte ihm einen Stoß Papiere hin. Er roch ihr Parfüm, es war eines dieser herben Männerparfüms, die sich die Studentinnen in diesen Tagen gerne auftrugen, wegen struktureller Dinge wahrscheinlich, dachte Jan (ja, wegen struktureller Ungerechtigkeiten und längst nötiger Aufweichungen der überkommenen Patriarchate und Machostrukturen, und er nicht anders, er auch ein strukturelles Problem, dachte Jan), während die Praktikantin (oder Volontärin) sich vor ihn (oder eher über ihn) beugte, um einen anderen Ausdruck aus dem Fach zu nehmen, sie war ihm ganz nah.
Denn wer kannte sich schon aus in der Geheimsprache der Lockdüfte (die oft auch Abstoßungsdüfte waren), wenn nicht Jan, der Frauenkenner und -fürchter; er war bei Kathrin in die Schule gegangen (und bei einem Up!-Feature über die »Hammerdüfte der Saison« letztes Jahr, da hatte er (oder doch die Praktikantin (oder Volontärin)) extensiv recherchiert), aber das hier, das Parfüm der Praktikantin (oder Volontärin), das war ein Geheimtipp. Er hatte sie gefragt, und seitdem herrschte ein seltsames Verhältnis der Allianz zwischen ihnen, zwischen Johanna (oder Jasmin?) und ihm, Jan, der dieses Parfüm nicht in seinem Feature erwähnt hatte, denn es sollte ein Geheimtipp (und also auch ein Geheimnis zwischen ihnen) bleiben.
Es war Penhaligon’s Blenheim Bouquet, es war Winston Churchills Parfüm, ein echtes »Insiderding« (nur worin Insider, dachte Jan, innerhalb welchen Fachbereichs, welcher Altersgruppe, welcher peer group?), so hatte Johanna (oder Jasmin) ihm verraten, es sei auch, so sie, nichts so wie dieses zitrusfrische Männerparfüm mit Akkorden aus Limone und Lavendel und Zedernholz, das sie trage (er hatte nach einer Alternative gefragt, vielleicht für ein Geburtstagsgeschenk, vielleicht für sie, die ihm damals schon längst mehr war als »Praktikantin« oder »Volontärin«, als »Johanna« oder »Jasmin«, aber er war ja treu, so treu); »nein, Jan«, so sie dann (oder doch: »nein, Herr Drescher«, ja, sie waren noch beim Sie gewesen, damals), nichts sei diesem Duft auch nur annähernd ähnlich, vielleicht noch diese Aesop-Düfte, aber eigentlich nichts, »nein, Herr Drescher«. Und es gebe, so Johanna (jetzt wusste er ihren Namen wieder, denn gerade gestern war doch die Mail rumgegangen, dass sie keine Praktikantin mehr war, sondern fest angestellt im Sender), dieses eine Parfüm Penhaligon’s Blenheim Bouquet gebe es also auch nur bei manufactum oder in der Havarie de Luxe und in besonders gut sortierten Parfümerien, und »nichts zu danken, Herr Drescher«, und »ciao«.
Johanna war weg, nur der Duft Churchills lag noch in der Luft.
Jan dachte wieder an nichts.