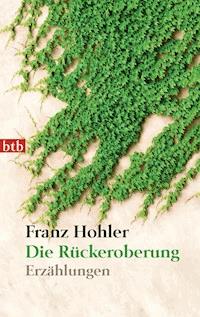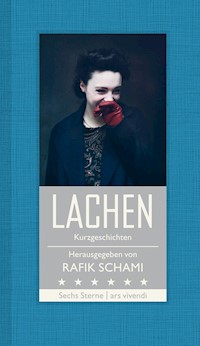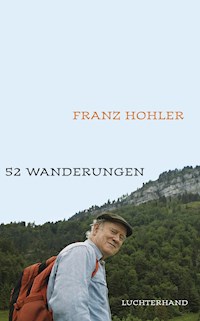
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Es gibt Landschaften, in die kommt man nach Hause.« Eine dieser Landschaften, die auf Franz Hohler gewartet hat, ist ein Plateau in der Nähe von St. Moritz. Dort hinauf zieht er, im Gepäck führt er ein kleines Zelt mit, ein Buch und Musikinstrumente. In dieser Bergeinsamkeit möchte er einmal den Vollmond aufsteigen sehen und in seiner stillen Pracht feiern.
Ein ganzes Jahr lang unternimmt Franz Hohler einmal pro Woche eine Wanderung. Er durchstreift Täler und Wälder, wandert über Wiesen, an Flüssen entlang und an breiten Fernstraßen. Er weiß sich an den kleinen Dingen zu erfreuen, an singenden Vögeln, an der aufgehenden Sonne, am ersten Schnee. Aber wie schöne und idyllische Szenen registriert er genauso den wachsenden Verkehr, die Zersiedelung seines Landes und daß sich selbst die entlegensten Berggasthöfe nur noch bewirtschaften lassen, wenn dort Fremde die Arbeit verrichten. Auf diesen Wanderungen lernen wir Franz Hohler auch von einer privaten Seite kennen. Er selber möchte mehr von sich in Erfahrung bringen, und vor allem fesselt ihn eine Erfahrung und läßt ihn jedesmal von neuem auf Wanderschaft gehen: Wie Alberto Giacomettis fadendünnes Männchen »Homme, qui marche«, Hohlers »Lieblingskunstwerk«, erfährt er mit jedem Schritt, wie schön es ist, sich durch Raum und Zeit zu bewegen. Eine Erfahrung, die ihn Woche für Woche näher zu sich selber bringt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 250
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Sihlaufwärts
Vor vier Tagen bin ich sechzig geworden.
Als ich das kommen sah, habe ich beschlossen, von meinem Geburtstag an ein Jahr lang keine Auftritte abzumachen, keine Lesungen, keine Schulbesuche, kurz, nichts von alledem, was mich zum Gefangenen meiner eigenen Agenda macht. Ich möchte, so sagte ich mir, in dieser Zeit für das Alter üben.
Für heute, den 5. März, war ein schöner, frühlingshaft warmer Tag angekündigt. Ich habe eine Flasche mit Zitronenmelissensirup und etwas Dörrobst in meinen kleinen Rucksack gesteckt, habe die Wanderschuhe angezogen und bin mit dem Zug nach Sihlbrugg gefahren.
Außer mir steigt dort niemand aus, es ist noch zu früh für Wanderungen, überall liegt Schnee, aber im Zauberwald zu meiner Rechten höre ich schon einen Vogel singen, den ich nicht kenne, melodiös und verführerisch, er beginnt mit einer mehrmals wiederholten Quarte, wie im klassischen Wanderlied, und fährt dann mit langgezogenen, hauchdünnen Tönen fort. Wie leicht er das Dröhnen des unglaublich dichten Autoverkehrs zu übertönen vermag, der wenige Meter unterhalb des Waldweges durch das Sihltal rollt. Würde ich seinem Ruf folgen, geriete ich vielleicht in ein Dickicht, aus dem ich nie mehr zurückkäme. Langsam verhallt sein Gesang und wird von vielfachem Hundegebell abgelöst; direkt neben der Autostraße befindet sich ein Ferienheim für Haustiere, und die Hunde, die sich hier kennenlernen müssen, tauschen in den Zwingern ihre Wut und ihr Heimweh aus.
Über die Brücke will ich jetzt, muß dann ein Stück auf der Hirzelpaßstraße gehen, die fast ausschließlich von Lastwagen befahren wird, sie schieben Aufschriften durch die Landschaft, wie »Scania«, »Morga«, »Galliker Logistics«, oder einfach ein großes, oranges »M«. Ein zerborstener Stein, der von einer Ladebrücke auf das Trottoir gefallen sein muß, zeigt mir an, daß ich in Gefahr bin, vielleicht sollte man auch als Wanderer einen Helm tragen.
Eine Häusergruppe, an der ich vorbeikomme, erweist sich zu meiner Überraschung als Pfarrer Siebers »Sunedörfli«, für das ich auch schon etwas gespendet habe. Dann gehe ich unter den mißbilligenden Blicken zweier Lamas, die untätig in einem Gehege stehen, zur Sihl hinunter. Der Uferweg ist immer noch mit Schnee bedeckt, ich schraube meinen Wanderstock auseinander, um meine Trittsicherheit zu verbessern.
Wie schnell verliert sich der Lastwagendonner und wie unvergleichlich viel schöner ist das Plätschern und Gurgeln des Flusses, das mich von nun an begleitet. Nach einer Weile ist es fast das einzige Geräusch, einmal flattern und schnattern ein paar Enten, dann höre ich wieder hoch oben den langen Pfiff eines Raubvogels, für alle Mäuse ein Warnruf des Todes. Immer enger wird das Tal, immer größer werden die Felsbrocken, die dem Fluß im Wege stehen, sie tragen alle noch Schneekappen, einer hat die Form einer Riesenschildkröte, ein Steinhals ragt über das Wasser hinaus, und der Panzer ist aus gleißendem Weiß. Nach der Stelle, welche Sihlsprung genannt wird, haben sich aus den Tropfen, die von der überhängenden Nagelfluh hinuntergefallen sind, Eissäulen gebildet, zwischen denen man durchgehen muß, ein winterliches Spalier für den Frühlingswanderer, der die Windjacke schon längst ausgezogen hat und im Hemd geht. An schattigen Stellen gilt es aber durchaus, auf das Eis zu achten, das den Boden noch bedecken kann. Auf beiden Seiten des Flußtales sprudeln Bäche mit einem Übermut die Abhänge herunter, als hätten sie vom Winter Ausgang bekommen. Einer von ihnen muß sein Bruttogefälle einem kleinen Elektrizitätswerk abliefern, welches 1894 erbaut wurde, wie ich auf einer Tafel lese.
Was für ein eigenwilliger Fluß, die Sihl. Statt sich von Einsiedeln aus auf geradem Weg in das einladende Zürichseebecken zu ergießen, hat sie alles getan, um diesem See auszuweichen, und es ist ihr gelungen; sie versteckt sich die längste Zeit hinter einer Seitenmoräne des Linthgletschers und mündet knapp hinter dem Seeausfluß in die Limmat.
Im Gehen denke ich, wieso mache ich dieses Jahr nicht jede Woche eine Wanderung? Als Fußgänger fühle ich mich gut und frei.
Der Weg führt nun ein Stück von der Sihl weg, in die Höhe, auf der andern Talseite taucht weiter oben Menzingen auf, es wirkt fast wie an den Hang gemalt, ohne Tiefe. Dann auf einmal der Blick auf eine neuzeitliche Festung, düster, mit hohen Drahtgittern umzäunt. Das Gefängnis Bostadel. Wer hier eine Zelle bewohnt, haßt wahrscheinlich das Sihltal und seine Schatten.
Mit etwas zu langen Schritten marschiere ich wie ein entlaufener Sträfling talaufwärts, bis ich von der Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege links hinauf gewiesen werde, über vereiste Holztreppen, und aus dem Wald ins blendende Sonnenlicht trete. Das Hauptversprechen des Dorfes ist das Postauto nach Schindellegi, zur Haltestelle »Post« muß ich mich durchfragen, denn es gibt keine Post mehr, und ich habe sie noch nicht gefunden, als ein gelb gestrichener Kleinbus die Straße zur geschlossenen Molkerei hochfährt, vor der ich etwas ratlos stehe und mit meinem Wanderstock winke, der Wagen hält an, der Chauffeur öffnet mir die Türe, und er fährt mich als einzigen Gast nach Schindellegi, wo mir vor der Abfahrt des Zuges nach Wädenswil gerade noch Zeit bleibt, um in einem bahnhofsnahen Restaurant ein Getränk zu mir zu nehmen, das mir eine überaus freundliche Asiatin serviert.
5. 3. 03
Tafeln
Der Zug nach Chur ist ziemlich gut besetzt, ich lasse mich schräg gegenüber einer Frau nieder, die am Laptop arbeitet und ihre Unterlagen auf dem Nebensitz ausgebreitet hat. Da uns ein wolkenloser Tag versprochen wurde, nehme ich die Sonnencrème aus meiner Jacke und schmiere mir mein Gesicht ein. Dann lese ich in der NZZ, die ich mir aus der S-Bahn als Zufallslektüre mitgenommen habe, einen Artikel über Daniil Charms, einen meiner Lieblinge.
Die Laptopfrau steigt in Pfäffikon aus, sie scheint sich nicht auf das zu freuen, was sie dort erwartet, ich hingegen freue mich sehr, als ich in Ziegelbrücke den Zug verlasse und den Autobus auf dem Bahnhofvorplatz besteige. Der Chauffeur ist in eine Zeitung mit Kleininseraten vertieft und läßt dazu die Nachrichten des Lokalradios laufen. Im Sicherheitsrat, so höre ich, gab es keine Mehrheit für eine militärische Intervention im Irak, und die Temperaturen klettern heute bis auf 20 Grad.
In Weesen sehe ich auf dem gelben Wegweiser, daß bis Walenstadt mit 6 Stunden zu rechnen ist, und setze mich in Bewegung.
Der Walensee gibt dem tiefen Tal zwischen der Churfirsten- und der Mürtschenstockkette eine Weite, die es eigentlich gar nicht hat.
Kaum erreiche ich das Ufer, mahnt mich eine Gedenktafel an einen Schiffsführer, der hier in treuer Pflichterfüllung verunglückte, 1952, da war ich 9 Jahre alt. Wer könnte mir diese Geschichte erzählen? Bauarbeiter einer Firma für Beach-Sportanlagen sind an der Arbeit und erstellen ein halbrundes Holzgebäude am Ufer, oder eher am Beach. Gleich dahinter macht mir eine Merktafel klar, daß ich auf einem Stück eines Geowegs unterwegs bin, laut Plan betrete ich nun die olivgrüne Churfirstendecke. Eine Auswahl großer Felsbrocken lädt zum Studium ein, am besten gefällt mir das Wort Schrattenkalk.
Die Uferstraße wird bald zum Uferweg, der nur zu bestimmten Zeiten befahren werden darf, da Autos nirgends kreuzen können, der Weg schickt mich durch einen engen Tunnel, hinter dem er sich dann malerisch am Fuß schroffer Steilhänge dem Ufer entlang windet. Eine weitere Gedenktafel erinnert an A. Raillard vom SAC Basel, der hier am 1.Sept. 1889 den Tod fand, anscheinend hat er sich mit dem Durchklettern dieser Felswand zuviel zugemutet.
Das Linthtal, lese ich auf der nächsten Tafel des Geowegs, folge eigentlich einer tektonischen Störung. Wenn ich den Walensee unter mir betrachte, der ständig an Bläue gewinnt, fällt es mir schwer, ihn als Störung anzusehen.
Die Bewölkung nimmt ab, der Weg steigt an, ein erstes Restaurant preist auf seinem Aushang Gugelhopf und Bauernspeck als Spezialität des Hauses an, aber ich widerstehe, 10 Uhr ist noch zu früh. Frühlingsblumen blühen, blaue und weiße Veilchen, weiße und blaue Geißenblümchen, gelbe Butterblumen und Huflattiche, dazwischen Margritli, die man auf hochdeutsch mit Maßliebchen ansprechen sollte. Die blauen Geißenblümchen, die hier in erstaunlicher Anzahl versammelt sind, müssen, wie ich später in meinem Bestimmungsbuch lese, als Leberblumen betrachtet werden, und ein Bekannter erzählt mir am selben Abend, in seiner Kindheit habe die Mutter zu Frühlingsbeginn immer auf einer Wanderung an den Walensee bestanden, nur um die »Läbereblüemli« zu sehen. Ich komme also gerade recht.
Ein Wegweiser versucht mich zur Rinquelle zu locken, nur 10 Minuten sei diese Natursehenswürdigkeit entfernt, da aber auf der Wiese frischer Mist ausgebracht ist, gehe ich weiter und erliege der Versuchung erst, als ein anderer Wegweiser eine zweite Variante vorschlägt. Der Wasserfall, der hier in zwei Stufen direkt aus dem Himmel zu stürzen scheint, ist einer der höchsten ganz Europas, sagt mir die Tafel neben dem Bänklein, und nun bin ich richtig stolz, daß ich ihn als das würdigen kann, was er ist. Er prasselt auf ein Schneefeld, das von einem Rutsch übriggeblieben ist, und in der Felswand daneben ist ein Loch zu erkennen, der Eingang eines riesigen und noch nicht zu Ende erforschten unterirdischen Labyrinths. Während der Schneeschmelze oder bei großen Regenfällen vermöge das Höhlensystem das Wasser nicht mehr zu halten, und es ergieße sich dann aus diesem Loch. Das dunkle Moos an den Felsen darunter läßt die Breite dieses Wasserfalles erkennen, den ich gerne einmal sähe, wenn er in Betrieb ist.
Als ich mich umdrehe und zum Walensee schaue, erhebt sich dahinter der Mürtschenstock schlank und unbegehbar wie das Matterhorn, ich setze mich hin und mache eine Zeichnung davon in meinen Skizzenblock.
Der Weg führt nun zuerst oberhalb der Felswände und Steinbrüche durch und dann steil hinunter, und so geht auch der Wanderer steil hinunter nach Quinten, dem einzigen Ort in der Schweiz, der nur zu Schiff erreichbar ist, oder eben zu Fuß.
Als mir von der Tafel der »Schifflände« schon wieder das Wort »Bauernspeck« entgegenblickt, gebe ich meinen Widerstand auf und trete ein. Die Wirtin begrüßt mich herzlich und namentlich, obwohl es über drei Jahre her ist, seit ich hier einkehrte. Der Speckteller schmeckt wunderbar, ein Elektromonteur, der auch in der Wirtsstube zu Mittag ißt, behauptet, er hätte sich vor etwa 30 Jahren einmal mit mir gestritten, woran ich mich aber glücklicherweise nicht mehr erinnern kann.
Einen südlichen Glanz hat dieses Dorf, Weinberge ziehen sich den Hang hinauf, auf dem Weg nach Walenstadt huschen Eidechsen zur Seite, Sommervögel tanzen, wie heißen sie schon wieder, die dunkelbraun-orangen mit den Tupfen und den Mustern afrikanischer Masken auf den Flügeln, bei den Schmetterlingen habe ich eigentlich nur den Zitronenfalter auf sicher, den ich wenig später im Waldreservat der ETH umherflattern sehe, auf das man durch eine Tafel aufmerksam gemacht wird. Hier werde der Wald so belassen, wie er sich selbst entwickle, das vermittle dem Fachmann Erkenntnisse über den Waldhaushalt. Das muß eine ältere Beschriftung sein – heute würde man die feministische Klippe wohl mit dem unverfänglichen Plural »Fachleute« umschiffen. Der Weg steigt nun noch einmal gnadenlos an, immer tiefer bleibt die Seeoberfläche zurück, immer lauter dröhnt der Lärm der Züge und der Autos vom andern Ufer herüber. Ich durchquere eine Lothar- oder Fivianschneise, in der es übel aussieht, und schließlich erreiche ich eine Schulter, von der aus mein Ziel zu sehen ist, ich trinke ein paar Schlucke aus einem wunderbar kalten Brunnen und mache mich auf den Abstieg. In Walenstadt grüße ich die Büste Hans Conrad Eschers, der die Linth-Störung behoben hat, und da es am Bahnhof weder eine Toilette mit Wasser noch einen Brunnen gibt, ziehe ich mir aus dem Getränkeautomaten einen Süßmost, den ich im Zug nach Ziegelbrücke langsam ausschlürfe, indem ich mit Genuß die Echsenzackensilhouette der Churfirsten und die ganze Strecke am jenseitigen Ufer betrachte, die ich heute zurückgelegt habe.
11. 3. 03
Mons rigidus
Stotzig sei er, dieser Berg, fanden die Römer, und nannten ihn rigidus, den steilen. Wären die Römer mit meiner Frau und mir zusammen um halb sieben Uhr morgens auf dem Gipfel gestanden, hätten sie ihn frigidus genannt, denn der eisige Wind blies uns sogar unter die Halstücher, mit denen wir unsere Gesichter vermummt hatten, drang in die gefütterten Handschuhe ein und machte die Finger steif.
Was einen an einem Märzsonntag in der Frühe auf den Rigi treibt, kann eigentlich nur der Sonnenaufgang sein. Da steht es vor uns, das Inselreich der Alpengipfel, und wird von einem atlantischen Nebelmeer umspült, vielleicht schwimmen Seekühe und Ichthyosaurier in seinen Wellen, und Trilobiten werden an die Ufer der Berge gespült, welche so unberührt aussehen, als seien sie erst vor kurzem aus dem Ozean emporgedrückt worden, durch ein Kräftemessen zweier Kontinentalplatten auf dem Boden dieses Ozeans. In bizarrem Clinch sind die Gesteinsmassen erstarrt und haben in der nachrömischen Zeit Namen wie Tödi, Schärhorn, Bristen, Dossen, Jungfrau oder Eiger bekommen, und die schirmen nun wie ein steinerner Cordon den Süden vom Norden ab. Ein paar Mergelhaufen sind beim Kampf von der Kette weggespritzt und liegen geblieben, als Vorposten sozusagen oder als Vorwarnung. Auf einem davon stehen wir und warten im Schnee gemeinsam mit der Alpenkette auf die ersten Boten der Sonne, welche aus dem Weltraum Nachrichten von Licht und Wärme überbringen. Und da sind sie, huschen von einem Berggipfel zum andern, verscheuchen die herumlungernden Nachtschatten wie lästiges Volk und schaffen Platz für den Auftritt der Königin des Tages, die Sonne.
Die Täuschung ist perfekt: die Königin erhebt sich über dem Horizont, um auf ihr Inselreich zu blicken. So glaubten alle Völker, und so würde auch ich glauben, wäre mir nicht das Wissen von Kopernikus, Kepler und Galilei weitergegeben worden, nämlich daß die Königin still steht und die Erde sich vor ihr verneigt. Erst vor wenigen Jahren hat sich auch der Vatikan den Erkenntnissen der Astronomie angeschlossen und das Urteil gegen Galilei im 17. Jahrhundert für ungültig erklärt.
Als das Inselreich den Glanz der Königin dankbar zurückwirft, verneigen auch wir uns vor der Majestät und gehen zurück in die warmen Betten des Hotels Kulm, wo es mir ohne weiteres gelingt, nochmals zwei Stunden zu schlafen.
Die Wanderung dann, die wir um halb elf antreten, ist kurz, sanft und kniefreundlich. Zuerst nach Staffel hinunter, wo ich fast auf eine kleine Sonnencrèmetube mit dem erstaunlichen Faktor 26 trete, die ich einstecke und mitnehme, dann weiter und vorbei an einem Gedenkstein für die Zweierbesatzung eines Postflugzeugs, das 1936 bei Nebel in den Rigi prallte. Die Briefe dieses Fluges werden heute bestimmt teuer gehandelt, Unglücke sind unter Philatelisten sichere Werte.
Wir tauchen ins Meer ein und erreichen im Wellenschlag des Nebels das Känzeli, von dem man bei klarem Wetter auf dem Meeresboden Luzern sieht. Jetzt sehen wir gar nichts, außer den grauen Wogen vor, hinter, unter, neben und über uns. Auf dem Weg nach Kaltbad hätten wir beinahe die kleine Waldkirche übersehen, die sich, hinter mächtigen Felsbrocken versteckt, unter eine Mergelwand duckt. Sie ist unserer Mutter zum kalten Bad gewidmet und stammt aus der Zeit, als man Galilei auch in ihrem Namen mit der Folter drohte. Eine Quelle fließt aus einem Felsspalt und wird durch ein Becken gefaßt, in das sich die Pilger wohl früher hineinlegten. Als wir wieder etwas bergauf gehen, erscheint die Königin erneut, zuerst als fahle Scheibe, bis sie uns in Kaltbad wieder in vollem Ornat begrüßt.
In First kehren wir in einem Restaurant ein, in dem ein erlegter Bär an der Wand hängt, und das Gebäude, das einmal der Bahnhof Rigi-First war, ist mit »Wölfertschen« angeschrieben.
16. 3. 2003
Die Lötschbergrampe
Ich habe den Wecker auf 5 Uhr gestellt und erwache um 4 Uhr. Eine Amsel singt, ich schließe das Fenster, kann aber nicht mehr einschlafen.
Um 6 Uhr sitze ich im ersten Zug nach Bern, der auch der erste Zug Richtung Brig ist, gehe in den Speisewagen und bestelle ein Frühstück. Auf dem Rückweg zu meinem Platz treffe ich einen Radioredaktor, der das Markus-Evangelium liest, weil er es am Radio vortragen muß. Ich nehme mich zusammen und lese das neue Stück von Lukas Bärfuß, »Die sexuellen Neurosen unserer Eltern«. Auf den ersten paar hundert Metern des Lötschbergtunnels bin ich fertig damit.
In Goppenstein steige ich in den Regionalzug um und fahre eine Station weiter, nach Hohtenn. Dort beginnt der bekannte Wanderweg, und jahrzehntelang dachte ich, da sollte ich einmal durchgehen. Heute gehen diese Jahrzehnte zu Ende, ich stehe vor dem Wegweiser und gucke etwas perplex auf das daran befestigte Schild »Höhenweg geschlossen«. Ob es Stellen gibt, bei denen man über abschüssige Lawinenkegel gehen muß? Aber das Wetter ist warm und wolkenfrei, verirren ist nicht möglich, und käme so eine Stelle, könnte ich ja umkehren.
Mit einem Hauch von Abenteurergeist ignoriere ich also die Warnung und breche auf. Schon nach zehn Minuten kommt der erwartete Kegel, oder ich komme zu ihm, die Brücke über den Bach, der aus ihm herausfließt, ist noch nicht wieder eingerichtet, aber er läßt sich leicht überqueren, und ich laufe nun eine gute Stunde über einen außerordentlich menschengerechten Wanderweg, der sich hoch über dem Rhônetal dahinzieht, immer etwa auf der Höhe der Bahngeleise. Die Berge gegenüber glänzen weiß, doch man sieht ihnen an, daß der Schnee am Schmelzen ist. Auf unserer Seite, die dem Süden zugewandt ist, herrscht überschwänglicher Frühling, ich höre sogar eine Lerche zwitschern.
»Gestein MALM«, teilt mir eine erste Aufschrift mit, und später erläutert mir eine Panoramatafel die von hier oben sichtbare Baustelle für den Lötschbergbasistunnel, der im Jahre 2007 Raron mit Frutigen verbinden sollte. Die Kirche von Raron ist gut zu sehen, der Friedhof daneben auch, unruhige Zeiten für Rilke sind das, der dort begraben liegt.
Bei meiner ersten Rast (Gestein »DOGGER«) rufe ich mit dem Handy meinen Buchhändler an und bitte ihn, mir drei Bücher von irakischen Autoren zu bestellen, auf die mich ein Arabischkenner und -übersetzer aufmerksam gemacht hat. Der Buchhändler verspricht, sein Bestes zu tun, und ich marschiere nun tief ins Bietschtal hinein, wo auf der Schattenseite noch ziemlich viel Schnee auf dem Weg liegt, über den ich aber gut vorwärts komme.
Gerade als ich bei zwei langen Rastbänken meine Hosen ausziehe, um in meine Shorts zu schlüpfen, taucht eine größere Gruppe von der Gegenseite her auf, und die Frauen und Männer setzen sich zu mir und trinken Tee aus Thermoskrügen oder Wasser aus Petflaschen. Währenddem ich mein Bündnerfleischsandwich hervornehme, erfahre ich, daß es sich um eine Fastenwandergruppe handelt, und packe das Brot wieder ein, aus Solidarität.
Im Laden von Ausserberg kaufe ich mir einen Joghurtdrink, mache dann hinter dem Dorf meine Mittagsrast und verspeise nun mein Sandwich. Auf einem Geländevorsprung, von dem aus man die ganze Mischabelgruppe und die Bergketten des Goms sieht, steht eine Kapelle, ich habe Lust einzutreten. Als ich die Tür öffne, stoße ich auf einen Mann, der direkt neben der Tür in der Kapelle steht. Ich grüße ihn, er nickt, ich schaue den schön renovierten Innenraum etwas an und gehe dann zu den Kerzen links vorne, um auch eine anzuzünden. Während dieser Zeit hat sich der Mann zuerst in die hinterste Bank gekniet, ist dann aber wieder aufgestanden und hat die Kapelle verlassen. Tatsächlich scheint mir der Raum zu klein für zwei Menschen, von denen der eine beten will. Ich entzünde eine Rechaudkerze und stelle sie zu zwei andern, die schon brennen, gehe dann zum Opferstock und werfe 1 Franken in Münzen ein, da ich kein Frankenstück bei mir habe. Dann sage ich laut, ich weiß nicht ob zu Gott oder zur kleinen heiligen Therese, der diese Kapelle geweiht ist, »Tu etwas für den Irak! «, und ich bin erstaunt, wie unwirsch meine Stimme klingt. Als ich die Tür öffne und hinaustrete, steht der Mann draußen gleich neben der Tür, so daß er mein rauhes Gebet gehört haben muß. Er geht zu seinem Auto, einem Kastenwagen, der weiter vorn parkiert ist, und ich kauere neben der Straße zu Boden, nehme meinen Zeichenblock aus dem Rucksack und beginne mit einer Farbskizze von der Kapelle. Nun geht der Mann wieder an mir vorbei, wirft einen Blick auf mein Papier und betritt erneut die Kapelle. Na also, denke ich, nun kann er in Ruhe beten, und überlege mir, wofür er wohl betet, um so mehr, als er sehr diesseitig aussieht, stämmig, lebenstüchtig und handwerklich, überhaupt nicht wie einer, der in der Mittagspause schnell beten geht. Als er wieder herauskommt, mustert er nochmals kurz meine Zeichnung. Vielleicht hat auch er sich gefragt, was einer wie ich in der Kapelle wollte. Aber gesprochen haben wir nicht miteinander, und so gehen wir weiter unserer Wege.
Schon zum zweitenmal sehe ich am Boden eine lange Kette von Raupen, die sich alle aneinander halten, als fürchteten sie, sich zu verlieren. Der Anblick rührt mich, er erinnert mich an eine Friedensdemonstration, aber ich werde trotzdem noch einen Biologen fragen, was es damit auf sich hat.
Nun ist die Temperatur sommerlich geworden, ich werde etwas träge und nehme nach dem Überqueren des Baltschiedertales (Gestein »LIAS«) die Gelegenheit wahr, in Eggerberg mit einem Zug nach Goppenstein zu fahren, der nur alle zwei Stunden verkehrt. Dort steige ich in den Schnellzug nach Bern um, und in Bern in den Zug für die letzte Strecke nach Zürich, die ich mit einem Blindenhund namens Napoleon zusammen zurücklege.
25.3.03
Zum Rheinfall
Morgen soll der vorlaute Frühling einer Kaltfront weichen, also möchte ich heute noch den warmen Tag genießen.
Ich fahre mit dem Zug nach Winterthur und steige dort in das Postauto nach Flaach, mit ein paar wenigen Leuten, die den Bus nach und nach zwischen Neftenbach und Buch am Irchel verlassen, als letzte steigt eine bildschöne junge schwarze Frau aus, von der ich mich frage, was sie wohl in Buch zu tun hat, ich entschließe mich zur Annahme, daß sie in ein Pflegeheim zur Arbeit geht. Ich bin der einzige, der bis nach Flaach fährt, und noch lieber wäre ich eine Haltestelle weiter gefahren, bis zur Rheinbrücke, aber die wird nur alle zwei Stunden bedient.
Ich eile also über den Feldweg einem Bach nach in Richtung Rhein, der Wegweiser gibt 35 Minuten an, ich gehe in meinem kleinen Ärger über diese Zwangsstrecke so schnell, daß ich in 20 Minuten auf der Brücke stehe, von der aus meine eigentliche Wanderung beginnt. Unter dem flinken Gezwitscher der ersten Grasmücken, die ich in diesem Jahr höre, betrete ich den Uferweg. Über einen Damm führt er, der den Fluß von einer Auenlandschaft trennt, aus der ab und zu die Rufe von Wasservögeln ertönen. Nun fällt die Hast von mir ab. Neben mir fließt nicht ein Fluß, sondern ein Strom, und er hat keine andere Aufgabe, als mit seinen Wassermassen der Schwerkraft zu folgen, die ihn gemächlich, aber unaufhaltsam nach Holland zieht. Er ist einverstanden damit, er muß sich nichts überlegen, manchmal überschwemmt er die Auen, aber zuletzt nimmt das Wasser immer denselben Weg.
Biber sind Nagetiere, und ihr Programm ist es, Bäume anzunagen, damit sie ihre Rinden abfressen und Burgen bauen können. Hier bin ich offenbar im Biberland, denn überall sind Bäume zu sehen, deren Stämme kurz oberhalb des Bodens angefressen sind, große Bäume zum Teil, Eichen und Eschen, einige sind umgestürzt, andere sind schon bedenklich dünn, sie wirken, als ob sie einen Balanceakt übten, und es ist nur noch eine Frage von wenigen Nächten, bis sie fallen. Wirkliche Biberburgen kann ich aber nicht erkennen, vielleicht bräuchte ich bloß jemanden, der sie mir zeigt.
Mit einer Fähre könnte ich nach Ellikon übersetzen, in die große Gartenwirtschaft, in der ich nur drei Ausflügler sehe, aber ich will auf dem Nordweg bleiben, der durch deutsches Gebiet führt. Eine sichtbare Grenze gibt es nicht, doch die zunehmende Zahl von alten Bunkern am Schweizer Ufer ist ein Zeichen, daß ich sie schon überschritten habe. Es sind Bühnenbilder aus dem letzten Jahrhundert, das Stück ist bei uns nicht mehr aktuell, und wir hoffen sehr, daß es nicht mehr neu inszeniert wird. Sein Regisseur ist zur Zeit ohnehin im Irak beschäftigt.
Nach einem kleinen Picknick auf der Bank eines Schiffshäuschens überquere ich den Rhein in Rheinau auf einem Fußgängersteg neben der alten Holzbrücke, die renoviert wird, und auf einmal stehe ich vor einer gewaltigen christlichen Architektur: auf einer Insel im Rhein erhebt sich eine Kirche mit zwei dicken Türmen, um die sich Klostergebäude scharen, auf dem Hügel davor steht eine Kapelle, wie als Warnung für die, welche die Kirche noch nicht sehen. Ich will einen Blick hineinwerfen, sehe aber, daß sie nur von 14 bis 16 Uhr geöffnet ist, ab April. Heute ist zwar der erste April, aber es ist erst 13 Uhr. Wichtiger ist mir im Moment jedoch, daß die Toilette schon geöffnet ist, und nach einem kurzen Besuch gehe ich erleichtert weiter, überschreite den Rhein abermals auf der Stauwehrbrücke und bin wieder in Deutschland. Vor 15 Jahren schlug ich Freunden aus der DDR, die zwar ein Visum für die Schweiz, aber nicht für die Bundesrepublik hatten, einen solchen Ausflug vor, aber sie getrauten sich nicht mitzukommen – ihre Erfahrung, daß Grenzen Grenzen sind, saß zu tief.
Oberhalb des Wehrs ist der Fluß zunächst ruhig wie ein See, aber als ich mich nach einer guten Stunde dem Rheinfall nähere, sehe ich ihn weiß hinter einem Ufervorsprung hervorzüngeln und höre ihn immer lauter werden, und schließlich erblicke ich sie ganz, diese riesige Stromschnelle, dieses tosende Durcheinander, in dem sich das Wasser auf verschiedensten Bahnen den kürzesten Weg nach unten sucht und durch verschiedenste Felsköpfe daran gehindert wird. Oft weiß ich angesichts von Sehenswürdigkeiten nicht recht, was machen, und so trinke ich in einem Selbstbedienungsrestaurant eine heiße Schokolade. Dann steige ich auf dem Fußweg neben dem Rheinfall hoch und fahre mit dem Zug von Neuhausen nach Schaffhausen, denn dort habe ich noch etwas vor.
Als ich vor fünf Jahren mit einem Kenner die Trinity College Library in Dublin besuchte und dort das Book of Kells bestaunte, eine reich ausgestaltete irische Evangelienhandschrift aus dem 9. Jahrhundert, sagte mir ebendieser Kenner,
© 2005 Luchterhand Literaturverlag, München in der Verlagsgruppe Random House GmbH Satz: Filmsatz Schröter, München
Alle Rechte vorbehalten.
eISBN 9783641080853
www.randomhouse.de
Leseprobe