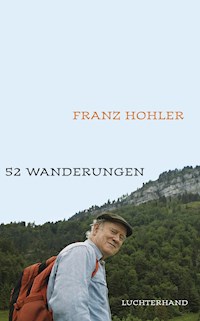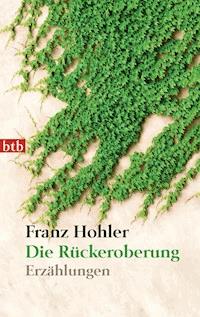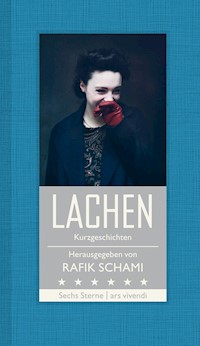Inhaltsverzeichnis
Buch
Autor
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Copyright
Buch
Als der HNO-Spezialist Manuel Ritter nach einem Ärztekongress gerade Platz in dem abfahrenden Zug genommen hat, klopft eine Frau gegen das Fenster seines Abteils. Einige Zeit danach steht diese Frau in seiner Praxis und möchte ein Kind von ihm haben. Obwohl ihn dieser Wunsch entrüstet - er ist glücklich verheiratet, glaubt er, und hat zwei Kinder - kann er der Fremden nicht widerstehen. Neun Monate später erhält er von ihr eine Karte mit der Zeile »Es hat geklappt«. Seither sieht er sein Leben mit einem empfindlichen Makel belastet, den er lange erfolgreich zu verdrängen versteht. Auch als sich ein Klopfgeräusch in seinem Gehör einstellt, möchte er am liebsten weiterleben, als sei nichts Gravierendes geschehen …
»Schwerlich kann man sich dem Sog dieses Textes entziehen …« Neue Zürcher Zeitung
Autor
Franz Hohler wurde 1943 in Biel, Schweiz, geboren, er lebt heute in Zürich und gilt als einer der bedeutendsten Erzähler seines Landes. Franz Hohler ist mit vielen Preisen ausgezeichnet worden, u. a. erhielt er 2002 den »Kassler Literaturpreis für grotesken Humor« und 2005 den »Kunstpreis der Stadt Zürich«.
1
Seit einer Stunde lag er im Bett und konnte nicht einschlafen. Auf dem Rücken nicht, auf dem Bauch nicht, auf der linken Seite nicht, und auf der rechten auch nicht. Das war ihm schon lange nicht mehr passiert. Er war neunundfünfzig, und gewöhnlich war er am Abend so müde, dass er, nachdem er im Bett noch ein paar Zeilen in einem Buch gelesen hatte, die Nachttischlampe löschte, der Frau an seiner Seite einen Gute-Nacht-Wunsch zumurmelte und nach wenigen Atemzügen einschlief. Erst wenn ihn seine Blase um zwei oder drei Uhr weckte, konnte es vorkommen, dass er den Schlaf nicht gleich wieder fand, dann stand er auf, nahm das Buch in die Hand und schlich sich leise aus dem gemeinsamen Schlafzimmer in seinen Arbeitsraum, bettete sich dort auf seine Couch und las so lange, bis ihm die Augen zufielen.
Er dachte an den morgigen Tag, es war ein Montag, das hieß, dass ihn eine volle Praxis erwartete. Um halb elf waren sie beide zu Bett gegangen, nun zeigten die Leuchtziffern seiner Uhr schon fast Mitternacht, und er sah seine Ruhezeit dahinschrumpfen, denn morgens um sechs würde mitleidlos der Wecker klingeln. Aufstehen und ins Arbeitszimmer wechseln, mit dem Buch in der Hand? Er fürchtete, dadurch seine Frau zu wecken, und er fürchtete ihre Frage, ob er nicht schlafen könne. Warum, würde sie dann fragen, warum kannst du nicht schlafen? Dann müsste er zu einer Notlüge greifen. Manchmal, wenn ihm ein Behandlungsfehler unterlaufen war oder wenn sich eine folgenschwere Komplikation eingestellt hatte, was zum Glück selten vorkam, stand der Patient nachts plötzlich vor ihm mit seinem ganzen Unglück und wollte ihn nicht in den Schlaf entlassen. Für solche Fälle hatte er ein Schächtelchen Rohypnol in seiner Hausapotheke, aber er hasste es, wenn er sich betäuben musste, und zudem war er mit der Dosierung nie ganz sicher. Nahm er eine ganze Tablette, schlief er zwar gut ein, hatte aber große Mühe mit dem Erwachen und musste noch lange in den Vormittag hinein mit der Wirkung kämpfen, nahm er nur eine halbe Tablette, reichte diese unter Umständen nicht zum Schlafen und gab ihm dennoch am nächsten Morgen ein dumpfes Gefühl. Es hing von der Schwere des Problems ab, ob er die ganze oder die halbe Pille schluckte.
Und heute handelte es sich um ein schweres Problem.
Schließlich stand er leise auf und ging ins Badezimmer. Er nahm seine Zahnbürste aus dem Glas, wusch es aus, füllte es mit Wasser und nahm eine Rohypnol-Tablette aus der Wandapotheke. Einen Moment lang betrachtete er sie, dann stieg er die Treppe hinauf in sein Arbeitszimmer, das Glas in der einen, die Tablette in der andern Hand. Im spärlichen Streulicht, das von draußen hereinfiel, ging er vorsichtig zum Schreibtisch, stellte das Glas ab, legte die Pille daneben und drückte den Schalter der Tischlampe.
Dann lehnte er sich zurück und dachte nach.
Wann genau war es gewesen? Vor 22 oder vor 23 Jahren? Er hatte es fast nicht begriffen damals, von sich selbst nicht begriffen. Nach und nach hatte er sich daran gewöhnt, dass es geschehen war; ändern konnte er es ohnehin nicht mehr, erzählt hatte er es niemandem, die fortschreitende Zeit schob es jeden Tag etwas stärker in den Hintergrund, und so hatte er es schließlich für verjährt gehalten. Heute war ihm auf einmal klar geworden, dass es eine Verjährung zwar in der Justiz geben mochte, niemals aber im Leben. Er mochte in mancher Hinsicht ein anderer gewesen sein seinerzeit, aber auf seiner Identitätskarte stand immer noch derselbe Name, Manuel Ritter, und diese seine Identität wurde jetzt aufgerufen. Er hatte anzutreten vor seiner eigenen Verantwortung, die hinter dem Gerichtspult saß und mit einem Hämmerchen auf den Tisch schlug, wenn er zu seiner Verteidigung ausholte.
Er atmete tief ein und öffnete die Schublade seines Schreibtischs. Das alles war so lange her, dass er nicht mehr genau wusste, wo er den Umschlag aufbewahrt hatte.
Er zog unter Dokumenten wie seinem Dienstbüchlein, seinem Impfausweis und seinen Arbeitszeugnissen die Kopien seiner Diplome als Arzt und als Facharzt hervor, deren Originale in seiner Praxis hingen, und legte alles auf den Schreibtisch. Als er ein Bündelchen Briefe in der Hand hielt, trat seine Frau ein und legte ihm die Hand auf die Schulter.
»Julia«, sagte er, »du hast mich erschreckt.« »Schau mal an«, sagte sie, »meine Briefe.« Sie fuhr ihm mit der Hand ganz leicht über die Haare. »Beschäftigt es dich, dass unser Sohn so verliebt ist?«
»Tatsächlich«, sagte er, »es ist … es ist irgendwie eigenartig, dass wir eine ganze Generation vorgerückt sind.«
Heute hatte ihr Sohn zum ersten Mal seine neue Freundin nach Hause gebracht, von der er ihnen schon eine Weile vorgeschwärmt hatte.
»Und«, fragte sie, »was hab ich dir geschrieben?«
Lächelnd schaute sie auf die Briefe mit ihrer Schrift und den Briefmarken mit dem spanischen König.
»Das wollte ich gerade … das möchte ich lieber alleine lesen«, sagte er.
Sie legte ihm die Hand wieder auf die Schulter.
»Hoffentlich kannst du dann noch schlafen«, sagte sie.
Er griff nach ihrer Hand.
»Hast du denn auch noch die Briefe von mir?« fragte er.
»Selbstverständlich«, sagte sie, »aber vielleicht schluckst du doch besser deine Pille. Gute Nacht, Lieber.« Sie beugte sich über ihn und küsste seinen Nacken.
Er lehnte sich zurück und hielt ihren Kopf mit beiden Händen.
»Gute Nacht, Julia«, sagte er.
Als sie sein Zimmer verlassen hatte, fühlte er sich so allein, wie als Kind, wenn seine Mutter die Tür hinter sich zugezogen hatte und er im Bett die Nacht erwartete.
Dann schluckte er die ganze Tablette und trank das Glas Wasser leer.
Es waren nicht die Briefe, die er gesucht hatte.
Es war etwas anderes. Es war das einzige Überbleibsel einer Geschichte, die ihm plötzlich wieder so lebhaft vor Augen stand, als sei sie gestern geschehen.
2
Am 5. Mai 1983 betrat Manuel Ritter auf dem Bahnhof Basel ein Erstklassabteil des Zuges nach Zürich. Sobald er zwei freie Sitze sah, stellte er sein Köfferchen auf den einen, zog seinen Regenmantel aus, hängte ihn an den Haken darüber und setzte sich dann, etwas keuchend. Er hatte sich verspätet, aber beim Betreten der Bahnhofshalle war ihm auf der großen Abfahrtstafel aufgefallen, dass der Zug, der eigentlich schon hätte weg sein müssen, doch noch nicht abgefahren war, und mit einem Laufschritt war er durch die Unterführung auf den Perron geeilt und eingestiegen.
Als sich der Wagen nun in Bewegung setzte, klopfte es von draußen an sein Fenster, und eine Frau blickte ihn an, eindringlich, fast hilfesuchend, machte noch ein paar Schritte in der Fahrtrichtung, dann war sie aus seinem Gesichtsfeld verschwunden.
Das ältere Paar auf der andern Seite des Mittelgangs schaute leicht verwundert herüber, Manuel zuckte lächelnd die Achseln und schüttelte den Kopf dazu.
Dann lehnte er sich zurück, und während sich der Zug über verschiedene Weichen schob, als müsse er sich seinen Weg aus der Stadt suchen, streckte ihm von einer Häuserwand ein Cowboy seine durchlöcherten Schuhe entgegen, mit denen er meilenweit für eine Zigarette gegangen war.
Schon wurde die Minibar hereingezogen, und ein fröhlicher Südländer rief »Café, Tee, Mineral!« durch den Wagen. Manuel konnte nicht widerstehen. Obwohl er heute sein Maß an Koffein schon konsumiert hatte, ließ er sich einen Kaffee einschenken. Er bereute es schon nach dem ersten Schluck, ließ eine Weile die ganze Hässlichkeit der Autobahnverschlingungen, Schallschutzwände und Bürohochhäuser an sich vorbeiziehen, öffnete dann sein Köfferchen und holte eine Mappe mit Unterlagen heraus. Er war Hals-, Nasen-, Ohrenarzt, hatte seit drei Jahren eine eigene Praxis und kam von einem Symposium über Tinnitus. Zwei englische Ärzte hatten am Vormittag über ihre Arbeit mit Elektrostimulation berichtet, und am Nachmittag waren neue Ergebnisse medikamentöser Therapien vorgestellt und diskutiert worden. Auf beiden Gebieten hatte er wenig Ermutigendes gehört. Er schaute noch einmal die Tabellen mit den Prozentzahlen an und nahm die Stimme des Kondukteurs erst wahr, als sich dieser zu ihm herunterbeugte. Während er seine entwertete Fahrkarte zurückerhielt, wurde an ihn offensichtlich noch eine Frage gerichtet, und auf sein »Bitte?« wurde die Frage wiederholt, nämlich ob er sich noch nie den Kauf eines Halbtaxabonnements überlegt habe. Manuel murmelte, er fahre fast nie Zug, worauf ihm der Kondukteur, ein junger Blonder mit einem Ringlein im linken Ohr, entgegnete, es genügten schon drei solcher Fahrten innerhalb eines Jahres, damit es sich rentiere, und er gebe ihm hier einen Prospekt.
Manuel nickte und las dann statt der Tabelle den Prospekt, der ihm nebst schönsten Landschaften auch alle möglichen Sonderaktionen und Städterabatte verhieß, auf die einzugehen er keinen Anlass sah. Er fuhr mit seiner Frau und den Kindern regelmäßig in eine Ferienwohnung im Engadin, das war sein Erholungsort im Sommer und im Winter, und wenn man eine Familie mit ihrer ganzen Winterausrüstung transportieren musste, war die Bahn für diese Reisen nicht geeignet. Gestern Abend hatte er seinen Wagen zum Service gebracht, deshalb hatte er heute nach Basel den Zug genommen, aber bei seiner Heimkehr würde das Auto bereits wieder vor seinem Haus stehen, auf seinen Garagisten war Verlass.
Als er erwachte, fuhr der Zug in Zürich ein. Rasch versorgte er die ungelesene Mappe in seinem Köfferchen, ließ den Halbtaxprospekt liegen, nahm seinen Mantel über den Arm, stieg aus und begab sich dann zum Gleis 11, auf dem die Züge vom rechten Ufer des Zürichsees ankamen und abfuhren. Obwohl er in Basel mit Verspätung abgereist war, erreichte er noch den Anschluss, den er seiner Frau für die Rückkehr angegeben hatte. Gerade kam der Zug an und entließ beachtliche Menschenmengen. Es ging gegen acht Uhr abends, die Stadt stieß ihren Lockruf aus, der bis weit in die Orte der Umgebung drang und Vergnügungen versprach, die es dort draußen in dieser Dichte nicht gab, Filme, Musik, Tanz, Frauen, unberechenbares Leben.
Der Drang zur Stadt hin war größer als der, sie zu verlassen, und der Wagen, den Manuel bestieg, war halb leer. Goldküstenexpress war der Scherzname des Zuges, der aus lauter roten Wagen bestand und nur am rechten Zürichseeufer verkehrte, welches als Wohnsitz des wohlhabenden Teils der Bevölkerung bekannt war. Als Manuel und Julia geheiratet hatten, lebten sie noch in einer Dreizimmerwohnung in Zürich, doch vor drei Jahren konnten sie ein Haus in Erlenbach beziehen und gehörten somit auch zur Goldküste, ob ihnen das passte oder nicht. Vor allem Julia hatte manchmal etwas Mühe damit. Manuel schaute zum Fenster hinaus auf den Bahnsteig.
Die Frau in Basel, was hatte sie von ihm gewollt? Hatte sie ihn gekannt? Die Situation, dass ihn jemand grüßte, den er selbst nicht kannte, war ihm nicht ganz neu, manchmal handelte es sich um ehemalige Patienten, die er bloß zweioder dreimal gesehen hatte, und heute während der Tagung hatte ihn eine Kollegin aus seiner ersten Assistenzzeit angesprochen, die sich erst wieder vorstellen musste, bis er wusste, wer sie war. Solche Begegnungen waren ihm peinlich, er wäre gern derjenige gewesen, der die andern mit seinem Gedächtnis in Verlegenheit gebracht hätte und in dessen Hirn die Menschen, mit denen er im Leben zu tun gehabt hatte, bereitsaßen wie in einem großen Wartezimmer, so dass er sie jederzeit mit ihrem Namen aufrufen konnte.
Den Gedanken, die Frau könnte bei der Tagung gewesen sein, verwarf er bald wieder, er konnte sich an kein solches Gesicht erinnern, und auch eine Patientin ihres Aussehens kam ihm nicht in den Sinn. Dunkle Haare hatte sie gehabt, reichlich, hinten irgendwie hinaufgebunden, und ein kleines rotes Band über den Fransen. Ihre Augen? Ebenfalls dunkel, zwischen braun und schwarz, und ihr Blick war nicht nur bittend, er war auch selbstbewusst, fordernd fast, als ob es um einen Notfall ginge. Aber woher sollte sie wissen, dass er Arzt war? Eine Engadinerin, die ihn aus den Ferien kannte? Das Phänomen, dass einem ein Mensch, den man immer nur hinter dem Ladentisch oder hinter einer Empfangstheke sah, seltsam fremd vorkam, wenn er einem in Freiheit begegnete, war ihm vertraut. Dennoch konnte er die Frau weder einem Geschäft noch einem Restaurant zuordnen. Wenn sie ihn jedoch ganz und gar nicht kannte, was wollte sie denn von ihm? War ihm vielleicht etwas heruntergefallen, als er durch den Bahnhof gerannt war? Doch er vermisste nichts, und sie hatte auch nichts in den Händen gehabt.
Hätte er irgendwie reagieren können? Um das Fenster zu öffnen, war er zu verblüfft gewesen, und für eine Betätigung der Notbremse war die Episode zu wenig dramatisch. Etwas daran gefiel ihm auch, es war wohl die Tatsache, dass eine durchaus anziehende Frau, ungefähr in seinem Alter, unbedingt etwas von ihm wollte. Wäre es umgekehrt gewesen, hätte die Frau im Zug gesessen und wäre er auf dem Bahnsteig gestanden und hätte an die Scheibe geklopft, wäre es das gewesen, was man eine Anmache nannte. War es möglich, dass diese Frau ihn anmachen wollte? Was gab das für einen Sinn, da doch der Zug schon fuhr? War es purer Übermut, oder war es Verzweiflung? Wurde sie verfolgt und suchte Hilfe? Sollte er gar die Polizei in Basel benachrichtigen? War sie manisch? Aus einer psychiatrischen Klinik davongelaufen? Oder hatte sie ihn einfach mit jemand anderem verwechselt?
Manuel erschrak, als es an die Scheibe klopfte. Seine Frau stand mit dem kleinen Thomas an der Hand auf dem Perron in Erlenbach, und mit ein paar Sätzen gelang es ihm gerade noch, die Tür zu erreichen und auszusteigen, bevor der Zug nach Herrliberg weiterfuhr.
»Julia«, sagte er lachend und küsste sie auf die Wange, »das war knapp.« Dann nahm er Thomas auf den Arm: »Und du bist auch gekommen, Thomi? Das ist aber lieb.«
»Miam schläft«, sagte Thomas.
»Woran hast du denn gedacht?« fragte Julia, »du warst ganz versunken.«
»An die Tagung«, sagte Manuel, »es war sehr interessant.«
3
Julia öffnete den Renault auf dem Bahnhofparkplatz; auf dem Rücksitz lag die einjährige Mirjam in einer Babytrage und schlief.
»Miam schläft«, sagte Thomas laut.
»Pssst«, sagte sein Vater und hielt einen Finger an die Lippen. Julia hob den Buben in sein Kindersitzchen und versuchte leise die Tür zu schließen, aber dennoch konnte sie einen kleinen Knall nicht vermeiden, der gerade stark genug war, Mirjam zu wecken. Die begann zu weinen.
»Miam wach«, sagte Thomas.
»Macht nichts«, sagte Manuel, der vorne eingestiegen war, lehnte sich über seinen Sitz nach hinten und sagte: »Mirjam, schau wer da ist! Miri, Miri, Miri!« Dazu bewegte er winkend seine Finger und zwinkerte ihr zu.
Aber Mirjam schaute nicht, wer da war, sondern beharrte weinend auf ihrem Unbehagen.
»Wir sind bald zu Hause!« rief die Mutter nach hinten und startete den Motor. Mirjam fuhr fort zu weinen.
»Miam still!« befahl ihr Thomas.
»Aber Thomas, so lass sie doch weinen, wenn sie will«, sagte Julia leicht gereizt und bat dann ihren Mann, der Kleinen den Nuggi zu geben, der bestimmt irgendwo in ihrer Trage war.
Manuel angelte mit seinem Arm über Julias Rücklehne nach hinten, ohne den Schnuller zu finden.
»Ich glaube, du musst anhalten«, sagte er.
»Ach nein«, sagte sie, »es dauert ja nicht lang.«
Mirjam krähte.
»Miam still sein!« kam es von hinten.
Manuel versuchte ein Machtwort: »Aber Thomas soll auch still sein.« Das war zuviel für diesen.
»Toma nicht still!« schrie er und begann nun ebenfalls zu weinen, trotzig und zwängelnd, und so fuhr der dunkelgrüne Wagen bergauf, mit wechselndem Motorengeräusch und stetigem Kindergeheul; Vernunft und Unvernunft waren gleichmäßig über die vier Wesen im fahrenden Gehäuse verteilt, die vernünftigen hatten beide ein Studium hinter sich und beschäftigten sich heute mit der Struktur des Innenohrs und den Lautverschiebungen vom Lateinischen zum Spanischen, und sie verstanden nicht, warum sich die unvernünftigen ausschließlich mit ihrem Missbehagen beschäftigten.
Langsam wurden sie von ihrem französischen Auto auf den schweizerischen Hügelzug hochgetragen, den der Linthgletscher vor zehntausend Jahren bei seinem Rückzug in die Berge als Seitenmoräne hatte liegen lassen und der heute übersät war mit Terrassensiedlungen, Villen und Einfamilienhäusern, über deren Zäune sich blühende Flieder-, Rhododendron- und Schneeballbüsche neigten und aus deren Gärten aufsteigende Grillräuchlein und das Brummen elektrischer Rasenmäher einen friedlichen Abend Anfang Mai verkündeten. Am frühen Morgen, als Manuel weggegangen war, hatte es noch geregnet, jetzt warfen gerade die letzten Sonnenstrahlen ihre überlangen Schatten auf Dächer, Bäume und Baugespanne, und alles lag wie frisch gereinigt da.
Um ihre Garageneinfahrt zu erreichen, musste man von einer ansteigenden Nebenstraße scharf links abbiegen und ein kurzes Stück steil hinunterfahren. Thomas und Mirjam, die immer noch unerlöst auf dem Rücksitz jammerten, würden sie später »das Höllentor« nennen.
Über der Einfahrt und über der bergseitigen Mauer verwehrte dichtes Busch- und Strauchwerk den Blick auf das Rittersche Wohnhaus.
Es war in den dreißiger Jahren so an den Hang gebaut worden, dass das unterste Geschoss nur die halbe Fläche der zwei oberen Etagen aufwies. Die Tiefgarage war erst später hinzugekommen, was zur Folge hatte, dass der abfallende Garten nun durch eine ebene begrünte Fläche unterbrochen wurde, die einmal ein beliebter Spielplatz der Kinder werden sollte.
Ein turmartiger Vorbau auf der einen Seite des Hauses mit Erkerfenstern in jedem Stock war ein Versuch des Architekten gewesen, den Verdacht auf Biederkeit abzuwenden. Der Balkon im zweiten Stock war etwas zu eng, ihm fehlte, und das ließ sich auch vom ganzen Haus sagen, ein Stück wirkliche Großzügigkeit. Julia hatte einmal gesagt, es sei wie ein Angestellter in einem etwas zu knappen Sonntagsanzug. Sie liebte solche Vergleiche.
Trotzdem, es bot genügend Platz für sie alle, und das hatte sie, als sie vor drei Jahren möglichst rasch etwas brauchten, überzeugt.
Sie hatten das Haus kurz nach der Geburt von Thomas gemietet, als ihnen die Wohnung in Zürich zu eng wurde. Die Besitzerin war ins Altersheim gezogen, und niemand von ihrer Familie wollte es bewohnen. Ihr älterer Sohn, der die
1. Auflage Genehmigte Taschenbuchausgabe Juli 2009, btb Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Copyright © 2007 by Luchterhand Literaturverlag, München,
einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH KS · Herstellung: SK
eISBN : 978-3-641-03978-3
www.btb-verlag.de
Leseprobe
www.randomhouse.de