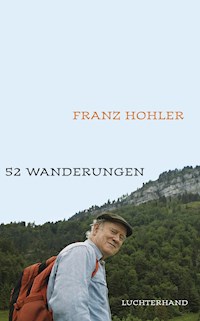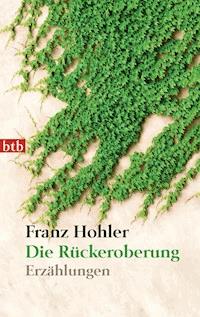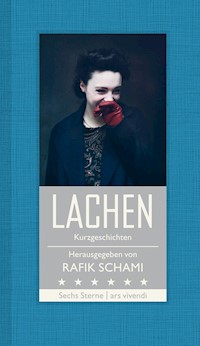9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Franz Hohler liebt es, in die Welt hinaus zu gehen. Bis an den Arabischen Golf und nach Teheran führen ihn seine Reisen. Aber manchmal genügen ihm auch kurze Wege in seine Nachbarschaft, um auf erstaunliche Geschichten zu stoßen. In diesem Band sind Franz Hohlers neueste Kurzerzählungen versammelt. Sie zeigen ihn einmal mehr als einen Autor, der leidenschaftlich gerne Geschichten erzählt.
Mit sicherem Gefühl für Pointen, mit leiser Ironie und einem wachsenden Gefühl für das Brüchige in der Welt erzählt er seine neuesten Geschichten. Da ist die Dichterin, die Kindern eine Geschichte über ein Feuer im Garten so lebhaft erzählt, dass ein kleiner dreijähriger Junge so sehr beeindruckt ist, dass er begeistert aufspringt und losläuft und gar nicht merkt, wie er dabei die eigentliche Geschichte versäumt. Da ist der Autor, der ausgerechnet auf einer Fahrt zu einer Lesung sein Buch vergessen hat mitzunehmen. Oder da ist der Erzähler, der merkwürdig einsilbig bleibt, als ihm ein Mann in der Nachbarschaft erklärt, bald würden sie hier die Fremden sein und die Einheimischen die Fremden von heute. Franz Hohler hat sich wie das Kind in der Geschichte vom »Feuer im Garten« die Gabe zum Staunen bewahrt. Er beobachtet die Welt um sich genau, und nicht selten verwundert ihn, was er sieht. Diese Momente des Staunens und der Verwunderung halten die hier versammelten neuen Erzählungen Franz Hohlers in der ihm eigenen, scheinbar beiläufigen Weise virtuos und fesselnd fest.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 119
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
FRANZ HOHLER
Ein Feuer im Garten
Luchterhand
Zum Buch
Mit sicherem Gefühl für Pointen, mit leiser Ironie und einem wachsenden Gefühl für das Brüchige in der Welt erzählt er seine neuesten Geschichten. Da ist die Dichterin, die Kindern eine Geschichte über ein Feuer im Garten so lebhaft erzählt, dass ein kleiner dreijähriger Junge begeistert aufspringt und losläuft und gar nicht merkt, wie er dabei die eigentliche Geschichte versäumt. Da ist der Autor, der ausgerechnet auf einer Fahrt zu einer Lesung vergessen hat, sein Buch mitzunehmen. Oder da ist der Erzähler, der merkwürdig einsilbig bleibt, als ihm ein Mann in der Nachbarschaft erklärt, bald würden sie hier die Fremden sein und die Einheimischen die Fremden von heute. Franz Hohler hat sich wie das Kind in der Geschichte vom »Feuer im Garten« die Gabe zum Staunen bewahrt. Er beobachtet die Welt um sich genau, und nicht selten verwundert ihn, was er sieht. Diese Momente des Staunens und der Verwunderung halten die hier versammelten neuen Erzählungen Franz Hohlers in der ihm eigenen, scheinbar beiläufigen Weise virtuos und fesselnd fest.
Zum Autor
Franz Hohler wurde 1943 in Biel, Schweiz, geboren, er lebt heute in Zürich und gilt als einer der bedeutendsten Erzähler seines Landes. Franz Hohler ist mit vielen Preisen ausgezeichnet worden, u. a. erhielt er 2002 den Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor, 2005 den Kunstpreis der Stadt Zürich, 2013 den Solothurner Literaturpreis, 2014 den Alice-Salomon-Preis und den Johann-Peter-Hebel-Preis. Sein Werk erscheint seit über vierzig Jahren im Luchterhand Verlag.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
© 2015 Luchterhand Literaturverlag, München
in der Verlagsgruppe Random House GmbH.
Umschlagmotiv: © shutterstock/Olga Kovalenko
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
Alle Rechte vorbehalten
ISBN 978-3-641-17726-3
www.luchterhand-literaturverlag.de
Ein Feuer im Garten
Im Halbkreis sitzen und liegen die Kinder auf Kissen um die Dichterin herum, und sie erzählt ihnen eine Geschichte, in der bald nach dem Anfang ein Kind nachts voller Angst ans Fenster rennt, weil es glaubt, es sei ein Feuer im Garten.
An dieser Stelle ruft ein Dreijähriger im Publikum laut: »Ein Feuer im Garten!«, steht begeistert auf und läuft weg, weg von der Erzählerin und den andern Kindern. Die Fortsetzung, welche erst die eigentliche Geschichte ist, die Fortsetzung braucht er nicht, denn man hat ihm soeben etwas Wichtiges mitgeteilt, etwas, das er sich vorstellen kann, etwas, das nun seinen ganzen Kopf und sein ganzes Herz, wahrscheinlich auch seine Beine und Arme ausfüllt, eine große, eine mächtige, eine wärmende Geschichte: ein Feuer im Garten.
Aufbruch
Beim Gang zum Bahnhof Oerlikon merke ich nach einem Griff in die Tasche, dass ich mein Mobiltelefon vergessen habe einzustecken.
Im Hauptbahnhof bleibt mir Zeit, eine heiße Schokolade zum Mitnehmen zu kaufen, eine »sehr« heiße, wie ich bei der Bestellung präzisiere. Als sie vor mir auf dem Tresen steht, versuche ich den weißen Deckel abzuklauben, um das Schokoladepulver, das separat auf dem Tablett liegt, in den Kartonbecher zu streuen und spüre plötzlich, dass das, was ich für den Deckel hielt, die sehr heiße Milch ist, in die ich mit dem Handballen gegriffen habe. Ich nehme mir eine Serviette, wische mir damit den Milchschaum ab, schütte das Pulver hinein, drücke dann den Deckel drauf, stecke das Rührstäbchen durch den Schlitz und gehe damit zum Gleis, an dem der Zug nach Brig schon bereitsteht.
Ich steige ein, setze mich, stelle die heiße Schokolade auf das Tischchen und nehme das Buch, aus dem ich heute Abend vortragen will, aus dem Rucksack. Da die Fahrt über zwei Stunden dauert, will ich unterwegs nochmals in aller Ruhe überlegen, welche Stellen aus meinem Roman ich wähle.
In der Hand halte ich aber zu meinem Erstaunen den Roman »Wald aus Glas« von Hansjörg Schertenleib, ein Buch, das ich gestern zu Ende gelesen habe. Es hat etwa dasselbe Format wie mein »Gleis 4«.
Im Abteil neben mir sucht eine Frau so lange ihr Handy, bis der Herr vis-à-vis sie fragt, ob er sie anrufen solle. Sie gibt ihm die Nummer, er tippt sie ein, und es klingelt aus den Tiefen ihrer Handtasche. Als sie sich bedankt, sagt er, gern geschehen, er habe Übung, seine Frau habe heute Morgen ihr Handy auch schon verlegt.
Trittsicher sehen wir aus, sind ausgerüstet für die tägliche Lebensexpedition und kämpfen doch ständig gegen unsere Auflösung.
Abschied
Heute war ich auf dem großen Friedhof in Zürich.
Ich habe Gottfried Keller gegrüßt, dessen »Sinngedicht« ich gerade lese, ihm gegenüber Walter Mehring, der mich als neugierige kleine Statuette gemustert hat. Ihn habe ich noch lebend gekannt, habe ihm sogar durch eine Fürsprache bei der Präsidialabteilung der Stadt eine Reise nach Berlin ermöglicht, damit er in einem dortigen Theater eine Revue mit seinen Texten besuchen konnte. Ich war bei Hugo Loetscher und Johanna Spyri, bei Alfred Polgar auch, der wie Mehring ebenfalls aus seinem amerikanischen Exil zurück nach Zürich kam, obwohl man ihn vor dem Krieg von hier ausgewiesen hatte.
Und auf einmal war ich bei den neuen Gräbern, wo eine Erdbestattung im Gange war. Vor einem weißen Sarg sprach ein junger Priester in einer langen weißen Soutane, die im Wind flatterte, ein Gebet, ein schwarz gekleideter Friedhofangestellter stand dabei, und zwischen ihnen saß auf einem Klappstuhl eine kleine alte Frau. Sie ganz allein war die Trauergemeinde. Als das Gebet gesprochen war, stand sie mühsam auf, nahm aus einer Schüssel, die der Pfarrer ihr darbot, ein Schäufelchen Erde und warf diese auf den Sarg. Eine einzige rote Rose lag darauf, während sich auf dem frischen Nachbargrab üppige Kränze und Blumen drängten. Dann drehte sie sich um, der Pfarrer steckte sein Gebetbuch in eine Mappe, hielt dann die Frau am einen Arm, der Friedhofmann hielt sie am andern, und langsam hinkte sie zur Fahrstraße, auf der sie ein Auto erwartete.
Als die drei bei mir vorbeikamen, zog ich meine Mütze und sagte zu ihr: »Ich kondoliere Ihnen«, und sie schaute mich bekümmert und wortlos durch ihre dicken Brillengläser an.
Später kam der Schwarzgekleidete zurück, drückte auf einen Hebel des Metallgestells, auf dem der Sarg lag, und langsam entrollten sich die Bänder, die ihn trugen, und versenkten ihn in der ausgehobenen Grube.
Ein kurzer Ruf genügte, und zwei Arbeiter in grünen Jacken kamen hergefahren, der eine mit einem kleinen Transportgefährt, auf den er das Gestell laden konnte, der andere mit einem Bagger, um das Grab zuzuschütten und den Sarg der Vergänglichkeit zu übergeben.
Von Zürich nach Zürich
Als ich, zwei Treppenstufen auf einmal nehmend, um 10.37 h das Perron erreiche, auf dem die S16 steht, piepsen ihre Türen und schließen sich, und sie setzt sich in Bewegung. Da mir 4 Minuten später die nächste Fahrt von Oerlikon zum Hauptbahnhof angeboten wird, ärgere ich mich nicht, sondern gehe gemächlich die Treppe hinunter und steige bei Gleis 1 wieder ans Tageslicht.
Pünktlich fährt die S14 ein, ich betrete den vordersten Wagen, gehe in den oberen Stock und lasse mich auf einem Längssitz nieder. Ich sitze gerne oben, es gibt auch einer kurzen Fahrt etwas Ferienhaftes. Mir gegenüber nimmt eine elegante Frau Platz, klappt ihr Handy auf und beginnt ein Telefongespräch in einer slawischen Sprache. Im Abteil hinter mir liest eine Frau mit getönter Brille den »Blick am Abend«, obwohl es Morgen ist. »Warum diese …?« heißt die Schlagzeile, doch was »diese« ist, verschwindet hinter einem Falz auf dem Oberschenkel der Leserin. Der Mann im andern Abteil tippt ein SMS in sein Mobilfunkgerät. Ein Dunkelhäutiger mit einem Zettel in der Hand hat sich in Fahrtrichtung neben einen andern Fahrgast gesetzt, es schien mir, dieser sei ein bisschen erschrocken, als er seinen Jackensaum etwas zu sich zog. Ein junger Mann mit ohrendeckenden Kopfhörern liest ein Buch, weiter hinten trinkt ein anderer junger Mann aus einer schwarzen Dose, die mit »ok« beschriftet ist. Von irgendwoher ist das Klappern einer Laptoptastatur zu hören. Die meisten Menschen benutzen die Zeit unterwegs, um sich mit der Welt außerhalb des Zuges zu verbinden, fast niemand sitzt einfach tatenlos da.
Im Tunnel wird auf dem Monitor Wipkingen angezeigt, zusammen mit den nächsten Bus-Verbindungen, die Nr. 33 nach Bahnhof Tiefenbrunnen komme ca. 3 Min. später, teilt mir die Schrift mit.
Eine Frau mit einem Sichtmäppchen und einem Buch im angewinkelten Arm steht schon an der Tür, als ich kurz vor der Ankunft im Hauptbahnhof herunterkomme. Nach der Einfahrt öffnen sich die Türflügel nicht gleich, ich drücke nochmals auf den grün getüpfelten Ring, der aussieht wie ein billiges Schmuckstück, und das befreiende, krampflösende Zischen ertönt.
Die Frau startet zu einem überraschend schnellen Laufschritt, ich hoffe das Beste für Buch und Mäppchen, zwei Männer zünden sich nach dem Aussteigen sofort eine Zigarette an, und der junge Mann mit den Ohrendeckeln schnippt im Takt zu einer unhörbaren Musik, die ihn beschwingt, beflügelt und antreibt, dem entgegen, was ihn in Zürich erwartet.
Die S-Bahn kann nicht aussteigen, sie wird in 24 Minuten wieder zurück aufs Land fahren.
Multikulti
Ich brauche eine neue Lesebrille, mit einer halben Dioptrie mehr als meine bisherige, und bin unterwegs zum Optiker.
An einem älteren Neubau in der Nähe des Marktplatzes ist ein Mann auf einer Bockleiter damit beschäftigt, ein Metallschild zu entfernen, indem er eine Doppelblattsäge darunterschiebt und es so von der Wand abzulösen versucht. Auf dem Schild steht »Kinderarztpraxis«. Ich bleibe stehen und frage den Mann, ob der Kinderarzt keinen Nachfolger habe. Nein, sagt der Mann, einen Nachfolger habe man nicht gefunden – Oerlikon sei wohl zu multikulti.
Er muss mein Erstaunen bemerkt haben, denn er steigt von der Leiter herunter und sagt mir, Zürich sei überhaupt extrem, auch in Albisrieden, wo er wohne, sei es schon schlimm. Wenn er sich dort in ein Café setze und sehe, dass er der einzige Schweizer sei, dann sei es für ihn gelaufen. Wir sind Fremde im eigenen Land, fährt er leise fort, indem er sein Gesicht näher zu meinem neigt. Als ich nicht gleich antworte, fügt er hinzu, aber die Schweizer sind ja selbst schuld, sie machen keine Kinder mehr – es sind die andern, welche die Kinder machen.
Und nun passiert mir etwas Eigenartiges: Ich weiß nicht, was ich sagen soll, obwohl ich das, was ich ihm sagen müsste, schon oft gesagt habe. Wer denn all unsere Häuser, Straßen und Tunnels baue, wer unsere Kanalisation entstopfe, unsere Züge reinige und unseren Abfall einsammle, wer wohl in seinem Café serviere, wer unsere Spitäler funktionsfähig erhalte und unsere Informationssysteme, wer uns beide denn nach unsern Schlaganfällen dereinst im Rollstuhl herumschieben werde und wie sinnvoll überhaupt in heutiger Zeit die Unterscheidung zwischen Menschen und Ausländern sei.
Aber diese Gedanken huschen wie Schatten durch eine Nebelwand, die in meinem Kopf aufgezogen ist, und keiner davon findet den Weg auf meine Zunge. Eigentlich wollte ich ja nur wissen, ob der Kinderarzt seine Praxis schließt und bin in eine Falle geraten. Einer hat mir seine Gefühlslage mitgeteilt, hat dazu eigens aufgehört, an einem Metallschild herumzusägen, und ich ahne, dass ich gegen diese Gefühle keine Chance habe, ich kenne sie sogar, denn auch ich sitze manchmal als einziger Einheimischer im Tram, und den Fremdling im eigenen Land, den mir der Mann zugeraunt hat, hat schon Hölderlin beschworen.