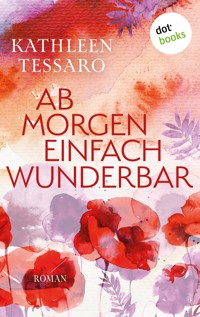
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wenn ein kleines Buch das ganze Leben verändert: Der Feelgood-Roman »Ab Morgen einfach wunderbar« von Kathleen Tessaro jetzt als eBook bei dotbooks. Wären wir nicht alle gerne selbstbewusst, elegant und mit der Anmut einer jungen Audrey Hepburn gesegnet? Leider findet Louise, dass sie das genaue Gegenteil ist, und das liegt nicht nur an ihrem alten Lieblingskleid mit dem Schnitt eines Kartoffelsacks … Doch dann entdeckt sie in einem Londoner Antiquariat durch Zufall ein schmales Bändchen, das alles auf den Kopf stellt – denn darin verrät die französische Stil-Ikone Madame Dariaux die Geheimnisse der perfekten Garderobe. Diese entpuppen sich bald als allerbeste Tipps für jede Lebenslage … und zu ihrer eigenen Überraschung merkt Louise, wie der neue Schwung ihren Alltagstrott immer mehr in ein charmantes Abenteuer verwandelt. Und wenn es eine Sache gibt, die wie das berühmte »kleine Schwarze« niemals aus der Mode kommt, dann ist es natürlich eine neue Liebe … »Hinreißend!«, jubelt die internationale Bestsellerautorin Marian Keyes über diesen Roman, über den die Zeitschrift GALA schrieb: »Charmante Lektüre mit einer liebenswerten Heldin. Herrlich zum Lachen und Mitfühlen.« Jetzt als eBook kaufen und genießen: Das mitreißende Lesevergnügen »Ab Morgen einfach wunderbar« von Kathleen Tessaro – auch bekannt unter dem Titel »Elégance« – wird alle Fans der Bestseller von Cecilia Ahern und Sofia Lundberg begeistern. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 452
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Wären wir nicht alle gerne selbstbewusst, elegant und mit der Anmut einer jungen Audrey Hepburn gesegnet? Leider findet Louise, dass sie das genaue Gegenteil ist, und das liegt nicht nur an ihrem alten Lieblingskleid mit dem Schnitt eines Kartoffelsacks … Doch dann entdeckt sie in einem Londoner Antiquariat durch Zufall ein schmales Bändchen, das alles auf den Kopf stellt – denn darin verrät die französische Stil-Ikone Madame Dariaux die Geheimnisse der perfekten Garderobe. Diese entpuppen sich bald als allerbeste Tipps für jede Lebenslage … und zu ihrer eigenen Überraschung merkt Louise, wie der neue Schwung ihren Alltagstrott immer mehr in ein charmantes Abenteuer verwandelt. Und wenn es eine Sache gibt, die wie das berühmte »kleine Schwarze« niemals aus der Mode kommt, dann ist es natürlich eine neue Liebe …
»Hinreißend!«, jubelt die internationale Bestsellerautorin Marian Keyes über diesen Roman, über den die Zeitschrift GALA schrieb: »Charmante Lektüre mit einer liebenswerten Heldin. Herrlich zum Lachen und Mitfühlen.«
Über die Autorin:
Kathleen Tessaro, geboren im amerikanischen Pittsburgh, studierte Schauspiel und Tanz, als sie im zweiten Jahr eigentlich nur für ein kurzes Austauschprogramm nach England ziehen wollte – und 23 Jahre blieb. In London entdeckte sie auch ihre Begeisterung für das Schreiben und landete mit ihrem Debütroman »Elégance«, der in Deutschland inzwischen unter dem Titel »Ab Morgen einfach wunderbar« vorliegt, den ersten von zahlreichen Bestsellern, die in viele Sprachen übersetzt wurden. Kathleen kehrte schließlich nach Pittsburgh zurück, wo sie mit ihrer Familie lebt.
Die Autorin im Internet: www.kathleentessaro.com
Bei dotbooks veröffentlichte Kathleen Tessaro ihre Romane »Ab Morgen einfach wunderbar – oder: Elégance«, »Die Schwestern von Endsleigh – oder: Debütantinnen«, »All die Liebe, die uns bleibt – oder: Für immer dein« und »Ein Sommerflirt in London«.
***
eBook-Neuausgabe November 2023
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 2003 unter dem Originaltitel »Elegance« bei HarperCollins, London. Die deutsche Erstausgabe erschien 2004 unter dem Titel »Elégance« bei Goldmann, München.
Copyright © der englischen Originalausgabe 2003 by Kathleen Tessaro
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2004 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ah)
ISBN 978-3-98690-706-8
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Ab morgen einfach wunderbar« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Kathleen Tessaro
Ab morgen einfach wunderbar
Roman
Aus dem Englischen von Karin Diemerling
dotbooks.
Für meinen geliebten Mann Jimmie und meine Freundin und Mentorin, Jill.
Kapitel 1:Danksagung
Vor einigen Jahren wollte es der glückliche Zufall, dass ich in einem Antiquariat auf ein außergewöhnliches Buch mit dem Titel »Elégance« von Genevieve Antoine Dariaux stieß. Jahre später, als ich beschloss, selbst ein Buch zu schreiben, wurde es zur wichtigsten Inspirationsquelle für diesen Roman.
Mit der freundlichen Erlaubnis der Autorin konnte ich eine Auswahl der Originalkapitel verwenden und habe sie an meine Geschichte angepasst. Der Stil jedoch und vor allem die ausgezeichneten Ratschläge gehen ganz auf Madame Antoine Dariaux zurück.
Ich möchte ihr meinen tiefen Dank für ihren Beitrag zu diesem Buch aussprechen und auch dafür, dass sie während der letzten zweieinhalb Jahre meine Muse und die Autorität für alle Fragen der Eleganz gewesen ist. Persönlich ist sie, das möchte ich an dieser Stelle betonen, noch liebenswürdiger und bezaubernder, als ihre klugen Worte und weisen Ratschläge erkennen lassen.
An einem eiskalten Februarabend stehen mein Mann und ich vor der National Portrait Gallery am Trafalgar Square.
»Da sind wir«, sagt er. Aber keiner von uns bewegt sich vorwärts.
»Hör mal«, versucht er zu verhandeln, »wenn es ganz furchtbar ist, gehen wir einfach wieder. Wir bleiben auf einen Drink und verschwinden dann. Wir können ja ein Codewort vereinbaren ‒ Kartoffel zum Beispiel. Wenn du gehen möchtest, baust du das Wort Kartoffel in einen Satz ein, dann weiß ich Bescheid. Okay?«
»Ich könnte dir auch einfach sagen, dass ich gehen möchte«, erwidere ich.
Er runzelt die Stirn. »Louise, ich weiß, dass du keine Lust dazu hast, aber du könntest wenigstens ein bisschen Entgegenkommen zeigen? Sie ist meine Mutter, Herrgott noch mal, und ich habe versprochen, dass wir kommen. Es passiert schließlich nicht jeden Tag, dass man Teil einer großen Fotoausstellung ist. Außerdem hat sie dich wirklich gern. Sie sagt ständig, dass wir drei uns mal wieder treffen sollten.«
Wir drei.
Ich seufze und starre auf meine Füße. Am liebsten würde ich es sofort sagen: Kartoffel. Kartoffel, Kartoffel, Kartoffel.
Ich weiß, es ist ein elendes Klischee, seine Schwiegermutter zu hassen, und ich verabscheue Klischees. Aber wenn die Schwiegermutter ein ehemaliges Mannequin aus den fünfziger Jahren ist und ein Talent dafür hat, einen bei jeder Begegnung wie einen kompletten Trottel dastehen zu lassen, kommt einem nur ein Wort in den Sinn. Und das Wort heißt Kartoffel.
Er legt den Arm um mich. »Das ist doch wirklich keine große Sache, Schäfchen.«
Ich wünschte, er würde mich nicht Schäfchen nennen.
Doch in jeder Ehe gibt es Dinge, die man sich eben gefallen lässt, wenn schon nicht aus Liebe, dann zumindest, um seine Ruhe zu haben. Außerdem haben wir Geld für ein Taxi ausgegeben, er hat sich rasiert, und ich trage das lange, graue Kleid, das ich normalerweise in einer Plastikhülle von der Reinigung aufbewahre. Es ist zu spät, um umzukehren.
Ich hebe den Kopf und zwinge mich zu einem Lächeln. »Also gut, gehen wir.« Wir passieren die beiden riesenhaften Sicherheitsbeamten und treten ein.
Ich lege meinen braunen Wollmantel ab und reiche ihn der Garderobenfrau, wobei ich diskret mit einer Hand über meinen Bauch streiche und eine deutliche Wölbung fühle. Zu viel Pasta heute Abend. Ein Trostessen. Essen, um mich zu trösten. Warum ausgerechnet heute Abend? Ich versuche, den Bauch einzuziehen, aber das ist zu anstrengend, also lasse ich es wieder sein.
Ich strecke meine Hand aus, und er nimmt sie, worauf wir zusammen die kühle, weiße Welt der Galerie des zwanzigsten Jahrhunderts betreten. Stimmengewirr schlägt uns entgegen, als wir über den hellen Marmorboden schreiten. Junge Männer und Frauen in gestärkten weißen Hemden tänzeln vorbei, Tabletts mit Champagner balancierend, und in einem Alkoven zupft ein Jazztrio den raffinierten Rhythmus von »Mackie Messer«.
Atmen, sage ich mir, immer schön durchatmen.
Und dann sehe ich sie, die Fotografien. Lange Reihen faszinierend schöner Schwarzweißporträts und Modeaufnahmen, eine Sammlung der Arbeiten des berühmten Fotografen Horst P. Horst aus den dreißiger bis zu den späten sechziger Jahren, sind an den klinisch weißen Wänden aufgehängt, glatt und silbrig schimmernd auf ihrem Hochglanzpapier. Makellose, unnahbare Gesichter blicken mich an, und ich sehne mich danach zu verweilen, mich in der Welt dieser Bilder zu verlieren.
Aber mein Mann fasst mich an der Schulter, schiebt mich weiter und winkt seiner Mutter zu, Mona, die in einer Gruppe modisch gekleideter älterer Damen an der Bar steht.
»Hallo!«, ruft er, plötzlich ganz angeregt und blendend gelaunt. Der müde, schweigsame Mann aus dem Taxi hat sich in einen charmanten Salonlöwen verwandelt.
Mona erspäht uns und winkt uns mit einer verhaltenen, geradezu königlichen Geste herbei. Wir zwängen uns seitlich durch die Menge und weichen dabei vollen Gläsern und brennenden Zigaretten aus. Als wir in ihre Reichweite kommen, setze ich eine Miene auf, die hoffentlich als Lächeln durchgeht.
Sie sieht immer noch phantastisch, geradezu übermenschlich gut aus. Ihre vollen, silbergrauen Haare sind zu einem kunstvollen Knoten hochgesteckt, der ihre hohen Wangenknochen betont und ihren Augen etwas Katzenhaftes verleiht. Sie hält sich absolut gerade, als hätte sie ihre gesamte Kindheit an ein Brett genagelt verbracht, und ihr schwarzer Hosenanzug verrät die lässige Eleganz der Schneiderkunst von Donna Karan. Die Frauen um sie herum sind alle aus demselben edlen Holz geschnitzt, und ich hege den Verdacht, dass wir es hier mit einer Zusammenkunft in die Jahre gekommener Models zu tun haben.
»Hallo, Liebling!« Mona hängt sich bei ihrem Sohn ein und küsst ihn auf beide Wangen. »Ich freue mich ja so, dass du kommen konntest.«
»Wir hätten das auf keinen Fall verpassen wollen, stimmt’s, Louise?«
»Auf keinen Fall!« Es kommt einen Tick zu eifrig heraus, um ehrlich zu klingen.
Sie begrüßt mich mit einem knappen Nicken und wendet sich dann wieder ihrem Sohn zu. »Was macht das Stück, Liebling? Du musst völlig erschöpft sein! Ich habe mich neulich mit Gerald und Rita getroffen, und sie sagten, du wärst der beste Constantine, den sie je gesehen hätten. Habe ich euch das schon erzählt?«, fragt sie in die Runde ihrer Freundinnen. »Mein Sohn spielt in Die Möwe im National Theatre mit! Falls ihr Karten wollt, braucht ihr es mir nur zu sagen.«
Er hebt abwehrend die Hände. »Es ist total ausverkauft. Ich kann leider gar nichts tun.«
Schon schiebt sich schmollend die Unterlippe vor. »Noch nicht einmal für mich?«
»Na ja«, gibt er nach, »ich kann es versuchen.«
Sie zündet sich eine Zigarette an. »Braver Junge. Oh, ich habe euch noch gar nicht vorgestellt. Das ist Carmen, sie ist die mit den Elefanten an der Wand dort hinten, und das ist Dorian, deren Rücken ihr von dem berühmten Korsett-Foto kennt, und Penny hier war das Gesicht von 1959, nicht wahr, meine Liebe?«
Wir lachen alle, und Penny seufzt wehmütig und zieht eine Schachtel Dunhill aus ihrer Handtasche. »Das waren noch Zeiten. Gibst du mir Feuer, Mona?«
Mona reicht ihr ein goldenes, graviertes Feuerzeug, während mein Mann sich laut räuspert. »Mum, du hast doch versprochen aufzuhören.«
»Ach, Schätzchen, das ist doch die einzige Möglichkeit, schlank zu bleiben, stimmt’s, Mädels?« Hinter einer dicken Qualmwolke nicken einhellig ihre Köpfe.
Dann passiert es ‒ ich bin entdeckt.
»Und das muss Ihre Frau sein!«, flötet Penny, ihre Aufmerksamkeit auf mich richtend. Sie breitet die Arme aus und schüttelt ungläubig den Kopf, sodass es für einen schrecklichen Moment so aussieht, als solle ich mich ihr an den Hals werfen. Ich schwanke unbeholfen und will gerade einen Schritt auf sie zu machen, als sie plötzlich verzückt wieder in sich zusammensinkt.
»Sie sind ja bezauuubernd!«, säuselt sie und sieht die anderen Bestätigung heischend an. »Ist sie nicht einfach bezauuubernd?«
Ich stehe da und grinse idiotisch, während sie mich anstarren.
Mein Mann kommt mir zur Hilfe. »Kann ich den Damen noch etwas zu trinken holen?« Er versucht, den Barkeeper auf sich aufmerksam zu machen.
»Ach, du bist ein Schatz!« Mona streicht ihm mit einer Hand glättend übers Haar. »Champagner für alle!«
»Und du?«, fragt er mich.
»Oh ja, Champagner, warum nicht.«
Mona nimmt Besitz ergreifend meinen Arm und drückt ihn auf diese entwaffnende Weise ‒ wie einst die beste Freundin, als man zehn war und das Herz dabei einen Sprung tat. Mein Herz tut auch jetzt einen Sprung bei dieser unerwarteten Zuneigungsbezeugung, und ich könnte mich dafür ohrfeigen. Schließlich kenne ich dieses Spiel und weiß, wie gefährlich es ist, sich von ihr umgarnen zu lassen, und sei es auch nur für eine Sekunde.
»So, Louise«, sagt sie mit ihrer erstaunlich kräftigen und tiefen Stimme, »nun erzähl mir mal, wie es dir geht. Ich will alles wissen.«
»Also…« Meine Gedanken rasen, und verzweifelt durchkämme ich mein Leben nach etwas Berichtenswertem. Die anderen Frauen sehen mich erwartungsvoll an. »Alles läuft gut, Mona… wirklich gut.«
»Und deine Eltern? Wie ist das Wetter in Pittsburgh? Louise stammt aus Pittsburgh«, verkündet sie etwas gedämpfter.
»Es geht ihnen gut, danke.«
Sie nickt. Ich fühle mich wie die Teilnehmerin an einer Nachmittagsquizshow, und wie jede gute Quizshowmoderatorin gibt mir Mona ein Stichwort, wenn ich nicht mehr weiterweiß.
»Arbeitest du eigentlich im Moment?«
Sie spricht mit dieser bestimmten Betonung vom Arbeiten, so wie alle Leute im Showbusiness, denn wenn man es mit dem Schauspielgeschäft zu tun hat, ist es schließlich ein himmelweiter Unterschied zwischen »arbeiten« und nur irgendeinem vorübergehenden Job nachgehen.
Ich weiß das sehr gut, aber ich weigere mich mitzuspielen.
»Ja, ich bin immer noch bei der Phoenix Theatre Company.«
»Ist es eine Bühnenrolle? Unsere Louise hält sich nämlich auch für eine kleine Schauspielerin«, fügt sie erklärend hinzu.
»Ich war ja auch Schauspielerin«, wehre ich mich. Jedes Mal gelingt es ihr, mich auflaufen zu lassen. Ich kann noch so sehr aufpassen, sie legt mich jedes Mal herein. »Ich meine, auch wenn ich schon einige Zeit nicht mehr auf der Bühne gestanden habe. Nein, es ist keine Bühnenrolle, ich arbeite im Foyer, an der Kasse.«
»Verstehe«, lächelt sie, als würde sie noch eine andere Bedeutung heraushören, die mir nicht bewusst ist. Dann stellt Dorian die gefürchtetste Frage von allen.
»Haben wir Sie denn schon in einer Rolle gesehen?«
»Na ja, ich habe natürlich den einen oder anderen Werbespot gemacht.« Ich versuche, gleichgültig zu klingen, und zucke mit den Achseln, wie um zu sagen: Wer hat das nicht?
»Tatsächlich?« Sie zieht eine Augenbraue hoch, spielt die Beeindruckte.
»Was denn für Werbespots?«
Mist.
»Also…« Ich denke fieberhaft nach. »Da war diese Lotteriekampagne von Reader’s Digest. In der könnten Sie mich gesehen haben.«
Sie sieht mich verständnislos an.
»Sie wissen schon, wo sie alle in einem Heißluftballon über England fliegen, Sekt trinken und nach den Gewinnern suchen. Ich war die auf der linken Seite, die die Karte hält und auf Luton zeigt.«
»Aha«, kommentiert sie höflich. »Klingt lustig.«
»Und nun arbeitest du also an der Kasse.« Mona zieht einen schönen, sauberen Schlussstrich unter das Ganze.
»Ja, ich habe zwar einige Eisen im Feuer, sozusagen, aber im Moment ist das mein Job.« Ich möchte meinen Arm jetzt unbedingt wieder haben.
Sie drückt ihn noch einmal leicht. »Es ist halt ein schwieriger Beruf, Darling. Gut, wenn man seine Grenzen kennt. Ich rate jungen Frauen immer, die Schauspielerei zu meiden wie die Pest. Tatsache ist nämlich, dass sie mehr Disziplin und Opferbereitschaft erfordert, als die meisten jungen Frauen heutzutage aufzubringen bereit sind. Hast du schon mein Foto gesehen?«
Keep smiling, sage ich mir. Immer schön lächeln, dann kommt sie nie darauf, dass du sie unter die Erde wünschst. »Nein, ich hatte noch keine Gelegenheit, mich umzusehen, wir sind ja gerade erst gekommen.«
»Hier, erlaube mir.« Sie zieht mich zu einem großen Porträt von ihr aus den fünfziger Jahren.
Sie ist unglaublich jung darauf, fast nicht wiederzuerkennen, abgesehen von den charakteristischen mandelförmigen Augen und den berühmten Wangenknochen, denen die Zeit nichts anhaben konnte. Sie steht mit dem Rücken an eine klassische Säule gelehnt, das Gesicht leicht zur Kamera gewandt, halb im Schatten, halb im Licht. Ihre hellen Haare fallen in apart frisierten Locken über ihre Schultern, und sie trägt ein schulterfreies Kleid aus eng anliegenden Schichten von fließendem Seidenchiffon. Die Unterschrift lautet »Vogue, 1956«.
»Was meinst du?«, fragt sie und beobachtet mich genau.
»Ich finde es wunderschön«, antworte ich ehrlich.
»Du hast Geschmack.« Sie lächelt.
Ein Pressefotograf erkennt sie und bittet sie, ein Foto machen zu dürfen.
»Tja, das ist wohl mein Schicksal«, lacht sie huldvoll, und ich mache mich schnell davon, während sie posiert.
Ich sehe mich in der Menschenmenge nach meinem Mann um. Endlich entdecke ich ihn, wie er lachend mit einer Gruppe von Leuten in einer Ecke steht. Er hat zwei Gläser Champagner in den Händen, und als ich auf ihn zugehe, blickt er in meine Richtung.
Ich lächle, worauf er etwas zu den Leuten sagt und mir entgegengeht, ehe ich mich dazugesellen kann.
»Wer sind die?«, frage ich, während er mir ein Glas reicht.
»Niemand Besonderes, nur Leute von einem dieser Theaterclubs. Sie haben mich in dem Stück gesehen.« Er führt mich zurück zu den Fotos. »Wie kommst du mit Mum klar?«
»Oh, gut«, lüge ich. »Ganz prima.« Ich drehe mich um, aber die Leute sind verschwunden, verschluckt von der hin und her wandernden Menge. »Wolltest du mich absichtlich nicht vorstellen?«
Er lacht und tätschelt meinen Hintern, was ich nicht ausstehen kann, zumal er es immer nur in der Öffentlichkeit zu tun scheint. »Aber nein, sei nicht so empfindlich. Offen gestanden fand ich sie ein bisschen, wie soll ich sagen, überschwänglich. Ich will doch nicht, dass sie meine charmante Frau langweilen.«
»Ach, wer mag das wohl sein?« Es kommt schärfer heraus als beabsichtigt.
Er tätschelt wieder meinen Hintern und geht nicht auf die Provokation ein.
Wir bleiben vor dem Bild einer rauchenden Frau stehen, deren Augen von der breiten Krempe ihres Hutes verborgen werden. In einer dunklen, verlassenen Straße steht sie wartend in einem Hauseingang. Die Aufnahme muss kurz nach dem zweiten Weltkrieg gemacht worden sein. Es liegt etwas Beunruhigendes in dem Gegensatz zwischen der in Trümmern liegenden Umgebung und der tadellosen Perfektion ihres maßgeschneiderten Kostüms.
»Also, das nenne ich Stil«, seufzt mein Mann.
Auf einmal ist mir furchtbar heiß, und ich fühle mich überwältigt von dem Gedränge, dem Zigarettenrauch und dem Lärm zu vieler und zu lebhafter Unterhaltungen. Mona winkt uns zu, aber ich lasse meinen Mann allein hinübergehen und bahne mir einen Weg in einen kleineren, weniger überfüllten Nebenraum. In der Mitte steht eine niedrige Holzbank. Ich setze mich und schließe die Augen.
Es ist dumm, so verkrampft zu sein, sage ich mir. In einer Stunde wird alles vorbei sein, Mona wird ihren glanzvollen Auftritt gehabt haben, und wir können uns beruhigt auf den Heimweg machen. Ich sollte mich entspannen. Den Abend genießen. Ich öffne die Augen und atme tief durch.
An den Wänden hängen lauter Porträtaufnahmen ‒ Picasso, Coco Chanel, Katherine Hepburn, Cary Grant ‒ Reihen um Reihen sorgfältig zurechtgemachter, berühmter Gesichter. Die Augen sind dunkler und durchdringender als normale Augen, die Nasen gerader und edler. Ich lasse mich in eine Art meditativen Zustand gleiten, wie verzaubert von dem Anblick eines solchen Übermaßes an Schönheit.
Dann entdecke ich das Porträt einer Frau, die ich nicht kenne, eine Frau mit glänzenden dunklen Haaren, die durch einen Mittelscheitel geteilt und in dichten Locken um ihr Gesicht gelegt sind. Ihre Züge sind klar und sehr eigen: hohe Wangenknochen, der Mund wie ein Amorbogen geformt, die dunklen Augen strahlend vor Intelligenz. Sie sitzt etwas nach vorn gebeugt, hat eine Wange in die Hand geschmiegt und macht den Eindruck, als würden wir sie gerade beim interessantesten Gespräch ihres Lebens überraschen. Sie hat ein schlichtes, diagonal geschnittenes Etuikleid aus hellen Satinstoff an, der sich schimmernd von dem stumpfen Material des Sitzpolsters abhebt, und ihr einziger Schmuck ist eine einreihige Kette aus ebenmäßigen Perlen. Ihr Gesicht ist nicht das berühmteste im Raum und auch nicht das attraktivste, aber aus irgendeinem Grund zweifellos das faszinierendste. Ich stehe auf und stelle mich davor. Die Bildunterschrift lautete: »Genevieve Dariaux, Paris 1934.«
Leider bleibe ich nicht lange allein. »Da sind Sie ja! Mona hat uns ausgeschickt, Sie zu suchen.« Penny kommt am Arm meines wenig entzückten Gatten hereingeschlendert.
Ruhig bleiben, rede ich mir gut zu und trinke einen dringend benötigten Schluck Champagner. »Hallo Penny, ich sehe mir nur die Ausstellung an.«
Sie beugt sich vor und droht mir spielerisch mit dem Finger.
»Sie sind sehr unartig, Louise, wissen Sie das, sehr, sehr unartig!« Dann zwinkert sie meinem Mann zu. »Ich verstehe nicht, wie Sie Ihre Frau Alkohol trinken lassen können. Bei Ihnen ist ja einer schlimmer als der andere!«
Mein Mann und ich wechseln ratlose Blicke. Wovon redet sie?
Penny lehnt sich noch weiter vor und senkt die Stimme zu einem Bühnenflüstern. »Ich muss sagen, Sie sehen toll aus. Und das hier«, fährt sie fort und reibt den Stoff meines Kleides prüfend zwischen Zeigefinger und Daumen, »ist gar nicht so schlecht. Die meisten dieser Kleider wirken ja wie unförmige Zelte, aber dieses finde ich wirklich ganz niedlich. Bei meiner Tochter ist es im Juni so weit, und sie sucht verzweifelt nach etwas wie diesem, in dem sie einfach herumschlurfen kann.«
Ich merke, wie mir das Blut aus dem Gesicht weicht.
Sie strahlt uns beide an. »Sie müssen ja sooo glücklich sein.«
Ich schlucke schwer. »Ich bin nicht schwanger.«
Verwirrt runzelt sie die Stirn. »Wie bitte?«
»Ich bin nicht schwanger«, wiederhole ich lauter.
Mein Mann lacht nervös. »Sie werden die Erste sein, die davon erfährt, das verspreche ich Ihnen.«
»Nein, ich denke, das werde ich sein«, sage ich, worauf er wieder lacht, beinahe schon hysterisch.
Penny glotzt mich immer noch verwundert an. »Aber dieses Kleid… es tut mir Leid, aber es ist so …«
Ich wende mich an meinen Mann. »Schatz?«
Er scheint etwas sehr Faszinierendes auf dem Fußboden entdeckt zu haben. »Hm?«
»Kartoffel.«
Keine Ahnung, was ich von ihm erwartet habe, vielleicht, dass er mich verteidigt oder zumindest einen solidarischen Gesichtsausdruck herzeigt. Aber er starrt einfach nur weiter auf seine Schuhe.
»Okay.«
Ich drehe mich um und gehe. Es ist, als stünde ich neben mir, wäre nicht länger Herrin meines Körpers, aber irgendwie schaffe ich es bis in die Sicherheit der Damentoilette. Zwei junge Frauen frischen gerade ihr Make-up auf, als ich hereinkomme, also marschiere ich direkt auf eine freie Kabine zu und verriegele die Tür. Ich lehne mich mit dem Rücken an die kühle Metalltür und schließe die Augen. An Demütigung ist noch niemand gestorben, sage ich mir. Sonst wäre ich schon seit Jahren tot.
Endlich verschwinden die beiden. Ich schließe die Tür auf und stelle mich vor den Spiegel. Wie jede normale Frau sehe ich jeden Tag in den Spiegel, beim Zähneputzen, wenn ich mir das Gesicht wasche oder die Haare kämme. Allerdings neige ich dazu, mich nur ausschnittsweise zu betrachten, und vermeide es, die einzelnen Teile zusammenzufügen. Ich weiß nicht genau warum, es kommt mir nur irgendwie sicherer vor.
Doch an diesem Abend zwinge ich mich, das Gesamtbild wahrzunehmen, und auf einmal stelle ich fest, wie die Stückchen und Teile sich zu einer Person zusammensetzen, die mir nicht vertraut ist und die ich nie sein wollte.
Meine Haare brauchen einen neuen Schnitt, und ich sollte sie unbedingt färben, um die vorzeitig grau gewordenen Strähnen loszuwerden. Sehr fein und aschblond liegen sie kraftlos um meinen Kopf und werden von einer falschen Schildpattspange streng zur Seite gehalten. Mein von Natur aus blasses Gesicht ist unnatürlich weiß. Nicht elfenbein- oder alabasterfarben, sondern eher vollkommen farblos wie bei einem Tiefseegeschöpf, das noch nie der Sonne begegnet ist. Vor diesem Hintergrund wirkt der knallrote Lippenstift, den ich in dem Versuch aufgetragen habe, mondän auszusehen, einfach nur grell und macht meinen Mund zu groß, eine klaffende Wunde im unteren Drittel meines Gesichts. Die Wärme der Menschenmenge hat mich zum Schwitzen gebracht, sodass Nase und Wangen glänzen und gerötet sind, aber ich habe keinen Puder dabei.
Mein Lieblingskleid hat trotz der Reinigung jegliche Form verloren und, wo wir nun schon mal ehrlich sind, selbst der ursprüngliche, sackartige Schnitt war vielleicht vor fünf Jahren einmal Mode, ist jetzt aber eindeutig passe. Ich weiß noch, wie sexy und selbstbewusst ich mich darin fühlte, als es die Konturen meines Körpers weich umfloss und eine nymphenartige Sinnlichkeit andeutete. Doch jetzt, da ich zehn Pfund mehr wiege, ist die Wirkung nicht mehr dieselbe. Zu allem Überfluss lassen die flachen, praktischen Spangenschuhe mit Klettverschluss meine Knöchel aussehen wie zwei kräftige Baumstämme. Es sind abgestoßene Treter für jeden Tag, mindestens zwei Jahre alt und viel zu ausgelatscht, um noch außerhalb der Wohnung getragen zu werden.
Gezwungenermaßen muss ich eingestehen, dass mein ganzes Erscheinungsbild tatsächlich »schwanger« schreit. Oder genauer gesagt: »Besser geht’s nicht unter diesen anderen Umständen.«
Entsetzt starre ich mein Spiegelbild an. Nein, das bin ich nicht wirklich, das ist alles nur ein schrecklicher Irrtum, ein Bermudadreieck aus Frisurenkatastrophe plus Kleiderkatastrophe plus Hässliche-Hippieschuhe-Katastrophe. Ich muss mich beruhigen und wieder zu mir selbst finden.
Ich probiere etwas aus.
»Hallo, ich heiße Louise Canova. Ich bin zweiunddreißig Jahre alt und nicht schwanger.«
In der leeren Toilette hallt meine Stimme wider.
Es funktioniert nicht. Mein Herz rast, und ich gerate in Panik. Also mache ich die Augen zu und befehle mir, mich zu konzentrieren und positive Gedanken herbeizurufen, doch stattdessen überschwemmen tausend schimmernde Gesichter in Schwarzweiß meinen Kopf. Es ist, als gehörte ich noch nicht einmal derselben Spezies an.
Plötzlich geht die Tür hinter mir auf, und Mona kommt herein.
Dreifach verfluchte Kartoffel.
Sie lehnt sich divenhaft gegen das Waschbecken. »Louise, ich habe gerade gehört, was passiert ist. Sie hat es bestimmt nicht so gemeint, und außerdem ist sie blind wie eine Fledermaus.«
Warum muss er ihr immer gleich alles petzen? »Danke Mona, nett von dir.«
»Aber wenn du möchtest« ‒ sie stellt sich hinter mich und streicht meine Haare mit zwei sorgfältig manikürten Fingern aus meinem Gesicht ‒, »kann ich dir meinen Frisör empfehlen, er hat ausgesprochen akzeptable Preise.«
Mein Mann wartet auf mich, als ich herauskomme. Er reicht mir meinen Mantel, und dann verlassen wir schweigend die Party und finden uns an derselben Stelle am Trafalgar Square wieder wie vor noch nicht einmal einer halben Stunde. Während er sich nach einem Taxi umsieht, holt er ein Päckchen Zigaretten aus der Tasche und zündet sich eine an.
»Was machst du da?«, frage ich.
»Rauchen«, sagt er. Mein Mann raucht nicht.
Ich sage nichts weiter.
Das gelbe Licht eines Taxis kommt aus der Ferne auf uns zugerauscht, und ich winke wie wild. Es ist inzwischen sehr neblig geworden. Das Taxi hält, und wir steigen ein. Mein Mann lässt sich schwer gegen den Rücksitz fallen und beugt sich dann wieder vor, um das Fenster herunterzukurbeln.
Auf einmal will ich ihn zum Lachen bringen, will ihn in die Arme nehmen oder vielmehr von ihm in die Arme genommen werden. Was zählt es schon, wie ich aussehe oder was andere von mir denken. Er liebt mich noch immer. Ich strecke meine Hand aus und lege sie auf die seine.
»Liebling? Findest du… findest du wirklich, dass ich okay aussehe?«
Er nimmt meine Hand und drückt sie. »Hör zu, Schäfchen, du siehst ganz prima aus. So, wie du immer aussiehst. Hör nicht auf sie. Sie ist wahrscheinlich bloß neidisch, weil du jung und verheiratet bist.«
»Ja«, stimme ich mit hohl klingender Stimme zu, obwohl das jetzt nicht gerade die Flut von Komplimenten war, auf die ich gehofft hatte.
Er drückt wieder meine Hand und küsst mich auf die Stirn. »Außerdem weißt du doch, dass ich mir aus diesem ganzen Blödsinn nichts mache.«
Das Taxi rast durch die Dunkelheit, und als ich dort sitze und mir der kalte Wind ins Gesicht bläst, kommt mir ein überraschender Gedanke.
Aber ich. Ich mache mir was draus.
Was ist Eleganz?
Eleganz ist eine Form von Harmonie, die der Schönheit gleicht, mit dem Unterschied, dass Letztere ein Geschenk der Natur ist und Erstere ein Ergebnis der Kunst. Wenn Sie mir gestatten, ein so hochtrabendes Wort für eine solch geringe Kunst zu verwenden, möchte ich sagen, dass es meine Mission im Leben ist, unscheinbare Frauen in elegante Damen zu verwandeln.
Genevieve Antoine Dariaux
Ein schmales graues Bändchen mit dem Titel Elégance steht eingezwängt zwischen einem dicken, offensichtlich unberührten Buch über die französische Monarchie und einer eselsohrigen Taschenbuchausgabe von D. H. Lawrences Liebende Frauen. Größer und dünner als die anderen Bücher im Regal, erhebt es sich mit herablassender Autorität über seine bescheidene Umgebung, und die geprägten Buchstaben seines Titels glänzen auf dem silbrigen Satineinband wie Goldmünzen unter der Wasseroberfläche eines munteren Bächleins.
Mein Mann behauptet, ich sei krankhaft besessen von Antiquariaten und würde überhaupt zu viel Zeit mit Tagträumereien verbringen. Aber entweder hat man Verständnis für die Lust, in eng gestellten Reihen staubiger Regale nach verborgenen Schätzen zu suchen, oder man hat es eben nicht. Es ist eine unerklärliche Leidenschaft, die an eine Art Geisteskrankheit grenzt.
Jedenfalls sind Antiquariate nichts für schwache Gemüter. Dort herrscht Chaos, sie sind launisch und frustrierend und werden von eigenen Naturgesetzen regiert, an denen, wie an der Schwerkraft, im Grunde nicht zu rütteln ist. Taschenbuchausgaben der Werke von D. H. Lawrence machen meiner Schätzung nach nicht weniger als 55 Prozent des Bestands in jedem Laden aus. Das antiquarische Naturgesetz diktiert außerdem, dass die übrigen 45 Prozent mindestens zwei Regalreihen literaturwissenschaftlicher Abhandlungen über Paradise Lost umfassen und dass es einen Kellerraum gibt, der ganz der Militärgeschichte gewidmet ist und immer von einem Mann um die siebzig heimgesucht wird. (Persönliche Studien haben ergeben, dass es sich stets um denselben Mann handelt. Egal, wie schnell man sich auch von einer Buchhandlung zur nächsten bewegt, er ist immer schon da. Er hat etwas über den Krieg vergessen, das in keinem Buch steht, ist aber wie eine Gestalt aus der griechischen Mythologie dazu verdammt, von Keller zu Keller zu wandern und gedruckte Erinnerungen an die besten oder schlimmsten Tage seines Lebens durchzusehen.)
Moderne Buchhandlungen können mit diesen exzentrischen Eigenschaften nicht konkurrieren. Sie haben feste Öffnungszeiten und Zentralheizung, und das Personal besteht aus milchgesichtigen jungen Leuten in schwarzen T-Shirts. Es mangelt ihnen an Kellerräumen und gefallenen griechischen Helden in muffigen Tweedanzügen. Man findet dort weder Hunde und Katzen, die wie Hausgeister neben altertümlichen Heizöfen liegen, noch den berauschenden Geruch von Moder und Schimmel, bei dem ungeklärt ist, ob er eher von den unordentlichen Bücherstapeln oder vom Inhaber selbst ausgeht. Einen Laden der Waterstone’s-Kette betritt man als einfacher Kunde; Antiquariate jedoch sind wahre Pilgerstätten, und die Auskunft »vergriffen« ist der Ruf zu den Waffen für all jene, die nach dem Heiligen Gral aus Papier und Druckerschwärze suchen.
Ich greife hinauf und ziehe das Buch vorsichtig aus dem Regal. Dann setze ich mich auf einen Stapel Militärgeschichte (die Bücher neigen dazu, wegzurutschen, wenn man nicht aufpasst) und schlage die Titelseite auf.
Elégance
Von Genevieve Antoine Dariaux
verkündet sie in schnörkeliger Schrift, und darunter:
Ein umfassender Ratgeber für Frauen, die bei jeder Gelegenheit gut und passend gekleidet sein wollen.
Dariaux ‒ den Namen kenne ich doch! Könnte es sich um dieselbe Frau handeln wie auf dem Foto? Als ich das Buch durchblättere, steigt ein schwacher Duft nach Jasminparfüm von seinen vergilbten Seiten auf. Es ist 1964 erschienen und scheint eine Art Nachschlagewerk zu sein, das alphabetisch geordnete Kapitel über jede Art von Modeproblem enthält. So etwas habe ich noch nie gesehen. Auf der Suche nach einem Bild der Autorin blättere ich weiter, und auf dem Umschlagrücken werde ich schließlich fündig.
Auf dem Foto ist sie etwa Ende fünfzig, hat klassische, ebenmäßige Gesichtszüge und dick mit Haarspray überzogene weiße Haare ‒ eine Margaret-Thatcher-Frisur, noch bevor diese zu ihrer komischen Berühmtheit gelangte. Aber es sind dieselben schwarzen, intelligenten Augen, die mich anblicken. Ich erkenne den charakteristischen, gebieterischen Zug um den Mund wieder; und da, schimmernd über der eng anliegenden schwarzen Strickjacke, die sie trägt, ist auch ihr Markenzeichen, die perfekte, einreihige Perlenkette. Madame Georges Antoine Dariaux lautet die Bildunterschrift. Allerdings blickt sie nicht mit der betörenden Offenheit des früheren Porträts direkt in die Kamera, sondern eher darüber hinaus, als fände sie es zu unhöflich, den Betrachter herausfordernd anzusehen. Da sie nun älter ist, zeigt sie mehr Diskretion, denn die ist schließlich ein Eckpfeiler der Eleganz. Neugierig blättere ich zurück zum Vorwort.
Eleganz ist selten geworden in unserer modernen Welt, vor allem weil sie Genauigkeit, Liebe zum Detail und die sorgfältige Entwicklung eines feinen Geschmacks in allen Fragen von Benehmen und Stil erfordert. Kurzum, wahre Eleganz fällt den meisten Frauen nicht leicht, und daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern.
In meiner dreißigjährigen Laufbahn als Directrice des Modesalons Nina Ricci in Paris habe ich mein Leben der Beratung unserer Kundinnen gewidmet und helfe ihnen, das auszuwählen, was ihnen am besten steht. Manche davon sind exquisit schöne Frauen und haben meine Hilfe im Grunde nicht nötig. Ich betrachte und bewundere sie, wie man ein Kunstwerk bewundert, aber es sind nicht diese Kundinnen, die mir am meisten am Herzen liegen. Nein, am liebsten habe ich die, die weder über die nötige Zeit noch die Erfahrung verfügen, um die Kunst des Gutangezogenseins zu beherrschen. Diese Frauen sind es, für die ich mein Wissen einsetze und meine Phantasie anstrenge.
Nun, liebe Leserin, hätten Sie Lust, sich von mir an die Hand nehmen zu lassen? Wenn Sie mir ein wenig Vertrauen schenken, kann ich Ihnen einige praktische Ratschläge geben, wie Sie das Beste aus sich machen ‒ nämlich durch Eleganz, Ihre eigene, persönliche Eleganz.
Endlich habe ich meinen Heiligen Gral gefunden.
Obwohl es erst vier Uhr nachmittags ist, dämmert es schon, als ich die Buchhandlung verlasse. Ich schlängele mich durch die Straßen, gehe die Bell Street entlang, über Marble Arch und durch St. James’s bis nach Westminster, wobei ich die ganze Zeit mein magisches Päckchen an mich gedrückt halte.
Big Ben läutet im Hintergrund, als ich die Haustür aufstoße und vom Lärm des Staubsaugers begrüßt werde.
Mein Mann ist zu Hause.
Irgendetwas an der ermüdenden Unaufhörlichkeit von Hausarbeit scheint ihn stets aufs Neue herauszufordern. (Leute, die ihn nur als aufsteigenden Stern der Londoner Theaterszene kennen, wissen nichts von diesen noch viel erstaunlicheren Talenten.) Jeden Tag sieht man ihn tapfer und mit frischer Entschlossenheit gegen Feindesheere aus Schmutz, Staub, Unordnung und Verfall ankämpfen. Genial, wie er ist, kann er jedes Chaos in eine saubere, bewohnbare Umgebung verwandeln, und das gewöhnlich in weniger als einer halben Stunde.
Er hört mich nicht, als ich hereinkomme, also stecke ich den Kopf ins Wohnzimmer, wo er energisch den Staubsauger über das Parkett schiebt (er behauptet, sehen zu können, wie sich der Staub darauf ansammelt, so bemerkenswert sensibel ist er in diesen Dingen), und rufe: »Hallo!«
Er schaltet das Gerät aus und stützt die Arme mit der männlichen Lässigkeit eines Fernsehcowboys, der sich an einen Zaun lehnt, auf das Rohr. Der Mann ist in seinem Element: Er bringt die Welt in Ordnung.
»Selber hallo. Was hast du getrieben?«
»Ach, nichts Besonderes«, schwindele ich und verstecke die braune Papiertüte hinter meinem Rücken. Angesichts seines pausenlosen Programms zur Heimverschönerung kommt es mir wie Verrat vor, einen Nachmittag mit dem Herumstöbern in alten Buchläden zu vertrödeln.
»Hast du den Lampenschirm zurückgebracht?«
»Äh, ja. Aber ich konnte keinen besseren finden, also haben sie mir einen Gutschein gegeben.«
Er seufzt, und betrübt sehen wir beide zu der Lampe aus hellem Marmor hin, die Mona uns vor einem Monat geschenkt hat.
In jeder Ehe gibt es bestimmte, starke Bindungen. Viel bedeutender als das Ehegelöbnis, sind es diese im Alltag wirkenden, ungenannten Kräfte, die eine Ehe zusammenhalten, Tag ein, Tag aus, Jahr für Jahr, durch endlose Prüfungen und Widrigkeiten hindurch. Bei manchen Paaren ist es das Streben nach gesellschaftlichem Aufstieg, bei anderen sind es die Kinder. In unserem Fall genügt die Suche nach dem idealen Lampenschirm.
Meinen Mann und mich verbindet die totale, unablässige Hingabe an die Einrichtung und Verschönerung unseres Heims, und diese Lampe ist der straffällig gewordene, drogensüchtige Teenager, der unseren häuslichen Frieden zu stören droht, indem er sich weigert, mit einem fertigen Lampenschirm aus einem Geschäft mit bezahlbaren Preisen zusammenzupassen. Das Ding ist furchtbar schwer, man kann es kaum anheben, geschweige denn durch London schleppen. Also sind wir zu einem sisyphusartigen Schicksal verdammt und müssen bis in alle Ewigkeit Lampenschirme kaufen, die wir am nächsten Tag zurücktragen.
Mein Mann schüttelt den Kopf. »Wir werden zu Harrods gehen müssen«, sagt er ernst.
Harrods ist immer die letzte Möglichkeit. Doch dort wird es keine »bezahlbaren« Lampenschirme geben.
»Aber weißt du was?«, fügt er hinzu, während seine Miene sich aufhellt. »Wir können zusammen hingehen und einen Ausflug daraus machen, wenn du möchtest.«
»Klar«, sage ich lächelnd.
Der Lampenschirm-Tag ‒ er wird sicher so toll werden wie der große Gartenspalier-Ausflug und der Nachmittag der Duschwanne. »Da muss ich doch dabei sein.«
»Prima.« Er reißt eines der Fenster auf und atmet genießerisch einen Schwall kühler Luft ein. »Es wird dich freuen zu hören, dass ich hier zu Hause deutlich mehr Erfolg hatte als du in der Stadt.«
»Tatsächlich?«
»Du weißt doch, dass die Tauben sich ständig in der Dachrinne über dem Schlafzimmerfenster niederlassen?«
»Ja…«, schwindele ich.
»Also, ich habe Stacheldraht um die Rinne gewickelt, und jetzt sind wir sie los!«
Ich versuche immer noch, mich an diese Tauben zu erinnern. »Gut gemacht!«
»Aber das ist noch nicht alles. Ich habe ein paar großartige Ideen, wie man den Gartenpfad entwässern kann. Heute Abend in der Pause werde ich die mal aufzeichnen. Vielleicht kann ich sie dir dann später zeigen?«
»Klingt super. Hör mal, ich werde jetzt nebenan ein bisschen was lesen. Du kannst ja zu mir hereinschauen, ehe du gehst, ja?«
Er nickt und lässt den Blick zufrieden durchs Wohnzimmer schweifen. »Allmählich nimmt es Gestalt an, Louie. Ich meine, die Wohnung sieht wirklich langsam nach etwas aus. Alles, was wir noch brauchen, ist dieser Lampenschirm.«
Resigniert beobachte ich, wie er den Staubsauger wieder anschaltet.
Immer fehlt noch ein Lampenschirm, ein Satz authentisch aussehender, pseudoantiker Kaminutensilien oder ein nicht verrutschender Läufer aus natürlichem Sackleinen. Wie Daisys grünes Licht in Der große Gatsby locken diese Dinge uns mit dem Versprechen eines endgültigen, anhaltenden Glücks und bleiben doch ewig unerreichbar.
Ich ziehe mich ins Schlafzimmer zurück, mache die Tür zu, streife die Schuhe ab und rolle mich auf dem Bett zusammen.
Das Bett ist riesig und besteht eigentlich aus zwei zusammengefügten Einzelbetten. »Verzahnt und verbunden«, nannte es der Verkäufer bei John Lewis. Wir brauchen so ein großes Bett, damit wir uns nachts nicht stören, denn mein Mann zuckt im Schlaf wie ein Hund, und ich brauche absolute Ruhe.
»Sind Sie sicher, dass Sie in einem Bett schlafen wollen?«, hatte der Verkäufer gefragt, als wir ihm unsere Wünsche schilderten. Mein Mann blieb hartnäckig. »Wir sind frisch verheiratet«, hatte er dem unverschämten Kerl hochmütig beschieden und ein wildes, stürmisches Sexleben impliziert, für das gerade mal die Fläche eines extra solide gebauten Doppelbettes ausreicht. So zuckt er nun irgendwo westlich von mir vor sich hin, während ich eine halbe Meile weiter östlich schlafe wie ein Stein.
Ich schlüpfe unter die Decke und hole das zierliche Bändchen aus seiner braunen Papiertüte. Ich weiß, dass ich am Beginn von etwas sehr Großem, etwas Umwälzendem stehe. Das ist es, wonach ich gesucht habe. Ich schlage das erste Kapitel auf.
Und bin im nächsten Moment eingeschlafen.
Als ich aufwache, ist er schon ins Theater gegangen. Auf dem Küchentisch liegt ein Zettel. »Hast geschnarcht, wollte dich nicht wecken.« Er hat wirklich einen Sinn für präzise Mitteilungen, das muss man ihm lassen.
Ich fühle mich schlecht.
Es ist nämlich so, dass ich viel zu viel schlafe ‒ ich wache spät auf, mache Nachmittagsschläfchen, gehe früh zu Bett. Ich lebe mit einem Bein in einem dunklen, warmen Tümpel der Bewusstlosigkeit, jederzeit bereit, ins Vergessen abzugleiten. Aber weil es etwas Asoziales hat, dieses ganze Schlafen, versuche ich, es zu verbergen.
Ich mache mir Toast (das nennt man wohl »kochen für eine Person«) und klettere wieder an Bord des Bettes. Dann beginne ich mit dem ersten Buchstaben im Alphabet, wobei ich mich bemühe, keine Butter auf die Seiten zu schmieren.
Kapitel 2:Accessoires
Man kann stets auf den Charakter einer Frau schließen, wenn man sich ansieht, wie viel Sorgfalt und Aufmerksamkeit sie den Details ihrer Kleidung widmet. Die zu einem Ensemble getragenen Accessoires ‒ Handschuhe, Hut, Schuhe und Handtasche ‒ gehören zu den wichtigsten Grundlagen einer eleganten Erscheinung. Ein bescheidenes Kleid oder Kostüm kann seine Wirkung verdreifachen, wenn es mit einem schicken Hut, einer schönen Tasche und passenden Handschuhen und Schuhen getragen wird, während das Modell eines Modeschöpfers viel von seinem Prestige verliert, wenn diese Dinge mit mangelnder Sorgfalt ausgewählt wurden. Unerlässlich ist eine vollständige Garnitur an Accessoires in Schwarz und, wenn möglich, eine weitere in Braun, dazu ein Paar beiger Schuhe und eine beige Strohhandtasche für den Sommer. Mit dieser Grundausstattung wirkt fast jede Kombination ansprechend.
Natürlich wäre es ideal, jede Garnitur an Accessoires in zwei verschiedenen Varianten zu besitzen, nämlich einer sportlichen und einer eleganten. In diesem Zusammenhang muss ich dem Missfallen Ausdruck geben, das ich stets empfinde, wenn ich eine Frau eine Krokodillederhandtasche zu vornehm-eleganter Kleidung tragen sehe, nur weil sie eine ungeheure Summe Geld dafür ausgegeben hat. Krokodilleder darf allein zu sportlicher Kleidung und legeren Rpiseensembles getragen werden, das gilt für Schuhe genauso wie für Taschen,und diesem hoch angesehenen Reptil sollte es überdies gestattet sein, sich jeden Nachmittag um fünf Uhr zurückzuziehen.
In dieser wie in keiner anderen Sparte ist die Qualität entscheidend. Seien Sie streng mit sich selbst. Sparen Sie. Sparen Sie, wenn nötig, am Essen (glauben Sie mir, es wird Ihnen gut tun), aber nicht bei Handtaschen oder Schuhen. Lassen Sie sich nie von etwas verführen, das nicht erstklassig ist. Der Ausspruch »Ich kann es mir nicht leisten, Billiges zu kaufen« ist heute zutreffender denn je. Obwohl ich alles andere als reich bin, kaufe ich meine Handtaschen seit Jahren bei Hermes, Germaine Guerin und Roberta. Dagegen habe ich all die kleinen, billigen Modetaschen, die ich zuerst so unwiderstehlich fand, früher oder später ausnahmslos verschenkt. Das Gleiche gilt für Schuhe und Handschuhe.
Mir ist bewusst, dass dies alles sehr streng und auch kostspielig klingt, aber Anstrengungen dieser Art sind der Schlüssel, das Sesam-öffne-dich, das die Tür zur Eleganz aufschließt.
Ich sehe zu meiner eigenen »Handtasche« hinunter, die in einem zerknüllten Haufen auf dem Boden liegt. Es ist ein dunkelblauer Rucksack von Gap, die Sorte, die Kekskrümel auf dem Boden auch dann magisch anzuziehen scheint, wenn man seit Monaten keine Kekse gegessen hat. Unnötig zu sagen, dass er mal eine Wäsche vertragen könnte.
Oder ein Glas Milch zu den Keksresten.
Ich frage mich, ob er als sportliche Tasche durchgehen könnte. Deutlich erinnere ich mich, wie ich ihn vor einigen Jahren in einer Kaufhausabteilung entdeckt habe, in der man alles wichtige für das neue Schuljahr erwerben konnte, und ganz glücklich war, weil ich all meine Handtaschendilemmas mit einem Schlag gelöst hatte. Es würde mir nie einfallen, mehr als eine Tasche zu kaufen, in mehr als einer Farbe oder einem Stil.
Die einzige andere Tasche, die ich besitze, ist eine zerknautschte Umhängetasche aus dunkelbraunem Leder, die ich vor vier Jahren im Schlussverkauf bei Hobbs erstanden habe. Das Leder ist so abgenutzt, dass der Rahmen der Tasche hindurchscheint, aber ich hänge zu sehr an ihr, um sie wegzuwerfen. Ich rede mir immer wieder ein, dass ich sie eines Tages reparieren lassen werde, obwohl sie schon längst aus der Mode gekommen ist.
Je länger ich darüber nachdenke, desto schwerer fällt es mir, auch nur eines meiner Accessoires zu benennen, das als einigermaßen schick, ganz zu schweigen von erstklassig, beschrieben werden könnte. Ganz sicher nicht die Sammlung brauner und grauer Baskenmützen, die ich ständig trage, und die so wahnsinnig praktisch sind, weil sie einem in den stürmischen Londoner Wintern nicht vom Kopf geweht werden und an den Tagen (es werden immer mehr), an denen ich meine Haare nicht gewaschen oder noch nicht einmal gekämmt habe, als »Notfallfrisur« dienen.
Dann merke ich, wie ich auf meine Füße starre oder vielmehr auf die viel getragenen beigen Leinen-Turnschuhe, die sie zieren. Es hat geregnet unterwegs, und diese Prachtstücke sind durchweicht. Außerdem ist der Stoff über einem großen Zeh ganz dünn geworden, und ich kann die grün-rot-gemusterten Weihnachtssocken darunter durchschimmern sehen, die meine Mutter mir geschickt hat. Ich wackle ein bisschen mit dem großen Zeh.
Meine Nase läuft, und als ich in den Taschen meines Regenmantels nach einem Papiertaschentuch suche, stoße ich auf das Paar nicht zusammenpassender schwarzer Handschuhe, das ich vor zwei Wochen auf dem Boden eines Kinos gefunden habe. Zu dem Zeitpunkt hielt ich es für einen tollen Fund, aber plötzlich wird sogar mir klar, dass ich den Einzelheiten meiner Kleidung offensichtlich nicht genug Sorgfalt und Aufmerksamkeit widme.
Eleganz mag im Detail liegen, aber leider kann ich mich in meiner Situation nicht mit Details aufhalten. Dazu ist die Lage viel zu ernst. Hier ist drastisches Handeln gefragt. In einem noch nie da gewesenen Anfall von Enthusiasmus beschließe ich, meine Verwandlung mit einem gründlichen Ausmisten meines Kleiderschranks zu beginnen. Ich werde alles systematisch durchgehen und das aussortieren, was mir nicht steht. Dann werde ich genug Durchblick haben, um auf der Grundlage der übrig gebliebenen Sachen einen neuen, besseren Stil zu entwickeln.
Prima, auf geht’s! Entschlossenen reiße ich die Tür des Kleiderschranks auf und falle fast in Ohnmacht vor Verzweiflung.
Ich besitze eine Stange voller Kleidungsstücke, die in über das ganze Land verstreuten Secondhandläden erworben wurden. Alles vor meinen Augen stellt einen faulen Kompromiss dar: Röcke, die in der Taille passen, aber weit ausgestellt sind wie die einer Volksmusikantin. Stapelweise kratzige oder hier und da mottenzerfressene Wollpullover, keiner davon in meiner Größe. Mäntel aus seltsamen Materialien und Jacketts ohne dazugehörige Hosen oder Röcke, die nur gekauft wurden, weil sie passen, was an sich schon bemerkenswert ist.
Aber all das ist nicht das Erschütterndste. Nein, was mich wirklich fertig macht, sind die Farben. Oder vielmehr der Mangel an solchen. Wann habe ich bloß beschlossen, dass Braun das neue Schwarz, Grau, Rot, Dunkelblau und jeder andere erdenkliche Farbton ist? Was würden wohl die »Colour me beautiful«-Girls davon halten? Oder der gute alte Freud?
Sehnsüchtig sehe ich zu dem in kühnem Purpurrot gestrichenen Wohnzimmer im Haus gegenüber hin, denn meine eigenen Wände sind magnolienrosa. Mattes Magnolienrosa, um genau zu sein. Das hier ist die Quittung, die erschreckende Folge, wenn man auf Nummer Sicher gehen will: Ich habe die Garderobe eines achtzigjährigen Iren. Mehr noch: eines achtzigjährigen Iren, dem sein Aussehen egal ist.
Doch so schnell gebe ich nicht auf.
Ich ziehe die Schublade mit meiner Unterwäsche auf und leere ihren ganzen Inhalt auf den Boden. Dann sehe ich die Berge von Strumpfhosen mit großen Laufmaschen und kleinen Laufmaschen durch (die einzigen zwei Sorten, die ich besitze), die ausgeleierten Unterhosen und die, bei denen das Gummiband herausschaut, sowie die BHs, die ich nie in die Waschmaschine hätte stecken dürfen und bei denen nun lebensgefährliche Drahtstücke herausstehen. Säuberlich sortiere ich alles in zwei Haufen mit Sachen zum Wegwerfen und zum Behalten.
So, fertig.
Ich gehe in die Küche, schnappe mir einen schwarzen Müllbeutel und stopfe ihn voll. Eine merkwürdige, unbekannte Energie durchströmt mich, und ehe ich mich’s versehe, durchforste ich auch den Rest meiner Klamotten.
Stapel von hässlichen, farblosen und braunen Sachen verschwinden in aller Schnelle. Ich werfe Pullover, Jacketts und alle Volksmusik-Röcke weg. Her mit einem zweiten Müllbeutel und hinein mit den ausgelatschten Schuhen und den schmucken Schals. Jetzt die dunkelbraune Umhängetasche von Hobbs. Ich kann mir eine neue kaufen. Schweißperlen laufen mir übers Gesicht, und die leeren Metallbügel klingen in meinem Schrank aneinander wie ein Windspiel. Ich binde die Beutel zu und zerre sie hinaus zu den Mülltonnen an der Rückseite des Hauses. Es ist dunkel, und ich komme mir vor wie eine Verbrecherin, die die Beweise einer besonders blutrünstigen Tat verschwinden lässt.
Schließlich stehe ich vor meinem fast leeren Schrank und begutachte das Ergebnis meiner Arbeit. Eine blassrosa Hemdbluse schwingt an der Stange, ein einzelner schwarzer Rock, ein dunkelblaues, tailliertes Trägerkleid. Auf dem Fußboden vor mir liegt ein kleiner Haufen gerade noch tragbarer Unterwäsche.
Das ist es. Das ist die Grundlage meiner neuen Garderobe, meiner neuen Identität, meines neuen Lebens.
Ich nehme einen gelben Post-it-Zettel vom Schreibtisch in der Ecke, schreibe mit rotem Leuchtstift etwas darauf und klebe ihn in einen Winkel meines Schrankspiegels.
Lass dich nie von etwas verführen, das nicht erstklassig ist, mahnt er mich.
Nein, nie wieder.
Ich sitze im Zug nach Brondesbury Park, auf dem Weg zu meiner Therapeutin. Das war eine Idee meines Mannes, weil er glaubt, dass mit mir etwas nicht stimmt.
Nach unserer Hochzeit wurde ich ständig von Albträumen geplagt. Ich wachte schreiend auf, überzeugt, dass ein fremder Mann am Fußende des Bettes steht. Das Zimmer sah genauso aus wie im Wachzustand, und dann war er plötzlich da und beugte sich über mich. Ich verjagte ihn, aber er kam jede Nacht wieder. Nach einer Weile gewöhnte sich mein Mann daran, bei meinen nächtlichen Schreien einfach weiterzuschlafen, aber als ich anfing, auch tagsüber zu weinen, und nicht mehr aufhören konnte, sprach er ein Machtwort. Er meinte, ich hätte zu viele Gefühle und müsse etwas dagegen unternehmen.
Wenn ich bei meiner Therapeutin ankomme, klingele ich und werde in ein Wartezimmer eingelassen, das eigentlich Teil eines Flurs ist, ausgestattet mit einem Stuhl und einem Couchtisch. Es gibt drei Zeitschriften; seit ich vor zwei Jahren mit der Therapie begonnen habe, sind es immer dieselben: eine Nummer von House and Garden aus dem Frühjahr 1997 und zwei Ausgaben von National Geographie. Ihren Inhalt kann ich auswendig hersagen. Trotzdem nehme ich House and Garden zur Hand und sehe mir wieder das Cottage an, das nur mit Hilfe von Ikeamöbeln und ein paar Töpfen Farbe in ein schwedisches Schmuckkästchen voller Antiquitäten verwandelt worden ist. Ich bin gerade dabei einzunicken, als die Tür endlich aufgeht und Mrs. P. mich hereinbittet.
Ich ziehe meinen Mantel aus und setze mich auf den Rand der Liege, ihre Version einer Psychiatercouch. Das Zimmer ist in gedämpften Farben gehalten und wirkt steril. Selbst die Landschaften an den Wänden strahlen eine unheimliche Stille aus, als wären sie von einem lobotomisierten Van Gogh gemalt ‒ bloß keine wilden, leidenschaftlichen Pinselstriche. Ich stelle mir gern vor, dass sich hinter der Glastür, die ihre Praxis vom Rest des Hauses trennt, eine explosive Sammlung primitiver phallischer Kunst und gewagter moderner Möbel in schreienden Farben befindet. Die Chancen sind gering, aber ich klammere mich an diese Hoffnung.
Mrs. P. ist mittleren Alters und Deutsche. Wie meinem fehlt auch ihrem Kleidungsstil das gewisse Savoir-faire. Heute trägt sie einen cremefarbenen Rock mit Nylonkniestrümpfen, und wenn sie sich setzt, sehe ich, wo der Elastikbund in ihr Bein kneift und eine rote Rolle geschwollenen Fleisches direkt unter dem Knie bildet. Ihr deutscher Akzent macht das Ganze auch nicht besser. Jedes Mal, wenn sie mich etwas fragt, komme ich mir vor wie in der schlecht geschriebenen Verhörszene eines Films über den Zweiten Weltkrieg. Vielleicht ist das die Ursache unserer Kommunikationsprobleme ‒ oder auch nicht.
Ich sitze also da, und sie mustert mich durch ihre eckigen Brillengläser hindurch.
Wir sind wieder in der Sackgasse angekommen, die Teil unseres wöchentlichen Rituals ist.
Ich grinse schuldbewusst.
»Ich glaube, ich möchte heute lieber sitzen«, sage ich.
Mrs. P. sieht mich unverwandt an. »Und warum möchten Sie das?«
»Ich will Sie sehen.«
»Und warum wollen Sie das?«, wiederholt sie. Immer wollen diese Leute wissen, warum. Mir scheint, der Unterschied zwischen einem Therapeuten und einem vierjährigen Kind ist nicht besonders groß.
»Ich möchte nicht allein sein. Ich fühle mich allein, wenn ich mich hinlege.«
»Aber Sie sind nicht allein«, betont sie. »Ich bin hier.«
»Ja, aber ich kann Sie nicht sehen.« Langsam werde ich ziemlich frustriert.
Sie schiebt ihre Brille höher auf die Nase. »Sie müssen also jemanden sehen, um sich nicht einsam zu fühlen?«
Sie übertreibt die Betonungen und gibt meine Worte an mich zurück, wie das so Therapeutenart ist. Aber ich lasse mich nicht einschüchtern. »Nein, nicht immer. Aber wenn ich mit Ihnen reden soll, möchte ich Sie lieber dabei ansehen.« Damit rutsche ich auf der Liege nach hinten, damit ich mich an die Wand lehnen kann.
Ich zupfe an den Knötchen in der weißen Chenilletagesdecke herum (ich bin sehr vertraut mit diesen Knötchen). Drei oder vier Minuten verstreichen schweigend.
»Sie vertrauen mir nicht«, sagt sie endlich.
»Nein, ich vertraue Ihnen nicht«, bestätige ich, nicht weil es wirklich stimmt, sondern weil sie es für wahr hält, und sie ist schließlich meine Therapeutin.
»Ich denke, Sie brauchen mehr Sitzungen«, seufzt sie.
Immer, wenn ich nicht tue, was sie von mir verlangt, brauche ich mehr Sitzungen. Es hat schon ganze Monate gegeben, in denen ich jeden Tag kommen musste. Normalerweise schaffen wir es nur bis zu diesem Punkt; zwei Jahre lang haben wir darüber debattiert, ob ich auf der Liege sitzen darf oder nicht. Aber heute habe ich ihr etwas zu erzählen.
»Ich habe gestern ein Buch gekauft. Es heißt Elégance.«
»Ist es ein Roman?«
»Nein, es ist eine Art Ratgeber, der einem sagt, wie man eine elegante Frau werden kann.«
Sie hebt eine Augenbraue. »Und was bedeutet es für Sie, eine ›elegante Frau‹ zu werden?«
»Schick zu sein, kultiviert, aber mir Raffinesse. Wie Audrey Hepburn oder Grace Kelly.«
»Und warum ist das wichtig für Sie?«
Auf einmal fühle ich mich frivol und übermütig, wie ein weibliches Mitglied der Kommunistischen Partei, das dabei ertappt wurde, die Vogue zu lesen. »Na ja, ich weiß nicht, ob es wirklich wichtig ist, aber es ist ein erstrebenswertes Ziel, finden Sie nicht?« Dabei fällt mein Blick auf ihre beigefarbenen, orthopädischen Sandalen.
Nein, vermutlich nicht.
Ich probiere es anders. »Was ich meine, ist, diese Frauen waren immer wie aus dem Ei gepellt, nie unordentlich oder ungepflegt. Überall, wo man sie sah, waren sie perfekt zurechtgemacht und tadellos gekleidet.«
»Und das möchten Sie auch sein, ›wie aus dem Ei gepellt, nie unordentlich oder ungepflegt‹?«
Ich überlege einen Moment. »Ja«, antworte ich dann, »ich würde für mein Leben gern gepflegt und schick sein und nicht immer wie eine Vogelscheuche herumlaufen.«
»Verstehe«, nickt sie. »Sie sind nicht gepflegt, das heißt, Sie sind ungepflegt. Nicht schick, das bedeutet unmodern. Und dazu noch eine Vogelscheuche. Sie halten sich also für unattraktiv.«
Bei ihr klingt alles noch viel schlimmer, als es ist.
Aber sie hat nicht ganz Unrecht.
»Nein, ich fühle mich nicht sehr attraktiv«, gebe ich zu und winde mich innerlich dabei. »Um ehrlich zu sein, ich fühle mich wie das Gegenteil von attraktiv. Als ob es nicht darauf ankommt, wie ich aussehe.«
Sie blinzelt mich über ihre Brille hinweg an. »Und warum kommt es nicht darauf an, wie Sie aussehen?«
Eine alles verschlingende Welle der Müdigkeit rollt auf mich zu.
»Weil… ich weiß nicht… weil es einfach nicht darauf ankommt.« Vergeblich versuche ich, ein Gähnen zu unterdrücken.
»Aber Ihr Mann bemerkt Sie doch sicher«, beharrt sie.
Ich weiß nicht, was sie mit »bemerken« meint. Ist das eine Art von Euphemismus? »Bemerkt« ihr Mann sie in ihren Kniestrümpfen und diesem Rock?
»Nein, er ist nicht so«, erkläre ich und verdränge die unwillkommene Vorstellung, wie sie einander »bemerken«. »Er interessiert sich nicht für solche Dinge.« Meine Augenlider befinden sich nun auf halbmast und sind furchtbar schwer.
»Was meinen Sie mit ›solchen Dingen‹?«
»Ich weiß nicht… Körper, Aussehen, Kleider.«
»Und was gibt Ihnen das für ein Gefühl?«, insistiert sie. »Dass er sich nicht für Ihren Körper, Ihr Aussehen oder Ihre Kleidung interessiert?«





























