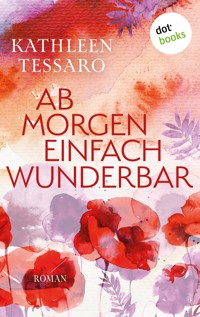4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Wenn ein Schmetterling das Fliegen lernt: Der bewegende Roman »All die Liebe, die uns bleibt« von Kathleen Tessaro jetzt als eBook bei dotbooks. Warum sind all die Träume, die uns früher durchs Leben tanzen ließen, irgendwann kaum mehr als eine verblasste Erinnerung? Die alleinerziehende Mutter Evie hat das Gefühl, in einer Sackgasse zu stecken: Wie wunderbar wäre es, noch einmal diese besondere Leichtigkeit zu fühlen, die sie mit ihrer Schulzeit verbindet, und mit ihrer allerbesten Freundin, die bei einem tragischen Unfall gestorben ist. Aber hat sie Robbie wirklich für immer verloren … oder lebt sie in ihrem Herzen weiter? Plötzlich meint Evie, die schmerzlich vermisste Stimme wieder hören zu können, so als wolle Robbie ihr helfen, das Alltagsgrau zu verscheuchen. Und vielleicht wird Evie so den Mut finden, eine wichtige Entscheidung zu treffen: Denn unerwartet steht sie auf einmal wieder mit klopfendem Herzen vor dem Mann, der ihr einst alles bedeutet hat … Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der zu Tränen rührende und lebensweise Roman »All die Liebe, die uns bleibt« von Kathleen Tessaro – auch bekannt unter dem Titel »Für immer dein« – wird alle Fans der Bestseller von Cecilia Ahern und Sofia Lundberg begeistern. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 500
Ähnliche
Über dieses Buch:
Warum sind all die Träume, die uns früher durchs Leben tanzen ließen, irgendwann kaum mehr als eine verblasste Erinnerung? Die alleinerziehende Mutter Evie hat das Gefühl, in einer Sackgasse zu stecken: Wie wunderbar wäre es, noch einmal diese besondere Leichtigkeit zu fühlen, die sie mit ihrer Schulzeit verbindet, und mit ihrer allerbesten Freundin, die bei einem tragischen Unfall gestorben ist. Aber hat sie Robbie wirklich für immer verloren … oder lebt sie in ihrem Herzen weiter? Plötzlich meint Evie, die schmerzlich vermisste Stimme wieder hören zu können, so als wolle Robbie ihr helfen, das Alltagsgrau zu verscheuchen. Und vielleicht wird Evie so den Mut finden, eine wichtige Entscheidung zu treffen: Denn unerwartet steht sie auf einmal wieder mit klopfendem Herzen vor dem Mann, der ihr einst alles bedeutet hat …
Über die Autorin:
Kathleen Tessaro, geboren im amerikanischen Pittsburgh, studierte Schauspiel und Tanz, als sie im zweiten Jahr eigentlich nur für ein kurzes Austauschprogramm nach England ziehen wollte – und 23 Jahre blieb. In London entdeckte sie auch ihre Begeisterung für das Schreiben und landete mit ihrem Debütroman »Elégance«, der in Deutschland inzwischen unter dem Titel »Ab Morgen einfach wunderbar« vorliegt, den ersten von zahlreichen Bestsellern, die in viele Sprachen übersetzt wurden. Kathleen kehrte schließlich nach Pittsburgh zurück, wo sie mit ihrer Familie lebt.
Die Autorin im Internet: www.kathleentessaro.com
Bei dotbooks veröffentlichte Kathleen Tessaro ihre Romane »Ab Morgen einfach wunderbar – oder: Elégance«, »Die Schwestern von Endsleigh – oder: Debütantinnen«, »All die Liebe, die uns bleibt – oder: Für immer dein« und »Ein Sommerflirt in London«.
***
eBook-Neuausgabe Januar 2024
Die Originalausgabe erschien erstmals 2005 unter dem Originaltitel »Innocence« bei HarperCollins, London. Die deutsche Erstausgabe erschien 2006 unter dem Titel »Für immer dein« Goldmann, München.
Copyright © der englischen Originalausgabe 2005 by Kathleen Tessaro
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2006 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive
von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ah)
ISBN 978-3-98952-015-8
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »All die Liebe, die uns bleibt« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Kathleen Tessaro
All die Liebe, die uns bleibt
Roman
Aus dem Englischen von Karin Diemerling
dotbooks.
Für meine Familie
»No Coward Soul Is Mine.«
EMILY BRONTË
PROLOG
Das Erste, was Sie über Robbie wissen sollten, ist, dass sie tot ist. Sie starb bei einem Unfall mit Fahrerflucht in New York City, als sie an einem Nachmittag im Februar die Straße überquerte, um sich eine Diätcola zu kaufen. Sie war verrückt nach Diätcola. Konnte nicht leben ohne das Zeug. Und sie war nie der Typ, der die Straße an der Ampel überquert.
Als Zweites sollten Sie wissen, dass wir schon Jahre zuvor keinen Kontakt mehr zueinander hatten. Nicht wegen irgendeines Streits, sondern weil wir uns gegenseitig aufgegeben hatten. Wir sahen die Welt nicht mehr mit den gleichen Augen. Sie weigerte sich standhaft, erwachsen zu werden, und ich hielt Erwachsensein damals für eine furchtbar wichtige, ernsthafte Angelegenheit.
Jetzt bin ich mir da nicht mehr so sicher.
Sie war eine starke Persönlichkeit, schon mit neunzehn. Zu stark, wie sich herausstellte. Aber das Schicksal ist manchmal kleinlich, wenn es um Liebe, Mut und Heldentum geht. Die schwungvollen Pinselstriche eines Gemäldes werden von ihm auf die ärgerliche, pointillistische Genauigkeit eines Seurat reduziert, dessen viele Punkte erst aus der Entfernung ein Bild ergeben, während man sich die ganze Zeit nach der Kühnheit und Ausdruckskraft eines Michelangelo sehnt, nach diesem seltenen Glücksgefühl, dass es einfach wunderbar ist, am Leben zu sein.
Das Leben ist eine Kunst, und manche Menschen haben ein Talent dafür. Ein grenzenloser Optimismus durchdringt sie, und wo andere unbestimmt und zögerlich sind, bestehen sie aus scharfen, klaren Kanten. Sie sprühen dermaßen vor Energie, dass die Lampen heller brennen, wenn sie einen Raum betreten.
Und das ist das andere, was Sie über Robbie wissen sollten.
Sie besaß haufenweise von diesem Talent.
***
Im Nachhinein betrachtet war es ein Fehler, im Erwachsenenbildungskurs für Schauspiel und Dichtung am Donnerstagabend Wein auszuschenken. Ich hatte gehofft, es wäre ein gutes Mittel, um das Gruppengefühl zu stärken und alle etwas lockerer zu machen.
Mr. Hastings ist inzwischen eindeutig locker. Genauer gesagt, er ist betrunken.
Er hat beschlossen, aus Das wüste Land von T. S. Eliot zu rezitieren.
Schon wieder.
Er liest jede Woche daraus vor. Seiner Ansicht nach ist es das beste Gedicht, das je geschrieben wurde, und kann nicht oft genug gehört werden. Manche von uns sehen das anders, aber er ist taub für jede Anregung, seinen Horizont auf dem Gebiet der Lyrik ein wenig zu erweitern.
Also sitzen wir zu acht auf diversen alten Sofas und Holzstühlen im Kreis, lassen den Blick aus unserem Dachzimmer im City Lit, dem populären Erwachsenenbildungszentrum, über die Dächer Londons schweifen und lauschen Mr. Hastings’ berüchtigter wöchentlicher Lesung.
Die Neonlampen blinken, die Lüftung pfeift, und draußen trommelt der Regen unaufhörlich gegen die schmutzige Fensterscheibe. Unten winden sich die schmalen Straßen und Gassen von Covent Garden von einer berühmten Theaterinstitution zur nächsten, um das Theatre Royal und das Lyceum herum und durch ein elegantes, gut betuchtes Premierenpublikum vor dem Royal Opera House hindurch. Sie ducken sich am Wyndham vorbei, am Garrick und am Duke of York und zwängen sich durch die niedrige, dunkle Passage zwischen dem Vaudeville und dem Adelphi, wo Bühnenarbeiter und Revuetänzerinnen sich in die Eingänge drücken und schnell ihre Zigaretten zu Ende rauchen, bevor der Vorhang aufgeht, ohne zu ahnen, dass woanders bereits eine große Vorstellung im Gange ist.
Mr. Hastings ist ein entschiedener Freund des gerollten R. Neben ihm hört sich John Gielgud wie Eliza Doolittle an, bevor sie auf Rex Harrison traf. Auch scheut er sich nicht, gelegentlich zu schreien, das heißt, die Lautstärke bei einem beliebigen Wort, das gerade sein Gefallen findet, kräftig zu erhöhen. Anfangs dachte ich, es gebe interpretatorische Gründe dafür. Falsch gedacht.
April ist der grausamste Monat, er treibt
Flieder aus toter Erde, er mischt
Erinnern und Begehren, er weckt
Dumpfe Wurzeln mit Lenzregen.
Clive Clarfelt, dessen dichter schwarzer Haarschopf den Verwüstungen der Zeit besser standgehalten hat als sein Gesicht, versucht, sich Wein nachzuschenken. Mr. Hastings wirft ihm einen bösen Blick zu. Clive starrt herausfordernd zurück und geht sogar so weit, trotzig zu schnauben. Die Augen von Mr. Hastings weiten sich, etwa im Stil von Dracula, der eine Jungfrau hypnotisiert.
Clive gibt nach.
Und die Lesung geht weiter.
Mr. Hastings’ schwankender, schlingernder Vortrag hat in Verbindung mit der stickigen Wärme der Zentralheizung einen beinahe sofortigen narkotischen Effekt. Mein Herzschlag wird langsamer, mein Atem flach. Und meine Gedanken schweifen ab ...
Plötzlich Stille.
Ich schrecke auf.
Mr. Hastings ist zu Tränen gerührt. Er putzt sich die Nase mit etwas, das er für sein Taschentuch hält, aber in Wahrheit Mrs. Patels Wollhandschuh ist. Sie ist viel zu höflich, um ihn darauf aufmerksam zu machen, und lächelt nervös, als er sich die Stirn abtupft und ihn anschließend in seine Brusttasche stopft.
Es ist an der Zeit, einzuschreiten.
»Das war sehr schön! Sehr bewegend! Finden Sie nicht auch?« Ich sehe mich in der Runde um. Meine Stimme rüttelt die übrigen Kursteilnehmer auf, die mich anblinzeln wie eine Gruppe von Nachttieren im Strahl einer Taschenlampe. »Sie lesen so ... so deutlich, Mr. Hastings, dass Sie bestimmt auch die anderen inspiriert haben.«
Ein paar nickende Köpfe, sogar einige zustimmende Laute.
Ich presche voran. »Und daher sollten wir jetzt noch jemand anderem die Gelegenheit geben zu lesen. Wie wäre es mit Ihnen, Brian?«
Mr. Hastings’ geschmeicheltes Lächeln erstirbt. »Aber ich bin noch nicht fertig! Es sind zwölf weitere Seiten!«
Ich zähle im Stillen bis drei. »Sicher, nur ist das Gedicht sehr lang, und wir sind heute eine recht große Gruppe. Ich denke, es ist besser abzuwechseln, so dass alle eine Chance erhalten. Wenn wir am Ende noch Zeit haben, können wir vielleicht noch einmal auf Eliot zurückkommen.« Ich sehe Brian hoffnungsvoll an. »Was haben Sie uns heute mitgebracht?«
»Eliot unterbricht man nicht!« Mr. Hastings nimmt es nicht gut auf. »Der ganze Sinn der Strophe geht verloren. Wird zerstückelt! Wo war ich stehen geblieben?« Er spricht schneller und lauter:
Was ist dies Wurzelwerk, das greift, der Ast, der sprosst
Aus diesem Steingeröll? O Menschensohn,
Du kannst nicht sagen, raten, denn du kennst nur
Gehäuf zerbrochner Bilder ...
»Mr. Hastings, bitte!«
Und ich will dir weisen ein Ding, das weder
Dein Schatten am Morgen ist, der dir nachfolgt,
Noch dein Schatten am Abend, der dir begegnet;
Ich zeige dir die Angst in einer Handvoll Staub.
»Bitte, Mr. Hastings!«
Es muss am Wein liegen.
Normalerweise kann ich ganz gut mit rebellischen Achtzigjährigen umgehen. In den drei Jahren, die ich bereits Abendkurse im City Lit gebe, habe ich Dutzende von Exzentrikern und ihre poetischen Ausbrüche mit wenig mehr als ein paar Komplimenten im Zaum gehalten. Aber sobald Alkohol ins Spiel kommt, werden sie hinterlistig, appellieren zuerst an mein Mitgefühl und stellen sich im nächsten Moment taub.
»Mr. Hastings«, donnere ich drohend (das heißt, so annähernd drohend, wie es mir der Mühe wert scheint), »das genügt jetzt!«
Er sieht mich finster an.
»Also, Brian ...«
»Wo ist denn mein Taschentuch, verdammt!« Mr. Hastings versetzt Mrs. Patel einen Stoß. »Ich hoffe sehr, dass Sie nicht darauf sitzen.«
Sie murmelt etwas Entschuldigendes.
Ich wende meine Aufmerksamkeit wieder Brian zu, einem schlaksigen jungen Postangestellten aus Dulwich. Brian ist ein bisschen schüchtern und hat noch nie etwas in der Gruppe vorgelesen. Er fummelt an einer zerknitterten Fotokopie herum und rückt seine Krawatte zurecht.
»Ja?«, lächle ich ihn ermutigend an. »Was haben Sie da Schönes?«
»Tja, na ja.« Er hat einen leichten Knall. »He, he, he! Es ist nichts Besonderes«, quietscht er. »Nur ein wenig Emily Dickinson.«
»Ach du Schande«, zischt Mr. Hastings.
Doris Del Angelo mischt sich ein. »Ich liebe Dickinson!«, sagt sie und funkelt Mr. Hastings an, der sich noch ein Glas von dem vor ihm stehenden Bordeaux einschenkt, dabei Clive und sein leeres Glas übersieht und auf ihre Brüste starrt, die zugegebenermaßen erstaunlich sind. Doris ist Ende sechzig und unerschrocken genug, ihren Busen in tief ausgeschnittenen, eng anliegenden Oberteilen auszustellen. Jede Woche spielt er eine zentrale Rolle in der Gruppendynamik. Jetzt schiebt sie ihn herausfordernd vor. »Ich bin sehr gespannt auf dieses Gedicht!«
Sollte ich versuchen, Mr. Hastings den Wein wegzunehmen? Ich sehe es schon vor mir, wie ich den alten Mann zu Boden ringe. Vielleicht lieber eine taktische Umpositionierung der Flasche? Dann sehe ich, dass er sie geleert hat.
Auch gut.
Zurück zu Brian. »Nur keine Angst, Brian. Jeder muss schließlich mal anfangen.«
Er lächelt. »Ich glaube, ich möchte dabei stehen.«
Er erhebt sich mutig. Einen Augenblick später sacken seine Knie weg, und er landet abrupt wieder auf seinem Sitz.
»Es ist immer ein bisschen beängstigend, zum ersten Mal aufzustehen und vor Publikum zu lesen, nicht wahr?« (Man muss solche Zwischenfälle konstruktiv nutzen.)
»He, he, he.« Er ist hysterisch, seine Hände zittern.
»Bleiben Sie doch einfach sitzen«, schlage ich vor. »Ganz ruhig und entspannt. Gehen Sie es langsam an.«
Die Gruppe wartet, während Brian seine Kräfte sammelt.
Könnt ich ein einziges Herz vorm Brechen bewahrn ...
»O Scheiße!« Mr. Hastings stützt den Kopf in die Hände.
»Bitte lesen Sie weiter, Brian. Sie machen das sehr gut.«
Wär nicht verfehlt mein Leben;
Könnt ich einem Dasein nehmen den Gram, [he, he, he]
Oder einem Schmerz Linderung geben
Oder ein geschwächtes Rotkehlchen [seltsames Zucken am rechten Auge]
Wieder hinauf in sein Nest heben,
Wär nicht verfehlt [he, he, he] mein Leben.
Gleich wird er sich übergeben oder in Ohnmacht fallen.
»Sehr gut, Brian, wirklich! Das haben Sie prima gemacht.«
Doris klatscht mit begeistert wogendem Busen Beifall. »Bravo, mein Junge!«
Eine Welle halbherzigen Applauses schwappt durch die Runde. Brian grinst und wird rot.
»Und wie haben Sie sich nun dabei gefühlt?«
»Hm, na ja. Ziemlich merkwürdig.«
»Nun, es hat sich auch verdammt merkwürdig angehört!« Mr. Hastings kämpft sich auf die Beine.
»Mr. Hastings ...«
»Ich pfeif auf Emily Dickinson!« Schwankend wie ein Matrose bei rauer See geht er zur Tür. »Ich pfeif auf euch alle!« Er klammert sich an den Türrahmen und ruft erbost über die Schulter: »Ich bin doch nicht quer durch London gefahren, um mir die Ergüsse von so einer morbiden kleinen Amerikanerin anzuhören. Gute Nacht!«
Es ist nicht ganz klar, ob seine letzte Aussage sich auf Emily Dickinson oder auf mich bezieht, aber es liegt mir auf der Zunge, ihn daran zu erinnern, dass auch T. S. Eliot ein morbider kleiner Amerikaner war.
Im selben Moment bemerke ich den feuchten Fleck auf dem Sofa. Mrs. Patel, stets auf der Hut vor peinlichen Situationen, bedeckt ihn schnell mit ihrem Schal.
Hastings’ Stimme hallt durch den Flur, laut und volltönend: »Good night, ladies, good night, sweet ladies, good night, good night!«
Während ich dasitze und auf den Schal und die darunter lauernde Scheußlichkeit starre und weiß, dass die Kursteilnehmer von mir eine Reaktion auf Mr. Hastings’ Meuterei erwarten, kommt mir wieder dieser Gedanke. Ich verdränge ihn gewöhnlich oder weiche ihm schnell aus, sobald er auftaucht, aber heute Abend habe ich nicht die Energie, ihn zu umgehen.
So habe ich mir das nicht vorgestellt.
Als ich vor vierzehn Jahren meine Heimatstadt Eden in Ohio verließ, um es in London zur Schauspielerin zu bringen, habe ich mir so etwas bestimmt nicht erträumt.
Da sehe ich sie plötzlich, wie sie an der Tür herumsteht.
Nur für einen Augenblick, dann ist sie wieder verschwunden. Aber sie ist es, kein Zweifel. Und sie grinst mich an. Selbst vom anderen Ende des Raums kann ich erkennen, wie sich ihre vollen Lippen zu einem lässigen, neckenden Grinsen verziehen, als wollte sie sagen: »So weit ist es also mit dir gekommen, was?«
Ja, Robbie. So weit ist es gekommen.
ERSTER TEIL
Februar 1986
Kapitel 1
Ich sitze neben einer rothaarigen Frau im Flugzeug. Mein Abendessen, bestehend aus Hühnchen in Sahnesoße mit Reis, habe ich nicht angerührt. Statt zu essen, starre ich auf meine neue Keith-Haring-Swatch (ein Abschiedsgeschenk von Jonny, meinem Freund). Ich reise zum ersten Mal ins Ausland. In nur acht Stunden und zweiundzwanzig Minuten werden wir in London landen, wo ein völlig neuer Lebensabschnitt für mich beginnen wird. Wer kann unter diesen Umständen schon Hühnchen essen?
Die Rothaarige kann es. Sie ist offenbar schon viel herumgekommen, trinkt genüsslich einen Schluck Wein und lächelt mich an.
»Ach, London ist toll. Tolle Pubs. Und man kann Fish and Chips essen. ›Chips‹ heißen die Pommes in England«, klärt sie mich auf. »Sie streuen dort Salz und Essig drüber.«
»Igitt!«, sage ich, welterfahren wie ich bin.
»Nein, es schmeckt gut. Man isst sie auch gern mit Erbsenmus.«
»Was für ’n Ding?«
»Erbsenmus.« Sie lacht. »Pürierte Erbsen eben. Muss man aber nicht nehmen.«
»O doch«, versichere ich ihr schnell. »Ich will alles ausprobieren!«
Sie nippt an ihrem Glas. »Wo kommen Sie her?«
»Aus Eden, Ohio.«
»Ist das in der Nähe von Akron?«
»Nein, eigentlich ist es in der Nähe von gar nichts.«
»Und was machen Sie? Studieren Sie?«
»Ja, Schauspiel. Ich will Schauspielerin werden. Bühnenschauspielerin«, füge ich hinzu, damit sie nicht denkt, dass ich mich billig verkaufe. »Ich bin an einer Schauspielakademie angenommen worden, Actors Drama Workshop Academy. Sagt Ihnen das was?«
Sie schüttelt den Kopf. »Ist das so etwas wie die Royal Academy of Dramatic Art?«
»Beinahe.«
»Na, Sie sind ein hübsches Mädchen. Sie werden bestimmt ein großer Star«, sagt sie freundlich und trommelt mit ihren langen pinkfarbenen Nägeln auf die Armlehne zwischen uns. »London wird Ihr Sprungbrett sein. Ist allerdings ziemlich weit weg von Ohio, Mädchen.«
Das ist ja das Tolle daran.
Ich passe nicht nach Ohio. Bis jetzt passe ich nirgendwohin. Zu Hause allerdings scheint das niemand zu kapieren, abgesehen von meinem Freund Jonny. Er wird im nächsten Semester anfangen, Grafikdesign an der Universität von Cleveland zu studieren. Er weiß, was es heißt, eine Künstlernatur zu sein, die in einer nüchternen Arbeiterstadt gefangen ist. Deshalb verstehen wir uns auch so gut. Ich hole seinen Abschiedsbrief an mich heraus und lese ihn noch einmal.
Ich weiß, das wird ein Riesenabenteuer für dich werden, Schatz, und ich bin jetzt schon sehr gespannt auf jede Folge deines Berichts. Schreib mir oft. Verlier nie den Glauben an dich. Und denk an mich, wie ich an meinem Zeichenbrett schufte und von dir und deinem wunderschönen Gesicht träume, bis du wieder zurück bist, warm und sicher in meinen Armen. Ich bin sehr stolz auf dich.
Mein geliebter Jonny.
Wir gehen seit fast zwei Jahren miteinander, und wenn ich zurückkomme, werden wir zusammenziehen, und zwar in New York, wenn alles gut geht. Ich male mir schon aus, wie wir morgens Kaffee trinken und barfuß in unserem Loft mit Blick auf den Central Park herumtapsen – manchmal ist auch ein Hund mit im Bild, manchmal sind wir nur zu zweit.
Ich falte den Brief sorgfältig zusammen und stecke ihn wieder in das Seitenfach meiner kleinen Reisetasche.
Dann denke ich an meine Eltern, wie sie nebeneinander in der Abflughalle des Flughafens von Cleveland standen. Sie können einfach nicht verstehen, warum ich so weit weggehen muss, warum überhaupt jemand den Wunsch haben sollte, die Vereinigten Staaten zu verlassen. Ich bin die Einzige in meiner Familie, die einen Reisepass besitzt.
Da draußen gibt es eine Welt voll herrlicher Sprache, überwältigender Gefühle und Geschichten, die so bewegend sind, dass sie einem das Herz brechen – nur in Eden, Ohio, existiert sie nicht. Wie soll ich ihnen klar machen, dass ich daran teilhaben will? Dass ich in die Kultur eintauchen will, die Shakespeare und Sheridan, Coward und Congreve hervorgebracht hat, den sprühenden Witz eines Oscar Wilde, die Satiren von Shaw und die Boshaftigkeit eines Orton. Ich will das alles sehen, es berühren, es am eigenen Leib erfahren, statt nebenbei darüber in Büchern zu lesen, während ich Bestellungen im Doughnut-Express aufnehme.
Endlich bin ich also auf dem Weg dorthin.
Ich lehne mich in meinem Sitz zurück und sehe zum Fenster hinaus. Irgendwo da unten fahren meine Eltern jetzt nach Hause und überlegen, was es zum Abendessen geben soll. Und jenseits dieser weiten blauen Fläche, auf einer kleinen grünen Insel, schlafen Menschen, die ich noch kennen lernen werde, gerade ein und träumen davon, was der morgige Tag bringen wird.
Die Stewardess beugt sich zu mir herüber und nimmt mein Tablett mit dem unangetasteten Essen weg. »Keinen Hunger?«
Ich schüttle den Kopf.
Meine nächste Mahlzeit wird aus Fish and Chips bestehen.
Mit jeder Menge Erbsenmus.
Die Hotelpension »Belle View« am Russell Square ist um einiges dunkler, kühler und bräunlicher, als die Fotos in der Broschüre vermuten ließen. Die Zimmer, die auf dem Papier so geräumig und einladend wirkten, sind klein wie Zellen und mit dem Luxus eigener Tee- oder Kaffeezubereitung (ein Wasserkocher und eine Teetasse auf einem Plastiktablett) und einem Waschbecken in der Ecke ausgestattet. Kochend heißes Wasser dampft aus dem einen Hahn, eiskaltes aus dem anderen. Ein gewisses Maß an Schnelligkeit und Abhärtung ist erforderlich, um sich das Gesicht zu waschen, aber hinterher wird man mit dem Gefühl belohnt, richtig was geschafft zu haben.
Die harte Realität eines gemeinschaftlichen Badezimmers auf dem Flur ist jedoch etwas ganz anderes. Sämtliche Ratschläge und Informationen haben mich nicht darauf vorbereiten können, nackt in einer flachen Wanne mit lauwarmem Wasser zu hocken, während drei bärenhafte deutsche Geschäftsmänner in nichts als alten Bademänteln draußen vor der Tür lauern. Die Erfahrung erinnert mich an Besuche beim Frauenarzt, zugleich intim und hochgradig unangenehm. Anscheinend haben die Engländer ein mir völlig fremdes Verhältnis zu ihrem Körper – wie zwei geschiedene Eheleute, die noch im selben Haus miteinander wohnen und gezwungen sind, höflich zu jemandem zu sein, den sie nicht ausstehen können.
Nachdem ich gebadet und mir einen Instantkaffee gemacht habe (Frühstück mit den Deutschen ist mir dann doch zu viel), ist der Zeitpunkt gekommen. Ich bin bereit, das Büro der Schauspielakademie im nördlichen London aufzusuchen und mich den Menschen vorzustellen, die mein künftiges Leben prägen werden.
Es ist weiter, als ich gedacht hatte. Ich nehme einen Bus zur Euston Station, dann die U-Bahn nach Camden Town und steige noch einmal in eine andere Linie um, ehe ich in der Tufnell Park Road stehe. Langsam schlendere ich durch die lange Wohnstraße, die zu dieser morgendlichen Stunde ausschließlich von alten Frauen bevölkert zu sein scheint, die auf den Bürgersteig starren und blaue Einkaufskarren aus Kunststoff hinter sich herziehen. Dann bin ich auf einmal da und befinde mich vor der Zweigstelle der United Kingdom Morris Dancing Association in Nordlondon. Das ist die richtige Adresse. Nur von einer Schauspielschule ist keine Rede.
Ein offenbar aus Glasgow stammender Hausmeister kommt mir zu Hilfe. Mit der Universalsprache aus Zeichen und Mimik erklärt er mir, dass ich tatsächlich die richtige Adresse habe und die Akademie sich irgendwo im Keller befindet.
Das Gebäude wirkt verlassen, meine Schritte hallen durch den Korridor. Ein ungutes Gefühl beschleicht mich. Das ist nicht der von künstlerischer Aktivität wimmelnde Musentempel meiner Vorstellung, in dem überall Studenten in den Fluren proben und singen und tanzen wie die Komparsen im Film Fame. Und wenn ich einen riesigen, kostspieligen Fehler begangen hätte? Wenn ich die ganze weite Reise umsonst gemacht hätte?
Ich biege um eine Ecke und gehe die Treppe hinunter.
»Wo zum Teufel sind die Anmeldeformulare für die Schüler! Verdammt, kann denn hier niemand mal was richtig machen? Ich brauche diese Formulare, und zwar sofort! Gwen!«
Erschrocken bleibe ich am Fuß der Treppe stehen.
Eine atemlose Frau von Anfang vierzig eilt an mir vorbei, einen Stapel fotokopierter Papiere in der Hand. Ihre Haare sind zu einem glanzlosen blonden Bob geschnitten, und sie trägt einen dunkelblauen Wollrock und eine unförmige grüne Strickjacke. Um ihren Hals klirren und klappern mehrere lange Goldketten, manche mit Anhängern, manche ohne. »Ich kann Sie sehr gut hören, Simon. Sie müssen nicht die hinterste Reihe im Haymarket-Theater mit Ihrer Vorstellung beeindrucken, wissen Sie.« Sie verschwindet in einem kleinen Büro.
Man hört Papier auf den Boden knallen.
»Das sind die Formulare vom letzten Jahr! Mein Gott, womit hab ich das verdient? Sag es mir, Herr! Wie habe ich dich erzürnt, dass du mich mit so viel Unfähigkeit bestrafst?«
Ich höre, wie die Frau den Stapel wieder aufsammelt.
Ihre Stimme ist leise, aber schneidend. »Das sind nicht die vom letzten Jahr, Simon, es sind die diesjährigen. Das weiß ich, weil ich sie persönlich fotokopiert habe. Wenn Sie so weitermachen, sind Sie bald ganz allein – noch ein Wort von Ihnen, und ich gehe. Dann können Sie Ihre Papiere das nächste Mal selbst aufheben.«
Sie knallt die Tür hinter sich zu und marschiert in einen anderen Raum auf der gegenüberliegenden Seite des Gangs.
Das ist jetzt vielleicht nicht der richtige Moment.
Doch als ich mich umdrehen und die Treppe hinauffliehen will, geht die Tür des Büros auf und ein Mann in einem elektrischen Rollstuhl kommt heraus. Er ist groß, was man auch im Sitzen erkennt, etwa Anfang fünfzig und hat eine wirre Mähne grauer Haare auf dem Kopf. Seine Beine wirken mager und seltsam marionettenhaft unter seinem abgetragenen Tweedanzug.
»Gwen!«, brüllt er und verschwindet im Nachbarzimmer. »Ich bin ein Mistkerl!«
»Ja, das ist uns allen bekannt.«
»Und Sie da, die Sie auf der Treppe herumlungern! Kommen Sie rein!«
Ich zögere.
»Ja, Sie!«, dröhnt er.
»Hören Sie auf, die Schüler zu verschrecken, Simon. Darüber haben wir schon öfter gesprochen.«
Vorsichtig trete ich näher und stecke meinen Kopf durch die Tür. Ich blicke in einen großen Raum mit einem breiten Schiebefenster, das ebenerdig auf einen verwucherten hinteren Garten hinausgeht.
»Hallo.« Ich fühle mich wie eine ertappte Lauscherin, was ich im Grunde auch bin. »Ich heiße Evie Garlick und habe mich für den Fortgeschrittenenkurs in Schauspiel eingeschrieben.«
Simon vollführt eine Drehung und schüttelt meine Hand. Mit seinem Griff könnte er ein Kind erwürgen. »Willkommen, Evie! Willkommen in London und der Actors Drama Workshop Academy! Ich bin Simon Garrett, und das ist meine Assistentin Gwen.« Schwungvoll breitet er die Arme aus. »Lassen Sie sich nicht von dieser bescheidenen Umgebung täuschen. Das ist nur ein zeitweiliges Quartier, bis unsere neuen Räume in South Kensington fertig gestellt sind. Direkt neben dem Hyde Park und Kensington Palace. Das wird Ihnen gefallen. Bitte, setzen Sie sich doch!« Er deutet großspurig auf einen Klappstuhl in der Ecke. »Machen Sie es sich bequem.«
Ich setze mich.
Gwen lächelt mich an. »Möchten Sie eine Tasse Tee? Ich würde Ihnen auch Kaffee anbieten, aber wir haben keine Filter mehr. Natürlich könnte ich Ihnen einen Pulverkaffee machen – trinken Sie so etwas? Als Amerikanerin vermutlich nicht. Es ist Nescafé.« Sie kramt ein Glas aus ihrer Schreibtischschublade hervor. »Den habe ich schon seit einer Weile.« Sie schüttelt ihn, aber es bewegt sich nichts. Das Granulat hat an einer Seite eine solide archäologische Schicht gebildet.
Dankbar für die Gastfreundschaft erwidere ich ihr Lächeln. »Nein, danke. Ich möchte nichts.«
»Wie war Ihr Flug?«
»Lang.«
»Das glaube ich.« Sie verzieht mitleidig das Gesicht. »Wie schrecklich für Sie! Es gibt nichts Schlimmeres als Langstreckenflüge, finde ich. Sind Sie sicher, dass Sie nicht doch eine schöne Tasse Tee wollen?«, fragt sie nach, als könnte das die Reisestrapazen ungeschehen machen.
»Nein, wirklich. Ich brauche nichts.«
Simon rollt flink auf mich zu und bremst einen Zentimeter vor meinen Zehen ab. »Nun, Miss Garlick! Aus welchem Grund möchten Sie Schauspielerin werden?« Er taxiert mich mit einem verunsichernden Blick.
»Also ...« Die Antwort auf diese Frage weiß ich. Ich habe mich mein halbes Leben lang darauf vorbereitet, und trotzdem bin ich nun davon überrascht, so früh am Morgen. »Ich liebe es, mich mit Sprache zu beschäftigen und sie mittels der uralten Tradition des Theaters ...«
»Unsinn!«, unterbricht er mich. »Es geht einzig und allein um Selbstdarstellung. Sie geben gerne an, hab ich Recht?«
Ich blinzle erschrocken.
Ich komme aus einer ländlichen Kleinstadt, in der Angeberei verpönt ist.
»Nein, es geht mir eher darum, die Absichten des Bühnenautors herauszuarbeiten und zu den Wurzeln des Stücks vorzudringen«, erkläre ich langsam.
Er wischt das ungeduldig beiseite. »Tun Sie nicht so verschämt, Miss Garlick! Es geht Ihnen in erster Linie darum, sich in Szene zu setzen. Los, sagen Sie es.«
Sieht so aus, als würde ich den Kürzeren ziehen.
Ich winde mich verlegen. »Und mich in Szene zu setzen.«
»Bravo.« Er gibt mir einen Klaps aufs Knie. »Denken Sie immer daran – was Shakespeare wirklich wollte, war, bewundert zu werden und viel Geld zu verdienen. All seine herrlichen Stücke, die schönen Verse und großen Gefühle hatten nur den einen Zweck: Er wollte raus aus Stratford-upon-Avon, in London berühmt werden und ein tolles Leben führen. Ich hoffe, Sie haben vor, in seine Fußstapfen zu treten!«
Simon lächelt mich erwartungsvoll an. Sein Atem riecht süß und irgendwie vertraut. Ich versuche höflich zu lachen, doch stattdessen kommt nur ein schnaubendes Geräusch heraus. Er scheint es nicht zu bemerken.
»So.« Unerwartet wirbelt er herum, worauf Gwen, die gerade zwei Tassen mit heißem Tee hereinträgt, ihm geschickt ausweicht. Er reißt die Schublade eines Aktenschranks auf und holt eine Polaroidkamera heraus.
»Lächeln, Evie!«
Ich zucke zusammen, als es blitzt, und schon wird das Foto ausgespuckt. Simon wirft die Kamera zurück in die Schublade. »Das hätten wir.« Er schreibt meinen Namen in großen Druckbuchstaben und mit rotem Filzstift auf den unteren Rand. »Damit wir nicht vergessen, wer Sie sind.« Strahlend befestigt er mein Foto mit einer Reißzwecke an einer Filztafel. »Da ist sie! Evie Garlick! Auf dem Weg, die Londoner Theaterwelt im Sturm zu erobern! Gut, es gibt viel zu tun. Viel zu tun. Schön, Sie kennen zu lernen, Evie. Haben Ihre Eltern per Scheck bezahlt?«
Ich nicke.
»Ausgezeichnet. Ihr Lehrer ist Boyd Alexander. Hat letztes Jahr einen Olivier für Fräulein Julie am National Theatre gewonnen. Ein Ibsen-Experte. Ausgezeichneter Regissseur.«
Ich nicke erneut. Ich habe keine Ahnung, was er mit einem Olivier meint, bin mir aber ziemlich sicher, dass Fräulein Julie von Strindberg ist.
»Ausgezeichnet«, sage ich. Das ist hier anscheinend ein wichtiges Wort.
»Absolut.« Geschwind rollt er in den Flur hinaus. »Gwen, wenn Sie so weit sind ...«
»Ja, schon gut! Hier, bitte.« Sie gibt mir einen Zettel mit einer Adresse darauf. »Ich habe Ihnen eine Unterkunft bei zwei netten Mädchen besorgt, die schon letztes Semester angefangen haben. Sie sind wirklich sehr nett und sehr engagiert. Und richtig ... nett. Sie werden sich dort bestimmt wohl fühlen.«
»Gwen! Wo bleiben Sie denn!«
»Komme ja schon! Meine Güte! Furchtbar nett, Sie kennen zu lernen.« Sie trippelt eilig ins Nachbarzimmer und nimmt die beiden Teebecher, einen großen ledergebundenen Kalender und eine Packung Butterkekse mit.
Zum ersten Mal bin ich allein in den Räumen der Schauspielschule.
Die meine Eltern Tausende von Dollar kosten wird. Für deren Besuch ich volle sechs Monate lang kämpfen musste. Die weiter von zu Hause entfernt ist, als ich je gewesen bin.
Diese drei Gründe allein sollten sie zu einem Ort des Glücks machen.
Ich schließe die Augen und versuche, nicht zu weinen. Dann stehe ich auf und betrachte mein Foto. Natürlich ist das eine Auge offen und das andere halb zu. Ich sehe aus wie eine grölende Betrunkene.
Hier ist sie, Evie Garlick. Auf dem Weg, die Londoner Theaterwelt im Sturm zu erobern.
Irgendwann später schaffe ich es mit meinen prallvollen Koffern (die mit braunem Paketklebeband umwickelt sind, damit sie nicht explodieren) zu der Adresse am Gloucester Place, meinem neuen Londoner Zuhause. Das Gepäck ist nicht weniger als viermal im beängstigenden Griff der U-Bahn-Rolltreppen stecken geblieben, und zwar mitten in der Rushhour. Ein Erlebnis, das einer zusätzlichen Runde durch Dantes Inferno gleichkommt. Eilige Pendler springen die Stufen auf der linken Seite hinauf, während der Rest sich auf der rechten Seite hintereinander drängt. Die Touristen dagegen müssen sich der öffentlichen Demütigung aussetzen, das gesamte Getriebe zum Stillstand zu bringen, indem sie ihre Koffer und Taschen durch die endlosen Tunnel auf Bahnsteige manövrieren, die auf dem kleinen, bunten Plan ganz nahe beieinander zu sein scheinen, in Wirklichkeit aber so dicht zusammenliegen wie Amsterdam und Rom. Der Portier im Belle View Hotel behauptete steif und fest, es sei das Billigste und Einfachste, mit der U-Bahn zu fahren. Und hier stehe ich nun, rot und verschwitzt und um einiges älter als beim Aufwachen heute Morgen.
Ich hole tief Luft und drücke auf die Klingel.
Ein großes, schlankes Mädchen in einem scharlachroten chinesischen Seidenmorgenmantel und mit grüner Gesichtsmaske öffnet die Tür. Ihre Haare stecken unter einem zum Turban gewickelten Handtuch.
»Ich habe heute Abend eine Verabredung«, erklärt sie und winkt mich herein. »Mit einem waschechten Engländer.«
Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.
»Toll.« Ich zerre meine Koffer die Stufen hinauf.
»Und ob.« Sie hält mir die Tür auf, während ich weiter mit meinem Gepäck kämpfe. »Er heißt Hughey Chicken! Ist das nicht unglaublich? Ich habe seine Telefonnummer von einer Freundin in New York. Sie sagt, er sei göttlich. Du bist wegen des Zimmers hier, stimmt’s?«
»Ja, genau.«
Sie gibt mir die Hand. »Ich bin Robbie.«
»Evie«, stelle ich mich vor. »Evie Garlick.«
»Echt?« Sie runzelt die Stirn, und ihre grüne Maske bekommt ein paar Risse. »Hast du schon mal daran gedacht, deinen Namen zu ändern?«
»Also, ich ...«
»Darüber können wir ja später reden. Du willst dich bestimmt erst mal umsehen.« Sie geht mir durch den Flur voraus, wobei ihre Seidenrobe um ihre schmalen Knöchel flattert. Mit einer Hand stößt sie eine Tür auf und macht das Licht an. »Ta-dah!«
Ich trete ein und sehe mich um.
Es ist eine Besenkammer. Ein Verschlag, in dem wir in Amerika höchstens die Waschmaschine und den Trockner unterbringen würden. Es gibt ein schmales Einzelbett mit einer braunen Tagesdecke, einen schiefen Kleiderschrank in der Ecke und ein Fenster mit Blick auf eine Backsteinmauer. Die Wände sind mit einer braun-grünen Blümchentapete aus den Sechzigern tapeziert, und der Teppich muss einmal rosa gewesen sein. Jetzt hat er ein paar kahle Stellen, helle, fadenscheinige Bereiche, die im trüben Licht der Deckenlampe mit dem staubigen Papierschirm trotzdem gut zu erkennen sind.
Für siebzig Pfund die Woche hätte ich mehr erwartet. Sehr viel mehr.
»Himmlisch, nicht? Genau das, was du dir immer erträumt hast? Keine Angst, mein Zimmer ist genauso schlimm.« Sie legt mir einen Arm um die Schultern. »Komm mit. Wir trinken erst mal was.«
Ich lasse meine Umhängetasche aufs Bett fallen und folge ihr in die Küche.
»Hast du Lust auf einen Sidecar?«
»Was ist ein Sidecar?«
»Hey, Evie, das ist der Himmel auf Erden! Beziehungsweise in einem Glas. Oder in unserem Fall« – sie kramt im Küchenschrank herum – »in zwei leicht angeschlagenen Tankstellen-Werbebechern.« Ich sehe zu, wie sie großzügige Mengen Brandy und Triple Sec zusammenschüttet und dann eine schrumplige alte Zitrone mit den Fingern auspresst. »Eis?«
»Klar.« Ihre Gesichtsmaske ist jetzt ganz verkrustet und fängt an abzublättern.
»Cheers!« Sie gibt mir einen Becher. »Komm mit rüber, während ich dieses Zeug abwasche.«
Ich trotte mit ins Badezimmer, hocke mich auf den Toilettendeckel und schlürfe meinen Cocktail, während sie sich kaltes Wasser ins Gesicht klatscht. Das Bad ist ein langer Schlauch mit einer dunkelblauen, langflorigen Matte. Jede verfügbare Oberfläche ist mit Pflegeprodukten zugestellt – Feuchtigkeitscremes, Reinigungslotionen, Shampoos –, und in einer Ecke der Badewanne stapeln sich benutzte Einwegrasierer neben einem übervollen Aschenbecher und mehreren leeren Kaffeetassen. Ein schwerer Nebel hängt in der Luft, der süß nach Badeöl und Rosenblütenseife duftet.
Ich nehme noch einen Schluck von meinem Drink und sehe zu, wie Robbie ihre Maske abschrubbt. Ihr Gesicht ist sehr hell, mit ein paar Sommersprossen getupft und ohne erkennbare Augenbrauen. Als sie das Handtuch vom Kopf zieht, fällt eine Masse weißblonder Locken auf ihre Schultern. Sie zündet zwei Zigaretten aus dem Päckchen in der Tasche ihres Morgenmantels an und reicht mir eine, während sie sich ans Waschbecken lehnt und einen tiefen Zug nimmt. Ich habe eigentlich nie richtig geraucht, weil ich keinen Geschmack daran finde. Aber jetzt, da die dickflüssige, süßliche Mischung aus Brandy und Triple Sec durch meine Adern fließt, fällt es mir leicht zu inhalieren, ohne zu husten. Ich rolle den Rauch um meinen Gaumen und blase ihn langsam aus, genau wie Lauren Bacall in Tote schlafen fest.
Auf einmal sieht alles gar nicht mehr so trübe aus.
Ich bin frei, cool und weltgewandt, trinke mitten am Tag Alkohol und hänge mit einem Mädchen im Bad herum, das ich gerade erst kennen gelernt habe.
»Komm, wir setzen uns lieber irgendwohin, wo wir bequem umkippen können«, schlägt Robbie vor, und ich begleite sie ins Wohnzimmer. Es ist dunkel und zugig und geht auf eine stark befahrene Durchgangsstraße hinaus. Die angegrauten Netzgardinen flattern jedes Mal, wenn ein Lastwagen oder ein Bus vorbeibraust. Sie legt eine Kassette von Van Morrison ein und wirft sich auf das abgewetzte schwarze Kunstledersofa, wobei sie ihre langen Beine über den Rand baumeln lässt. Sie hat keine Unterwäsche an. Ich setze mich ihr gegenüber in einen der hässlichen, zum Sofa passenden Sessel.
»Also, was machen wir mit deinem Namen?« Sie bläst Rauchringe in die Luft, die wie verblassende Heiligenscheine über ihrem Kopf schweben.
»Müssen wir denn etwas damit machen? So schlimm ist er doch gar nicht, oder?«
Sie zieht eine Augenbraue hoch. »Du willst mit einem Namen wie Evie Garlick Schauspielerin werden? Kann ich mir prima vorstellen: Romeo und Julia, mit Tom Cruise und Evie Garlick. Evie Garlick in Anna Karenina. Mit dem Preis für die beste Nachwuchsschauspielerin wird Evie Garlick geehrt!« Sie kichert.
»Okay, schon gut.« Diese Scherze kenne ich längst. »Was schlägst du vor?«
»Hmm ...« Sie kneift die Augen zusammen. »Raven wäre gut, finde ich. Ja, Raven gefällt mir. Wegen deiner Haare.«
»Die sind braun, nicht rabenschwarz.«
»Ach, das können wir ändern, kein Problem. Was hältst du davon?«
»Evie Raven?«
»Nein, Süße, Raven als Vorname! Lass mich überlegen ... Raven Black, Raven Dark, Raven Night, Raven Nightly! Das ist perfekt! Damit musst du einfach berühmt werden.«
Ich habe noch nie daran gedacht, mir die Haare zu färben, doch andererseits bin ich nicht nach London gekommen, um zu bleiben, wie ich zu Hause war. Trotzdem ist es ein ganz schön großer Schritt. »Raven Nightly. Ich weiß nicht. Klingt irgendwie nach Pornostar.«
»›Tom Cruise‹ etwa nicht? Ich finde den Namen toll. Außerdem bin ich gut in so was, ich hab die Namen von all meinen Freundinnen erfunden. Meine Freundin Blue zum Beispiel, mit ihr fing diese ganze Farbennamenmode an.«
»Wirklich?« Ich habe noch nie von der Farbennamenmode gehört.
»Na klar. Und du glaubst doch wohl nicht, dass Robbie mein echter Name ist, oder?«
Plötzlich fühle ich mich nicht mehr so cool und weltgewandt.
»Meine Eltern haben mich Alice getauft.« Sie zieht eine Grimasse. »Ist das zu glauben? Dagegen musste ich was unternehmen, und androgyne Namen sind so viel aktueller, findest du nicht?«
»Wie alt bist du eigentlich?« Vielleicht ist sie ja älter als ich und weiß daher so gut Bescheid.
»Neunzehn. Und du?«
»Achtzehn. Und woher kommst du?«
»Aus dem Village.«
Ich starre sie verständnislos an.
»New York City«, klärt sie mich auf. »Ein waschechter Spross des Big Apple.«
»Wow.«
Sie ist New Yorkerin. Und keine zugereiste, sondern eine echte, gebürtige. Noch nie habe ich jemanden getroffen, der schon immer in New York gelebt hat. Es erscheint mir unvorstellbar, dass in New York Kinder erlaubt sind, geradezu pervers und gefährlich, so als würde man Kleinkinder in den Nachtclub mitnehmen. Ich dachte immer, die gesamte Bevölkerung bestünde aus ehrgeizigen Erwachsenen, die aus Iowa und Maine stammen und sich mit Zähnen und Klauen an die Spitze ihrer jeweiligen Berufe kämpfen, wenn sie nicht gerade eine Galerieeröffnung, eine Broadwayshow oder ein Filmfest mit ausländischen Filmen besuchen.
»Wow«, wiederhole ich.
Sie grinst und sonnt sich in meiner kleinstädtischen Bewunderung.
»Ich ... ich wohne vielleicht auch bald in New York«, stoße ich hervor.
»Ach ja?«
»Ich habe nächsten Monat ein Vorsprechen für die Juilliard School.«
»Aha.« Ihr Gesichtsausdruck wird plötzlich hart und abweisend, als wäre eine Tür zugeschlagen. »Diese Vorsprechen sind echt der letzte Scheiß. Nichts als eitle Arschlöcher, wenn du mich fragst.«
»Oh.«
Ein Bus brettert vorbei und treibt einen kalten Luftzug ins Zimmer. Robbie wendet sich von mir ab. Ich folge ihrem Blick, sehe aber nur ein leeres Bücherregal und den glänzenden, dunklen Fernsehbildschirm.
»Ich meine, das heißt noch lange nicht, dass sie mich nehmen oder so. Es ist halt Juilliard, richtig? Alle sprechen mal für Juilliard vor.« Ich lache oder gebe vielmehr ein meckerndes Geräusch von mir, das ein Lachen sein könnte, wenn echte Unbekümmertheit dabei wäre.
Wir hören der Musik zu und schlürfen unsere Drinks.
Dann lächelt sie spontan, und die Tür geht wieder auf. »Hey, lass dich nicht von mir runterziehen. Du findest es ja doch früher oder später heraus, also kann ich es dir auch gleich sagen: Ich bin eine beschissene Schauspielerin.«
Das schockiert mich. »Ach, das glaube ich nicht, Robbie ...«
Sie unterbricht mich mit einer Handbewegung. »Doch, das stimmt. Ich habe dreimal für Juilliard vorgesprochen. Und für die New Yorker Uni und in Boston und so ziemlich überall auf diesem Planeten. Aber weißt du, es macht mir nichts mehr aus«, sagt sie leichthin. »Ich habe meinen Frieden mit der ganzen Sache gemacht. Wirklich.«
Mit meinen achtzehn Jahren kenne ich niemanden, der seinen Frieden mit irgendetwas gemacht hätte, schon gar nicht mit der vernichtenden Erkenntnis seines begrenzten künstlerischen Talents. Das macht mir irgendwie Angst ... wie kann sie so etwas überhaupt sagen? Mich überkommt das dringende Bedürfnis, ihre eigene Meinung von sich zu ändern.
»Du bist bestimmt gut, Robbie. Ich meine, manchmal dauert es Jahre, ehe jemand seinen Typ ausbildet, und solange kann es sehr frustrierend sein. Schließlich können nicht alle die junge Naive spielen.«
»Aber du schon, stimmt’s?« Sie streckt ihre Beine aus und macht es sich wieder gemütlich. »Dann erzähl doch mal, wie es bei dir angefangen hat.«
Aha, sie wechselt das Thema.
»Hm, ich weiß nicht genau.« Ich lehne mich im Sessel zurück. »Ich habe mal bei einem Stück in der Grundschule mitgemacht. Ich war die Größte in meiner Klasse, weil ich ein Jahr zurückgestuft worden war. Das lag daran, dass ich nicht richtig lesen konnte oder die Uhrzeit sagen und solche Dinge.«
Ich weiß nicht, warum ich ihr das erzähle. Obwohl ich sie erst seit einer halben Stunde kenne, fühle ich mich bei ihr irgendwie gut aufgehoben. Es geht eine gewisse Energie von ihr aus, eine Leichtigkeit, die mir noch nie begegnet ist, beinahe, als würde ihr etwas fehlen. Wo bei anderen eine dicke Schicht aus Konvention und Kritik sitzt, ist bei ihr nur Luft.
»Das nennt man Legasthenie«, bemerkt sie sachlich.
»Tatsächlich?« Meinen Eltern war mein Zurückbleiben in der Schule immer so peinlich, dass zu Hause nie darüber gesprochen wurde. »Bist du sicher?«
»Glaub mir, ich habe mehr Zeit mit irgendwelchen Schultests zugebracht, als du dir vorstellen kannst. Erzähl weiter«, drängt sie und lässt auch das ganz normal erscheinen.
»Oh.« Ich bin etwas verwirrt von dieser unerwarteten, späten Diagnose. »Damals, in meiner Mädchenschule ›Jungfrau vom Heiligen Herzen‹, war man mit dieser Schwäche einfach nur schwer von Begriff. Jedenfalls galt ich als ein bisschen dumm und seltsam, war größer als die anderen Mädchen und sah auch noch ziemlich komisch aus, weil meine Mutter eigentlich einen Jungen haben wollte und mir immer die Haare ganz kurz schnitt. Aber dann bekam ich die Hauptrolle in der Schulaufführung, weil ich so groß war und kurze Haare hatte.«
Ein mitfühlender Ausdruck legt sich über ihr Gesicht. »Und endlich warst du einmal in etwas gut!«
Ich starre sie an. »Woher weißt du das?«
»Es ist immer dieselbe Geschichte. Man will jemand anders sein, und dann ist man es, und die Leute applaudieren auch noch...« Sie grinst. »Dein Geheimnis ist bei mir sicher.«
»Es war das erste Mal, dass ich mich in meiner eigenen Haut wohl gefühlt habe. Vorher wollten die anderen nie etwas mit mir zu tun haben. Und meine Eltern kamen auch zu der Aufführung.« Ich sehe meine Mutter mit strahlendem Lächeln und meinen Vater mit Krawatte in der vordersten Reihe der Schulaula sitzen. »Sie waren unheimlich stolz auf mich. Bis dahin waren sie noch nie stolz auf mich gewesen, und so habe ich damals beschlossen, Schauspielerin zu werden.«
Sie ist auf einmal ganz still und blickt stirnrunzelnd zu Boden.
Ich habe zu viel gesagt. Das ängstliche, nackte Gefühl, mit dem ich aufgewachsen bin, ist wieder da. Plötzlich sitze ich wieder in der Schule mit meinen kurzen Haaren und der scheußlichen Uniform und versuche angestrengt, mich mit den beliebten Mädchen anzufreunden.
»Heute kann ich die Uhr lesen«, füge ich schnell hinzu. »Es hat nur etwas länger gedauert.«
Sie lacht, das Stirnrunzeln verschwindet und damit auch meine Betretenheit.
»Was ist mit dir?«, frage ich.
»Ich?« Sie macht fest die Augen zu. »Ich schauspielere schon mein ganzes Leben.«
»Dann musst du gut sein«, beharre ich.
»Weißt du was?« Sie richtet sich auf. »Es interessiert mich gar nicht wirklich.« Wieder zurücksinkend wackelt sie mit ihren rot lackierten Zehen und bewundert ihr Werk.
Einen Moment lang bin ich sprachlos. »Aber ... aber warum bist du dann hier?«
»Ach, Schätzchen!« Sie lächelt mich nachsichtig an. »Wer will denn schon arbeiten gehen? Außerdem weiß ich, dass ich bestimmt irgendeine Art von Talent habe, ich habe nur noch nicht das richtige Milieu gefunden. Alles bloß eine Frage der Zeit. Egal.«
Sie zündet sich eine neue Zigarette an, und der Schein der Flamme beleuchtet ihre Porzellanhaut. »Was ich gerade überlege, Raven ...«
Ich zucke zusammen. »Das klingt ziemlich komisch.«
»Du wirst dich schon daran gewöhnen. Was ich gerade überlege – ich habe ja dieses tolle Date mit Hughey Chicken heute Abend, aber er muss sich vorher noch mit einem Freund in Camden treffen. Deshalb dachte ich, du könntest vielleicht mitkommen. Eine Art Doppelverabredung daraus machen.«
»Du meinst ein Blind Date.«
»Na ja, wenn du es so betrachtest.«
Wie soll man es denn sonst betrachten?
»Weißt du, ich habe einen festen Freund. Er ist Grafiker und studiert an der Uni in Cleveland.«
Sie sieht mich fragend an. »Na und?«
»Ich halte nichts von Untreue und so. Wir werden wahrscheinlich zusammenziehen, wenn ich zurückkomme.«
»Hey, entspann dich! Ich habe doch nicht gemeint, dass du ihm Bett und Frühstück anbieten sollst. Wir wollen uns nur einen netten Abend machen. Schließlich sind wir in London, oder? Willst du denn keine Leute kennen lernen? Dich amüsieren?«
Ich zögere.
Eine coole Abenteurerin würde natürlich jetzt ja sagen. Aber was, wenn der Typ hässlich ist? Oder ein Spinner? Oder kein hässlicher Spinner, sondern eine Klasse zu hoch für mich, nämlich gut aussehend und souverän? Ich denke an Jonny, an sein komisches, schiefes Lächeln. Solange wir nur was trinken gehen, ist es wohl okay. Jonny ist nicht besitzergreifend. Außerdem gehe ich ja nicht allein mit dem Typen aus ... Aber was soll ich anziehen? Ich bin doch gerade erst angekommen und habe noch nicht mal ausgepackt.
Robbie grinst mich an und lässt ihre Beine baumeln. »Na, was ist? Wir treffen uns in einem Pub, und dann ziehen wir weiter und hören uns eine Band im Camden Palace an.«
»Ich ... ich weiß nicht.«
»Rave ...« Jetzt hat sie schon eine Abkürzung dafür. Ich habe einen Kosenamen von einem Namen, der nicht mein eigener ist. »Rave, ich kenne Hughey doch auch nicht, verstehst du? Es wird bestimmt lustig. Ein Abenteuer!«
Ich weiß nicht, warum das auf einmal so einleuchtend klingt, aber das tut es (möglicherweise haben die Sidecars was damit zu tun). »Na gut, okay. Aber nur, um dir Gesellschaft zu leisten. Und wenn es dir nichts ausmacht, möchte ich heute Abend lieber meinen eigenen Namen benutzen.«
Sie zuckt mit den Schultern. »Gut. An deiner Stelle würde ich allerdings meinen Nachnamen nicht nennen.«
Die Wohnungstür geht auf.
»Hallo!«
»Wir sind hier!«, ruft Robbie zurück. »Und betrinken uns!«
Ein Mädchen in einem schlecht sitzenden braunen Mantel lugt herein. Sie sieht aus wie fünfzehn, hat glattes, schulterlanges Haar, das mit einer knallrosa Spange zurückgesteckt ist, und riesige blaue Augen. Sie trägt einen Stapel Bücher unterm Arm – einen dicken, ledergebundenen Nachdruck von Shakespeares erster Quartformatausgabe, einen Penguin-Theaterführer zu Romeo und Julia, eine Ausgabe von Die Möwe und einen zerlesenen Band mit Tschechows Kurzgeschichten.
»Hi.« Sie kommt mit ausgestreckter Hand auf mich zu. »Ich bin Imogen Stein.«
Ich stehe auf. »Evie Garlick. Freut mich, dich kennen zu lernen.«
»Evie kommt mit zu meiner Verabredung mit Hughey Chicken!«, ruft Robbie und hebt ihren Becher.
»Lieber du als ich«, sagt Imogen, setzt ihre Bücher sorgsam auf dem Boden ab und schlüpft aus ihrem Mantel. Darunter trägt sie ein Trägerkleid mit tief angesetzter Taille, das ihr mindestens zwei Nummern zu groß ist, und solide braune Schnürschuhe, wie sie auch meine Großmutter bevorzugte. »Was trinkt ihr da?«
»Sidecars. Soll ich dir auch einen machen?«
»Ja, gern.«
Robbie steht auf, und Imogen lässt sich aufs Sofa fallen. »Du hast nicht zufällig eine Kippe?«, bettelt sie. Robbie wirft ihr das Päckchen zu, ehe sie in die Küche geht.
Ich beobachte sie, während sie sich die Zigarette anzündet. Etwas stimmt nicht an diesem Bild. Sie sieht aus wie ein Kindermodell für Laura Ashley, saugt jedoch gierig den Rauch ein und wirft die Beine übereinander wie eine vierzigjährige Prostituierte nach einer langen Nacht.
»Du warst also unterwegs?«, versuche ich ein Gespräch zu beginnen.
Es geht doch nichts darüber, das Offensichtliche festzustellen.
Sie fährt sich erschöpft mit einer Hand über die Augen. »Ja, Proben. Die Möwe.«
»Ah ja? Welche Szene?«
»Die Schlussszene. Du weißt schon: ›Ich bin die Möwe. Nein, nicht doch...‹« Sie nimmt noch einen Zug und scheint den ganzen Glimmstängel auf einmal inhalieren zu wollen.
»Das ist eine tolle Szene«, sage ich aufmunternd. »Und eine mörderisch schwierige Rede.«
Sie nickt und bläst Rauch durch die Nase. »Allerdings. Ich bin die Möwe. Ich bin die Möwe, ganz eindeutig.«
Wir schweigen.
Vielleicht macht sie Method Acting nach Stanislawski. Solche Schauspielerinnen nehmen ihre Arbeit sehr ernst.
Ich fange ihren Blick auf und lächle.
Sie starrt mich an. Dann, zu meinem Entsetzen, füllen ihre Augen sich mit Tränen.
Mist. Wenn sie sich wirklich für eine Möwe hält, kriegen wir Probleme.
»Ich liebe ihn. Ich liebe ihn so sehr, und er nimmt noch nicht einmal Notiz von mir!« Sie schlägt die Hände vors Gesicht.
Spielt sie jetzt eine Rolle? Sollte ich mit ihr improvisieren? Ich stehe auf. »Ich ... äh ... muss jetzt mal auspacken und so ...«
»Aber ich liebe ihn! Ich weiß, dass er meine große Liebe ist! Ich weiß es einfach!«
Robbie kommt mit einer Teetasse ohne Henkel zurück. »Er ist schwul, Imo. Das weiß jeder. Tut mir Leid, wir haben keine Becher mehr.« Sie schenkt mir aus einer angelaufenen silbernen Sauciere nach.
»Er ist nicht schwul!«, zischt Imo. »Bloß Engländer!«
»Er trägt Kaschmirsocken, hält Fußball für brutal und wohnt mit einem Mann namens Gavin zusammen. Der Organist ist«, fügt Robbie hinzu. »Sieh es endlich ein, er ist schwul. Du brauchst mir natürlich nicht zu glauben, aber ich bin immerhin im Village aufgewachsen, und wenn ich keinen Schwulen erkennen kann, dann muss ich blind sein.«
»Von wem ist denn die Rede?«
»Von Imos Szenenpartner Lindsay Crufts. Er sieht sehr gut aus, kann sich hervorragend ausdrücken und ist ein Schwanzlutscher vor dem Herrn.«
»Robbie!« Imo funkelt sie an. »Das Wort ›Schwanzlutscher‹ möchte ich nicht noch einmal im Zusammenhang mit meiner großen Liebe hören!«
Robbie zwinkert ihr zu. »Mensch, bist du süß, wenn du sauer bist.«
»Weißt du«, sagt Imo verschnupft, »für eine, die vorhat, mit einem Schwachkopf namens Mr. Chicken zu poppen, reißt du ganz schön die Klappe auf.«
Robbie kichert. »Du bist ja nur eifersüchtig.«
»Ja, klar.«
Ich bleibe außen vor bei diesem Geplänkel, würde aber liebend gern mitmachen. Theatralisch hebe ich meinen Becher. »Und während du mit Mr. Chicken poppst, bleibt mir nichts anderes übrig, als mit Mr. Chickens geheimnisvollem Freund zu poppen.«
Sie sehen mich beide verblüfft an und lachen.
Ich lache ebenfalls, ohne zu wissen, warum.
Imo ringt nach Atem. »Du hast keine Ahnung, was poppen bedeutet, oder?«
»Doch«, sage ich verunsichert. »Ausgehen, einen draufmachen, oder?«
»Nein, bumsen«, erklärt Robbie. »Sie sagen hier poppen dazu. Klingt so harmlos nach Popcorn, nicht?«
Ich tue das als einen alten Hut ab. »Ja, das wusste ich schon. Ich war nur kurz ... verwirrt.«
Sie grinsen sich einvernehmlich an.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich die beiden mag. Es nervt mich, dass sie so selbstverständlich rauchen und Drinks mixen können, und das Bad ist ein Schweinestall. Vielleicht sollte ich mir lieber eine eigene Wohnung suchen.
Auf einmal klopft es oder besser gesagt hämmert es an die Wohnungstür. »Hallo! Aufmachen!«
»Verdammt! Das ist Mrs. Van Patterson, die Vermieterin. Bist du ihr schon begegnet?«
Ich schüttle den Kopf.
»Sie ist ein einziger Albtraum. Holländerin und geizig bis zum Umfallen.« Robbie stößt Imo mit dem großen Zeh an. »Du machst auf. Dich mag sie.«
»Tut sie nicht!« Imo stößt ihren Fuß weg. »Geh du.«
»Nein, mich kann sie nicht ausstehen. Du siehst wenigstens aus wie eine Jungfrau.«
»Ich bin Jungfrau«, seufzt Imogen. Sie stellt ihre Teetasse ab und hievt sich vom Sofa. »Schön, schickt nur die Jungfrau vor. Die Jungfrau wird sich opfern.« Murrend schlurft sie zur Tür.
Ich beuge mich vertraulich in Robbies Richtung. »Ist sie nicht ein bisschen zu jung, um Alkohol zu trinken?«
Robbie schüttelt den Kopf. »Sie ist neunzehn, auch wenn man es ihr nicht ansieht. Ihr Vater ist ein einflussreicher Hollywoodagent. Tonnenweise Geld. Aber ihre Mutter ist total durchgeknallt. Zieht sie an wie ein Zwölfjährige und besteht darauf, dass Imo sie jeden Tag anruft. Sie ist eine ›Wiedergeborene‹. Hat einen totalen Jesus-Tick. Echt traurig, so was.«
»Aber sie heißt doch Stein mit Nachnamen, ist das nicht jüdisch?«
Robbie nickt. »Schon mal von ›Juden für Jesus‹ gehört?«
Habe ich nicht, aber langsam bin ich es müde, nicht mitzukommen.
Folglich gebe ich die immer passende Allzweckantwort: »Oh, verdammt!«
»Genau«, stimmt sie mir zu.
Wir hören, wie die Tür aufgemacht wird, und Robbie bedeutet mir, still zu sein.
»Guten Tag, Mrs. Van Patterson. Wie geht es Ihnen?«
»Ihr Mädchen verbraucht zu viel heißes Wasser! Die Stromrechnung ist astronomisch hoch. Es ist eine Schande, wie viel Wasser ihr verschwendet. Der Boiler hat einen Zeitschalter. Ihr dürft ihn nicht höher stellen, auf keinen Fall!«
»Aber das heiße Wasser ist jedes Mal alle, wenn wir Geschirr gespült haben oder auch nur eine von uns duscht.«
»Ach was, das kann doch gar nicht sein. Was macht ihr denn, badet ihr jeden Tag?«
»Soll vorkommen.«
»Werd nicht frech, junges Fräulein. Zweimal die Woche ist mehr als genug.«
»Wo ich herkomme, ist es ganz normal, jeden Tag zu baden.«
»Wo du herkommst, seid ihr alle verzärtelt! Die Amerikaner denken immer, das Geld liegt auf der Straße. Ihr Mädchen wisst gar nicht, was ihr für ein Glück habt. Gloucester Place ist eine der vornehmsten Adressen in London. Hast du schon mal Monopoly gespielt?«
»Ja, Mrs. Van Patterson, sicher.«
»Das hier ist wie die Parkallee, verstehst du?«
»Hm ...«
Ein vielsagendes Schweigen.
»Habt ihr etwa geraucht da drin?«
»Aber nein, Mrs. Van Patterson, natürlich nicht. Riechen Sie denn Rauch?«
»Allerdings rieche ich Rauch!«
Imo senkt ihre Stimme. »Ich glaube, das sind die von oben. Es geht mich zwar nichts an, aber ich bin mir sicher, sie schon beim Rauchen im Hausflur gesehen zu haben.«
»Aha! Verstehe. Du bist ein gutes Mädchen, Imogene Stein. Ein nettes, wohlerzogenes Kind. Viel besser als deine Mitbewohnerin. Aber ihr dürft nicht so viel heißes Wasser verbrauchen, ja? Okay?«
Die Tür schließt sich, und wir hören die Vermieterin nach oben stampfen.
Imo kommt wieder rein und setzt sich. »Tja, das ist noch mal gut gegangen für das Haus Tschechow.« Sie hebt toastend ihre Teetasse.
Robbie und ich sehen uns an und erheben ebenfalls unsere Becher. »Ich bin die Möwe!«, rufen wir im Chor.
Imogene grinst. Sie ist jung und alt zugleich.
»Jawohl, das bin ich. Ich bin die Möwe.« Sie klopft eine neue Zigarette aus dem Päckchen, zündet sie an und legt die Füße auf den Couchtisch. »Hat jemand Lust auf ein schönes, langes Bad?«
In Wind und Regen stehe ich vor der Haustür und krame in meiner Jackentasche nach den Schlüsseln. Dann sehe ich mich noch ein letztes Mal um.
Nein, sie ist nicht da, steht nicht hinter dem Goldregen oder wartet auf der anderen Seite der Gartenpforte.
Nicht, dass ich wirklich an Geister glaubte.
Aber Robbie zu sehen ist etwas anderes.
Sie war nicht durchsichtig oder weiß oder nebulös oder sonstwie geisterhaft. Im Gegenteil, sie sah ganz normal und greifbar aus, trug Jeans und einen dieser hässlichen orangefarbenen Pullis, die sie zu der Zeit strickte, als sie glaubte, Strickwarendesignerin sei ihre wahre Berufung. (Sie hat nie aufgehört, nach ihrer wahren Berufung zu suchen, und jedes Jahr eine neue gefunden. In jenem Jahr bekamen wir alle Pullover. Ich habe immer noch zwei davon, einen in Fuchsiarot und einen in einer Art Giftmüllgrün. Sie sind irgendwie gleichzeitig zu eng und zu weit, und ich glaube, der Halsausschnitt ist eigentlich ein Ärmelloch, und die Ärmellöcher sind Halsausschnitte. Sie nannte das ihr »Markenzeichen«.)
Bei Ende des Kurses war sie verschwunden. Ich habe auf dem Weg zur U-Bahn-Station Covent Garden nach ihr Ausschau gehalten und halb erwartet, dass sie mir hinterhergeht oder sich in den dunklen Ecken der Drury Lane verbirgt oder auf dem Bahnsteig steht und die Vanity Fair liest. Sie hat Covent Garden immer sehr gemocht und ständig irgendwelche Australier aus einer der Bars abgeschleppt.
Aber sie war nicht da.
Und hier ist sie jetzt auch nicht.
Natürlich habe ich mir das Ganze nur eingebildet. Erstaunlich, was ein bisschen Schlafmangel und ein paar übersprungene Mahlzeiten alles bewirken können. Ich sollte erleichtert sein, bin aber merkwürdigerweise bloß enttäuscht. Je älter man wird, desto mehr Freundinnen und Freunde verliert man an Ehe, Kinder oder Beruf, kurzum an das Erwachsensein. Freundschaft an sich wird zu einer Erscheinung, zu einer flüchtigen Vision, die sich im harten Tageslicht schnell wieder auflöst.
Ich drehe den Schlüssel in der großen, scharlachachrot gestrichenen Haustür.
Die Nummer siebzehn war einst eine herrschaftliche cremefarbene Stuckvilla im georgianischen Stil, die sich kaum von den anderen herrschaftlichen cremefarbenen Stuckvillen in der Acacia Avenue in St. John’s Wood unterschied. Heute muss man jedoch sagen, dass sie schon bessere Tage gesehen hat. Sie ist das einzige Haus in der Straße, dessen Gartentür bei jedem Öffnen quietscht wie ein aufgebrachtes Ferkel und dessen vanillefarbener Anstrich abblättert wie die weißen Schokoladenchips auf einer Luxus-Hochzeitstorte. Der Garten hat in dieser Nachbarschaft, in der kastenförmige Hecken und mit Formschnitt traktierte Lorbeerbäume ein Muss sind, etwas Wildromantisches und sieht viel mehr nach Brontë als nach Austen aus. Im Sommer wirft der Feigenbaum seine schweren Früchte auf das Pflaster vor dem Haus, wo sie eine zähe, klebrige Masse bilden, und jeden Herbst schleudert die hohe Kastanie ihre rotbraunen Geschosse mit unheimlicher Präzision auf ahnungslose Passanten. Eine trotzige, schäbige Pracht ist an die Stelle der einst tadellosen Fassade getreten, aber in den fünf Jahren, die ich jetzt dort wohne, hat das Haus für mich nur an Faszination gewonnen.
Es beherbergt keine gewöhnliche Hausgemeinschaft, und Bunny Gold, die Besitzerin, ist auch keine gewöhnliche Vermieterin.
Als Bunnys Mann Harry vor zehn Jahren unerwartet starb, kam ans Licht, dass er nicht nur ein liebevoller Ehemann und Vater, eine geachtete Stütze der jüdischen Gemeinde und Inhaber eines höchst erfolgreichen Steuerberatungsbüros war, sondern auch ein besessener Spieler.
Er hatte bereits seine Altersversorgung, seine Lebensversicherung und einen großen Teil ihrer gemeinsamen Ersparnisse zur Tilgung seiner Schulden verwendet, und Bunny, die ihr ganzes Leben in einer Seifenblase aus Shoppen, gesellschaftlichen Ereignissen und der Erziehung ihres einzigen Kindes Edwina zugebracht hatte, war am Boden zerstört. Ein Seitensprung wäre sicher auch ein Schock gewesen, aber sie bankrott zurückzulassen war noch viel schlimmer. Zumal sie sich nicht von ihrem geliebten Zuhause trennen wollte.
Also begann sie, Zimmer zu vermieten, auch wenn sie zuerst keine Wohngemeinschaft im Sinn hatte und die Bezeichnung sie entsetzt hätte. Für sie ist unser Zusammenleben eine sehr persönliche Form der Künstlerförderung. Sie sieht sich eher als Mäzenin denn als Hauswirtin und vermietet nur an Künstler, deren Arbeit sie bewundert. Sie ist schon zweiundsiebzig, doch ihre Begeisterung für fast jede Art von Musik, Malerei, Tanz oder Theater stellt in Verbindung mit einem bemerkenswerten Interesse an der Avantgarde eine wahre Inspiration dar.
Da gibt es also mich, die Schauspielerin/Lehrerin, Allyson, eine australische Sängerin/Lehrerin und den neuesten Ankömmling, Piotr, einen Konzertpianisten/Lehrer aus Polen.
Außerdem natürlich die große Liebe meines Lebens, Alex. Wir teilen uns zwei Zimmer und ein eigenes Bad in der obersten Etage des Hauses mit Blick auf den hinteren Garten.
Wir sind die Privilegierten.
Regelmäßig treffen Ansichtskarten aus der ganzen Welt von ehemaligen Mietern ein, die Bunny einladen, sie in Rom, Paris, New York, Berlin usw. zu besuchen. Mit den Jahren habe ich selbst ein paar davon kennen gelernt. Wie Bunny immer sagt: »Evie, wenn das so weitergeht, wird eine von uns beiden der anderen bald einen Heiratsantrag machen müssen.«
Damit hat sie Recht. Ich sollte mich weiterentwickeln und ausziehen, aber das hört sich leichter an, als es ist. Die Jahre gehen dahin, während man eigentlich bloß darauf wartet, dass das Wasser im Teekessel kocht. Vielleicht werde ich eines Tages auch Ansichtskarten schicken, selbst wenn ich es nur bis in den Londoner Süden schaffe.
Im Moment jedoch bin ich einfach nur froh, zu Hause zu sein.