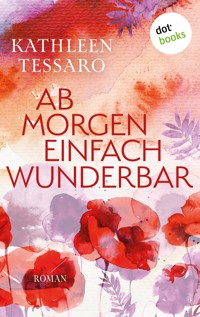4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Wartet die Liebe immer dort, wo wir sie am wenigsten erwarten? Die Komödie »Ein Sommerflirt in London« von Kathleen Tessaro als eBook bei dotbooks. Sein Name klingt so britisch und charmant, als wäre er einem Theaterstück von Oscar Wilde entsprungen – kein Wunder also, dass sich Hughie Armstrong Venables-Smythe durch eine pikante Anzeige angesprochen fühlt: Eine Agentur sucht junge Männer, attraktiv und moralisch flexibel, die im Auftrag reicher Gentlemen mit deren Frauen flirten, um ihnen die Zeit zu vertreiben. Obwohl Hughie eigentlich meint, sein Herz bereits an die kühle Geschäftsfrau Leticia verloren zu haben, stürzt er sich mit Feuereifer in seine erste Mission. Aber wird sich die mondäne Olivia wirklich für den sympathischen Luftikus begeistern … oder hat Amor seine Pfeile für sie, Leticia und sogar Hughie selbst bereits in ganz andere Richtungen verschossen? Diese Geschichte ist so beschwingt wie ein Glas Champagner an einem langen Sommerabend: »Ein Roman für alle Frauen, die schon zu viel Zeit mit billigem Wein und falschen Männern verschwendet haben«, urteilt The Guardian. Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der turbulente Gesellschaftsroman »Ein Sommerflirt in London« von Kathleen Tessaro – auch bekannt unter dem Titel »Der Flirt« – wird alle Fans der Bestseller von Lia Louis und romantischen Komödien wie »Notting Hill« und »Love Actually – Tatsächlich Liebe« begeistern. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Sammlungen
Ähnliche
Über dieses Buch:
Sein Name klingt so britisch und charmant, als wäre er einem Theaterstück von Oscar Wilde entsprungen – kein Wunder also, dass sich Hughie Armstrong Venables-Smythe durch eine pikante Anzeige angesprochen fühlt: Eine Agentur sucht junge Männer, attraktiv und moralisch flexibel, die im Auftrag reicher Gentlemen mit deren Frauen flirten, um ihnen die Zeit zu vertreiben. Obwohl Hughie eigentlich meint, sein Herz bereits an die kühle Geschäftsfrau Leticia verloren zu haben, stürzt er sich mit Feuereifer in seine erste Mission. Aber wird sich die mondäne Olivia wirklich für den sympathischen Luftikus begeistern … oder hat Amor seine Pfeile für sie, Leticia und sogar Hughie selbst bereits in ganz andere Richtungen verschossen?
Über die Autorin:
Kathleen Tessaro, geboren im amerikanischen Pittsburgh, studierte Schauspiel und Tanz, als sie im zweiten Jahr eigentlich nur für ein kurzes Austauschprogramm nach England ziehen wollte – und 23 Jahre blieb. In London entdeckte sie auch ihre Begeisterung für das Schreiben und landete mit ihrem Debütroman »Elégance«, der in Deutschland inzwischen unter dem Titel »Ab Morgen einfach wunderbar« vorliegt, den ersten von zahlreichen Bestsellern, die in viele Sprachen übersetzt wurden. Kathleen kehrte schließlich nach Pittsburgh zurück, wo sie mit ihrer Familie lebt.
Die Autorin im Internet: www.kathleentessaro.com
Bei dotbooks veröffentlichte Kathleen Tessaro ihre Romane »Ab Morgen einfach wunderbar – oder: Elégance«, »Die Schwestern von Endsleigh – oder: Debütantinnen«, »All die Liebe, die uns bleibt – oder: Für immer dein« und »Ein Sommerflirt in London«.
***
eBook-Neuausgabe August 2023
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 2008 unter dem Originaltitel »The Flirt« bei Harper, an Imprint of HarperCollins Publishers, London. Die deutsche Erstausgabe erschien 2010 unter dem Titel »Der Flirt« bei Goldmann, München
Copyright © der englischen Originalausgabe 2008 by Kathleen Tessaro
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2010 by Wilhelm Goldmann Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive
von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ah)
ISBN 978-3-98690-762-4
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Ein Sommerflirt in London« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Kathleen Tessaro
Ein Sommerflirt in London
Roman
Aus dem Englischen von Elvira Willems
dotbooks.
Kapitel 1:La Vie Bohème
Die Anzeige erschien in der zweiten Septemberwoche in der Stage. Das Edinburgh Festival war offiziell vorbei, und das richtige Leben drängte sich wieder unwirsch in das kollektive Bewusstsein der arbeitslosen Schauspieler, die die London Area bevölkerten.
Sie lautete:
Einmalige Gelegenheit für attraktiven, moralisch flexiblen jungen Mann mit guten Manieren. Unregelmäßige Arbeitszeiten. Großzügiges Salär. Diskretion unabdingbar.
Bitte schicken Sie ein Foto und einen kurzen Liebes-Lebenslauf an:
Valentine Charles
111 Half Moon Street
Mayfair, London
Mit einem Kugelschreiber bewaffnet, den er der Kellnerin abgeschwatzt hatte, einer Tasse starken Tees mit viel Milch und Zucker und seinem Handy, dessen Gesprächsguthaben merklich geschrumpft war, saß Hughie Armstrong Venables-Smythe in Jack’s Café wie gewöhnlich an einem Tisch nahe am Fenster. Draußen herrschte strahlender Sonnenschein, doch in der Luft lag eine schneidend frische Herbstbrise. Ältere Leute, die ramponierte Einkaufsroller im Schottenkaro hinter sich herzogen, blieben vor dem Schnäppchenladen auf der Kilburn High Road stehen, um sich über die Vorzüge des Bleichmittels zu informieren, das dort in rosa Plastikkörben zum halben Preis angeboten wurde. Andere feilschten erhitzt mit dem rotgesichtigen irischen Metzger, dessen Frühstücksspeck verdächtig billig war.
Hier war Hughie unter seinesgleichen, hier lebte er an der Frontlinie einer Von-der-Hand-in-den-Mund-Existenz eines Gelegenheitsschauspielers in London NW6, das trotz des jüngsten Anstiegs der Immobilienpreise in den Augen seiner Mutter immer noch eine ziemlich miese Gegend war.
Er entdeckte die Anzeige, markierte sie und lehnte sich zufrieden zurück. In seiner Branche galt es schon als Tagewerk, die Stage zu kaufen und Anzeigen einzukringeln. Zur Feier des Tages zündete er sich eine neue Zigarette an.
Er hatte gerade erst angefangen zu rauchen: Marlboro Lights. Eine widerliche Angewohnheit, die er von seiner Freundin Leticia übernommen hatte. Sie strotzte nur so vor den wunderbarsten, widerlichsten Angewohnheiten, die der Menschheit bekannt waren, und das Rauchen war bei weitem noch die gesellschaftlich akzeptabelste. Mit seinen dreiundzwanzig Jahren gab ihm das ein Gefühl von Weltläufigkeit. Andererseits konnte Hughie jede Hilfe brauchen, schließlich war Leticia einige Jahre älter als er und um einiges weltläufiger, als er je sein würde. Obwohl sie erst seit zwei Wochen, in Gedanken nannte er es »miteinander ausgehen«, aber ging man wirklich miteinander aus, wenn man im Grunde nirgendwo hinging oder irgendetwas miteinander tat, außer sich mehrmals die Woche an seltsamen, finsteren Orten zu treffen, um sich wildem, wortlosem, schrägem Sex hinzugeben? Wahrscheinlich nicht. Die korrekte Bezeichnung wäre wohl eher »sich treffen«, obwohl sie sich also erst seit ungefähr zwei Wochen »trafen«, war Hughie schon schrecklich verliebt.
Ah, Leticia!
Was hätte man an ihr nicht lieben können?
Alles an ihr war perfekt – von ihrem glänzenden schwarzen Bubikopf, ihren braunen Rehaugen und ihren weichen, rosafarben Amorbogen-Lippen bis hin zu der Art und Weise, wie sie in der Gasse hinter ihrem Laden für maßgeschneiderte Damenunterwäsche in Belgravia »Schlag fester, du geiler kleiner Scheißkerl!« schrie.
Er schloss die Augen und dankte dem Herrn im Himmel stumm – wie er das im Augenblick mehrfach am Tag tat – für den besonders glücklichen Zufall, der ihn gezwungen hatte, sich in dem überfüllten Bus Nummer 12 neben sie zu setzen. Von dem Augenblick an, da er, als sie am Marble Arch vorbeifuhren, gespürt hatte, wie ihre Hand an der Innenseite seines Oberschenkels hinaufkroch, bis sie beide am Piccadilly Circus hastig ausgestiegen waren, hatte er gewusst, dass der Lauf seines Lebens für immer eine andere Bahn eingeschlagen hatte. Bis dahin war Gott für ihn kaum mehr gewesen als eine vage Vorstellung, doch an diesem Tag war Hughie zu dem Schluss gekommen, keine andere Kraft im Universum könne all seine Gebete so vollkommen erhört haben.
Er zog an seiner Zigarette und runzelte die Stirn.
Leticia war eine richtige Frau, keine anspruchslose Studentin. Sie war herrlich pervers und weithin beliebt, unbarmherzig und schnell gelangweilt. Wie wollte er sie halten? Liebe allein genügte da nicht. Um sie an sich zu binden, waren unzählige Köstlichkeiten und Vergnügungen erforderlich.
Kein Geld zu haben war weder köstlich noch vergnüglich.
Dies waren die Leiden, vor denen man ihn in der Schauspielschule gewarnt hatte, die Krux von La Vie Bohème. Hier war er, ein am Hungertuch nagender junger Schauspieler, gefangen im Mahlstrom zwischen künstlerischer Integrität und kommerziellen Ansprüchen. Er stellte sich ein Publikum vor, das Zeuge seines stillen Heroismus wurde, und schob sich mit einer galanten Geste sein wuscheliges aschblondes Haar aus dem hübschen Gesicht.
Und tatsächlich, jeder, der ihm begegnete, ging davon aus, dass er Arbeit hatte. Kaum einer begriff, dass man als Schauspieler zwar reichlich Arbeit haben konnte, was aber noch lange nicht hieß, dass man tatsächlich auch bezahlt wurde!
Hughie zog noch einmal an seiner Zigarette.
Was war bloß aus der Kunst geworden?
Hughies Mutter und seine Schwester Clara fingen immer wieder davon an, wie er leben, essen und ein nützliches Mitglied der Gesellschaft sein sollte. Bla, bla, bla. Sie kapierten es einfach nicht. Nicht zum ersten Mal spürte Hughie die vertraute, entmutigende Last, die es bedeutete, ein Venables-Smythe zu sein.
Es hatte eine Zeit gegeben, da war es Schicksal gewesen, ein Venables-Smythe zu sein; ein Passierschein in die Welt der britischen Oberklasse. Doch zu der Zeit, als Hughie in den einst berühmten Clan hineingeboren wurde, hatte es nur noch den Namen zu erben gegeben, einen vornehmen Akzent und eine leicht traumatische Internatsschulzeit. Sein Großvater hatte den Familiensitz samt unschätzbar wertvoller Antiquitäten und Familienporträts im Jahre 1977 an eine amerikanische Hotelkette verkauft. Die Kaufsumme, die einem damals riesig vorgekommen war, hatte sich im Nachhinein als echter Spottpreis erwiesen. Dafür hatte er sich eine miserabel umgebaute Wohnung in Chelsea gekauft, einen Großteil seines Geldes in Betamax investiert und Hughies Vater, Robert Armstrong Venables-Smythe, seinen Playboy-Lebensstil finanziert. Hughies Vater, der einst genauso attraktiv gewesen war wie Hughie jetzt, fand Gefallen an Ralph-Lauren-Hemden, Gucci-Slippern, italienischen Autos und quirligen Blondinen mit üppigen Brüsten. Hughies Mutter, Rowena Compton Jakes, eine neunzehnjährige, flachbrüstige Brünette, schüchtern bis zur gesellschaftlichen Unbrauchbarkeit, hatte er kennengelernt, als sie bei Tiffany’s arbeitete, wo sie für die Hochzeitstische zuständig war. Zwei Jahre später hatten sie geheiratet, und Robert hatte in Fulham ein Immobilienbüro gegründet. Er hatte nichts über den Immobilienmarkt gewusst, doch er besaß sehr viel Charme, mit dem er bei ausgedehnten Mittagessen im San Lorenzo eine Reihe junger Sekretärinnen beglückte, die ihn Bobby nannten.
Als Hughie fünf Jahre alt war, verschwand sein Vater bei einem mysteriösen Unfall beim Tiefseefischen vor der Küste von Malta. Seine Mutter behauptete immer noch, der Unfall sei vorgetäuscht gewesen, doch er war nie zurückgekehrt, und das Immobilienbüro war still und leise bankrottgegangen. Der vernichtende Schlag hatte den Beginn harter Zeiten markiert.
Doch harte Zeiten bringen große, heldenmütige Taten hervor. Und so geschah es, dass Hughies Mutter ihre wahren Qualitäten zum Vorschein brachte. Sie strich das Wohnzimmer rot, kaufte bei Peter Jones einige Sofakissen und verkündete, sie sei jetzt Innenausstatterin à la Jocasta Innes. Ein Drink am Morgen half ihr über ihre Schüchternheit hinweg. Den äußeren Schein gesellschaftlicher Ehrbarkeit hielt sie aufrecht, indem sie in Designer-Secondhand-Läden einkaufte und ihre Kinder unter großen persönlichen Opfern auf die besten Schulen schickte. Und sie war durch und durch davon besessen, dass ihre Kinder nicht nur die Art von finanzieller Sicherheit erlangen sollten, die sowohl ihrem Vater als auch ihrem Großvater versagt geblieben war, sondern sich auch zurück in den Schoß ihrer Klasse katapultieren sollten.
Und so erhielt Hughies fleißige ältere Schwester Clara ein Stipendium, um in Cambridge Altphilologie zu studieren, während Hughie, der von nahezu sämtlichen Einrichtungen von Bedeutung abgewiesen wurde, sich in einer drittklassigen Schauspielschule in King’s Cross einschrieb und sich daranmachte, sein Handwerk zu erlernen.
Ab und an versuchte Hughie, sich das Gesicht seines Vaters vorzustellen. (Seine Mutter hatte sämtliche Fotografien systematisch vernichtet.) Wie er jetzt wohl aussehen würde?
Er schob die Zigarette in einen Mundwinkel und holte das einzige übrig gebliebene Foto aus seiner Brieftasche. Das verblasste Polaroid zeigte Hughie mit drei Jahren an einem Strand in Spanien an der Hand seines Vaters. Robert beugte sich über ihn, seine andere Hand lag auf Hughies unterem Rücken. Er lachte, braun gebrannt, glücklich.
Hughie hatte das Foto im Laufe vieler Jahre so oft und so lange betrachtet, dass es eine Erinnerung bildete, wo keine existierte. Manchmal stellte er sich vor, immer noch die beruhigende Berührung seines Vaters zu spüren, eine feste Hand, die ihn durch das Unbekannte leitete und ihm half, ein Mensch zu werden, ein Mensch, auf den er stolz sein könnte.
Hughie schob das Foto zurück in seine leere Brieftasche.
Das Unbekannte: Da war es wieder, lauerte ihm auf. Er war gerade von einem dreiwöchigen Engagement in Edinburgh zurückgekommen, wo er in einem improvisierten Musical über Obdachlosigkeit mit dem Titel Abfall! mitgespielt hatte. Viel mehr als »Land of Hope and Glory« konnte er nicht singen, doch er hatte während seiner Schulzeit in Harrow oft genug Benjamin Britten gehört, um so tun zu können, als sei er ein passionierter Liebhaber atonaler Harmonien. Sooft er einen falschen Ton erwischte, machte er ein ernstes Gesicht und sang noch lauter. Mit der Zeit hatte der Rest der Truppe seinen musikalischen Wagemut zu bewundern gelernt. (Allerdings hatte er nach einem nächtlichen Trinkgelage um einiges atonaler gesungen, als er überhaupt vorgehabt hatte.)
Doch jetzt war er wieder in London, lebte auf dem Sofa in Claras Vorderzimmer, und Geld war offiziell ein Problem. Im Grunde war auch Clara ein Problem.
Clara war dem Rat ihrer Mutter gefolgt: Sie arbeitete in einer großen PR-Agentur in der City, schritt in hochhackigen Schuhen aus wie ein Mann, trug marineblaue Kostüme und hatte sich die Haare zu einem schlaffen, farblosen Bubikopf schneiden lassen – der bei jeder anderen Frau auf die Miss-Moneypenny-Art sehr sexy gewesen wäre. Ihre Arbeitszeit und ihr Ehrgeiz waren dergestalt, dass Hughie sie kaum zu sehen bekam, doch sie hinterließ ihm kleine gelbe Haftnotizen, auf denen stand, was er zu tun (oder zu lassen) hatte (je nachdem). Manchmal war Hughie davon überzeugt, dass sie mitten am Tag nach Hause kam, um frische Zettelchen auf alles zu kleben, was er je angerührt hatte: »Das ist KEIN Aschenbecher!« auf den Porzellan-Übertopf aus dem achtzehnten Jahrhundert, den ihr Verlobter Malcolm (ein Porzellan-Spezialist bei Sotheby’s, den – außer Clara – alle eindeutig für schwul hielten) ihr geschenkt hatte; »Klapp die Brille RUNTER!« auf den Toilettendeckel; »Kauf dir deine EIGENE MILCH!« auf den Kühlschrank und »Vergiss nicht schon wieder deine blöden SCHLÜSSEL!« auf die Innenseite der Tür, als er gerade (ohne seine verdammten Schlüssel) die Wohnung verlassen wollte. Es stimmte ja, er hatte nur ein paar Tage bleiben wollen, aber sie stellte sich auch wirklich an, die blöde Kuh. Nichts hatte sich zwischen ihnen verändert, seit er sechs und sie zehn Jahre alt gewesen waren und sie ihn den ganzen Tag herumkommandiert hatte wie eine kleinere, bösere Ausführung ihrer Mutter, nur dass sie erheblich nüchterner war als ihre Mutter und ihr folglich erbarmungslos rein gar nichts entging.
Er drückte seine Zigarette aus und winkte die Kellnerin herbei.
Ein schmächtiges Mädchen mit kastanienbraunem Haar kam herüber und reichte ihm die Rechnung.
»Sie nehmen nicht zufällig Amex, oder?« Hughie lächelte (das Venables-Smythe-Lächeln musste man gesehen haben – zwei Reihen strahlend weißer Zähne, gerahmt von Grübchen, und ein Paar sehr blaue Augen).
»Ich ... ähm ...«
»Schauen Sie« – er linste auf ihr Namensschild –, »Rose, die Sache ist die, ich bin ein bisschen knapp mit Bargeld. Aber ich komme regelmäßig her, Sie haben mich schon mal gesehen. Ich bin fast jeden Tag hier.«
»Ja, ja... das stimmt«, räumte sie ein. »Aber es ist auch schon das dritte Mal in einer Woche, dass Sie ein bisschen knapp sind.«
»Hören Sie.« Er stand auf. »Ich sage Ihnen was: Warum gewähren Sie mir nicht noch einen Tag Kredit, und ich verspreche Ihnen beim Grab meiner Mutter, dass ich morgen reinkomme und es wiedergutmache.« Sein Lächeln wurde breiter. Sie errötete. »Dann sind wir uns einig?«
»Okay.«
Hughie drückte ihr rasch einen Kuss auf die Wange. »Sie sind ein Star, Rose! Ein absoluter Star!« Er öffnete schwungvoll die Tür.
»Warten Sie einen Moment! Wie heißen Sie?«
»Verzeihen Sie! Hughie.« Er streckte ihr die Hand hin. »Hughie Armstrong Venables-Smythe. Also, geben Sie mich nicht auf, Rose, ja? Ich komme gleich morgen früh her, Sie haben mein Wort.« Und er schob sich seine Ausgabe der Stage unter den Arm und ging.
Draußen hob er einen abtrünnigen Apfel auf, der außer Sichtweite des Obstverkäufers an der Ecke gerollt war, rieb ihn an seiner Jeans sauber, biss hinein und dachte, während er nach Hause schlenderte, über die Anzeige nach.
Unregelmäßige Arbeitszeiten. Großzügiges Salär. Das klang doch so, als wäre es genau das Richtige für ihn. Aber am aufregendsten fand er »moralisch flexibel«. Zunächst einmal war er sich nicht sicher, ob er überhaupt irgendeine Moral besaß. Wie konnte man das heutzutage wissen? Was waren die Kriterien? Abgesehen von den allzu offensichtlichen Richtlinien (Würde man jemanden töten? Wie stand man dazu, alte Menschen zu bestehlen?), fühlte er sich auf diesem Gebiet merkwürdig uninformiert. Doch es war klar, dass »moralisch flexibel« bei weitem attraktiver war als alle anderen Optionen.
Leticia würde ihn dafür lieben.
Kapitel 2:Eine Selfmadefrau
Leticia Vane schlenderte, mit dem Schlüsselbund in ihrer Hand klimpernd, die Elizabeth Street hinunter. Sie gehörte zu den jungen Frauen (ja, selbst mit fast Mitte dreißig betrachtete sie sich noch als junge Frau), die genau wussten, wie ihr Körper aussah und welche Wirkung er hatte, wenn sie sich bewegte. Obwohl in diesem Teil der Welt am Vormittag kaum jemand auf der Straße war, stellte sie sich gerne vor, die Leute würden sie beobachten und spüren, dass in ihr eine gewisse gefährliche Lust brodelte.
In der Tat war Leticia Vane in vielerlei Hinsicht ihre eigene erlesenste Kreation. Sie hatte das wenige Rohmaterial genommen, das die Natur ihr zugeteilt hatte, und es gegossen, geformt und daran herumgesäbelt wie ein Bildhauer, der ein Stück Marmor abschlägt.
Nichts war geblieben von ihrem vorigen Leben als Emily Ann Fink aus Hampstead Garden Suburb. Die dichte, durchgehende Augenbraue, mit der sie zu zieren Gott für angebracht gehalten hatte, war verschwunden und zu zwei schlanken, ausdrucksstarken Bögen gezupft, der Überbiss war längst korrigiert worden, das langweilige braune Haar in einem schimmernden Schwarz gefärbt, das die Farbe ihrer Augen besser zur Geltung brachte. Sie hatte ein nettes Gesicht, doch sie hatte begriffen, dass sie keine Schönheit war, und deshalb sehr viel Zeit ihrer Figur gewidmet. Gegessen wurde nur ein Mal am Tag, die übrige Zeit wurde geraucht. Jung zu sterben war um einiges besser, als fett zu sterben. Es hatte sehr viel harte Arbeit erfordert, Leticia Vane zu erschaffen, Arbeit, die nicht viele Menschen goutierten.
Natürlich gab es auch eine Vorgeschichte. Eines von zwei Kindern eines Wirtschaftsprüfers und einer deprimierten Lehrerin zu sein war ihr nicht gut genug. Leticia wollte etwas Exotischeres und machte aus ihren Eltern Diplomaten, die in fernen Ländern dienten. Sie war an einer Reihe exotischer Orte aufgewachsen, hatte Sprachen gelernt (war jedoch viel zu höflich, in der Öffentlichkeit damit anzugeben), hatte unnatürlich früh erste Affären gehabt, war Hals über Kopf verliebt gewesen, litt aber immer noch an einer Vergangenheit, die viel zu geheim und zu schmerzhaft war, um irgendjemandem davon zu erzählen.
Sie hatte sich immer danach gesehnt, einzigartig zu sein. Eine Rarität. Und jetzt rechnete sie sich aus, dass sie wahrscheinlich noch zehn Jahre hatte, um die Früchte ihrer Arbeit wirklich zu genießen. Denn die fragile Natur ihrer Errungenschaften machte sie umso kostbarer.
Und so schlenderte sie mit wiegenden Hüften die Straße entlang, nur für den Fall, dass jemand aus dem Fenster schaute und überlegte, was diese junge Frau um diese Tageszeit vorhatte. Angeberisch drehte sie den Schlüssel in dem Schloss des winzigen Ladens.
Bordello war ein Laden für Damenunterwäsche, doch es gab keine Regale und keine Kleiderstangen, an denen in langen Reihen seidene Fähnchen hingen, keine ausgezehrten Schaufensterpuppen mit harten Brustwarzen in Stringtangas aus Spitze. Der Raum sah viel eher aus wie ein Pariser Salon um die Jahrhundertwende als wie ein Laden. Die Wände waren mit schmalen schwarz-weißen Streifen tapeziert, die Louis-quatorze-Fauteuils waren mit elfenbeinfarbener Rohseide bezogen, ein seltener kobaltblauer Kronleuchter warf azurblaues Licht in den Raum. Leticia offerierte maßgeschneiderte Dessous. Es gab keine Musterstücke. Es gab jedoch meterweise exquisit gealterte Seiden- und Satinstoffe in den blassesten Farben: Champagner, Taubengrau, Perlmutt und Daumennagelrosa. Ballen mit duftigem Organdy stapelten sich in den Ecken, und es gab Körbe mit Spitzen – alte, handgefertigte, winzige Kunstwerke, die sie aus der ganzen Welt zusammengetragen hatte. Auf einem runden Mahagonitisch in der Mitte des Raums stapelten sich ihre Skizzenbücher mit ihren neuesten Kreationen. Es gab keine Umkleideräume, nur ein luxuriös ausgestattetes Badezimmer mit einer antiken Badewanne sowie ein schmales Schneideratelier.
Leticia verkaufte einen sexuellen Traum, in dem ihre Kundinnen die Stars waren. Sie schuf ein Bühnenbild von subtiler erotischer Eleganz, gerade glamourös und sinnlich genug, um die Phantasie der Frauen, für die sie arbeitete, zu beflügeln.
Und Leticia Vane arbeitete nicht für jede. Wer zu ihr kommen wollte, brauchte eine Empfehlung. Exklusivität war keine Frage des Geldes mehr, jeder und alle hatten Geld. Wer begehrenswert sein wollte, musste sich nur rar machen. Prominente waren der Todeskuss für jedes Unternehmen, denn wenn sie aus der Mode kamen, ging man flugs mit unter. Und sie fertigte nichts für Frauen mit Brustimplantaten. Leticias Einwände waren rein ästhetischer Natur, denn Implantate zerstörten schlichtweg die Ausgewogenheit ihrer Kreationen. Leticia war stolz darauf, dass sie da helfen konnte, wo die Natur nachlässig oder schroff gewesen war. Ihre Nachthemden hatten eingearbeitete BHs, die sie anhand von Gipsabgüssen der Brüste ihrer Kundinnen entwarf. Sie kümmerte sich um Unstimmigkeiten in Größe und Form und glich sie mit sanfter Hand aus. Indem sie die Innenseite der Körbchen neigte, ließ sie die Brüste nach vorn sinken, unbekümmert überquellen, doch niemals ganz herausrutschen, gebändigt durch hauchdünne Schichten reinsten Tülls.
So etwas Vulgäres wie offene Slips oder ausgeschnittene BHs zu fertigen kam ihr nicht in den Sinn, doch sie wusste, wie man die Hautfarbe betonte und den Stoff ihrer Kreationen mit der Hand so einfärbte, dass die Brustwarzen darunter rosa und leicht geschwollen wirkten. Und ihre berühmten französischen Schlüpfer waren so seidig und weit, dass sie leicht zu einer Seite geschoben werden konnten, ohne sie ganz ausziehen zu müssen.
Leticias größter Pluspunkt war, dass sie Männer verstand und Mitgefühl mit Frauen hatte. Das Problem bei den meisten Dessous war, dass just die Körperteile, die zur Geltung gebracht werden sollten, abschreckend wirkten. Nicht jeder Mann war scharf darauf, nach einem langen Arbeitstag nach Hause zu kommen und seine Frau in absonderlich grelle Miederwaren für dreihundert Pfund geschnürt vorzufinden – wie sie versuchte, sexy zu sein in einem Aufzug, in den sich hineinzuzwängen sie eine volle halbe Stunde gebraucht hatte. Ein so gearteter Annäherungsversuch brachte nur beide in Verlegenheit, da sie unsicher waren, wie mit den diversen Schnappverschlüssen und Bändern umzugehen war. Hinzu kam der Druck, besonders tollen Sex zu haben, der die horrenden Ausgaben rechtfertigte. Leticia wusste, wenn eine Frau sich so viel Mühe gab, dann befand sich ihr Sexleben in einer Krise. In so einem ungewohnten Kostüm kam eine Frau sich leicht lächerlich vor. Die Verzweiflung stand ihr doch quasi auf der Stirn geschrieben. Eine Frau, die sich so deutlich anbot, lief umso mehr Gefahr, sexuell zurückgewiesen zu werden.
Leticia glaubte fest daran, dass Qualität das Ergebnis von Quantität war. Guter Sex war schlicht ein Nebenprodukt von viel Sex, in allen Varianten, grob, langsam, schnell, bis hin zu traumhaft und langatmig, beiläufigem Befummeln, neckenden Berührungen, oralen Schlemmereien – all das war für sie Sex. Und so schuf sie, um eine unbewusste Aura sexueller Empfänglichkeit zu fördern, verfeinerte Versionen alltäglicher Stücke; täuschend schlichte weiße Nachthemden, die aus solch hauchdünnem Material gefertigt und so raffiniert geschnitten waren, dass sie den Körper in einen aufreizenden, duftigen Schleier hüllten, die Brustwarzen betonten, dem Schwung der Hüfte schmeichelten, Beine länger wirken ließen und sich bei jeder Bewegung verführerisch bauschten. Gerade weil sie so unschuldig und anspruchslos wirkten, waren sie unbestreitbar erotisch. Statt »Fick mich!« zu schreien, flüsterten sie: »Nimm mich ... schau ... ich sehe nicht mal hin!« Das Raffinierteste daran war, dass der Wunsch nach Sex von ihm ausging, weil er gar nicht anders konnte, als der Faszination der erotischen Untertöne zu erliegen. Die Stücke zwangen einen Mann dazu, zu handeln, und gaben der Frau das Gefühl, passiv und träge zu sein. Sie konnte sich zurücklehnen und ihren Ehemann ködern. Und ein Mann, der sexuell die Initiative ergriff, fühlte sich potenter als einer, dem Sex aufgedrängt wurde.
Diese unschätzbare Einsicht hatte Leticia, zusammen mit allem anderen, was ihr Gewerbe betraf, von ihrem Patenonkel Leo gelernt. Er war Kostümbildner im West End gewesen. Und wie Leticia war er durch und durch seine eigene Kreation. Er rauchte dünne, schwarze russische Zigaretten, hatte sich wahrscheinlich schon in den sechziger Jahren die Nase richten lassen und trug sein schönes silbernes Haar schulterlang wallend. Seinen Kleidungsstil bezeichnete er als »à la Audrey« – schwarzer Rollkragenpullover aus Kaschmir, schwarze maßgeschneiderte Hose, weiche Lederslipper, die er sich eigens anfertigen ließ. Er lachte oft und weigerte sich beharrlich, sich irgendeiner Form von Selbstmitleid oder Pessimismus hinzugeben.
Er stammte aus einer anderen Welt – nicht nur aus der Theaterwelt, sondern aus einem völlig anderen Zeitalter, einem Zeitalter, das wegen Tricks und Betrügereien keine Skrupel gehegt hatte, das nicht den Wunsch gehabt hatte, natürlich zu erscheinen, und das begriffen hatte, dass ein kleiner Taschenspielertrick nichts war, dessen man sich schämen musste. Er war Garderobier von Marlene Dietrich gewesen, als sie ihre Haare unter ihrer Perücke festgesteckt hatte, hatte bei My Fair Lady Schweißpolster in Julie Andrews’ Kleider genäht und sogar die Ärmel von Vivian Leighs Kostümen abgeändert, damit nach einer schlechten Nacht niemand bemerkte, wie ihre Hände zitterten.
Leticia zog ihre Jacke aus, hängte sie an einen Haken hinter der Tür und sah sich zufrieden um. Leo war jetzt in Rente, doch er liebte den Laden. Die Badewanne war seine Idee gewesen. (Sie bebte gewaltig, wenn man die Wasserhähne aufdrehte, doch sie sah exquisit aus.) Er war der einzige Mensch, der ihre Sammlung von Spitzen und die seltene Qualität der Ballen wunderschöner Stoffe zu schätzen wusste.
Wenn er nicht gewesen wäre, würde sie womöglich immer noch in Hampstead Garden Suburb dahinvegetieren. Er hatte ihr ein Vogue-Abonnement geschenkt, da war sie acht Jahre alt. Als sie zehn war, hatte er Leticia in seinem eigenen Atelier einen eigenen kleinen Arbeitstisch zur Verfügung gestellt. Dort saß sie, fertigte Skizzen an und sah aufmerksam zu, wenn er die größten Bühnendiven der damaligen Zeit aus verängstigten, egomanen Neurotikerinnen in Geschöpfe verwandelte, die universeller Bewunderung würdig waren. Als Teenager nahm er sie mit ins Theater, bestellte ihr im legendären Kettner’s ihren ersten Cocktail, brachte ihr bei, sich die Augenbrauen zu zupfen und sich auf eine Art zu bewegen, die Aufmerksamkeit erregte. Er lehrte sie den Unterschied zwischen einer Präsenz, die alle in ihr warmes Glühen einschloss, und einer Haltung, die einem die ganze Welt vom Leib hielt.
Es gab nichts, was Leo nicht mit einem magischen Hauch verzaubern konnte. Nichts, was er nicht richten konnte.
Sie schlug ihren Terminkalender auf und überflog die Liste der Namen. Eine Liebesromanautorin, eine Herzogin und eine reiche Amerikanerin aus Savannah. Mehr als drei Termine am Tag machte sie nicht gern, und auf keinen Fall vor elf Uhr am Vormittag. Der frühe Morgen war nicht besonders sexy, sobald man aufgestanden war und sich angezogen hatte, lastete das Gewicht des Tages zu schwer auf jedermanns Gewissen.
Ihr Handy klingelte. Sie klappte es auf. Es war Leo.
»Engel, wie geht es uns heute Morgen?«, schnurrte er mit einer von Tausenden von Zigaretten rauen Stimme.
»Hervorragend. Kommst du heute vorbei? Bitte sag, dass du kommst! Ich habe eine Bestellung für einen seidenen Kimono, den ich weder für Liebe noch für Geld richtig drapiert kriege. Die Frau hat einen Busen wie eine Gebirgskette. Ich verspreche dir, ich lade dich zu einem langen, alkoholisierten Mittagessen ein, wenn du das hinkriegst.«
»Ich würde ja zu gerne, aber ich kann nicht. Ich fühle mich heute Morgen ein bisschen mitgenommen. In Wirklichkeit habe ich die halbe Nacht mit Juan Strip-Poker gespielt. Du erinnerst dich doch an Juan, oder?«
»Der Krankenpfleger aus Brasilien?« Sie blätterte die Morgenpost durch. Mal wieder eine Postkarte von ihren Eltern aus Israel. Etliche braune Umschläge. Wie langweilig. Sie warf sie ungeöffnet in den Papierkorb. »Warst du nicht zu dem Schluss gekommen, er sei zu jung für dich? Spricht er überhaupt Englisch?«
»Sei nicht so gehässig, Schatz. Sein Englisch ist richtig gut geworden. Abgesehen davon« – sie hörte, wie er sich eine neue Zigarette anzündete – »vergeuden wir unsere Zeit nicht mit Konversation.«
»Bitte! Ich will nicht alle deine Geheimnisse wissen!«
»Du kennst sie sowieso.«
Sie lächelte. »Ich habe eines.«
»Wirklich? Was oder eher wer ist es?«
»Na, wer ist denn jetzt gehässig? Er heißt Hughie, und er ist köstlich!«
»Wie alt?«
»Oh, ich weiß nicht ... Anfang zwanzig?«
Sie hörte ihn ausatmen. »Du brauchst einen richtigen Mann, Leticia. Keinen grünen Jungen.«
»Und das aus deinem Mund!« Resolut klappte sie ihren Terminkalender zu. »Richtige Männer gibt’s gar nicht. Ist dir das noch nicht aufgefallen? Abgesehen davon ist er nur eine Affäre.«
»Affären haben auch Gefühle, weißt du.«
»Das bezweifle ich. Alles, was Männer wollen, ist Sex. Besonders junge Männer.«
»Und was ist mit dir? Was willst du?«
Sie fuhr mit den Fingern über einen besonders exquisiten und teuren Ballen blauen französischen Seidensatins. »Wen schert’s, was ich will? Was zählt, ist, was ich haben kann.«
»Emily Ann ...«
Sie zuckte zusammen. »Du weißt, dass ich diesen Namen hasse, er ist so unglaublich hässlich!«
»Emily«, wiederholte er nachdrücklich, »ich mache mir Sorgen. Diese Affären werden bei dir noch zur Gewohnheit.«
»Warum auch nicht? Wir leben in einer Wegwerf-Gesellschaft. Es hat keinen Sinn, sich zu sehr an etwas zu binden.«
»Du bist viel zu jung, um so zynisch zu sein.«
»Oh, bitte!« Sie seufzte. »Lass uns heute nicht ernst werden! Ich kann nicht, ich bin nicht in der Stimmung. Ich will mich bloß ein bisschen amüsieren. Und Hughie ist amüsant.«
»Er ist auch ein Mensch aus Fleisch und Blut.«
»Was meinst du damit? Dass ich einen schlechten Einfluss auf ihn ausübe? Keine Vorträge ... nicht heute.«
»Ich sage doch nur, dass du vorsichtig sein sollst.«
»Hör auf, Leo«, warnte sie ihn.
Er achtete nicht darauf. »Du tust so, als wärst du hart, obwohl wir doch beide wissen, dass du das gar nicht bist.«
»Ich muss jetzt.«
»Schatz, ich hab dich lieb, und ich will nicht, dass du verletzt wirst.«
»Was? Von Hughie?« Sie lachte. »Siehst du, darum geht’s doch! Er kann mich nicht verletzen! Und ich kann ihn nicht verletzen. Wir haben Regeln, Leo. Es geht nur um Sex ... mehr nicht.«
»Ich habe Neuigkeiten für dich, Sonnenschein. Regeln hin oder her, dein Herz hast du nicht unter Kontrolle. Das hat niemand.«
»Hör zu, ich ruf dich später noch mal an. Ich habe jede Menge Arbeit, und wenn du nicht vorbeikommst, muss ich sehen, wie ich allein mit dieser Kimonomonstrosität fertig werde. Wir reden später, ja? Und keine heißen Brasilianer mehr, verstanden?«
Sie klappte das Handy zu und drückte die Hände auf die Augen.
Leo war so schwierig.
Und plötzlich war er wieder da, der dumpfe Schmerz, legte sich schwer über sie. Jetzt war es ein dumpfer Schmerz, doch mindestens ein Jahr lang war es ein brennender, schneidender Schmerz in ihrer Brust gewesen, als würde jemand sie ohne Anästhesie am offenen Herzen operieren. Sie hatte nicht essen, nicht schlafen können ...
Der verdammte Kerl! Warum musste er so ... so hart über sie urteilen?
Sie atmete tief durch.
Es spielte keine Rolle. Das lag inzwischen alles hinter ihr. Sie war wieder auf die Füße gekommen und besser drauf denn je.
In ihrem Atelier stellte Leticia den Wasserkessel auf den Herd und zündete sich eine Zigarette an. Zwischen der Herzogin und der Schriftstellerin war genug Zeit, dass Hughie vorbeikommen konnte. Sie lehnte sich an die Arbeitsplatte, inhalierte tief und schloss die Augen.
Hughie war groß und jung und sah auf klassische Weise gut aus. Und er war unglaublich leicht zu kontrollieren! Es gab keine Machtkämpfe, keine zimperlichen Verabredungsrituale oder Manipulationen. Sie rief an, er kam, sie bumsten. Und dann bumsten sie noch ein bisschen.
Es war eine einfache und in gewisser Weise schöne Beziehung. Hughie hatte etwas an sich, eine Frische. Keine tiefgründigen Gedanken oder finsteren Stimmungen mischten sich in sein Spiel. Natürlich musste er noch viel lernen, er war wie ein Rohdiamant. Doch das war aufregend. Und das Beste war, dass er verrückt war nach ihr. Es war nur eine Affäre, doch in jeder Beziehung gab es einen, der anbetete, und einen, der angebetet wurde. Angebetet hatte sie schon, und sie zog es bei weitem vor, dass es jetzt andersherum war.
Das Teewasser kochte. Sie löffelte die losen Blätter des Earl-Grey-Tees behutsam in eine blaue Tiffany-Kanne und goss das heiße Wasser darüber. Das Aroma breitete sich im Raum aus.
Versonnen blickte sie aus dem Fenster in den kleinen Garten hinter dem Haus.
Leo hatte unrecht. Niemand konnte sie je wieder verletzen, das würde sie nicht zulassen.
Sie rührte den Tee kurz um und schenkte sich eine Tasse ein. Das waren die Stunden, die sie am meisten liebte, wenn der Tag noch vor ihr lag wie eine golden schimmernde Verheißung, unberührt von Enttäuschungen oder Frustrationen. Sie setzte sich an den Tisch, stellte ihre Teetasse auf eine kleine Bank, weit weg von ihrer Arbeit, schlug ein in Seidenpapier eingewickeltes Päckchen Seide auf und führte sicher und geschickt die Nadel.
Die Morgensonne wärmte ihr den Rücken, draußen sangen die Vögel. Leticia trank ihren Tee.
Kaum etwas war so fragil wie alte Spitze oder das menschliche Herz.
Dann hörte sie etwas.
Hartnäckig, lästig.
Aus dem Badezimmer.
Es tropfte, und das bedeutete, dass hier dringend ein Klempner gebraucht wurde.
Kapitel 3:Tee für Tisch fünf
Rose, die Kellnerin in Jack’s Café, blieb am Fenster stehen und beobachtete, wie Hughie Armstrong Venables-Smythe die Straße hinunter durch die Menschenmenge schlenderte.
»Bestellung fertig!«, rief Bert aus der Küche hinter ihr.
»Ich habe gesagt, Bestellung fertig!«, rief er noch einmal.
Rose drehte sich um und servierte dem Mann an Tisch sieben zwei gebratene Eier, Würstchen, Bohnen und Tomaten, bevor sie die Reste von Hughies Frühstück abräumte. Dann nahm sie 4,95 Pfund aus ihrer Tasche mit dem Trinkgeld und tat sie in die Kasse.
»Rose! Tee für Tisch fünf!«, rief Bert. »Was, zum Teufel, ist denn heute los mit dir?«
»Nichts«, sagte sie und schenkte Tee aus. »Überhaupt nichts.«
Sie brachte Sam, dem Klempner, der regelmäßig an Tisch fünf saß, seinen Tee. Sam war Ende dreißig und hatte einen Wust dunkler, ungebärdiger Haare, inzwischen mit Grau durchsetzt, wilde, blassgraue Augen und ein sardonisches Lächeln. Er hatte Anfang des Jahres das alles andere als florierende Klempner- und Heizungsinstallateur-Geschäft seines Vaters geerbt, mitsamt dessen bereitwilligem Lachen und seiner langsamen, trägen Gangart. Im Augenblick war er gerade in einen Katalog mit Plastik-Knierohren vertieft.
»Danke.« Er nahm, konzentriert die Stirn runzelnd, einen Schluck.
»Gütiger Himmel, Sam, machst du je mal eine Pause?«
»Wozu?« Er zuckte die Achseln. »Es ist jetzt mein Geschäft, wenn ich es nicht zum Erfolg bringe, dann tut’s niemand.«
»Aber Knierohre zum Frühstück?« Sie schüttelte den Kopf. »Dein Vater war immer viel lockerer.«
»Tja, wenn mein alter Herr genauso viel Zeit in das Geschäft investiert hätte, wie er im Pub verbracht hat, dann wäre er womöglich noch unter uns.« Sein Tonfall war scharf.
Der alte Roy, Sams Vater, hatte in demselben Block mit Sozialwohnungen gewohnt wie Rose, sie kannte die beiden seit Jahren. Er war ein legendärer Charakter gewesen, bei Frauen und Männern gleichermaßen beliebt; ein Mann, dessen freche gute Laune ihn von den normalen Regeln des Lebens auszunehmen schien. Im Laufe der Jahre hatten er und Sam, der eine so stur wie der andere, häufig miteinander im Clinch gelegen. Sam war ehrgeizig, und der alte Roy war normalerweise verkatert. Doch jetzt, da er nicht mehr lebte, fiel Rose an Sam eine gewisse Nervosität auf; eine uncharakteristische Ernsthaftigkeit, die seine ganze Persönlichkeit umgab. In letzter Zeit hatte er nur noch Interesse für eine Sache: seine Karriere.
»Tut mir leid, Sam, ich hab nicht überlegt.« Mit einem Tuch fuhr sie geistesabwesend über die Tischplatte und stieß die Zuckerdose um. »Oh, verdammt!«
Er schaute auf, klare Augen umrahmt von dichten, fransigen Wimpern. »Bist du mal wieder in deiner Traumwelt?«
»Was redest du da?«
»Nun« – er stellte seinen Teebecher ab – »er hat dich geküsst, nicht wahr, Red?«
Sam entging nichts.
»Und wenn schon.« Sie errötete, wandte sich ab und tat so, als würde die Aufgabe, am Nebentisch einen Kaffeefleck zu entfernen, sie völlig in Anspruch nehmen. »Und nenn mich nicht immer Red. Ich bin zu alt für Spitznamen. Ich bin fast zweiundzwanzig, längst kein Kind mehr.«
»Ja. Klar.«
Ohne sich umzudrehen, wusste sie, dass er lachte.
»Du magst ihn«, neckte Sam sie.
»Ach, ich weiß nicht.« Rose gab sich alle Mühe, gelangweilt und blasiert zu klingen. Leider war sie zu aufgeregt, um die Verstellung lange durchzuhalten. »Aber ich glaube, er mag mich. Er kommt morgen wieder!«
»Hat er seine Rechnung bezahlt?«
»Also, er hätte ja gern, aber wir nehmen keine Amex.«
Sam verdrehte die Augen. »Jedes Mal, wenn er reinkommt, endet es damit, dass du für ihn bezahlst.«
»Er hat gerade kein Bargeld, das ist alles. Viele Leute kriegen ihr Geld erst am Monatsende.« Sie band ihr Haar im Nacken zu einem Pferdeschwanz zusammen. (Jetzt, da er weg war, konnte sie das wieder tun.) »Ich finde, er sieht aus wie Prinz William.«
»Warum lernst du keinen netten, normalen Kerl kennen?«
»Und wann sollte ich dafür Zeit finden?«, fragte sie verärgert. »Vergiss nicht, ich habe ein Kind. Wer will denn schon mit einer alleinerziehenden Mutter ausgehen?«
»Ach, Unsinn, Rose! Du bist noch so jung! Es gibt da draußen so viele Männer. Weißt du, richtige Männer mit Geld statt Versprechungen.«
Rose zog eine Grimasse.
»Apropos Kind, wie geht es Rory?«, fragte er.
Sie seufzte. »Er hat gestern in der Kindertagesstätte ein anderes Kind gebissen.«
»Na, die machen doch alle schwierige Phasen durch, wenn sie in die Schule kommen.«
»Du verstehst das nicht.« Sie sammelte sämtliche Ketchup-Spender ein und machte sich daran, sie aufzufüllen. »Er hat den Kleinen gebissen, der allergisch auf Nüsse, Weizen und Milch ist; der kleine Kerl hat kaum etwas, wofür es sich zu leben lohnt! Und am Tag davor hat er der Erzieherin einen Kopfstoß verpasst. Sie hatte eine Beule von der Größe eines Eis an der Stirn!«
»Also ...« Mehr konnte er mit seiner Junggesellenerfahrung dazu wohl nicht beitragen. »Ich würde mir keine Sorgen um ihn machen. Und jetzt« – er wechselte das Thema, um auf vertrauteres Terrain zu kommen – »was machen wir mit dir?«
»Mit mir?« Rose wischte die glänzenden Deckel der Ketchup-Spender sauber.
»Ja, mit dir. Du bist eine kluge junge Frau. Findest du nicht, es wäre an der Zeit, dass du etwas anderes machst als kellnern?«
Sie lächelte schief. »Es kann nicht jeder so ein erfolgreicher Geschäftsmann sein wie du, Sam.«
Er zog die Augenbrauen hoch. »Was soll das heißen? Hör zu, ich mache aus dem Laden ein gut gehendes Geschäft, und wenn es mich umbringt. Wenn du glaubst, ich wollte wie mein Vater in einer Sozialwohnung in Kilburn leben und sterben, dann irrst du dich.«
»Hey!« Sie schlug mit dem Küchenhandtuch nach ihm. »Ich würde gern mal wissen, was daran so schlecht ist?«
»Was woran so schlecht ist?«
Sie drehten sich beide um.
Es war Ricki, Roses Cousine. Ricki arbeitete als Landschaftsgärtnerin bei einer Firma in Islington. Mit ihren kurz geschnittenen Haaren, ihrem gebräunten, muskulösen Körper und ihrer Kluft aus schweren Arbeitsstiefeln, tailliertem T-Shirt und tief auf den Hüftknochen sitzender Jeans, die ihren festen, flachen Bauch vorteilhaft zur Geltung brachte, sah sie eher gut aus als hübsch. Auf dem Weg zur Arbeit schaute sie jeden Tag auf einen Kaffee und einen Toast zum Mitnehmen kurz herein. Die Hände tief in die Taschen vergraben, schlenderte sie herüber und schenkte Sam ein listiges Lächeln.
»Er schwadroniert doch wohl nicht schon wieder darüber, wie er mit seinem Abflussstampfer die Welt erobern wird, oder?« Sie drückte ihm die Schulter. »Wie oft müssen wir dir das noch sagen? Es ist okay, dass du verrückt und machtbesessen bist. Wir unterstützen dich gern.«
»Danke. Da geht’s mir gleich viel besser.«
»Wie läuft’s überhaupt?« Sie schob sich auf die Bank ihm gegenüber und griff nach dem Katalog. »Wow. Interessant. Weißt du, du solltest öfter unter Menschen gehen.«
»Ich weiß, ich weiß«, räumte er ein und fuhr sich mit seinen langen Fingern durch seine struppigen Locken. »Aber wenn es mir dieses Jahr gelingt, Profit aus dem Geschäft zu schlagen, dann kann ich bald expandieren und ein paar Leute einstellen. Ich meine, mein alter Herr hat die Firma wirklich in einem miserablen Zustand hinterlassen. Bei ihm wurde alles grob über den Daumen gepeilt. Wollt ihr wissen, was für ein Ablagesystem er hatte? Einen Pappkarton unter der Spüle in der Küche.«
Ricki stibitzte sich von seinem Teller eine Scheibe Toast. »Dir würde es gar nicht schaden, öfter mal was nur über den Daumen zu peilen.«
»Was soll das heißen?«
»Es soll heißen« – sie biss ein Stück Toast ab –, »dass du viel zu ernst bist. Wann bist du das letzte Mal ausgegangen?«
»Du kapierst das einfach nicht.«
Ricki sah ihn an. »Ich begreife das sehr wohl. Er fehlt dir.«
Sam rutschte auf seinem Platz herum und starrte aus dem Fenster. »Ja. Also ... eigentlich« – er wechselte das Thema – »hatte ich es zur Abwechslung mal auf Rose abgesehen.«
»Oh, ja?« Ricki packte Roses Hand und zog sie auf ihr Knie. »Da bin ich dabei. Also, warum haben wir es heute auf sie abgesehen?«
»Verpiss dich!« Rose wand sich, doch Ricki war stark und hielt sie fest.
»Ich finde, sie könnte leicht ’ne bessere Arbeit finden als in Jack’s Café, was meinst du?«
»Ganz deiner Meinung. Zweitausend Prozent.«
»Und der blonde Kerl, den sie so mag, hat ihr heute einen Kuss gegeben!«, fügte Sam hinzu.
»Ausgeschlossen! Der piekfeine Schnösel?«
»Das reicht!« Rose befreite sich aus Rickis Griff. »Ich brauche weder Ratschläge in Karriere- noch in Liebesangelegenheiten, und bestimmt nicht von euch zwei Losem! Abgesehen davon« – ungeduldig strich sie ihre Schürze glatt – »habe ich Pläne.«
Sam und Ricki schauten einander an. »Aaauuutsch!«
»Und die wären?«, wollte Sam wissen.
»Das ist persönlich.« Rose rümpfte die Nase und eilte in die Küche, um Rickis Kaffee zu holen. »Aber seid versichert, dass es nichts damit zu tun hat, euch Idioten den ganzen Tag Tee auszuschenken!«
»Gut. Freut mich, zu hören«, rief Ricki hinter ihr her. Sie sah Sam an und schüttelte den Kopf. »Mist.«
»Ja, das fasst es so ziemlich zusammen«, pflichtete er ihr bei. »Geht’s dir gut?«
»Müde.« Ricki gähnte. »Und einsam. Und müde, einsam zu sein.«
Sam trank seinen Tee aus. »Dann such dir ’ne Freundin.«
»Ja, richtig. Wenn das so einfach wäre, hättest du auch längst eine.«
»Hey, ich bin nicht einsam!«, widersprach er. »Ich bin nur zu bezaubernd und beschäftigt und ...«
»Alt?«
»Ja, alt. Du könntest deine Ansprüche runterschrauben.«
Ricki schnaubte. »Mach ich, wenn du’s machst.«
»Eigentlich«, räumte er ein, »bin ich lieber allein.«
»Ich auch.«
Rose kam mit ihrer Bestellung zurück, und Ricki reichte ihr einen Fünfer und stand auf. »Also, ich mach mich besser mal auf die Socken, ich muss heute zu einem neuen Kunden.« Sie gab Rose einen Kuss auf die Wange. »Ruf mich an, wenn du diese Woche Hilfe mit Rory brauchst, okay?«
»Okay. Danke.«
»Und du«, wandte Ricki sich an Sam, »pass auf dich auf. Vergrab dich nicht zu sehr in der Arbeit. Nimm’s locker.«
»Ich nehm’s locker, sobald ich mich in meinem Ferienhaus in der Toskana zur Ruhe gesetzt habe.«
»Ja dann, ciao, Baby!«
Sam griff wieder nach dem Katalog.
Rose verteilte die Ketchup-Spender.
Der Frühstücksansturm war vorbei.
Rose stellte ein paar Stühle zurecht und klemmte die Tür auf. Frische Luft wehte herein. Sie schloss die Augen und genoss die kühle, erfrischende Luft auf dem Gesicht.
Ihr Glück wendete sich, sie spürte es. Nicht nur hatte der Mann, in den sie seit zwei Wochen verknallt war, sie endlich bemerkt, sie hatte auch ein Vorstellungsgespräch, das erste richtige Vorstellungsgespräch in ihrem Leben. Und es war nicht irgendein Job, es war eine angesehene Position: der Posten der Juniorassistentin der amtierenden stellvertretenden Hauswirtschafterin eines Herrenhauses in Belgravia.
Chester Square Nummer 45.
Belgravia.
Allein der Name klang poetisch!
Am vergangenen Samstagnachmittag war sie mit Rory mit dem Bus dort vorbeigefahren, nur um sicherzugehen, dass sie wusste, wohin sie musste. Sie waren vor Nummer 45 mit seinen Reihen gepflegter Blumenkästen und den gestutzten Lorbeerbäumchen links und rechts der Haustür stehen geblieben. Der Messingklopfer in Form eines Löwenkopfes hob sich schimmernd von dem glänzenden schwarzen Lack der Tür ab. Die Fenster funkelten in der Sonne. Alles war ruhig, harmonisch, wohltuend für das Auge.
In einem so schönen Haus konnte nichts Schlimmes passieren. Sehnsucht erfüllte Roses Brust. Sie wollte ihren eigenen Haustürschlüssel. Sie würde eintreten und eine von Behagen und Eleganz geprägte Welt vorfinden, eine Welt, die vollkommen anders war als die, in der sie jetzt lebte.
Rose setzte sich hinter die Kasse, holte eine Ausgabe von Hello! hervor und vertiefte sich in die Hochglanzfotos von Prominenten.
Im Café war es friedlich und ruhig.
Dann klingelte Sams Handy.
»Ja? Ja, das stimmt. Ein Tropfen? Was für ein Tropfen? Oh. Ein Schwall, was? Ja, gut« – er schaute auf die Armbanduhr –, »ich könnte jetzt gleich vorbeikommen, aber vielleicht kann ich das Ganze heute nicht reparieren.« Er sammelte sein Zeug zusammen. »Wie lautet die Adresse?«
Müllmänner, die außer Dienst waren, drängten zur Tür herein. Sam schob sich an ihnen vorbei und winkte Rose im Hinausgehen zu.
Rose erwiderte seinen Gruß mit einem Nicken.
In wenigen kurzen Tagen würde ihr Leben in der Tat sehr interessant werden. Doch bis dahin waren Gäste zu bedienen.
Kapitel 4:Chester Square Nummer 45
Olivia Elizabeth Annabelle Bourgalt du Coudray saß in dem blaugoldenen Frühstückszimmer am Chester Square Nummer 45 und drehte den riesigen Diamant-Memoire-Ring an ihrem Finger, während sie auf den Wutausbruch ihres Mannes wartete.
Sie hatte den Fehler begangen, in der Nacht aufzustehen, und ihren Mann damit geweckt. Anschließend hatte er sich die ganze Nacht so heftig wie nur möglich von einer Seite auf die andere geworfen, die Decke an sich gerissen, um sie gleich wieder wegzustrampeln, und am Kissen gezerrt und frustriert geseufzt. Und jetzt saß Olivia mit flatternden Nerven da, hielt ihre Kaffeetasse. Sobald er herunterkam, würde er ihr einen Vortrag halten und sie beschuldigen, ihn wach gehalten zu haben.
Ihr Mann Arnaud steigerte sich gern in Wut hinein. Neben kubanischen Zigarren und in der Öffentlichkeit wiedererkannt zu werden war dies eine seiner Lieblingsbeschäftigungen. Es ging doch nichts über eine schöne Schimpfkanonade, um den Tag zu beginnen, da leuchteten seine Augen auf, und seine Haut glühte. Es spielte keine Rolle, dass er die Hälfte aller Tennisballfabriken der Welt besaß und dass sein Familienvermögen derart groß war, dass er in Frankreich als politische Figur galt (zu allem wurde er nach seiner Ansicht gefragt, von der Zukunft der Europäischen Union bis hin zur Käseproduktion). Selbst Milliardäre ließen sich von einer an Schlaflosigkeit leidenden Frau den Frieden rauben.
Als eine von sechs Töchtern der berühmten Bostoner Familie Van der Lyden hatte Olivia ihre Jugend zwischen New York, den Hamptons und der französischen Riviera verbracht und nur so lange in Boston verweilt, um einen Abschluss in Kunstgeschichte zu erwerben. Sie war privilegiert gewesen, ihre Geschlechtsgenossinnen eiferten ihr nach, sie wurde regelmäßig für Vogue und Harper’s Bazaar fotografiert. Als Arnaud begann, energisch um sie zu werben, hatte die amerikanische Presse dies als Vereinigung zwischen zwei glänzenden Sternen am internationalen gesellschaftlichen Firmament begrüßt. Doch hier in England war sie praktisch ein Nichts. Und in Paris bei Arnauds Familie fühlte sie sich eindeutig fehl am Platze. Es war nicht gerade zuträglich gewesen, dass Arnauds Mutter, die furchterregende Comtesse Honorée Bourgalt du Coudray, ihr auf ihrem Hochzeitsfest in der Paris Opéra auf Schritt und Tritt gefolgt war, ihr Französisch korrigiert hatte und sich für den Zustand der Haare ihrer neuen Schwiegertochter entschuldigt hatte.
Olivia schaute hoch und richtete den Blick auf den ovalen Spiegel, der auf der anderen Seite des Zimmers hing. Sie besaß den gesunden amerikanischen Glamour, der Ralph Lauren und Calvin Klein inspirierte, sportlich gute Laune gepaart mit klassischen Zügen. Ihr blondes Haar war dick und glatt, ihre blauen Augen groß und ihre Wangenknochen ausgeprägt. Doch sie hatte mit angehört, wie ihre Schwiegermutter eines Abends Arnaud laut erklärt hatte: »Sie ist unauffällig und reizlos, sie besitzt keine Klasse.« Ein vernichtendes Urteil, das Olivia seither quälte. »Warum hast du Frischkäse gewählt, wo du dir genauso gut hättest Camembert leisten können?«
Selbst jetzt marterte das Schreckgespenst ihrer Schwiegermutter sie wie unaufhörliche Kritik aus der ersten Reihe in ihrem Kopf.
Reizlos. Unauffällig. Die Comtesse hatte nur ausgesprochen, was sie selbst die ganze Zeit schon geargwöhnt hatte: Sie war eine Schwindlerin, eine blasse Imitation eines Menschen ohne echte Talente oder originelle Gedanken, ohne greifbares Ziel im Leben. Viele Jahre lang hatten ihre gute Erziehung und ihre Schönheit ausgereicht. Doch jetzt, wo sie vierzig war, schwand auch die dahin.
Olivia war Arnauds zweite Frau. Zu dem Zeitpunkt, da sie ihn geheiratet hatte, hatte er bereits zwei erwachsene Kinder, besaß ein riesiges gesellschaftliches Netzwerk, das sich über mehrere Kontinente erstreckte, einen einschüchternd vollen Terminkalender, Häuser überall in der Welt, eine Reihe von Firmen und ein Heer von Bediensteten. Und obendrein einen Ruf als unheilbarer Playboy. Damals war sie so dumm gewesen, zu denken, sie könnte Einfluss auf ihn ausüben. Doch nach zehn Jahren Ehe war genau das Gegenteil passiert.
Und in der einen Rolle, die die Natur ihr vielleicht zugedacht haben könnte, hatte sie versagt.
Kein Wunder, dass Arnaud ihr gegenüber so gleichgültig geworden war.
Sie trank ihren Kaffee.
Er war kalt.
Schwierig war er immer schon gewesen, diktatorisch. Doch früher hatte sie eine privilegierte Position eingenommen, sie war das Objekt seiner Begierde gewesen, perfekt, unanfechtbar.
Das vergangene Jahr hatte das alles verändert.
Lange Zeit hatte sie sich unbedingt Kinder gewünscht. Dann hatte sie schließlich entdeckt, dass sie schwanger war, und sie hatte sich nicht länger wie eine Napfschnecke an Arnauds Leben geklammert, sondern Gelassenheit und Sicherheit entwickelt. Das Beste war, dass sie ihrem Mann das Eine schenken würde, was mit Geld nicht zu kaufen war. Er war plötzlich wieder jung, er würde bald Vater werden, er platzte vor unanfechtbarer Männlichkeit. Die Hand auf ihrem wachsenden Bauch, fuhr er sie voller Stolz in London herum. Nie zuvor waren sie sich so nah gewesen, und sie hatten zusammen Möbel fürs Kinderzimmer ausgesucht, Schulen ausgewählt, über Namen diskutiert.
In der achtzehnten Schwangerschaftswoche war sie plötzlich mitten in der Nacht aufgewacht. Zwischen ihren Beinen war Blut, klebrig und warm, und sie wurde von Schmerzen gequält, die ihren Bauch wie eine Faust mit immer festerem Griff umklammerten.
Arnaud war außer Landes. Sie war allein ins Krankenhaus gegangen. Die Entbindung war lang und schmerzvoll.
Sie sah ihr totes Kind nicht, hielt es nicht in den Armen.
Arnaud hatte sich geweigert, über die Fehlgeburt zu sprechen. Stattdessen hatte er ihr den Memoire-Ring gekauft: lupenrein, funkelnd, schrecklich teuer.
Seither quälte die Nacht sie.
Und so saß Olivia mit dem kalten Kaffee in den Händen in dem wunderschönen, im Regency-Stil ausgestatteten blaugoldenen Frühstückszimmer am Chester Square. Hinter ihr, auf dem Kaminsims, tickte laut die grässliche Ormolu-Uhr, die die Comtesse ihnen zur Hochzeit geschenkt hatte.
Fünfzehn Minuten später kam Arnaud herunter. Mit zweiundsechzig Jahren war er immer noch sonnengebräunt und in guter körperlicher Verfassung. Er war ein begeisterter Tennisspieler und hatte je nach Stimmung bis zu drei Jachten in Monte Carlo liegen. Sein schwarzes Haar wurde allmählich schütter. Er ließ es jeden Morgen von seinem Kammerdiener so frisieren, dass es sich über die kahlen Stellen legte. Jetzt schüttelte er den Kopf, und es fiel an Ort und Stelle.
Olivia strich mit ihren Fingern über ihr Haar, beherrscht von der vertrauten Angst, dass es in seiner Gegenwart nicht zufriedenstellend frisiert war.
Gaunt, der Butler, schritt herein und brachte mit grimmiger Steifheit frischen Kaffee und Toast.
»Guten Morgen, Sir.«
Arnaud brummte.
Gaunt schlich hinaus.
Eine Weile sagte Arnaud nichts, warf seinen Toast beiseite, schlug geräuschvoll die Zeitung auf.
Doch sie musste fragen, natürlich. »Wie hast du geschlafen?«
Er kniff seine schwarzen Augen zusammen und legte die Zeitung beiseite. »Wie ich geschlafen habe? Lass mich dich fragen, was du glaubst, wie ich geschlafen habe?«
»Ich weiß nicht.«
»Schlecht, lautet die Antwort. Schlecht!«
»Tut mir leid«, sagte sie.
»Auf und ab! Auf und ab! Was machst du die ganze Zeit?«
»Ich weiß nicht. Es tut mir leid, Arnaud.«
»Du brauchst Schlaftabletten! Geh zum Arzt, und lass dir Pillen verschreiben.«
»Ja.« Sie starrte unverwandt auf ihren Teller, auf die schwarze Kettenbordüre, die an dem silbrig weißen Rand herumlief.
»Wenn das so weitergeht, lasse ich meine Sachen in ein anderes Zimmer bringen.« Er rückte vom Tisch ab. »Ich muss mich um wichtige Dinge kümmern. Gaunt! Gaunt!«
»Ja, Sir?« Gaunt tauchte wie aus dem Nichts auf.
»Holen Sie mir Mortimer ans Telefon! Ich habe Pollard heute Abend im Garrick ein Abendessen versprochen. Wir müssen über Marketingstrategien diskutieren.« Er warf seine Serviette weg.
»Ja, Sir.«
»Das Auto soll in vierzig Minuten vor dem Haus stehen.«
»Sehr wohl, Sir.«
»Bist du ...« Olivia zögerte.
Er starrte sie an. »Ja? Werde ich was?«
Sie fragte nur ungern; ihre Stimme klang jämmerlich dünn. »Bist du heute Abend zu Hause?«
»Schatz, was habe ich gerade gesagt? Ich treffe mich heute Abend mit Pollard im Garrick. Wenn du nachts schlafen würdest, statt herumzuspazieren wie eine Katze, müsste ich mich nicht wiederholen.«
Er nahm Kaffeetasse und Zeitung und stolzierte davon. Den halben Weg die Treppe hinauf hörte sie ihn über Kipps, den Kammerdiener, schimpfen, weil der seine Pantoffeln auf die falsche Bettseite gestellt hatte. Schließlich schlug eine Tür zu.
In der darauffolgenden Stille war Olivia sich deutlich bewusst, dass zahllose unsichtbare Augen auf sie gerichtet waren; Zeugen ihrer wachsenden häuslichen Disharmonie. Die Monate, da Arnaud sie umworben hatte, gehörten einem anderen Leben an.
Er besaß eine überaus starke, überzeugende Persönlichkeit, und er wusste immer genau, was er wollte und was zu tun war. Dann richtete er das grelle Scheinwerferlicht seiner gewaltigen Aufmerksamkeit auf sie. Zu Anfang war sie ihm gegenüber gleichgültig gewesen, was ihn zu beispiellosen romantischen Gesten angespornt hatte. Jeden Morgen waren Kartons mit frischen Blumen geliefert worden, Diamantohrringe von den besten Juwelieren, ein Saphirring, sogar eine Halskette aus seltenen schwarzen Perlen wurden als Geschenke geschickt. Einmal hatte er ihr eine Skizze von Degas gekauft, die sie beiläufig in einem Auktionskatalog von Bonhams bewundert hatte. Sie waren in seinem Privatflugzeug an exotische Orte überall in der Welt gereist, wo man sich rasch und geflissentlich um ihre sämtlichen Bedürfnisse gekümmert hatte. Sie war ganz im Schatten seiner überlebensgroßen Persönlichkeit aufgegangen. Es war eine Erleichterung gewesen, sich in ein vorgefertigtes Leben einzufügen, wo ihr sämtliche Entscheidungen abgenommen wurden.
Doch all das war längst vorbei.
Langsam schob sie ihren Stuhl nach hinten.
Plötzlich war Gaunt wieder da, hob die Serviette vom Boden auf, faltete sie, hielt ihr die Tür auf.
»Kann ich Ihnen etwas holen, Madam?«
Seine Aufmerksamkeit kam ihr fast wie Freundlichkeit vor. Tränen brannten ihr in den Augen. »Nein.« Sie zwang sich zu einem Lächeln. »Das Frühstück war wunderbar. Vollkommen. Vielen Dank.«
Sie trat in die Halle. Endlose Stunden dehnten sich vor ihr aus, leer und unerträglich.
»Ich bitte um Verzeihung ...« Gaunt zögerte, ein dunkler Schatten in der Tür.
»Ja?«
»Die Gartenbaufirma hat jemanden geschickt. Wegen des neuen Brunnens.«
»Oh. Natürlich.«
Olivia folgte ihm nach draußen.
Es war ein typischer Londoner Garten, ein kleiner Hofraum, der zu einem kleinen Rasenfleck führte, geschmückt mit Blumenbeeten in ordentlichen Reihen. In einer Ecke tröpfelte ein winziger Springbrunnen matt vor sich hin, und hinten, in der Nähe der Mauer, die für Privatheit sorgte, standen drei hohe, schlanke Eukalyptusbäume.
Ein dunkelhaariger junger Mann wartete, den Rücken ihr zugewandt. Er drehte sich um, als Olivia ins Sonnenlicht trat, einen Augenblick von den Strahlen geblendet. Doch als ihre Augen sich an die Helligkeit gewöhnten, erkannte sie, dass der Gärtner in Wirklichkeit eine Frau war, eine große, braun gebrannte junge Frau mit dunklem, kurz geschnittenem Haar. Sie trug ein weißes T-Shirt und hatte die Daumen in die Hosentaschen gehakt. Ihre dunklen Augen begegneten Olivias, und ihre Lippen öffneten sich zu einem trägen Lächeln.
»Das ist Ricki, von der Gartenbaufirma«, stellte Gaunt sie vor.
»Hi.« Sie hatte einen festen Händedruck. »Sie wollen sich also von diesem Springbrunnen trennen, ist das richtig?«
»Ja, er tröpfelt nur, ein sehr lästiges Tröpfeln.«
»Hm. Das ist schnell erledigt. Haben Sie überlegt, welche Art von Plätschern Sie gerne hätten?«
»Sie meinen, ich kann mir das aussuchen?«
»Ja, Wasser kann ganz verschieden klingen, je nachdem, aus welchem Material die Einfassung des Brunnens gefertigt ist, wie hoch der Ablauf ist, wie tief das Wasserbecken darunter ... es liegt ganz an Ihnen. Ich persönlich würde ihn aus der Ecke rausholen und ein bisschen etwas Dramatischeres installieren, direkt hier« – sie zeigte auf die Mitte des Rasens –, »genau in der Mitte. Haben Sie Kinder?«
»Nein«, erwiderte Olivia scharf. »Warum?«
»Nichts. Kinder und Wasser sind keine gute Kombination. Es ist gefährlich.«
»Oh. Ja. Natürlich.«
»Aber da das kein Problem ist«, fuhr Ricki fort, »könnten wir hier etwas ganz Phantastisches schaffen. Eine Aluminiumrinne vielleicht, die über die ganze Länge des Rasens läuft.« Sie trat in die Mitte. »Wasser kann hier hinten vor der Mauer in Form eines hohen Wasserfalls aus schwarzem Schiefer zulaufen. Sehen Sie, das Aluminium fängt das Licht auf, das kontrastiert mit der Dichte des Schiefers. Wirklich phänomenal! Und im Sommer, wenn das Gras saftig grün ist, ist es wie eine silberne Klinge, die den Rasen zweiteilt. Der Wasserfall muss hoch genug sein, damit er ein wunderbares, fließendes Gurgeln macht, kein Sprudeln oder Plätschern wie bei einem Bach, sondern etwas Starkes, Beruhigendes ... Und, was meinen Sie?«
Die Vorstellung, dass eine Klinge aus Wasser den Rasen durchschnitt, faszinierte Olivia. Und Rickis Begeisterung war unwiderstehlich. »O ja! Das klingt wunderschön! Da ist nur eines: Mein Mann wird es abscheulich finden.«
Ricki lachte und zuckte die Achseln. »Na und?«
»Sie kennen meinen Mann nicht.« Olivia lächelte schief. »Es ist sicherer, wenn wir etwas eher Traditionelles machen.«
»Lassen Sie mich raten, ein Vogelbad in Form einer Muschel mit einem pinkelnden Cherub obendrüber?«
»Ja, das klingt eher nach dem, was er erwartet«, gestand sie.
Ricki schüttelte den Kopf und sah sie mit ihren großen schwarzen Augen eindringlich an. »Manchmal ist das Gefährlichste, was man tun kann, auf Nummer sicher zu gehen. Wir könnten hier etwas wirklich Interessantes schaffen ... etwas Kühnes.«
Zu ihrer Überraschung errötete Olivia. »Nun, ja, aber ...«
»Verzeihen Sie, Madam.«
Schon wieder Gaunt.
»Simon Grey von der Mount Street Gallery wartet im Wohnzimmer. Er hat keinen Termin, aber er sagt, es sei eine Angelegenheit von einiger Dringlichkeit.«
»Natürlich.« Sie wandte sich wieder zu Ricki um. »Tut mir leid, ich muss gehen.«
»Dann bleibt’s bei dem pinkelnden Cherub?«
»Ja. Ja, ich fürchte. Hat mich sehr gefreut, Sie kennenzulernen.«
Ricki neigte den Kopf zur Seite. »Mich ebenfalls.«
Verwirrt eilte Olivia ins Haus zurück. Simon hier, um diese Tageszeit? Wie seltsam.
Simon Grey war der Kurator der Mount Street Gallery, die sie großzügig finanziell unterstützte, um junge Künstler zu fördern. Auf sein Drängen hin war sie vor Kurzem Vorsitzende geworden. In zwei Wochen sollte ihre bislang größte Ausstellung eröffnet werden – Die Nächste Generation –, in der auch die Arbeit eines umstrittenen jungen Performancekünstlers namens Roddy Prowl gezeigt werden sollte.
Kunst war das Einzige, wofür Olivia sich mit ihrem ganzen Wesen begeisterte. Oft bedauerte sie, dass sie selbst keinerlei künstlerische Ader besaß. Nicht, dass sie es je gewagt hatte, einen Zeichenkurs zu belegen. Als sie mit neun Jahren zum ersten Mal den Wunsch geäußert hatte, zu malen, hatten ihre Eltern sie rigoros zu den alten Meistern geschleppt.
»Das ist Malerei«, hatte ihre Mutter ihr erklärt und behutsam einen Fussel von ihrer ansonsten makellosen Schuluniform gezupft. »Also versuch’s erst gar nicht.«
»Wenn eine Van der Lyden etwas versucht, hat eine Van der Lyden auch Erfolg!«, hatte ihr Vater mit gingetränkter Stimme gedröhnt.
Stattdessen hatten sie ihr Kunstgeschichte vorgeschlagen. »Sehr viel nützlicher und unendlich weniger schmutzig, als mit Farben herumzuhantieren.«
Vielleicht hatte dies Olivia Appetit auf die Postmoderne gemacht.
Sie schob die Wohnzimmertür auf. »Simon. Oh, mein Guter! Simon?«