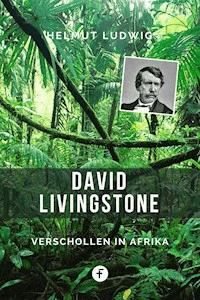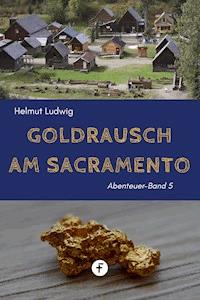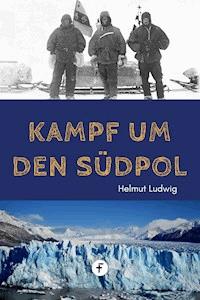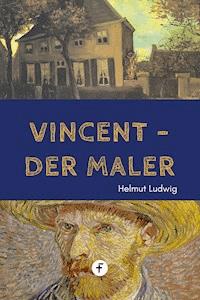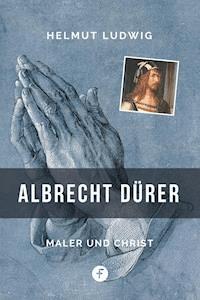Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Folgen Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Abenteuer an der Elfenbeinküste Maurice, der kleine Franzose in Afrika, erlebt allerhand bei seinem Streifzug durch die Großstadt Abidjan. Als er allein mit einem Aufzug fährt und dieser plötzlich wegen Stromausfall steckenbleibt, wird es für ihn gefährlich. Niemand scheint seine Hilferufe zu hören … Ingo alarmiert die Stadt Aus einer langweiligen Geographiestunde – wen interessiert schon Quartär, Anhydrit, älteres und jüngeres Steinsalz, selbst wenn's vor den Toren der eigenen Stadt liegt – wird ein spannendes Abenteuer. Da ist ein Kalkberg mit Gipsbrüchen und Höhlen, und Ingo mit seiner Jungengruppe entschließt sich, nach den Resten der alten Kaiserburg zu graben. Alles läuft planmäßig, bis Max verschwindet. Sollte er sich heimlich aus dem Staub gemacht haben? Gegen Abend wird die Sache peinlich. Denn von Max keine Spur. Die Nacht vergeht, heimlich wird gesucht, ohne Erfolg. Erst der nächste Tag bringt Aufklärung und zugleich eine großartige Entdeckung. Max ist in ein Erdloch gerutscht, das sich als Eingang zu einer bisher unbekannten Tropfsteinhöhle erweist. Aber was hilft die ganze Entdeckung, wenn man nicht mehr heraus kann … Und viele weitere Abenteuer für Kinder ab 8 Jahren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 285
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Abenteuer an der Elfenbeinküste
6 spannende AbenteuerAbenteuer-Band 8
Helmut Ludwig
Impressum
© 2017 Folgen Verlag, Langerwehe
Autor: Helmut Ludwig
Cover: Caspar Kaufmann
ISBN: 978-3-95893-085-8
Verlags-Seite: www.folgenverlag.de
Kontakt: [email protected]
Shop: www.ceBooks.de
Dieses eBook darf ausschließlich auf einem Endgerät (Computer, eReader, etc.) des jeweiligen Kunden verwendet werden, der das eBook selbst, im von uns autorisierten eBook-Shop, gekauft hat. Jede Weitergabe an andere Personen entspricht nicht mehr der von uns erlaubten Nutzung, ist strafbar und schadet dem Autor und dem Verlagswesen.
Dank
Herzlichen Dank, dass Sie dieses eBook aus dem Folgen Verlag erworben haben.
Haben Sie Anregungen oder finden Sie einen Fehler, dann schreiben Sie uns bitte.
Folgen Verlag, [email protected]
Newsletter
Abonnieren Sie unseren Newsletter und bleiben Sie informiert über:
Neuerscheinungen aus dem Folgen Verlag und anderen christlichen Verlagen
Neuigkeiten zu unseren Autoren
Angebote und mehr
http://www.cebooks.de/newsletter
Autor
Helmut Ludwig (* 6. März 1930 in Marburg/Lahn; † 3. Januar 1999 in Niederaula) war ein deutscher protestantischer Geistlicher und Schriftsteller. Ludwig, der auch in der evangelischen Pressearbeit und im Pfarrerverein aktiv war, unternahm zahlreiche Reisen ins europäische Ausland und nach Afrika. Helmut Ludwig veröffentlichte neben theologischen Schriften zahlreiche Erzählungen für Jugendliche und Erwachsene.1
1 https://de.wikipedia.org/wiki/Helmut_Ludwig
Inhalt
Titelblatt
Impressum
Autor
ABENTEUER AN DER ELFENBEINKÜSTE
Es geht um Tod und Leben
Ein Unglück kommt selten allein …
Das Geheimnis der Bretagne
Die Lage spitzt sich zu
Belohnung für schlimme Stunden
DAS GEHEIMNIS DER BAUMBURG
TOLLE NACHT UND TOTE GLEISE
Die Meute im Schloss
Tote Gleise
Dorfgendarm und Grenzkommissar
Tolle Nacht
Der Ring fliegt auf
INGO ALARMIERT DIE STADT
1. Die untergegangene Siegesburg
2. Bergexpedition
3. Max ist überfällig
4. Ein handfester Empfang
5. Die Meute sucht
6. Kletterzwirn und Kellerkerzen
7. Das schlägt dem Fass den Boden aus
8. Das unheimliche Höhlenreich
9. Rettungsmannschaft
10. Stadt in Aufregung
11. Eiszeitlicher Aaskäfer »Silphidae« und klingender Stein
12. Professoren und Spezialisten reisen an
13. Ingo erlebt eine Schrecksekunde
14. Ein Aprilscherz wird Wirklichkeit
RALF REISST AUS
Ralf reißt aus
Schwefelbrand im Klassenzimmer
Der Hausmeister hört einen Satz zu viel
Der folgenschwere Rachefeldzug
Um Ralf wird es dunkel
Ralf brennt durch
Zwei betrunkene Fahrer
… führerlos bergab gerast …
Schmuggler?
Im Gefängnis
Beinahe ein Fehlurteil
Ein Lehrer wird Ehrenmitglied
ÜBERFALL IN SPANIEN
Irgend etwas liegt in der Luft!
Gift?
Ein gefährlicher Plan
Schüsse an der Zonengrenze
Posten auf der Autobahn
Linie 23 - Die Polizei fährt mit
Frankreich!
Aufregendes Paris - Was nun?
Die Aasgeier
Der Verzweiflung nahe
Der Lebensretter war arbeitslos
Unruhiges Blut
Arriba España!
Überfall in der Einöde Kastiliens
Heimatlos in der Heimat
Rettung vor dem Untergang
Der Absturz
Der Fall ist kompliziert
Zwischenspiel
Auf neuer Straße
Unsere Empfehlungen
ABENTEUER AN DER ELFENBEINKÜSTE
Es geht um Tod und Leben
Maurice kratzte sich verlegen hinter dem rechten Ohr. Er wusste nicht recht, was er mit dem angebrochenen Nachmittag anfangen sollte. Am Morgen war er stundenlang an der großen Lagune entlanggepirscht, hatte vergeblich versucht, einen Fisch an den selbstgebastelten Angelhaken zu locken. Dann war er die lange Strecke zum Europäer-Viertel von Abidjan hinaufgegangen und hatte sich die Sonne auf den Kopf scheinen lassen. Er war an den Villen der Botschafter vorbeigebummelt, die ihr Land in der Republik Elfenbeinküste vertraten, und hatte die schönen Anlagen und Gärten bewundert und mit seiner Zwille Zielübungen unternommen - zuerst auf eine Kokosnuss am Baum, und als das langweilig wurde, auf ein verbeultes, verrostetes Reklameschild, von dem er Schuss für Schuss die letzten Emaillereste entfernte.
Mittags verspürte er Hunger. Da kaufte er sich von seinem Taschengeld ein Sandwich und war richtig froh, dass die Schulferien eben erst begonnen hatten. Aber was sollte man nur mit den vielen schulfreien Tagen anfangen, wenn man jetzt schon nichts Rechtes anzustellen wusste! Gestern hatten sie gegen die Ivorer Fußball gespielt und haushoch verloren. Wenn der Schiedsrichter nicht gewesen wäre, hätte das Spiel zum Schluss beinahe mit einer Mannschaftskeilerei geendet. Mit 14 verliert man eben nur sehr ungern. Vierzehn Jahre alt war Maurice - ein Franzosenjunge, der jetzt an der Elfenbeinküste wohnte. Er hatte schon einen schönen Teil der Welt gesehen. Und Maurice war nicht wenig stolz darauf.
Er hockte sich in den Schatten einer Bushaltestelle und dachte nach. Hinter ihm dehnte sich ein weites Buschgelände. Vor ihm führte die rote Sandstraße hinüber zum Europäerviertel von Abidjan, das Maurice ziellos durchstreift hatte.
Links von ihm stand der mächtige Hotelturm des »Ivoire Intercontinental«. Wenn Maurice's Zählung stimmte, hatte das Hotel 24 Stockwerke. Er hatte gehört, dass man vom Dach des luxuriösen Hochhaushotels einen atemberaubenden Blick über ganz Abidjan haben soll.
Sein Vater hatte ihm das erzählt. Er hatte zunächst einige Wochen im »Hotel Ivoire« gewohnt und schwärmte von der internationalen Atmosphäre und der guten Bedienung durch die Afrikaner. Vater hätte das selbst alles nie bezahlen können. Denn das »Hotel Ivoire« hatte gepfefferte Preise. Aber das hatte die Firma alles bezahlt, in deren Auftrag sein Vater an der Elfenbeinküste weilte. Er reiste als Kaffee-Experte und Großeinkäufer für die europäische Weltfirma, in deren Auftrag er in Abidjan eine Filiale aufbauen sollte, im Land herum und besuchte die großen Plantagen. Maurice überlegte: Der Kaffee, den sein Vater hier im Land in Rohform einkaufte, wanderte in viele tausend europäische Kaffeemühlen und landete in noch mehr tausend Kaffeetassen in Frankreich, Deutschland, in der Schweiz, in Holland, Belgien, Luxemburg und sogar in Italien. Alle diese Länder wurden von der Firmenzentrale in Marseille beliefert. Mit Kaffee, den sein Vater hier im Lande Elfenbeinküste zusammenkaufte.
Durch diese berufliche Tätigkeit seines Vaters waren sie also nach Abidjan gekommen: Vater hatte nach den ersten Wochen des Aufbaus, in denen er im »Hotel Ivoire« lebte, eine schöne Wohnung gemietet, ein Einfamilienhaus mit Garten, und hatte dann Maurice und seine Mutter nachgeholt. Nun war vor einigen Wochen Großvater auf seiner geliebten Stierzucht-Farm in der Camargue gestorben und hatte ein beträchtliches Vermögen hinterlassen. Die Stierzucht-Farm musste verkauft werden, weil in der Familie kein Nachfolger war. So hatten sie Großmutter zu sich nach Abidjan geholt. Das Haus war groß genug. Und Großmutter hing bald mit aller Liebe am großen Garten hinter dem Haus.
Maurice besuchte die Oberschule in Abidjan und eroberte sich die große Stadt Stück um Stück. Dazu brauchte man viele Wochen und durfte beim Erledigen der Schulaufgaben nicht bummeln.
Abidjan wurde das Tor zur Welt genannt. In zahlreichen Buchten und Biegungen breitete die Lagune ihre silbernen Wasserarme um die Stadt mit ihren 500000 Einwohnern. Da waren die malerischen Buchten Banco im Westen und Cocody im Osten, zwischen denen sich das Stadtzentrum-Plateau auf einer Halbinsel ausbreitete. Dann war da das bunt-schreiende Gewimmel der Geschäftsstraßen im Afrikanerviertel Treichville, daneben die Anlagen des Passagier- und Fischerhafens. Drüben, auf der anderen Seite der Lagune war der Flughafen, auf dem die großen Jets und Luftriesen aus vieler Herren Länder donnernd auf die Rollbahn auf setzten.
Maurice hatte die prächtigen Sonnenuntergänge erlebt und war einmal sogar in einer schmalen Piroge von freundlichen Fischern mit hinaus auf die Lagune gerudert worden. Stundenlang hatte er die Figuren aus Elfenbein bei den ivorischen Straßenhändlern bewundert, die Holzstatuen, die Bronzearbeiten, den Gold- und Silberschmuck, der in Handarbeit gefertigt wurde. Auch die Töpferwaren und die seltsamen Bilder, die die Ivorer mit schwarzer Farbe auf weißen selbstgewebten Stoff gemalt hatten, entgingen ihm nicht.
Maurice hatte viele farbenfrohe und abenteuerliche Eindrücke in dieser großen Stadt sammeln können. Er hatte neue Freunde aus den verschiedensten Ländern gewonnen: Yussuf, der Junge aus dem Libanon, dessen Vater ein Handelskontor in Abidjan besaß. Gerhard, der Sohn des deutschen Ingenieurs, der am Ausbau der westafrikanischen Riviera mitarbeitete. Jonny, Sohn eines amerikanischen Völkerkundlers, der seine Studien im Lande Elfenbeinküste weitertrieb. Und nicht zu vergessen: Malik. Malik kam aus einem Viehtreiberstamm im Norden des Landes, hatte eine Missionsschule besucht und war für die Oberschule in Abidjan ausgewählt worden. Malik war ein großartiger Kamerad, sportlich, intelligent und schon verlobt! Mit sieben Jahren war er in seinem Heimatstamm seiner Cousine versprochen worden. Das war dort Sitte. Die Kinder wurden früh in ihrer Kindheit mit verwandten Kindern verlobt, damit der Besitz der Herden sich nach ihrer Heirat vergrößerte.
Malik hatte erzählt, dass er seine kleine »Verlobte« immer nur von weitem sehen durfte. Nur einmal war es ihm gelungen, den Aufpassern der Familie ein Schnippchen zu schlagen. Er hatte seinem besten Freund 60 Colanüsse versprochen, wenn er seine »Verlobte« zu einem kleinen Gespräch unter dem großen Jujubaum bewegen könnte. Malik selbst saß mit seiner Fotobox auf dem Juju-Baum und konnte auf diese Weise seine »Verlobte« von oben wenigstens fotografieren. Dann war die Verlobung entzweigegangen, als Malik von der Missionsschule für die Oberschule in Abidjan ausgesucht wurde. Aber das Bild der Box hatte Malik Maurice gezeigt. Er trug es immer bei sich.
Heute war Maurice in der Obhut seiner Großmutter. Vater und Mutter hatten zusammen eine Reise zu drei Kaffee-Farmern unternommen. Mutter konnte zum ersten Mal mitfahren, weil Ferien waren und Maurice morgens ausschlafen konnte. Mit Großmutter verstand sich Maurice gut.
Das alles ging Maurice im Schatten der Bushalte-Baracke an der roten Sandpiste, hinter der sich am Stadtrand von Abidjan der Busch ausdehnte, durch den Kopf. Merkwürdige Großstadt Abidjan: Hier eine rote Sandpiste, die in den Busch führt und in einem Ivorerdorf an der rückwärtigen Lagune endete. Und nur fünfhundert Meter weiter
links das modernste Hotel am Rand der großen Stadt, das »Hotel Ivoire«. Dreihundert Meter davon entfernt lag das Fischerdorf mit seinen Ivorern, die weder lesen noch schreiben konnten und sich vom Fischfang einigermaßen ernährten. Frühzeit der Menschheit und 20. Jahrhundert lagen hier so nah beieinander.
Maurice wurde jäh aus seinen Betrachtungen gerissen, als es hinter ihm plötzlich raschelte. Maurice fuhr wie vom Blitz getroffen herum und sah eine große Schlange aus dem Busch auf sich zukommen. Jetzt nur nicht die Nerven verlieren. Keine verkehrte Bewegung! Maurice wusste, dass Schlangen sofort angreifen, wenn sie gereizt werden.
Maurice zwang sich zur Ruhe. Er überlegte, was er aus dem Biologieunterricht über Schlangen wusste. Da richtete sich die Schlange auf. »Sie greift an!« schoss es Maurice durch den Kopf. Im nächsten Augenblick sah Maurice, dass die Schlange vor ihm etwa drei Meter lang sein musste. Es war ganz offensichtlich eine Mamba. Der Bio-Lehrer hatte erklärt, dass die Mamba zur Gattung der Dendraspis gehört, dass es eine Dendraspis viridis und eine Dendraspis jamesoni gibt. Beide sind in Westafrika sehr gefürchtete Giftschlangen, die nicht nur angreifen, wenn sie in die Enge getrieben werden. Sie machen von ihren tödlichen Giftzähnen sofort Gebrauch und sind sehr aggressiv. Sie gehen ohne äußere Ursache blitzschnell zum Angriff über.
Das alles wurde Maurice in diesem Augenblick bewusst. Ihm war klar, dass es hier um Tod und Leben ging. Weglaufen war aussichtslos. Die Schlange würde schneller sein. Maurice bewegte sich im Zeitlupentempo rückwärts und starrte das giftige Reptil dabei unentwegt an, als ob er es mit seinen Augen bannen wollte. Die Schlange zischte mit der vorschnellenden gespaltenen Zunge. Maurice wusste, sie würde angreifen, zustoßen, nicht locker lassen. Er versuchte, sich mit einem Sprung hinter der Holzwand der Bushaltebaracke in Sicherheit zu bringen und bekam einen Stein zu fassen, den er aufhob und umkrampfte, dass die Fingerknöchel weiß wurden. Die Spannung wurde unerträglich. Bevor Maurice noch einmal zur Seite springen konnte, war die Mamba wieder auf Armeslänge heran. Maurice kroch die Kälte des Grauens über den Rücken. Vorsichtig, ganz vorsichtig tastete er in die Hosentasche, keinen Blick von der Mamba lassend, und fischte die Zwille heraus. Dann ging alles blitzschnell. Er legte den Stein auf das Lederstück der Zwille, zog die Gummistränge so jäh an, dass sich die Holzgabel der Zwille mitbog, zielte kurz und schoss ab. Der Stein sauste los und traf die Mamba mit voller Wucht am Kopf. Die Giftschlange zuckte, wand sich am Boden. Maurice sprang geistesgegenwärtig zu und zertrat ihr den Kopf, der die tödlich-giftigen Zähne barg. Im gleichen Augenblick sprang er zurück, um nicht von der sterbenden Schlange an den Beinen umschlungen zu werden. Das Tier zuckte in heftigen Reflexbewegungen und war tot.
Maurice merkte erst jetzt, dass er am ganzen Körper über und über von Schweiß bedeckt war - ein Schweiß der Angst und des Grauens. Er hatte in diesem Kampf gesiegt und eine Mamba getötet. Maurice konnte es noch gar nicht fassen. Eine Gruppe Ivorer kam die rote Sandpiste entlang. Als sie Maurice vor der getöteten Schlange stehen sahen, kamen sie näher, redeten aufgeregt miteinander und drückten Maurice anerkennend die Hand. Maurice wischte sich verlegen mit dem Arm über die Stirn. Der Zwille verdankte er sein Leben.
Er hob die getötete Schlange vorsichtig am Schwanz hoch und hielt sie den staunenden Ivorern entgegen. Dann legten sie das Reptil der Länge nach auf den roten Sand und maßen mit Schritten nach. Etwas über drei Meter, stellte Maurice fest und musste sich schütteln. Die Ivorer lachten und klatschten in die Hände. Neue Schaulustige kamen näher.
Maurice entfernte sich jetzt von der Stelle des Kampfes. Er bog in eine Seitenpiste, die in eine asphaltierte Straße mündete. Dann stand er vor dem mächtigen Komplex des »Hotel Ivoire«. Auf der einen Seite lag das Sportzentrum des Hotels. Darunter lagen die Tennisplätze. Maurice ging dahin, sah die vielen jungen Leute im Spielautomaten-Salon stehen, und stieg hinunter ins Erdgeschoß, wo die große Eisbahn war, auf der sich weiße und farbige Menschen tummelten.
Eine volle Stunde lang fand Maurice hier Ablenkung nach dem schrecklichen Erlebnis. Zum Rhythmus der Musik liefen und tanzten die jungen Sportfans hier auf der weiten Eisfläche, während draußen die Sonne heiß über der Elfenbeinküste stand.
Ein Unglück kommt selten allein …
Nach dem Besuch der Eisbahn stieg Maurice die Stufen zur Ladenstraße des Luxushotels empor. Es gab sogar ein Kino im Hotel und viele Geschäfte und ein Café. Maurice bummelte an all den Schaufenstern vorbei bis zur großen Empfangshalle des »Hotel Ivoire«. Am Empfang standen Menschen vieler Länder und Rassen. Eben war eine Gruppe deutscher Touristen angekommen. Eine Reiseleiterin lief aufgeregt herum. Ein Koffer war nicht mitgekommen und vielleicht am Flughafen stehen geblieben. Der ivorische Busfahrer sah in allen Kofferboxen des Fahrzeugs nach. Der Koffer wurde nicht gefunden.
Inzwischen wurden am Empfang die Zimmer für die Neuangekommenen verteilt - viele hundert Zimmer. Wie viele mochte solch ein Riesenhotel wohl insgesamt anzubieten haben? Maurice kam aus dem Staunen nicht heraus. Durch die mächtigen Glaswände sah man hinaus auf den Park zum großen Schwimmbecken, in dem viel Betrieb war und darüber hinweg zur Lagune. Wie schön müsste das alles von oben aussehen, aus der Flugzeugperspektive sozusagen! Maurice erinnerte sich, wie sein Vater vom Turmblick über Abidjan, über die ganze Stadt hinweg, geschwärmt hatte. Er bummelte weiter durch einen langen, sehr geräumigen Verbindungstrakt, in dem viele Menschen geschäftig hin und her eilten. Keiner kannte den andern. Maurice gelangte am anderen Ende des Verbindungstraktes zum Hochhausturm des Hotels. Er drückte sich am Empfang des Turms vorbei, weil er fürchtete, jemand könnte ihn hinausweisen. Er hatte ja eigentlich nichts im Hotel zu suchen.
Maurice wartete, bis der Aufzug da war. Dann trat er ein und drückte auf die oberste Taste. Im Lift zeigten die rotaufleuchtenden Zahlen an, welches Stockwerk der Lift gerade passierte. 24 Stockwerke! Dann stand Maurice vor dem Expresslift zum Dachgarten des Turms.
Gerade, als Maurice den Expresslift betreten wollte, fiel sein Blick auf ein Schild neben dem Lift. Darauf stand geschrieben: »Dachgarten samstags ab 16.00 Uhr geschlossen.« Es war Samstag - und bereits 16.30 Uhr! Zu spät also. Maurice überlegte.
Es kam auf einen Versuch an. Es kostete ja nichts. Vielleicht hatte er Glück, und es war noch offen, oder er konnte durch die Scheibe der Tür zum Dachgarten einen Blick auf Abidjan werfen. Wenn er nun schon einmal hier war … Und sollte gar nichts zu machen sein, konnte Maurice ja wieder mit dem Expresslift zur Halle zurückfahren.
Also betrat Maurice den Lift, drückte den Knopf, der den Türverschluss auslöste, tippte dann auf den Abfahrtsauslöser zum Dachgarten. Der Expresslift schoss empor, dass es Maurice auf den Magen ging. Maurice begann zu zählen. Er wollte wissen, wieviel Sekunden der Express zum Dachgarten benötigte. Maurice kam bis sieben, dann passierte etwas, was ihm die Luft wegbleiben ließ:
Die Beleuchtung im Lift ging aus. Die Melodie, die aus dem Lautsprecher der Kabine die schnelle Expressfahrt untermalen sollte, erstarb, so wie ein Tonband langsam ausläuft. Es war schwarze Nacht in der Kabine. Der Lift stand still.
Diesmal brauchte Maurice tatsächlich einen Augenblick lang Zeit, um in sich aufzunehmen, was da passiert war. Dann stand bei ihm fest: Er war in der Liftkabine gefangen, eingesperrt, irgendwo im himmelhohen Turmschacht zwischen der Halle und dem Dachgarten. Maurice spürte, wie ihm schlecht wurde - vom plötzlichen Stillstand des Expresslifts oder vom Schrecken, den die Finsternis in der Kabine auslöste. Zuerst dachte Maurice, es würde schon gleich weitergehen. Er versuchte, einen klaren Gedanken zu fassen. Wo waren die Betätigungsknöpfe des Lifts an der Kabinenwand zu finden? War da nicht auch ein Notsignalknopf?
Maurice tastete sich durch die nachtschwarze Finsternis an der Wand entlang. Dann stellte er fest, dass auch die Klimaanlage Stillstand. Nichts funktionierte in der steckengebliebenen Kabine. Es musste doch ein Notaggregat geben, das bei Stromausfall den Lift zur Endstation hinauf oder zur Halle zurückbringen würde!
Irgendwann hatte Maurice einmal gehört, dass man einen steckengebliebenen Lift sogar mit einer Handwinde herunterdrehen konnte. Aber wie lange sollte einer drehen, wenn der Lift in der Mitte oder im oberen Drittel des endlosen Aufzugsschachtes steckte? Maurice vergegenwärtigte sich die Höhe des Hotelturms. Endlos hoch erschien er ihm jetzt. Das Ganze kam ihm vor wie ein böser Alptraum.
Seine Hand fühlte die Bedienungsknöpfe. Er drückte alle, einen nach dem andern. Nichts, gar nichts regte sich. Da war noch ein kleiner Schalthebel unter den Bedienungsknöpfen zu fühlen. Vielleicht war es der Notsignalschalter? Maurice drückte ihn in seiner Aufregung so heftig nach unten, dass der Schalterhebel abbrach und auf den Kabinenboden fiel.
Maurice fühlte, dass die Luft dick zum Schneiden wurde. Er überlegte, wie lange die Luft in einer solchen Kabine ausreichen würde, um einen Menschen atmen und leben zu lassen?
Maurice war in Schweiß gebadet. Es war nicht nur die Angst und die Aufregung. Die Luft wurde tatsächlich heißer, spürbar drückender, sauerstoffarmer.
Maurice begann zu klopfen. Seine Hände trommelten gegen die Blechwand der Kabine, bis die Fäuste wehtaten. Dann schrie Maurice mit aller Kraft um Hilfe. Er brüllte, bis er kaum noch Stimme hatte und heiser war. Plötzlich kam ihm in den Sinn, dass er auf diese Weise den Sauerstoff noch schneller verbrauchte und dann keine Luft zum Atmen blieb.
»Nicht auf regen, ruhig durchatmen«, sagte er sich selbst. Aber schon war die Angst wieder da: Was mochte passiert sein? Wenn er hier länger gefangen war? Der Dachgarten war doch geschlossen. Vielleicht käme niemand auf den Gedanken, dass trotzdem jemand hinaufgefahren sein könnte.
Ob draußen der Strom auch ausgefallen war? Oder ob nur die Sicherungen für den Expresslift herausgesprungen waren? Dann würde es draußen so schnell niemand merken. Wer wollte schon den Express am Samstagabend benutzen, wenn ausdrücklich in der Halle am Einstieg angeschrieben war, dass der Dachgarten samstags ab 16 Uhr geschlossen war?
Sollte trotzdem jemand den Liftknopf drücken und merken, dass der Express nicht kam, würde er annehmen, der Lift sei ausgeschaltet worden, weil der Dachgarten geschlossen war.
Maurice spürte, wie die Angst immer größer wurde. Er spürte das Herz am Hals schlagen und merkte, dass die Hände feucht wurden. Immer wieder versuchte er, die Bedienungsknöpfe zu ertasten und drückte von oben bis unten energisch auf jeden einzelnen Knopf. Er suchte mit den Fingern auf dem Kabinenboden nach dem abgebrochenen Schalterhebel, fand ihn jedoch nicht.
Plötzlich erinnerte er sich, dass er an der gegenüberliegenden Wand der Kabine ein Telefon gesehen hatte. Natürlich, das war die Verbindung zur Außenwelt. Eine Notrufanlage! Maurice atmete auf. Er spürte, dass ihm die Angst und die dicke Luft wie ein Kloß im Hals saßen. Er tastete sich zum Telefon durch, fand den Hörer, hob ab. Angespannt horchte er. Kein Rufzeichen! Kein Strom! Das Telefon war tot. Er versuchte auf der Wählscheibe jede Nummer. Nichts! Kein Zeichen. Die Verbindung nach draußen war restlos unterbrochen.
Er trommelte noch einmal mit den Fäusten gegen das Blech der Kabinenwand. Aber dann sagte er sich, dass das ganz nutzlos sei. Der Liftschacht war aus Beton. Kein Laut würde nach draußen durchdringen. Alle Schreie würden ungehört verhallen.
Diese Erkenntnis entmutigte Maurice zutiefst. Was konnte er noch tun? Er setzte sich auf den Kabinenboden, versuchte ruhiger zu atmen und merkte, dass zuallererst frische Luft in die Kabine müsste.
Beim Nachdenken fiel ihm ein, was er längst in Frankreich einmal in der Zeitung gelesen hatte. Da war in Schweden eine Putzfrau gewesen, die als letzte nach Betriebsschluss einer Fabrik das Werk verlassen wollte, als der Aufzug plötzlich ausfiel, weil irgendwo die Hauptsicherung durchgebrannt war. Auch das war an einem Sonnabend gewesen. Die Frau hatte bis zum Montag im Aufzug gesteckt. Sie hatte das Wasser aus dem Putzeimer getrunken, um zu überleben. Maurice schüttelte sich bei dem Gedanken, doch dann wurde ihm klar, dass er ja nicht einmal Wasser aus einem Putzeimer zum Überleben haben würde. Wenn er nun länger oder gar lange im Expresslift aushalten müsste? Undenkbar! Nur nicht an so etwas denken! Die Putzfrau war am Montag ohnmächtig im Lift entdeckt worden und dann im Krankenhaus gestorben. Einfach furchtbar!
Wieso eigentlich ans Sterben denken? Maurice ärgerte sich über sich selbst. Nur nicht die Nerven verlieren, sagte er sich zum zweiten Mal an diesem Tag. Er hatte den Kampf mit der Mamba schließlich auch bestanden. Er war kühl und sachlich in dem Augenblick der Gefahr geblieben. Nun musste er auch hier in der finsteren Kabine den Kopf oben behalten. Ja, aber wenn die Luft tatsächlich ausginge? Luft verbraucht sich doch beim Atmen.
Und wieder klammerte sich ihm die Angst wie eine luftabdrückende Hand würgend um den Hals. Maurice musste schlucken.
Dann stand er in der Finsternis vorsichtig auf, tastete mit den Händen zur Decke der Kabine empor und überlegte, dass die Elektriker die Beleuchtungsröhren an der Kabinendecke auswechseln mussten, wenn eine der Leuchtröhren defekt war. Also musste er irgendwo in der Kabinendecke ein Loch finden. Er suchte danach. Und richtig: Maurice spürte, wie sich die lichtdurchlässigen Kunststoffplatten an der Decke der Kabine hochdrücken ließen und Luft aus dem hohen Aufzugsschacht nachströmte. Fürs erste kam er sich damit gerettet vor. Dann überlegte Maurice, ob er nicht durch das Dach der Kabine aussteigen könnte. Vielleicht sah er irgendwo oben Licht, das Ende des Schachtes. Vielleicht könnte er an den Drahtseilen, die die Kabine hielten, hochklettern. Aber was, wenn dann plötzlich der Lift wieder Strom hätte und nach oben schießen würde? Maurice spürte wieder die würgende Angst, die ihn umklammerte. Dass er gegen die Finsternis nichts machen konnte! Er hatte nichts eingesteckt. Wenn er doch nur eine Taschenlampe oder wenigstens Streichhölzer bei sich hätte. Doch so war er machtlos gegen seine Gefangenschaft in der schwarzen Dunkelheit.
Wie lange dauerte dieses Gruselspiel nun schon? Maurice hatte kein Zeitgefühl mehr. Die Angst hatte alles weggefegt.
Würde er einen ganzen Tag in dieser Gefangenschaft bei schlechter werdender Luft ohne Nahrung und Wasseraufnahme überleben können? Maurice hatte keine Ahnung. Die Frau in Schweden war danach im Krankenhaus gestorben. Maurice hatte sich nie Gedanken über Tod und Sterben gemacht. Aber nun wurde ihm deutlich, dass ein Wegdämmern bei immer ärmer werdender Luft ganz schrecklich und qualvoll sein müsste. Er verdrängte solche Vorstellungen wieder und versuchte sich einzureden: Die müssen ja irgend etwas tun.
Vielleicht ist überall kein Strom. Vielleicht sind die Techniker schon unterwegs, um die Sache zu reparieren.
Aber wenn nun kein Mensch gemerkt hätte, dass der Expresslift zum Dachgarten außer Betrieb ist? Und wenn darum auch niemand auf den Gedanken kommen konnte, dass ein Mensch in der Kabine steckt?
Maurice setzte sich auf den Boden und grübelte. Dabei kamen ihm die merkwürdigsten Gedanken. Die Zeit rann so träge dahin, dass er jegliches Zeitgefühl verlor. Wie lange war er nun schon gefangen? Eine Stunde oder drei oder noch länger?
Draußen war es inzwischen Nacht geworden. Drinnen dämmerte Maurice in seiner Gefangenschaft beim Nachdenken ein. Dann schreckte er wieder hoch. War da nicht ein Geräusch gewesen? Reichte die Luft noch aus? Warum war der Strom immer noch nicht wieder da? Nur nicht entschlafen! Es könnte ein Schlaf sein, aus dem es kein Erwachen mehr gäbe, wenn die Luft weg war, der Sauerstoff verbraucht. Wusste man denn, ob von oben überhaupt Luft in den tiefen Schacht nachströmen konnte? Die Stahltüren des Ausgangs waren doch geschlossen. Er musste etwas tun, irgend etwas unternehmen, um nicht einzuschlafen. Er durfte jetzt nicht untätig sein.
Maurice rappelte sich aus seiner Ecke, in der er eingeschlafen war, hoch und versuchte, sich durch das abgedeckte Loch in der Kabinendecke hochzuziehen. Er wollte versuchen, auszusteigen; zum mindesten aber wollte er sehen, ob von oben Licht und Luftzufuhr zu erwarten waren. Er zog sich ruckartig hoch und spürte, wie ihm das Atmen in der bedrückenden Atmosphäre schwer fiel. Dann hievte er sich hoch und streckte den Kopf aus der Kabine. Mit den Händen tastete er herum. Plötzlich spürte er die fettverschmierten Drahtseile, an denen der Aufzug hing. Aber es war auch außerhalb der Kabine dunkel, finster, schwarze Nacht. Nichts Helles war oben zu erkennen. Maurice rief laut in den Betonschacht des Lifts hinauf. Aber nur das Echo prallte von den Wänden zurück und narrte den verzweifelten Rufer.
Weiter hinausklettern war aussichtslos und gefährlich dazu, falls der Lift doch plötzlich Strom bekäme und emporschießen würde. Maurice kletterte wieder nach drinnen und ließ sich in der Ecke der Kabine nieder. Die lange Zeit hatte ihn mürbe gemacht. Er verspürte Durst, quälenden Durst. Er versuchte, sich abzulenken, an irgend etwas zu denken. Aber das war jetzt alles uninteressant, verblasst. Es half nicht aus der Ausweglosigkeit heraus. Plötzlich fiel Maurice ein, dass er in dieser Lage vielleicht beten könnte. Sein Großvater war ein frommer Mann gewesen, der fest an Gott geglaubt und immer auch zu Gott gebetet hatte.
Warum war Maurice nicht längst darauf gekommen? Und dann betete er in seiner Angst und Verlassenheit, in seiner Verzweiflung. Er betete so, wie er es vom Großvater in Erinnerung hatte und von dem jungen Vikar, der die Jungschargruppe in seiner französischen Heimat geleitet hatte. Zum Schluss bat Maurice Gott, dass er hier nicht sterben müsste.
Danach wurde er ruhiger und gefasster. Er hatte das Gefühl, in dieser Lage jetzt etwas Wichtiges getan zu haben. Maurice hockte in seiner Ecke und ließ den Film seines Lebens in der Dunkelheit an sich vorbeiziehen. Längst vergessene Ereignisse tauchten dabei wieder auf.
Das Geheimnis der Bretagne
Maurice hatte seinen Großvater sehr geliebt. Der aufgeschlossene alte Mann und Maurice hatten zusammen viele interessante Dinge erlebt. Das waren für Maurice heute noch die schönsten Kindheitserlebnisse. Damals hatte er mit Maurice das Geheimnis der Bretagne erforscht. Er hatte Maurice gezeigt, dass schon in der Vorzeit die Menschen sich Gedanken um Gott gemacht hatten. Schon damals taten sie für ihren damaligen Glauben gewaltige Dinge. Sie hatten gemeinsam 350 Tonnen schwere Megalithen, riesige Steine, bei Carnac aufgerichtet und dort ihre primitiven Gottesdienste gefeiert. Viel später haben christliche Missionare mit den Steinen, die jene frühen Menschen damals zusammengetragen hatten, Kirchen gebaut und Kreuzesberge errichtet. Die tonnenschweren Steine bei Carnac am Strand des »Kleinen Meeres« hatten den Forschern der Urreligion in der Bretagne viele Rätsel aufgegeben. Wer legte vor fünftausend Jahren das riesige Steinsäulen-Feld an? Was waren das für Menschen, die ohne Maschine solche gewaltigen Leistungen vollbrachten?
Großvater hatte erzählt, dass die Bretagne ursprünglich ein Land voller Geheimnisse und Sagen aus jener vergessenen Zeit sei. Maurice erinnerte sich an die hingeduckten Häuser mit tief heruntergezogenen Strohdächern, deren Firste von wuchernden und blühenden Eiskräutern gekrönt waren. Sie erlebten auch die gewaltigen Prozessionsstraßen, die alle bisher bekannten Anlagen ähnlicher Art aus der Frühgeschichte Europas in den Schatten stellten. Großvater hatte Maurice damals erzählt, dass hier die Sagen um Parzival und Tristan geboren wurden. Vier- bis fünftausend Jahre lag die Zeit zurück, aus der die weiträumig angelegten Prozessionsstraßen von Carnac stammten.
Die Erinnerung an solche gewaltigen Zeiträume, von denen der Großvater erzählt hatte, ließ Maurice die Zeit seiner Gefangenschaft in der rabenschwarzen Lift-Kabine erträglicher Vorkommen als in seiner ersten Panikstimmung. Maurice dachte weiter über den Ausflug mit Großvater in die Bretagne nach.
Es lenkte ihn nicht nur ab, sondern vermittelte ihm mehr Ruhe und Sicherheit, weil er sich mit diesem Erlebnis wieder an seinen Großvater erinnerte. Großvater strahlte immer solche Sicherheit und Geborgenheit aus. Ob das daher kam, weil er ein frommer Mann war? Auch wenn er Stiere in der Camargue züchtete, die zum Stierkampf verwendet wurden? Maurice entsann sich, dass der Großvater ihm auch das einmal erklärt hatte. Seine Stiere waren bestimmt für den französischen Stierkampf, der unblutig ist, bei dem der Stier nicht umgebracht wird wie beim spanischen Stierkampf. Die französische Art dieses Kampfes war eher ein sportlicher Wettkampf zwischen Mensch und Tier.
Maurice dachte weiter über jenen Ausflug in die Bretagne nach. Die größte Überraschung für ihn waren damals die ungeheuerlichen Größenausmaße. Er kam sich selbst ganz klein inmitten der großen Steinsäulen vor. Auch Großvater konnte nicht ganz genau erklären, wie die Menschen aus dieser verschollenen Zeit die teilweise 20 Meter hohen Steinbrocken transportiert haben mochten.
Großvater erzählte, dass die Gesamtanlage bei Carnac an die ägyptischen Pyramiden-Bauweisen heranreichten. Seit 5000 Jahren blieben die Rätsel von Carnac in der Bretagne ungelöst. Sechs- bis achtreihig waren die Steinprozessionsstraßen angelegt. Nach etwa drei Kilometern endeten sie immer in einem großen Rundbau, der aus den mächtigsten Steinen der ganzen Anlage geformt war. Dort musste die Mitte des Heiligtums gewesen sein. Da fanden Gottesgerichte und Tänze statt, die einem Vereinigungskult zwischen Erde und Sonne galten. Großvater hatte damals erzählt, dass man die gewaltigen Hünengräber-Steinkammern in Carnac »Tische der Riesen« nannte. Die Grabopferbeigaben deuteten auf eine höhere Kulturstufe hin. Da lebten sesshafte Menschen, die Bauern und Künstler waren. Sie glaubten fest an ein Leben nach dem Tod.
Es ist merkwürdig, dachte Maurice, dass mir das alles in diesem Augenblick wieder einfällt.
Großvater hatte damals auch erzählt, dass die bekannte englische Steintempelanlage von Stonehenge durch Carnac an Größe und Ausdehnung hundertmal übertroffen würde. Die Bretagne hat das Geheimnis der Grabkammern und Steintempel gut zu hüten gewusst.
Wenige Interessierte kamen von weither, um die Menhire (Steinsäulen) von Carnaczu sehen. Großvater erzählte, dass die meisten Touristen von Carnac unbeschwert im blauen Meer badeten und sich kaum für die alten Zeugen der Kultanlage interessierten.
Maurice entsann sich, dass einige der großen Felsblöcke, die früher zum Teil Gesichter von Dämonen und Priestern trugen, über 300 Tonnen wogen. Die kleineren Steine waren sechs Tonnen schwer, wie sich Maurice erinnerte. Man hatte festgestellt, dass die Urbewohner des Landes die Megalithen aus weitentfernten Steinbrüchen mit Hilfe von Feuer und wasserquellendem Holz herausgesprengt haben mussten.
Später bauten christliche Missionare mit den Vorgefundenen Steinen Kapellen und Kalvarienberge. Dieser Ausdruck hatte sich Maurice eingeprägt. So wurde die Riesensteinkrone der Kirche von Carnac aus einem solchen Menhir gehauen.
Die religiösen Anstrengungen jener verschollenen Generation hatten doch noch dem Bau von Kirchen und Gotteshäusern gedient. Das alles hatte der Großvater damals so gesehen und berichtet. Und Maurice saß nun in seiner Fahrstuhlkabine und erinnerte sich. Was würde sein Großvater in einer Notlage wie dieser getan haben? Maurice wusste, dass sein Großvater vertrauensvoll gebetet und sich geborgen gefühlt haben würde. Großvater glaubte nämlich, dass Gott unser aller Leben in seiner Hand hält. Dieser beruhigende Glaube machte sich langsam in Maurice bemerkbar. Die Panik war gewichen. Die Angst hatte spürbar nachgelassen.
Die Lage spitzt sich zu
Gewaltige Anstrengungen hatten jene Menschen damals zur Verherrlichung ihrer Götter unternommen. Später bauten die Menschen ihrem Gott große Kirchen, gewaltige Dome und Kathedralen. Was tun wir heute für Gott? Wir lassen ihn gewähren und rufen ihn allenfalls an, wenn wir in Not sind und nicht weiter wissen.
Als Maurice in dieser Nacht nicht nach Hause kam, geriet seine Großmutter in immer größere Angst und Unruhe. Auch sie rief zu Gott und bat um Hilfe für Maurice. Die alte Frau benachrichtigte die Polizei. Sie war ganz sicher, dass etwas passiert sein musste, denn Maurice war nie nachts ausgeblieben.
Sie rief die Polizeireviere an und telefonierte mit den Einlieferungsabteilungen der Krankenhäuser von Abidjan.
Alle Mühe blieb vergeblich. Maurice wurde nicht auf gefunden.
Seine Eltern ahnten von alledem nichts. Sie waren im Landesinnern unterwegs. Die Großmutter wusste nicht einmal, wo sie die beiden erreichen konnte.
Auch für Maurice spitzte sich die Lage zu. Er hatte sich noch einmal an die Bedienungsknöpfe herangetastet, weil er meinte, vielleicht sei inzwischen der Stromausfall behoben, und er müsste neu drücken, damit der Lift sich einschaltete.
Wieder geschah nichts.
Die Luft wurde unerträglich schwül.
Maurice setzte sich hin und spürte die bleierne Müdigkeit durch sämtliche Glieder kriechen. Draußen war längst Nacht. Das war ihm klar geworden. Viele Stunden mussten inzwischen vergangen sein.
Maurice ließ sein ganzes bisheriges Leben an sich vorüberziehen. Er wehrte sich gegen das Einschlafen, weil er Angst hatte, nicht wieder aufzuwachen. So sann er über alle Abschnitte und Stationen seines Lebens nach.
In dieser Stunde wurde ihm deutlich, dass sein bisheriges Leben gar keinen richtigen Sinn gehabt hatte. Wozu hatte er gelebt? Was würde Zurückbleiben, wenn …?
Sicher, er hatte seine Großmutter, die ihn sehr liebte. Er hatte Eltern, die an ihm hingen. Er dachte, dass auch seine Freunde ihn gern mochten. Aber genügte das als Sinn und Ziel alles bisherigen Lebens? In der Schule hatte er sich Mühe gegeben und war bisher auch nicht ohne Erfolg geblieben. Aber was würde das nutzen, wenn das Leben plötzlich zu Ende sein würde?
Maurice wurde in dieser Stunde vor dem langen Einschlafen reifer und erwachsener. Er sah ein, dass er doch sehr sorglos in den Tag hineingelebt hatte und sich gar nicht immer ganz richtig verhalten hatte. Das tat ihm jetzt wirklich leid.
Dann aber ließ sich die bleierne Müdigkeit in der sauerstoffverbrauchten Luft nicht länger verdrängen. Zuerst sackte Maurice in sich zusammen und döste vor sich hin. Dann legte er sich ganz flach auf den Boden der Kabine und versuchte langsam und ruhig zu atmen. So schlief er ein. Lange, sehr lange.
Er träumte ganz wirres und schreckliches Zeug. Es war kein guter Schlaf, der ihn übermannt hatte. Es war die totale Erschöpfung nach den schrecklichen Aufregungen und Ängsten.
Wie lange, wie viele Stunden Maurice geschlafen hatte, wusste er nicht. Plötzlich war ihm, als sei alles hell, ganz hell geworden - als zöge der Aufzug nach oben.
Tatsächlich war in diesem Augenblick der Strom wieder da, und der Aufzug schoss hoch, dem Dachgarten zu.